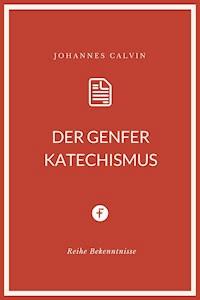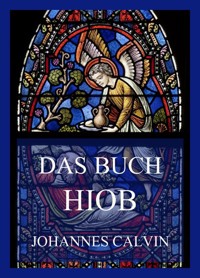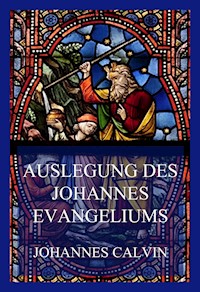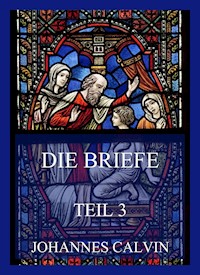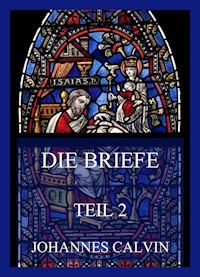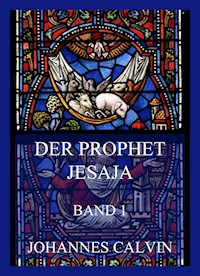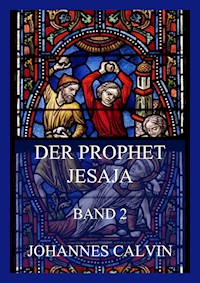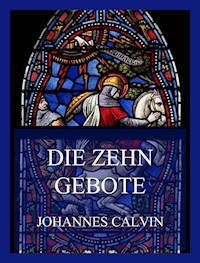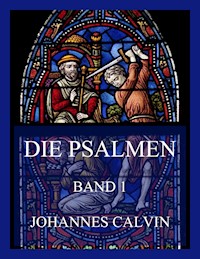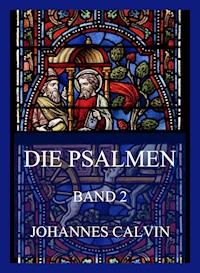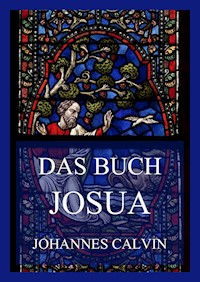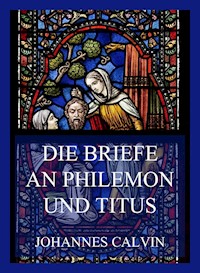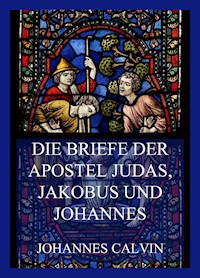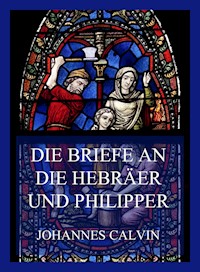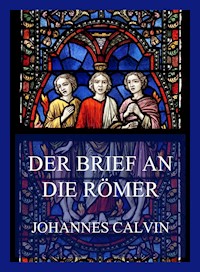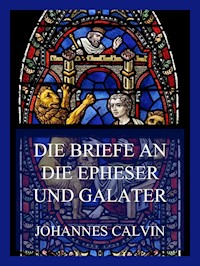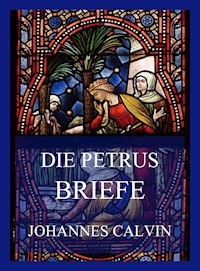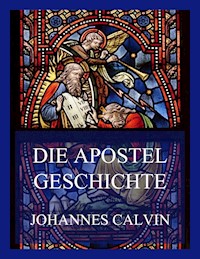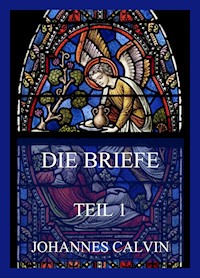
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Johannes Calvin (10. Juli 1509 - 27. Mai 1564) war ein französischer Theologe, Pfarrer, Reformator und eine der Hauptfiguren bei der Entwicklung des Systems der christlichen Theologie, das später Calvinismus genannt wurde, einschließlich der Lehren von der Prädestination und der absoluten Souveränität Gottes bei der Rettung der menschlichen Seele vor Tod und ewiger Verdammnis. Die calvinistischen Lehren wurden von der augustinischen und anderen christlichen Traditionen beeinflusst und weiterentwickelt. Verschiedene kongregationalistische, reformierte und presbyterianische Kirchen, die sich auf Calvin als Hauptvertreter ihrer Überzeugungen berufen, haben sich über die ganze Welt verbreitet. Calvin war ein unermüdlicher Polemiker und apologetischer Schriftsteller, der viele Kontroversen auslöste. Mit vielen Reformatoren, darunter Philipp Melanchthon und Heinrich Bullinger, tauschte er freundschaftliche und tröstende Briefe aus. Neben seiner bahnbrechenden "Unterweisung in der christlichen Religion" schrieb er Bekenntnisschriften, verschiedene andere theologische Abhandlungen und Kommentare zu den meisten Büchern der Bibel. Das vorliegende Werk umfasst seinen mannigfaltigen Briefwechsel. Dies ist der erste von drei Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 913
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Briefe
Band 1:
1531 - 1548
JOHANNES CALVIN
Die Briefe 1, J. Calvin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662769
Der Originaltext dieses Werkes entstammt dem Online-Repositorium www.glaubensstimme.de, die diesen und weitere gemeinfreie Texte der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Wir danken den Machern für diese Arbeit und die Erlaubnis, diese Texte frei zu nutzen. Diese Ausgabe folgt den Originaltexten und der jeweils bei Erscheinen gültigen Rechtschreibung und wurde nicht überarbeitet.
Cover Design: 27310 Oudenaarde Sint-Walburgakerk 88 von Paul M.R. Maeyaert - 2011 - PMR Maeyaert, Belgium - CC BY-SA.
https://www.europeana.eu/item/2058612/PMRMaeyaert_b4ca2422261f4db3d5919ea7ff734329d08d9b34
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort des Übersetzers.1
Geleitwort von Paul Wernle.3
1531. 13
1532. 17
1533. 19
1534. 23
1536. 24
1537. 44
1538. 50
1539. 97
1540. 131
1541. 170
1542. 210
1543. 232
1544. 261
1545. 287
1546. 324
1547. 368
1548. 411
Vorwort des Übersetzers.
Vorliegende Übersetzung von Briefen hat zur Grundlage die im Corpus Reformatorum als Band 38 bis 50, in den Werken Calvins (Joannis Calvini opera quae supersunt omnia) als Band 10 b bis 22, von den Straßburger Theologen Wilhelm Baum, Eduard Cunitz und Eduard Reuß herausgegebene Korrespondenz des Reformators (Thesaurus epistolicus Calvinianus sive collectio amplissima epistolarum tam ab Jo. Calvino quam ad eum scriptarum etc. Brunsvigae ap. C. A. Schwetschke et Filium [M. Bruhn] 1872 – 1880). Es enthält dieses Werk neben vielen an Calvin gerichteten oder seine Person betreffenden Schreiben seiner Zeitgenossen ca. 1250 Briefe Calvins selbst, die jedoch wohl nur den kleineren Teil der von ihm geschriebenen darstellen; schon allein die in der Korrespondenz erwähnten, aber nicht mehr erhaltenen Briefe ergeben eine recht hohe Zahl.
Da nun die Absicht dieses Buches nicht ist, eine vollständige, deutsche Ausgabe der Briefe Calvins zu bieten, sondern nur die, ein von der Hand des Reformators selbst gezeichnetes Bild seiner Wirksamkeit zu geben, so mussten aus der großen Zahl die Briefe ausgewählt werden, die irgend einen Strich zu diesem Bilde in seinen hellen oder dunklen Partien liefern; dagegen musste ausgeschieden werden, was nicht charakteristisch oder bloße Wiederholung war. Die Auswahl wurde so getroffen, dass Herr Prof. Wernle in Basel und ich, unabhängig voneinander, je eine Liste der zu übersetzenden Briefe anlegten. Die Vergleichung der beiden Listen ergab dann eine so große Übereinstimmung der Auswahl, dass wir wohl hoffen dürfen, nichts Charakteristisches weggelassen zu haben. Rein theologische Erörterungen, wie sie bisweilen in den Briefen vorkommen, wurden, wenn sie nicht notwendig und auch für Nichttheologen verständlich waren, weggelassen, da es darauf ankam, in erster Linie nicht den Theologen, sondern den Menschen Calvin zur Darstellung zu bringen. Da auch nicht über Calvin gesprochen, sondern ihm selbst das Wort gelassen werden sollte, so sind auch die den Briefen vorangestellten erklärenden Bemerkungen so kurz wie möglich gehalten.
Von den erhaltenen Briefen Calvins ist etwa ein Fünftel in französischer Sprache geschrieben, die übrigen lateinisch. Ohne dass die Originalsprache jedes Mal angegeben ist, wird der Leser aus der Anrede – du bei den lateinischen, Sie bei den französischen – und aus der Verschiedenheit des Stils leicht erkennen, welche Briefe Calvin in seinem schnöden, knappen Latein, welche er in seinem klaren Französisch, das aber doch von der Eleganz der heutigen Sprache Frankreichs noch fern ist, geschrieben hat. Wo zur deutlichen Übersetzung Ergänzungen nötig waren, sind sie in eckige Klammern [ ] gesetzt; runde Klammern ( ) enthalten Einschaltungen des calvinischen Textes. Ebenso sind bei den vielen Bibelzitaten, die, soweit es anging, in der Übersetzung Luthers wiedergegeben sind, die Belegstellen in eckigen Klammern beigefügt; wo Calvin selbst die Stellen angab, stehen runde Klammern.
Während der Übersetzungsarbeit machte ich die unliebsame Entdeckung, dass die mir vorliegende Textausgabe, wohl infolge des nicht genau geregelten Zusammenarbeitens der drei Herausgeber, in der Datierung, Benennung und Erklärung der Briefe, von der ich auch bei meinen erklärenden Vorbemerkungen größtenteils abhängig war, nicht unbedingt zuverlässig ist. Für die ersten Jahre der calvinischen Korrespondenz bis 1544 bot dafür A. L. Herminjards prächtiges Werk (Correspondance des Reformateurs dans les pays de langue francaise. H. Georg Geneve, 8 Bände) eine gute Kontrolle; für die späteren Jahre war ich auf meine Vermutungen und die freundliche Beratung Herrn Prof. Wernles angewiesen. Über eine Anzahl Umstellungen und Änderungen in Titulatur und Datierung einzelner Briefe werde ich an anderem Ort Rechenschaft ablegen, da solche spezielle Untersuchungen nicht in dieses Buch gehören. Die im Inhaltsverzeichnis angegebenen Nummern der Briefe in der Textausgabe unter der Rubrik C. R. (Corpus Reformatorum) lassen erkennen, wo ich mir solche Umstellungen erlaubt habe. Ein Personal-Register soll am Ende des zweiten Bandes seinen Platz finden.
In der Hoffnung, dass die Leser ebensoviel Freude erleben an diesen Briefen, wie ich sie bei der Arbeit genossen habe, und dass das Buch helfe, die große Gestalt Calvins auch unserm Geschlechte lebendig zur Anschauung zu bringen, lasse ich es seinen Weg in die Öffentlichkeit antreten.
Basadingen, 11. November 1908.
Rudolf Schwarz.
Geleitwort von Paul Wernle.
Calvinbriefe würden von rechts wegen keiner empfehlenden Einführung bedürfen, wenn der Mann so bekannt wäre, wie er es verdient. Was man aber in weiten Kreisen von ihm weiß, ist nicht viel anderes, als dass er den Servet verbrannte, die Genfer tyrannisierte, die berühmte, aber nicht so viel gelesene Institutio schrieb und indirekt der Begründer der Hugenottenkirche wurde. Im besten Fall rechnen wir ihn zu den großen Männern, denen wir aus gehöriger Zeitferne jenen offiziellen Respekt zollen, durch den einer sich als Gebildeter ausweist. Eine andere persönliche Stellung zu Calvin ist auch gar nicht denkbar, solange wir darauf angewiesen sind, unsere genauere Kenntnis des Mannes vorzüglich aus den Werken von Kampschulte und Cornelius zu schöpfen, denen allgemein das Lob gründlichster exakter und unparteiischer historischer Arbeit gespendet wird. Der Gesamteindruck, den man aus diesen Werken von Calvin gewinnt, ist so überwiegend ungünstig, dass ein intimeres Verhältnis zu diesem Reformator bei keinem Leser sich bilden wird.
Da ich selber meine anfängliche Auffassung Calvins aus einigen Hauptschriften Calvins und aus den Werken dieser beiden deutschen Gelehrten gewonnen habe, wäre es undankbar, nun hinterdrein ihre großen und bleibenden Verdienste zu bestreiten. Ich weiß nur, dass ich in meinen Vorlesungen bei Calvin nur dann warm werden konnte, wenn ich meine Empörung über das traurige Los aller Calvingegner in und außer Genf unverhohlenen Ausdruck gab. Wie erstaunt war ich aber, als ich zum ersten Mal an die Briefe des Mannes geriet und mich anschickte, an ihrer Hand von Jahr zu Jahr sein Leben zu durchwandern! Jene für mich so anstößigen Züge seines Charakters wurden durch die Briefe bestätigt, allein sie traten gar sehr zurück hinter andern mit gänzlich unbekannten und ordneten sich dem Ganzen eines übermächtigen, in sich geschlossenen und mit sich versöhnenden Lebensbildes ein, dessen Zauber ich trotz allem Widerstreben unterlag. Ich erkannte jetzt deutlich, warum der Eindruck des Kampschulteschen Calvin ein falscher Eindruck ist, ja sein musste. Der Calvin, den er uns besonders in seinem zweiten Band vorführt, der Ausländer, der in zehnjährigem heißem Ringen mit Hilfe von Ausländern das Genfer Volk bändigt, ist bloß ein Bruchstück und gar nicht der wahre Calvin; den gewinnt man erst, wenn man alles Gleichzeitige zusammenfasst, den Mann, der in Deutschland alles Kriegsunglück mitleidet, alle Zerrissenheit der Evangelischen mitempfindet und vergeblich heilen will, der in England nach kurzem hoffnungsvollem Aufstieg den jähen Zusammenbruch erlebt, der in Frankreich ein Märtyrerjahr nach dem andern durchkostet und auf Hoffnung, wider Hoffnung, Keime einer neuen Kirche da und dort zerstreut sich bilden sieht, der in der Nähe alles Ungemach der Neuenburger, der Waadtländer, der Montebéliardkirche, als wäre es sein eigenes, trägt, der mit Bullinger den verheißungsvollen Bund schließt, der herzliche Freund seiner Freunde Farel, Viret, Beza, der Virets Familienleben so zart und treu besorgt begleitet, der selber seine treue Gehilfin verliert und seinen Freunden sein überströmendes Leid mit tapferer Fassung als ein Mann berichtet – all das füllt jene zehn Genfer Kampfjahre mit aus und gibt ihnen eine so ganz andere Farbe. Und hätte uns auch Kampschulte in einem dritten Band das Fehlende nachgetragen, zerstückelt, auseinandergerissen, was zusammengehört, wäre es doch, und auch ohne das, man müsste ein ganz anderes Herz zu diesem Mann, ja überhaupt ein anderes Herz zu heroischer Glaubensart haben, als es der altkatholische Forscher an seine Forschung bringen konnte. Wenn man nur das versteht, was man liebt, so ist er mit seinem Arbeitsfreund und Fortsetzer trotz aller Feinheit der kritischen Methode und allem hingegebenen Fleiß zu einer wirklichen Calvindarstellung gar nicht fähig gewesen.
In der ersten neuen Begeisterung meiner Calvinbrieflektüre kam mir der Gedanke: ist es recht, dass so wenig Menschen die Freude an diesem Mann genießen? Wie wäre es, wenn eine reiche Auswahl des Schönsten in weite deutsche Kreise dringen könnte? Das wäre das Calvindenkmal, das wir Deutsche diesem Mann schuldig sind und das uns selber ehrt. Eine glückliche Fügung brachte mir in Herrn Pfarrer Schwarz in Basadingen, meinem früheren Schüler, den Mann, der nicht nur die Zeit zu der gewaltigen Arbeit erübrigen konnte, sondern der die feine Übersetzergabe und mehr noch die Lust und Liebe zur Sache und Person mitbrachte. An der Auswahl war ich mit beteiligt; wir wählten unparteiisch alles aus, was charakteristisch ist für den Mann im Guten wie im Bösen. Alles Übrige ist sein Werk; nur diesen begleitenden Eingang glaubte ich ihm noch schuldig zu sein.
Ein Calvinleben in Briefen ist unser Gedanke gewesen nach Art des Carlyleschen Cromwell, bloß ohne Vollständigkeit und mit der äußersten Beschränkung der begleitenden Noten, damit der Leser nichts vor sich habe als Calvin. Ein solches Calvinleben ist natürlich einseitig; es lässt uns alle Ereignisse und alle Personen mit Calvins Augen, d. h. mit seiner Liebe und seinem Hass, sehen. Ein vorsichtiger Leser wird allemal zwischen den Tatsachen und ihrer calvinischen Beleuchtung zu unterscheiden haben, er wird bald sich sagen, dass die Gegner Calvins, besonders die in Genf, nicht die Scheusale und bewussten Gottesfeinde gewesen sind, die sie vor Calvin – übrigens auch nicht von Anfang an, die Briefe zeigen uns das allmähliche Wachsen seines Unmuts – waren. Mit einer Libertinersekte – diese Erkenntnis danken wir Kampschulte – hatten sie ja nichts zu tun, es waren die echten Kinder Genfs, die Patrioten des Genfer Befreiungskrieges, die sich ihrer Freiheit nun auch freuen wollten im Leben und Leben-lassen, ohne ein anderes Ideal oder Ziel, darum auch gar nicht imstande, Calvins rigoristischem Ideal der Gottesstadt irgendetwas entsprechend Geschlossenes, Klares gegenüberzustellen. Indes braucht Gerechtigkeit gegen die Calvingegner nicht notwendig Ungerechtigkeit gegen Calvin zu sein. Der Mann, der etwas will, etwas Ganzes, Unbedingtes, das ihn erfüllt, von dem er selbst bezwungen und über sich selbst hinausgehoben ist, der ist in der heutigen Zeit allgemeiner Charakterschwäche und vornehm tuender Gleichgültigkeit besonderer Art wert, selbst wenn wir seine Ziele gar nicht billigen sollten. Und dazu ist er während dieser Kämpfe längst nicht mehr der Kirchenmann Genfs allein, sondern der Mann, der nach Frankreich, England, Deutschland, Polen die entscheidenden Direktiven auszugeben hat, dessen weltgeschichtliche Aufgabe aber zu ihrer Bewältigung einer unbedingt sicheren Basis, eines Herr- und Meister-Seins im eigenen Haus, bedarf. Als in Genf 1555 der letzte Widerstand gebrochen wurde, da bekam es der Protestantismus der ganzen Welt zu spüren, dass dieser Mann, mit Abzug seiner täglichen Berufsarbeit, seiner literarischen Tätigkeit und seiner gebrochenen Gesundheit, seine volle Kraft nach außen verwenden konnte. Seine Briefe werden doch manches besser verstehen lassen, gerade wenn man sieht, mit was für kleinlichen Manövern, mit welcher Feigheit und Unentschlossenheit, ja eigentlichem Mangel irgendeines Willens, der Mann zu kämpfen hatte, der sein Leben nur für die größten Ziele hinzugeben entschlossen war. Einseitig bleibt das alles, wer dürfte heute an eine Wiederaufnahme denken! Auch bleibt nach Abrechnung alles Entschuldbaren immer noch viel Ungerechtigkeit und Härte, ja Grausamkeit, nicht zu reden von soviel Ärger, Reizbarkeit, grundlosem Verdacht und Schwarzseherei, über die Calvin nicht Herr geworden ist. Wir schreiben keine Apologie dafür, wünschen, dass nichts beschönigt werde, was vor dem christlichen Gewissen nicht bestehen kann. Wir haben keine wichtige Stelle, die gegen Calvin spricht, unterdrückt; wie er war, nicht besser und nicht schlechter, soll er hier sich geben. Wer sich dann, in die ganz gleiche Zeitlage hineinversetzt, schuldfrei und überlegen sein zu können zumutet, dem sei das überlassen. Wir Protestanten haben keine Heiligen im Sinne der sündlosen Musterhaftigkeit; Calvin zumeist würde es widersprechen, soviel er auch den Menschen gegenüber sich auf sein gutes Gewissen zu gut tat, anders denn als demütiger Sünder vor der göttlichen Gerechtigkeit zu erscheinen. Wir nehmen das buchstäblich so an, und so seien auch diese Briefe als Konfessionen betrachtet mit viel mehr wirklichen Schuldbekenntnissen, als Calvin selbst während des Schreibens sich bewusst war. Soli Deo gloria!
Die ersten 7 Briefe sind vor der „Bekehrung“ geschrieben und führen uns den noch weltlichen Calvin, den Juristen und Humanisten vor, der am Ende schon im Herzen evangelisch ist, aber doch noch lacht über den blinden Eifer der Pariser Sophisten. Die Bekehrung war für Calvin und seine spätern Jünger die strikte Absage an den katholischen Kult, Messe, Bilder und Priesterschaft; da hörte das Lachen auf, wo das Martyrium in Aussicht stand. Brief 8 – 10 zeigen uns den Bekehrten in unstetem Wanderleben; welcher Abstand: der frühere Plauderer und der Konfessor vor Franz I. (Brief 9)! Briefe 11 – 17 stammen aus der ersten Genfer Zeit und widerhallen von den Kämpfen Calvins und Farels mit dem Wächter er Orthodoxie Caroli in Lausanne (12 – 14), den staatskirchlichen Berner Pfarrern, die dem Eindringen eines selbständigen Geistes in das bernische Waadtland abhold sind (15), und den Genfern, Bürgerschaft und Rat, welche von der geforderten Sittenzucht und von einer gewissen Selbständigkeit der Pfarrer in den kirchlichen Fragen nichts wissen wollen (16, 17, vgl. 18 f.). Es war auch die Zeit der versuchten Abendmahlsverständigung mit Luther; wie selbständig und freimütig tritt der Anfänger Calvin dem 18 Jahre älteren berühmten Straßburger Reformator Butzer gegenüber (15)! Auf die Genfer Vertreibung folgt die peinliche Zeit der Restitutionsversuche und der Berufslosigkeit in Brief 18 – 25. Die Seele des Vertriebenen kocht von erlittenem Unrecht und widerstrebt dem Bekenntnis eigener Mitschuld; wie ganz allmählich die Ruhe einkehrt und seinen Genfer Getreuen gegenüber der Reformator erst in Straßburg (27) seine Pflicht erkennt, nicht zu verschärfen, sondern zu mildern, der erste Schritt eigener Selbstüberwindung, das alles tritt uns hier lebendig entgegen. Man lese die Schauerschilderung der Genfer Ersatzpfarrer, vom Hass gezeichnet (22) und dann wieder die Erzählung vom Tod von Farels Neffen an der Pest, den Calvins furchtlose Liebe begleitet hat (25); es ist derselbe Mensch! Brief 26 – 75 schildern uns dann den Calvin der Straßburger Zeit, da er zum ersten Mal in die große Weltgeschichte hineingezogen wurde, selber zur weltgeschichtlichen Persönlichkeit heranreifend mit den weit ausgebreiteten Freundesbeziehungen, der Einsicht in die politischen Fäden von Deutschland nach Frankreich hinüber und mit der klaren Beurteilung aller Aktoren des viel verschlungenen politisch-konfessionellen Dramas. Was muss er jetzt schon alles mit seinem Herzen tragen, während er französischer Gemeindepfarrer in Straßburg und Teilnehmer an den wichtigen Religionsgesprächen in Hagenau (52), Worms (61 – 63) und Regensburg (65, 68 – 73) ist! Die Genfer Wirren, denen zuletzt nur durch seine Rückberufung abzuhelfen ist, das Unglück aller verfolgten Waldenser und Hugenotten, Farels, des Freundes in Neuchchatel, Ungestüm und Unbedachtsamkeit, die Abkehr der Zürcher von den gemeinsam protestantischen Interessen und dazu eben das Nächste: Gemeindesorgen und Widerstand (33, 34, 46, 48, 59, 60), Freudiges und Widriges mit Pensionären (54), nicht zuletzt die Gründung des eigenen Hausstandes, und die große verworrene evangelische und katholische Politik zur Zeit der hessischen Doppelehe und des letzten friedlichen Einheitsversuches von katholischer Seite. In diesen Briefen gewinnt das menschlich Anziehende unser Interesse neben dem Sachlichen, das viele Hin- und Herberaten über die Heirat in den Farelbriefen (37, 44 – 46, 49, 54), der Schmerzensschrei aus Regensburg bei der Kunde vom Tod des liebsten Helfers und seines Schülers und von der Pestgefahr im eigenen Haus, vorn und am Schluss eines der feinsten, objektivsten politischen Bulletins (65), und der dann folgende Trostbrief an den Vater des einen Verstorbenen (67), die Klage über die Arbeitslast (34), auch Allzumenschliches, wie der Jähzornausbruch bei der Verhandlung mit Caroli (40) und der Ausguss alles Zornes über den Sünder dabei, den Freund Farel (40, 42, 43), zuletzt das so lang und schwer auf ihm lastende Problem der Genfer Rückberufung, der er sich mit tiefem, innerem Widerstreben und in klarer Voraussicht der Kette von Irrsalen, die dort auf ihn wartete (32, 35, 55), nur auf das unermüdliche Drängen der Genfer und Farels Blitze und Donner unterwarf. Aber wie anders kehrt er nach Genf zurück, als er es verlassen!
Brief 76 ist auf der Rückreise nach Genf geschrieben, die ganze dann folgende Briefsammlung gehört der zweiten Genfer Zeit an. Es kommen zuerst ein paar Jahre verhältnismäßiger Ruhe und Sammlung bis 1546 (Briefe 77 – 150), Calvin führt in Genf seine Kirchenverfassung und Kirchenzucht ein, entfernt nach und nach aus dem Klerus die ungenügenden Elemente, stößt auch etwa auf Widerstand der Genfer Bevölkerung oder einiger Räte, aber nichts lässt ahnen, welche Kämpfe ihm erst bevorstehen. Mit Sorgen gewahrte er in Deutschland das Steigen der kaiserlichen Macht und die Verträumtheit der Protestanten, die sich noch gar mit dem Kaiser gegen Frankreich verbünden, statt vom französischen König sich ihre Freiheit garantieren zu lassen; wir erkennen den Franzosen Calvin (Brief 115), den er zeitlebens in politischen Fragen nie ausgezogen hat. Und doch kommt gerade aus Frankreich die Kunde von den scheußlichen Waldensermassakern (132), die Calvin zu einer großen Bittreise bis nach Straßburg und zu unermüdlichem Eintreten für die erst noch politisch verdächtigen Glaubensbrüder veranlasste. Dann wieder trieb er seine Nikodemiten, die heimlichen Evangelischen in Frankreich, zu offenem Bruch mit dem katholischen Götzendienst an und versuchte sogar Luther dafür zu gewinnen, der doch eben mit den Schweizern wieder auf dem Kriegsfuß stand und dem der ängstliche Melanchthon den Calvinbrief aus der Schweiz gar nicht abzugeben sich getraute (122, 123, 125). Schon erlebte er in dem befreundeten französisch-württembergischen Montbeliard den Anfang der Konflikte zwischen lutherischer und reformierter Gottesdienstordnung (103, 113, 117), die ihm, dem geborenen Unionsmann, später am allermeisten das Leben verbitterten. Während er in Frankreich die monistischen Mystiker, die Libertiner, bekämpft und deshalb in die Ungnade der königlichen Schwester Margarethe von Navarra fällt (130), muss er erleben, dass ein Neuenburger Kollege seine Orthodoxie im Bekenntnis zu Christus in Zweifel setzt (98, 107, 121, 124) wie früher jener Caroli; dafür stempelt er wieder den begabten Castellio zu einem wegen ketzerischer Anwandlungen zum Kirchenamt untauglichen Mann um reiner Lappalien in unserm Sinn willen (108, 109), hinter denen doch die Grunddifferenz eines Geistes der relativistischen Aufklärung und eines solchen des kraftvollen Dogmatismus sich verbirgt. Auch sonst tritt uns Calvin hier mit den Schranken seiner Zeit entgegen, wenn er dem Hexenwahn in der Pestzeit grausame Opfer weiht (128, 129) oder später, wenn er die Entführung eines gottlosen Alkoholikers durch den Teufel an Ort und Stelle durch Syndics und Rat protokollarisch feststellen lässt und den Zweiflern das Gericht der Hölle verkündet (183). Dazwischen soviel Zeugnisse einfacher Menschlichkeit: die Angst bei der Niederkunft seiner Frau (89), von der ein anderer Brief (88) erzählte, wie sie Calvin bei seinen Krankenbesuchen unterstützte und vertrat, die Sorge für den Stiefsohn (142), die seine Aufnahme einer offenen Kritik Virets an einer Calvinschrift (137), der Ärger über einen nicht gefundenen und rasch für gestohlen vermuteten Brief (136).
Mit dem „Fall“ Pierre Ameaux setzt dann 1546 die eigentliche Periode der Genfer Kämpfe ein, die sich steigern von Jahr zu Jahr und Calvins dominierenden Einfluss vorübergehend völlig brechen, ihm den Zusammenbruch seines Werkes und einen schmachvollen Weggang in Aussicht stellen, bis zuletzt, dank der Unentschlossenheit und Unvorsichtigkeit der Gegner, Calvin doch wieder das Steuer in die Hand bekommt. Der Kampf ging darüber, ob Genf das alte weltlich frohe Genf bleiben oder eine geistliche Stadt der eingewanderten französischen Puritaner werden solle. Er erreicht seinen Abschluss erst in unserem zweiten Briefband. Es kann sich hier nicht darum handeln, alle diese von Jahr zu Jahr sich steigernden „Fälle“, den Fall Ameaux, Gruet, die vielen Fälle Perrin und Familie, Sept, Berthelier, die zwei berühmten Ausländerfälle Bolsec (von 327 an) und Servet (von 374 an, vgl. aber 155, 156, 242) auch nur flüchtig durchzugehen; unsere Hauptquelle dafür sind neben der Calvinkorrespondenz die Genfer Ratsprotokolle, von denen das Wichtigste in den Calvinwerken Band 21 und in Rogets Histoire du peuple de Geneve zusammengestellt ist. Worauf es mir bei ihrer Beurteilung anzukommen scheint, ist schon oben angedeutet. Es fehlt nicht an vielen komischen Intermezzi in diesen peinlichen Konflikten, die Aufregung über das Theater (168, 170), die schlitzten Hosen (201), die verschiedenen Tanz- und Singszenen und die fürchterlichen Szenen, welche die rabiaten Frauen dem Konsistorium und speziell Calvin bereiteten (203 u. a.); dazwischen die hoch dramatische Szene, wo Calvin sich zwischen die Schwerter der Tumultuanten stürzt (218), an die er noch auf seinem Sterbebette erinnerte. Wer Calvin gerecht werden will, lese vor allem Brief 165 an den Stadthauptmann Perrin; dass er nach oben und gegen seine besten Freunde, (zu ihnen gehörte dieser spätere Hauptfeind ursprünglich), wie nach unten die gleiche Forderung vertrat und in Gottes Namen kein doppeltes Recht gelten lassen durfte, das verursachte den Konflikt mit Perrin. Aber dann daneben die bittere Kritik, die Castellio an der Genfer Geistlichkeit und Calvin üben konnte (114), und die gewiss nicht grundlos war! Und wer dürfte es wagen, gegenüber Bolsec und Servet heute als Jünger Jesu zu Calvin zu stehen? Wir haben freilich nicht das geringste Recht, diese beiden Verfolgten uns zu idealisieren; wer sie in ihrem ganzen Treiben näher studiert, auch in dem, was sie Calvin positiv entgegenzusetzen hatten und der Art, wie sie es vertraten, der kann nur lächeln über die moderne Verehrung dieser angeblichen Märtyrer der Freigeisterei. Was für sie spricht, das ist schlechterdings nichts anderes als ihr grausames Leiden für ihre ketzerische Überzeugung, und das ist freilich genug. Denn was man zu Calvins Gunsten anführt, die Zustimmung, die er im Servetfall von allen schweizerischen Kirchen und von Melanchthon erhielt, kann immer nur deren Mitschuld bezeugen und weiter gar nichts. Männer wie Castellio, Toussaint, Zurkinden und viele andere sind an diesem Punkt die wirklichen Jünger Jesu und Ankläger der Reformatoren, die Männer der Zukunft, die über ihrer Zeit standen, wie es sich für einen Reformator gehört. Es darf nie eine andere Rechtfertigung Calvins geben als das schlichte Eingeständnis seiner schweren Schuld und unsre eigene Demütigung vor dem Gott, der seine erlauchtesten Kinder in so schwere Schuld will fallen lassen.
Aber nun nehme man dazu die Menge von erquickenden und rührenden Zügen gerade aus diesen Kampfjahren, vor allem Calvins Verhältnis zu Viret, der ihm als verheiratet damals persönlich näher stand als Farel. Wie er den Fortschritten der Krankheit von Virets Frau mit Sorge folgt (148, 150, 151, 158): „Wisse, dass wir alle um sie besorgt sind, als ob sie eines jeden Frau oder Tochter wäre!“ „Ach könnte ich doch zu dir eilen, dein Leid etwas zu erleichtern oder zum Teil mit dir zu tragen!“ Und dann die ängstliche Sorge um den Witwer, dass er sich von dem schweren Schlag erholen möge in Freundesnähe (159, 161). Wenige Monate nachher schon will er dem Freund für eine zweite Frau sorgen, und er sucht nicht nur in Genf mit größtem Eifer, sondern treibt selbst den vornehmen de Falais in Straßburg dafür an (169, 171 – 174, 181, 184). Bei der ersten Niederkunft der zweiten Frau Virets sendet er seine eigene schwerkranke Frau zu Hilfe und entschuldigt sich dann, dass sie selber ihm vielleicht zur Last gefallen sei (235). Unterdessen müssen wir dem Fortgang der Krankheit von Calvins Frau folgen durch alle Hoffnungen und Befürchtungen hindurch (219, 235, 240 – 242, 251). Farel und Viret sendet er die Todesnachricht mit den letzten Begebenheiten aus dem Leben der Sterbenden (259, 260), und noch später widmet er seinem Hausarzt Textor einen Kommentar, um ihm zu danken für das, was er seiner Frau getan (299). Aber Virets Frau und Familie bewahrt er als Witwer seine zarte Teilnahme, kondoliert dem Töchterlein Virets bei seiner Entwöhnung von der Mutter (269) und betet für die zweite glückliche Geburt der Frau (290). Und das ist der unmenschliche, finstere Fanatiker Calvin?
Nehmen wir dazu noch das Verhältnis zu dem vornehmen Refugianten de Falais und seiner Familie, das freilich später dadurch, dass Bolsec Falais´ Hausarzt wurde, so betrübend in die Brüche ging. Man möchte nur einmal berechnen, welche Zeit Calvin diesem Mann gewidmet hat, nicht nur in der Menge der Briefe, von denen bloß ein Teil hier aufgenommen ist, sondern in einer Reise extra für ihn nach Basel, und in Geschäften in Genf und Umgebung für den Kauf eines Hauses oder Landguts, dessen Ausstattung, Preis, Weinvorräte usw., wozu eine höchst unglückliche Verlobungsgeschichte einer nahen Verwandten de Falais´ mit einem französischen Geistlichen sich gesellt, bei der Calvin auseinanderwirren, gegenseitige Ansprüche schlichten, für eine neue standesgemäße Verlobung sorgen muss; nicht zu vergessen die Apologie, die Calvin für den Mann verfasst hat, damit er seiner Güter nicht verlustig gehe. Das ist ein Fall, den wir zufällig kennen; mit gar manchen der französischen Refugianten hatte Calvin ähnliche Sorgen, bis er sie heraus hatte aus ihrer Heimat und Verwandtschaft und bis er sie in Genf soweit gebracht hatte, dass sie ordentlich leben konnten. Dazwischen auch sehr häufig Verhandlungen etwa eines Basler- und eines Genfer Bürgers wegen Austausch ihrer Söhne, die Calvin vermittelte (167). Es sind aber auch ganz feine, innerlich vornehme Männer zu Calvin umgesiedelt wie jener de Normandie, dessen Heroismus trotz allen Ärgernissen der Welt Calvin in einer seiner Vorreden ein so prachtvolles Denkmal setzte (300). Und über den neuen Freunden vergaß Calvin die alten nicht. Der Dank, den er seinem ersten guten Lateinlehrer, Mathurin Cordier, und seinem ersten Griechischlehrer, Volmar, jetzt nach so vielen Jahren erstattet durch Widmung einzelner seiner Werke (175, 292), ist für Calvin selber so menschlich ehrenwert. Das ist der Mann, von dem es heißt, dass er nur hassen konnte.
Freilich für ihn selbst sind das Nebensachen. Mit Luthers Todesjahr brach in Deutschland endlich der schmalkaldische Krieg aus, der den deutschen Protestantismus zunächst vernichtete. Wir können uns kaum vorstellen, was das für einen Mann bedeutete, der selber sein Evangelium aus Deutschland bekommen hatte, der jahrelang dort gewesen war, die Verhältnisse studiert, alle wichtigen evangelischen Führer als Freunde gewonnen hatte. Nicht auf einmal, sondern allmählich mit unheimlicher Steigerung brach eine Säule des Protestantismus nach der andern zusammen; wie lange hat er für Konstanz, für Straßburg gezittert und gehofft (187, 207, 212, 216). Als der württembergische Montbeliard unter Herzog Christoph dem Sohn noch tapfer ausharrte gegen das Interim, feierte Calvin diesen Fürsten in der Widmung eines Pauluskommentars als letzten deutschen Helden (225), er vernahm später, dass Christoph sich doch in die Gnade des Kaisers begeben habe. In solchen Zeiten größter menschlicher Dunkelheit erhebt sich das Gottvertrauen Calvins zu heroischer Größe, und allein um dieser Briefstellen willen (194, 198, 199, 204, 206) lohnt sich die Lektüre dieses Buchs. Wie hat er sich damals als Lutheraner gefühlt, den Brenz getröstet (248), den tapferen Magdeburgern zugejubelt, den feigen Melanchthon scharf an seine Pflicht gemahnt (298)! Gerade darum betrieb er so eifrig den Ausgleich mit Bullinger in der Abendmahlsfrage, damit endlich in der höchsten Not die Evangelischen geeinigt retten könnten, was noch zu retten war. Da war es für ihn eine wahre Gottesführung, dass eben jetzt, da der deutsche Protestantismus ohnmächtig daniederlag, England unter dem minorennen Eduard VI. und seinem Protektor Somerset der Reformation freie Bahn gab, so dass selbst alle Flüchtlinge vom Kontinent als allen Sprachen in London eine neue Heimat fanden. Jetzt ist das Reformatorenbewusstsein über Calvin gekommen, das ihn die gewaltigen Episteln und Vorreden an Herzog Somerset (238, 246, 293, 322) und König Eduard (305, 311, 312, 343) und bald darauf auch an Sigismund August von Polen (263) und Christian von Dänemark (337) richten lässt, mit denen er den weltgeschichtlichen Vorstoß des Calvinismus in allen Ländern Europas eröffnet. An Enttäuschungen freilich und an Kräften des Widerstandes gegen ihn eine Reihe ohne Ende: in England schwere politische Wirren der sich den höchsten Einfluss nicht gönnenden Großen, zäher Widerstand des alten Kirchenwesens, Beginn der Spaltung unter den Evangelischen selbst, der Anglokatholiken und der Puritaner und zuletzt plötzlicher Zusammenbruch des ganzen Reformationswerkes durch die Thronbesteigung der katholischen Maria, in Frankreich Verfolgung ohne Ende unter Heinrich II. wie unter seinem Vater Franz und Jahr für Jahr keine andere Aussicht für jeden Evangelischen als Tod oder Auswanderung (die berühmten Studentenmärtyrer in Lyon 340, 344, 359, 361, 364, 365, 366), in der Schweiz die fortwährenden Konflikte der Berner Kirche zwischen Lutheranern und Zwinglianern, Staatskirchlichen und mehr Freikirchlichen, Deutschen und Welschen, verbunden mit fortgesetzter Anfeindung Calvins selbst aus dem Bernbiet mit Unterstützung der Berner Regierung, Widerstand gegen den Consensus im Abendmahl in Bern und Basel, auch Irrungen mit Bullinger, dessen selbständige Art sich dem calvinischen Geist nicht einfach unterordnen konnte. Wer kann das nur aufzählen, was diesem Kämpfer bei jeder seiner Aktionen sofort von Hemmnissen, Missverständnissen, Verdächtigungen in den Weg getreten ist? Aber er geht seinen Weg vorwärts, mag kommen was kommen will, oft verzagt, aber nie verzweifelt, bekümmert, aber nie verbittert, entschlossen, auch alle Niederlagen als Zuchtruten Gottes aufzunehmen, zum Schwärmer viel zu nüchtern, zu klar, zu demütig, aber dennoch den Blick auf das Unsichtbare gerichtet, seiner Sache und ihres Sieges absolut gewiss, weil es Gottes Sache ist. Ihn beseelte ein Enthusiasmus für Gottes Ehre und Reich, aber es ist ein Enthusiasmus, der sich selbst gebändigt hat, der sich genau Rechenschaft gibt, dass die Welt draußen unsern Wünschen nie folgen wird, dass aus unserer Schwachheit und Sünde selbst die schwersten Verwicklungen sich ergeben müssen, selbst wenn gar keine Widerstände von außen kämen, dass vor dem Erreichbaren die Sehnsucht nach dem Überschwänglichen zurückzutreten hat, und ein Fortschritt nur langsam, maßvoll, Schritt für Schritt, ja auf Umwegen und im Zickzack sich anbahnen wird, aber dennoch Hoffen, Glauben an ein Reich Gottes, das Gott auf dieser Erde, obschon nur provisorisch und immer unvollkommen, sich durch die Menschen schaffen will, das ist Calvin.
Auf wie manches andere wäre noch hinzuweisen! Man muss die einzelnen Freundschaften jede für sich durch die mannigfachen Krisen begleiten, die nicht ausbleiben konnten, wenn der eine Freund Calvin hieß, die Melanchthonkorrespondenz, die Bullingerkorrespondenz, die Freundschaft mit Farel; leider ist von der Butzerkorrespondenz, die zum allerwichtigsten gehörte, fast nichts erhalten. Calvin als Freund, das müsste ein Glanzkapitel einer Calvinbiographie sein; wie freimütig, offenherzig und doch wie taktvoll, vornehm verkehrt er mit diesen Männern! Von einem solchen Mann Kritik zu empfangen, muss immer ein innerer Gewinn gewesen sein; es gibt da nur eine Ausnahme, das Verhältnis zu Toussaint, in das später (im zweiten Band) dritten Personen unheilbare Dissonanzen brachten. Einmal kam es vor, dass Farel Calvins Fleiß besonders herausstrich. Calvin antwortete, er habe nicht ohne Beschämung die Stelle in Farels Brief gelesen, in der Farel seinen Fleiß lobe, „da ich mir doch meiner Faulheit und Langsamkeit bewusst bin“ „Der Herr gebe, dass ich trotz meines langsamen Kriechens doch etwas ausrichte“ (303). Was muss der Mann von sich selbst verlangt haben?
Damit schließe dieser kurze Versuch, unter deutschen Lesern Interesse und Freude zu wecken für einen Mann, mit dem sich niemand ohne persönlichen innern Gewinn näher beschäftigen kann. Der zweite Briefband wird nach dem Abschluss der Genfer Kämpfe die machtvolle Entstehung der Hugenottenkirche und ihre ersten kriegerischen Aktionen, den Sieg der Reformation in England und Schottland, das Vordringen des Calvinismus in Deutschland und die Leidensgeschichte der evangelischen Union uns mit Calvins Augen und Herz erleben lassen.
1531
Nr. 1 - An Francois de Connan in Orleans.
Die Juristen Alciato, Professor zu Bourges, und Pierre de l’Estoile (Stella), Professor zu Orleans, standen in wissenschaftlicher Fehde. Calvin hat seinem älteren Freund Nicolas Du Chemin (Chemynus) Beihilfe geleistet bei einer Schutzschrift für de l’Estoile und rechtfertigt dies vor seinem Freund Francois de Connan (1508 – 1551). Zasius war ein deutscher Rechtsgelehrter, mit dem de l’Estoile in Fehde stand.
Calvin nimmt als Korrektor an einer juristischen Fehde teil.
Endlich erscheint die Verteidigungsschrift unseres Du Chemin und versucht ihr Glück wie alle Bücher, obwohl sie eigentlich nicht in der Absicht geschrieben wurde, einmal in die Öffentlichkeit hinaus zu treten. Doch war es Recht, auch das, was dieser Mann nur spielend geschrieben, um seinen Geist anzuregen und zu üben, zu veröffentlichen, damit seine Verteidigung dem de l’Estoile nicht fehle, und nicht irgendein unbekannter Albucius Siegeslieder anstimme, ohne Blut oder auch nur Schweiß vergossen zu haben. Wenn einer lieber Alciato setzt für Albucius, - zu bejahen wag ichs nicht und verneinen will ichs nicht -, aber einige besonders Scharfsinnige wittern, Alciato habe unter dem geborgten Namen versteckt bleiben wollen, damit nicht der übermäßig bissigen Beredsamkeit einer ungeduldigen Zunge Gleiches mit Gleichem vergolten werde. Es darf auch niemand meinen, de l’Estoile sei selbst hilflos gewesen, und sein Schweigen darf nicht als ein Bekenntnis aufgefasst werden, als hätte sich Albucius bis jetzt des Sieges rühmen dürfen, sondern man muss bedenken, dass ein Mann, der mit ernsten Dingen beschäftigt ist und auch in dieser Sache auf die Wahrheit sich stützt und ihr vertraut, mit so ganz unwichtigen Dingen keine Zeit verlieren wollte, da die Sache ja genügend für sich selbst spricht. Sonst hätte er schon gegen tausend Gegner wie Albucius die Feder gezückt, da er ja mit solcher Geistesschärfe begabt ist, mit solchem Fleiß und endlich mit solcher Rechtskenntnis, dass er darin in unsern Tagen über jeden andern unstreitig die Meisterschaft davon trägt.
Diese Überzeugung hegte auch Du Chemin und hätte seine Gedanken gar nicht auf die Herausgabe eines solchen Werkchens richten können, wenn er nicht von einigen Andern mit stichhaltigen Gründen dazu gebracht worden wäre, die ihm zeigten, wie dem de l’Estoile sein geduldiges Schweigen Schaden bringe. Denn einige Erzzänker argumentieren so: er hätte sich selbst in dieser Sache nicht im Stich gelassen, wenn er irgendwie sich hätte verteidigen können, da er doch dem Zasius immer Widerstand geleistet habe. Dadurch notwendiger Weise gezwungen, änderte unser Du Chemin seinen Plan und legt nun öffentlich dar, was er fast zwei Jahre lang hatte unveröffentlicht lassen wollen, um die Verleumdung dieser Leute zu vernichten. Er wollte aber in erster Linie dafür gesorgt haben, dass es unverstümmelt und unverderbt dem Publikum in die Hände komme. Deshalb hat er, als er hörte, dass ich mich zur Reise nach Paris rüste, mir unserer vertrauten Freundschaft wegen den Teil der Arbeit anvertraut, fleißig dafür zu sorgen, dass sich keine Druckfehler einschlichen. Ich übernahm dieses Amt gerne, aber nur unter der Bedingung, dass ich für keine andere Schuld als die der Nachlässigkeit haften sollte. Dann scheint mir, habe ich mein Amt gut verwaltet, wenn ich die Sorgfalt angewendet habe, die er wünscht. Auch Alciato darf es nicht übel nehmen, wenn er einsieht, dass er vor allem rechtmäßig bekämpft wird, aber auch bescheiden und ehrerbietig und nicht ohne ein seiner Ehre geziemendes Einleitungswort. Ich meine, er sei so sehr fürs Gemeinwohl eingenommen, so der Wahrheit ergeben, dass er nicht über ihr stehen wollte seines persönlichen Ansehens wegen. Nun er also einsieht, dass die Wahrheit in der Tiefe versunken ist, wird er auch zugeben, dass man sie wieder suchen muss in Rede und Widerrede, wenn nur dafür gesorgt wird, dass die Wahrheit, die man sucht, nicht über dem Zanken erst recht verloren geht. Das wollte ich gelegentlich gesagt haben, um mich zugleich vor Alciato und dir zu verteidigen; denn ich fürchte, du seist auch der Sache des Gegners zugetan, weil du ihn persönlich liebst, und werdest auch mir zum Vorwurf machen, dass ich nicht auf Alciatos Seite stehe. Ich weiß wohl, wie sehr dir sein Lob zur Gewohnheit geworden ist, dir, dem für den ausgezeichneten Lehrer in der Tat dankbarsten Schüler. Dass du aber auch von de l’Estoile, den du ja auch gehört hast, die beste Meinung hast und mit Ehrerbietung redest, das hab ich neulich aus unserm Gespräch und auch oft aus deinen früheren Briefen erfahren, so dass ich eigentlich gar nicht denken dürfte, du trügest in diesen Streit irgendein Vorurteil hinein. Besonders da dir ja der zur Genüge bekannt ist, der sich anschickt, diese ganze Sache nach seinem Urteil zu behandeln, unser Du Chemin, den du ja kennst als einen Mann, wohl erfahren in strenger Arbeit, durchdringenden Verstandes, und, was das Wichtigste ist, peinlich genauen Urteils. In seinem literarischen Wissen bis zur Vollkommenheit durchgebildet, beschäftigt er sich jetzt mit Glück, und hat sich auch vorher schon lange beschäftigt, mit juristischen Studien. Was nun unsere Sache angeht, so sollen die Leser darüber ihr freies Urteil haben, natürlich nicht die Laien, sondern solche, die etwas tiefer in die Geheimnisse der Rechtswissenschaft eingedrungen sind. So kannst auch du, hochgelehrter de Connan, es beurteilen, nicht als einer aus der Masse, sondern wirklich durch tiefere Erkenntnis aus der großen Zahl ausgeschieden. Freilich wie es nun liegt, glaub ich, dass diese Streitschrift der Art ist, dass ihr leicht und gewiss ein günstiges Urteil auch von dir, wie übrigens von einem jeden ernsthaften Leser, den sie sich erringt, gebührt. Lebe wohl.
Paris, 6. März 1531.
Nr. 2 - An Francois Daniel in Orleans.
Gespräch mit Daniels Schwester über ihren Eintritt ins Kloster. Vom Quartiersuchen.
Am Tag nach unsrer Ankunft hier konnte ich vor Reisemüdigkeit keinen Fuß vor die Haustür setzen. Die nächsten vier Tage, in denen mir immer noch unwohl war, habe ich ganz dazu gebraucht, meine Freunde zu begrüßen. Am Sonntag ging im zum Kloster mit Cop, der sich mir als Begleiter anbot, um nach Euerm Wunsch mit den Nonnen einen Tag festzusetzen, an dem deine Schwester sich zum Klosterleben verurteilen könne. Man antwortete mir, sie habe mit einigen Altersgenossinnen nach Klosterbrauch vom Schwesternkonvent die Erlaubnis erhalten, das Gelübde zu tun. Unter ihnen ist auch die Tochter eines Geldwechslers in Orleans, der deines Bruders Lehrherr ist. Während Cop mit der Äbtissin davon redete, versuchte ich die Sinnesart deiner Schwester zu erforschen, ob sie jetzt, eher gebrochen als gebeugt, ihren Nacken dem Joch willig darbiete. Ich sprach ihr immer wieder zu, mir alles frei heraus anzuvertrauen, was sie auf dem Herzen habe. Nie habe ich jemand bereitwilliger und entschlossener gesehen, so dass es schien, ihr Wunsch könne nicht rasch genug erfüllt werden. Man hätte meinen können, es handle sich für sie um Puppenspiel, wenn sie vom Gelübde hörte. Ich wollte sie davon nicht abbringen, denn dazu war ich ja nicht gekommen; aber ich ermahnte sie mit ein paar Worten, sie solle sich doch nicht überheben im Vertrauen auf die eigene Kraft, dass sie nicht zu kühn ein Gelübde für sich ablege, sondern alles abstellen auf die Kraft Gottes, in dem wir leben und sind. Während dieses Gespräches gab mir die Äbtissin die Erlaubnis einer nochmaligen Zusammenkunft. Als ich sie bat, einen Tag festzusetzen, gab sie mir die Wahl frei, nur sollte Pylades dabei sein, der in den nächsten acht Tagen nach Orleans kommen wird. Da also ein bestimmter Beschluss nicht anging, überließen wir die Entscheidung dem Pylades. Handelt nun im Einverständnis mit ihm, wie Euch gut scheint, da ich Euch hier nicht weiterhelfen kann. Von mir ist zu berichten, dass ich noch keine feste Wohnung habe, obwohl viele vorhanden sind, wenn ich hätte mieten wollen, und andere mir von Freunden angeboten wurden, wenn ich von ihrer Gefälligkeit hätte Gebrauch machen wollen. Der Vater unseres Freundes Coiffart bot mir sein Haus an mit einem Gesicht, dem nichts erwünschter schien, als mich bei seinem Sohn zu haben. Coiffart selbst drang oft und warm in mich, sein Stubengenosse zu werden. Ich hätte das Angebot des Freundes am liebsten mit offenen Armen angenommen, da du weißt, wie angenehm und fördernd der Umgang mit ihm ist. Und ich hätte ihm sofort die Hand drauf gegeben, wenn ich mir nicht vorgenommen hätte, dies Jahr vor allem bei Danesius zu hören, dessen Schule von Coiffarts Haus zu weit entfernt ist. Alle hiesigen Freunde lassen grüßen, besonders Coiffart und Viermaeus, mit denen ich eben ausreiten will. Grüße deine Mutter, deine Frau und deine Schwester Francisca. Lebwohl.
Paris, 27. Juni.
1532
Nr. 3 - An Du Chemin in Paris.
In Geldnöten.
Ungern, lieber Nicolas, falle ich dir beschwerlich, zumal wie ich fürchte, zu ungelegener Zeit.
Aber da ich glaube, dir mich vertraulich erklären zu können, so verlasse ich mich, wie ich deine Liebe zu mir auffasse, ganz auf dich. Mein Bruder, der (wie ich weiß) von meinen Schuldnern Geld für mich bekommen hat, hat in seiner gewöhnlichen Nachlässigkeit mich umsonst drauf warten lassen. Nun drängt mich die Not, die keinen Tag, keine Stunde länger dauern kann. Wenn du ihr abhilfst, befreist du mich aus einer Verlegenheit, die du dir nicht vorstellen kannst, wenn du sie nicht selbst spürst. Zwei Kronen brauche ich, die mir Cop vorgestreckt hätte, wenn sein Beutel selbst nicht eben durch den Ankauf von allerlei Zimmergerätschaften erschöpft wäre. Andere wohnen zu weit von uns weg, als dass ich in dem mir dringlichen Geschäft Zeit hätte, hin und wieder heim zu gehen. Leb wohl.
Es soll nicht lange sein. Ende der Woche kannst du mich hoffentlich wieder aus der Liste deiner Schuldner streichen.
[Paris 1532.]
Nr. 4 - An Francois Daniel in Orleans.
In Paris herrschte die Pest, worauf sich vermutlich der Anfang des Briefes bezieht, und weshalb Calvin abreisen wollte.
Empfehlung eines Arztes.
Ich hatte vor, dir in so böser Zeit nichts zu schreiben, wenn nicht wider mein Erwarten sich mir hier Stoff geboten hätte. Denn als ich eben ans Abreisen dachte, befiel mich ein heftiger Durchfall. Als zu dessen Bekämpfung der Überbringer dieses Briefs, ein wirklich erfahrener Arzt, bei mir war, erzählte er mir, er habe vor, nach Orleans zu ziehen und sich dort niederzulassen, da er hoffe, dort für seine Kunst einen günstigen Ort zu finden. Ich hielt es für meine Pflicht, ihm mit einer Empfehlung zu helfen, damit er nicht als ganz fremder Gast in Eure Stadt komme. So bitte ich dich, um unserer Freundschaft willen, ihn aufzunehmen und ihm, soviel du kannst, zu helfen. Ich weiß wohl, was es heißt, einen Arzt zu empfehlen! Lobt man einen Unwürdigen, so zieht man zu allgemeinem Verderben ein Mörderschwert aus der Scheide. Denn man zeigt einem den Weg, viele zu töten, der, wie ein Schriftsteller sagt, ungestraft morden darf. Von diesem Mann aber wage ichs zu behaupten, er sei in seiner Wissenschaft recht gelehrt, auch der Praxis nicht so fremd, dass er etwa aus Unerfahrenheit Fehler machte, dazu in seinem Charakter seiner Gelehrsamkeit nicht nachstehend. Das verbürge ich mit meinem Wort dir und deinen Freunden für diesen Mann. Sorge also dafür, dass auch solche sich ihm sicher anvertrauen, die es sonst nicht wagen würden, mit Lebensgefahr einen Unbekannten zu erproben. Was ich im Sinne habe, erfährst du von unserm Francois und kann dir auch der Überbringer dieses Briefs sagen. Grüße Mutter, Frau, Schwester usw.
Nr. 5 - An Francois Daniel in Orleans.
Calvins Kommentar zu Seneka ist erschienen.
Nun sind die Würfel gefallen! Mein Kommentar zu Senekas Schrift über die Milde ist erschienen, aber auf meine eigenen Kosten. Das hat mehr Geld gebraucht, als du dir vorstellst.
Nun mühe ich mich, wieder etwas einzubringen. Hier habe ich einige Professoren ersucht, das Buch in den Schulen zu lesen. In Bourges habe ich einen Freund bewogen, zu öffentlichen Vorlesungen den Katheder zu besteigen. Auch du kannst mir etwas zu Gefallen tun, wenn es dir nicht lästig ist. Du wirst es tun aus alter Freundschaft, besonders da du ohne Verlust in deinem Ansehen mir einen Dienst leistest, der vielleicht auch dem Gemeinwohl gelten darf.
Wenn du mich durch eine solche Gefälligkeit dir verpflichten willst, so schicke ich dir 100 Exemplare, oder soviel dir gut scheint. Unterdessen nimm dies Eine, das du empfängst, damit du nicht glaubst, ich wolle dir etwas vorschreiben. Ich möchte, dass du meinetwegen ganz frei entscheidest. Lebe wohl und antworte mir bald.
Paris, 22. April.
1533
Nr. 6 - An Francois Daniel in Orleans.
Begleitschreiben zu Brief 7.
Ich schicke dir hier eine Sammlung Neuigkeiten, mit der Bedingung aber, dass sie (bei deiner Freundestreue!) durch deine Hand auch zu den andern Freunden kommen, die du mir herzlich grüßen sollst, außer Framberg, den ich jetzt einmal mit Schweigen erreichen will, da ich weder mit Schmeicheln etwas von ihm herauslocken, noch mit Tadeln herauskriegen konnte.
Und das Ärgste, als sein Bruder neulich hierher kam, trug er ihm nicht einmal einen Gruß auf.
- - -
Für deine Schwestern magst du den Übersetzer machen, damit ihr nicht allein zu lachen habt -
Lebwohl, liebster Bruder und Freund
Dein Bruder Calvinus.
Ich brauche nicht zu sagen, der Brief sei in größter Hast geschrieben; er spricht für sich. Gib acht, dass der Bericht nicht unvorsichtig unter die Leute gebracht wird.
Nr. 7 - An Francois Daniel in Orleans.
Dieser im vorhergehenden Brief verheißene Bericht bezieht sich auf folgende Umstände: Marguerite de Valois, Königin von Navarra, die Schwester König Franz I., und ihr Beichtvater M. Gerard Roussel (M. G.) neigten zur evangelischen Frömmigkeit hin und wurden deshalb von den Anhängern des Alten angefochten, vom König aber noch beschützt.
Skandale in Paris gegen Marguerite de Valois.
Obwohl ein ganzer Wald von Ereignissen vor mir steht, aus dem ich mir Stoff zu einem Briefe holen könnte, will ich doch meine Feder zügeln, so dass du nur kurze Angaben statt ausführlicher Erzählung bekommst. Gäbe ich nach, mein Brief schwölle zum richtigen Buch an. Am ersten Oktober, zur Zeit, da die Knaben, die aus der Grammatikklasse in die der Dialektik vorrücken, Theaterstücke zu spielen pflegen, wurde im Navarra-Gymnasium eine Komödie gespielt, die nach einem Dichterwort mit Galle und schärfstem Essig besprengt war.
Es trat auf eine Königin, nach Frauenart mit Spinnen beschäftigt, und an nichts denkend, als an Rocken und Spindel. Dann kam eine Megäre (es war eine Anspielung auf M. G.), die ihr die Fackel vorhielt, dass sie Rocken und Spindel fallen ließ. Sie wich ein wenig zurück, wehrte sich ein wenig, dann aber, als sie der Furie nachgab, bekam sie ein Evangelienbuch in die Hand, über das sie alle ihre früheren Gewohnheiten, ja fast sich selbst, vergaß; zuletzt erhob sie sich zu wilder Tyrannei und plagte arme Unschuldige mit allerlei Bosheit. Viele ähnliche Erfindungen waren noch beigefügt, die wahrhaftig die Frau nicht verdiente, die sie hier nicht etwa nur bildlich und versteckt mit ihrem Spott herunterrissen. Einige Tage wurde die Sache unterdrückt, dann aber (die Zeit gebiert ja die Wahrheit!) wurde sie der Königin hinterbracht. Man fand, es sei für die Lust der Leute, die nach neuen Dingen gelüstet, ein zu böses Beispiel, wenn eine solche Frechheit ungestraft bliebe. Ein Richter begleitet von 100 Knechten zog zum Gymnasium und ließ seine Leute das Haus umstellen, damit keiner entwische. Er selbst ging mit wenigen Leuten hinein, fand aber den Komödiendichter nicht.
Es hieß, dieser habe keineswegs etwas geahnt, sondern habe nur zufällig vom Schlafzimmer eines Freundes aus den Lärm gehört, ehe man ihn selbst sah, und habe dann rasch einen Schlupfwinkel aufgesucht, um bei Gelegenheit daraus zu entweichen. Der Richter nahm dann die Knaben fest, die in dem Stück gespielt hatten. Als der Schulleiter dies hindern wollte, kams zum Wortwechsel, und von einigen Jungen wurden Steine geworfen. Trotzdem ließ er sie festhalten und nochmals aufsagen, was sie auf der Bühne gesprochen hatten. Alles wurde aufgeschrieben. Da man den Anstifter des Frevels nicht erwischen konnte, wars das Nächste, von denen Rechenschaft zu fordern, die zugelassen und dann noch länger mit Schweigen gedeckt hatten, was sie hätten hindern können. Der Eine, der durch Namen und Ansehen sich auszeichnet, (es ist der berühmte Magister Loret) bewirkte, dass er statt des Gefängnisses weniger schimpfliche Haft im Hause eines so genannten Kommissars erhielt, der Andere, Morin, nach ihm der Zweite erhielt Hausarrest bis zu näherer Untersuchung. Was man bis jetzt erfahren hat, weiß ich nicht. Wie ich weiß, ist er aber schon auf übermorgen vorgeladen.
Soviel von den Komödien. Einen andern gleich boshaften, wenn auch nicht so frechen Streich, haben ein paar herrschsüchtige Theologen begangen. Bei der Untersuchung der Buchhandlungen trugen sie ein französisches Buch, betitelt Spiegel der sündigen Seele, in die Liste der zu verbietenden Bücher ein. Als die Königin dies erfuhr, beklagte sie sich beim König, ihrem Bruder, und bekannte, sie sei die Verfasserin. Der befahl schriftlich den Professoren der Universität Paris, zu erklären, ob sie das Buch wirklich auf die Liste der Bücher unerlaubten religiösen Inhalts gesetzt hätten. Wenn es sich so verhalte, so sollten sie ihr Urteil vor ihm rechtfertigen. Darüber berichtet der gegenwärtige Rektor, der Mediziner Nicolas Cop an die vier Fakultäten der Medizin, Philosophie, Theologie und des kanonischen Rechts. Bei den Magistern der freien Künste, vor denen er zuerst redete, zog er in langer heftiger Rede gegen die her, die so frech seien, sich ein solches Recht gegen die Königin herauszunehmen. Er riet ihnen, wenn sei nicht den Zorn des Königs spüren wollten, so sollten sie sich nicht in die Gefahr begeben, der Königin, einer Mutter aller Tugend und edlen Wissenschaft, den Krieg zu erklären. Wenn sie das aber auf sich nehmen wollten, so sollten sie doch damit nicht die Frechheit derer stärken, die jederzeit zu jedem beliebigen Skandal bereit seien, mit dem Vorwande, es handle so die Universität, wenn sie selbst ganz gegen den Willen der Universität vorgingen. Man beschloss zu beschwören, man stehe der Sache ganz fern. Denselben Beschluss fassten auch die Theologen, die Kanonisten, die Mediziner. Der Rektor verkündete seinen Fakultätsbeschluss, dann der Dekan der Mediziner, dann ein Doktor des kanonischen Rechts, dann ein Theologe. Zuletzt sprach Le Clerc, der Pfarrer von St. Andre, auf den alle Schuld zu fallen schien, da alle anderen sie von sich abwälzten. Zuerst rühmte er mit großartigen Worten die Orthodoxie des Königs, der sich bisher immer als mutigen Beschützer des Glaubens bewiesen habe. Nun gebe es aber feindselige Menschen, die dieser vortreffliche Gesinnung zu verderben wagten, die sogar zum Untergang der heiligen theologischen Fakultät sich verschworen hätten. Er hoffe aber, sie würden nichts erreichen bei der Glaubenstreue, die er am König kenne. Was die vorliegende Sache betreffe, so sei er zwar durch Universitätsbeschluss zur Zensur der Bücher abgeordnet, aber nichts habe ihm ferner gelegen, als etwas gegen die Königin zu unternehmen, eine Frau von heiligem Wandel und reinem Glauben, wofür die Leichenfeier zeuge, die sie beim Tod ihrer Mutter habe halten lassen. Für verbotene Bücher halte er nur die unsittlichen, wie z. B. Pantagruel, Das Lustwäldchen und Schriften ähnlichen Kalibers. Vorliegendes Buch sei nur deshalb auf die Liste der zu beanstandenden Bücher gesetzt worden, weil es ohne Bewilligung der Fakultät erschienen sei, unter der Umgehung des Verbotes, irgendetwas auf die Religion Bezügliches ohne Erlaubnis der Fakultät herauszugeben. Schließlich stütze er sich darauf, dass im Auftrag der Fakultät geschehen sei, was jetzt zur Untersuchung komme. Liege eine Schuld vor, so seien sie alle beteiligt, auch wenn sie es jetzt ableugneten. Das sagte er alles auf Französisch, damit sie alle einsähen, ob er die Wahrheit gesprochen. Es flüsterten sich aber alle zu, er zeige damit bloß seine Dummheit. Es waren auch Petit, der Bischof von Senlis, d l’Estoile und ein höherer Beamter des königlichen Hofes anwesend. Als Le Clerc schloss, sagte Petit, er habe das Buch gelesen und nichts gefunden, was Korrektur verdiene, er müsste denn seine Theologie ganz vergessen haben; er beantrage, dem König durch Veröffentlichung eines Beschlusses Genugtuung zu leisten. Cop als Rektor verkündete hierauf, die Universität anerkenne die Zensur nicht, sie möge im Einzelnen sein, wie sie wolle, durch die die Schrift zu den verbotenen oder beanstandeten Büchern gerechnet worden sei, billige sie nicht und nehme sie nicht auf sich. Die Zensoren möchten selber sehen, wie sie sich verteidigten. Es solle darüber ein Dokument abgefasst werden, in dem die Universität sich beim König entschuldige und ihm danke, dass er sie so mild und väterlich zur Rede gestellt habe. Es wurde auch eine königliche Urkunde vorgelegt, durch die der Bischof von Paris das Recht erhält, in den einzelnen Gemeinden Prediger einzusetzen, die früher nach Willkür jener Theologen gewählt worden waren, je nachdem einer ein Schreihals war und von der dummen Wut beseelt, die sie frommen Eifer nennen, während doch Elias nie so wutentbrannt war, als er um das Haus Gottes eiferte.
1534
Nr. 8 - An Francois Daniel in Orleans.
Calvin hatte für den Rektor Cop eine Rede evangelischen Inhalts geschrieben, die dieser bei einem Universitätsanlass ablas. Infolge davon musste Calvin aus Paris fliehen, um einer Verhaftung als Ketzer zu entgehen. Er fand in Claix bei Angouleme ein Asyl im Haus des Chorherrn du Tillet, in dessen reicher Bibliothek er arbeitete.
Im Asyl bei du Tillet in Angouleme.
Mit dir kann ich ja schwatzen, wie ich will, und auch ohne bestimmten Stoff eine Seite füllen.
Doch was soll ich dich mit meinen Kleinigkeiten aufhalten? Es genügt, dir jetzt das anzudeuten, worüber du dir vielleicht Sorge machtest, nämlich dass es mir gut geht und ich im Studium vorwärts komme, obwohl ich, wie du weißt, eigentlich müßig sitze. Selbst der trägste, faulste Mensch müsste zum Fleiß aufgestachelt werden durch die Freundlichkeit meines Gönners, die so groß ist, dass ich wohl merke, eigentlich gelte sie mehr meiner Wissenschaft als meiner Person. Umso mehr muss ich versuchen, ja eigentlich danach ringen, dass ich nicht mit zuviel Güte, die mir drückend, ja fast beschwerlich wäre, überschüttet werde. Obschon ich, freilich nur wenn ich allen Eifer aufwende, Entsprechendes oder fas Entsprechendes leisten kann, so ist mir doch in dieser Güte eine sehr scharfe Konkurrenz entgegengetreten. Deshalb zupft mich der Gedanke am Ohr, dafür gerade die Studien zu pflegen, um deretwillen mir so viel gewährt wird. Wenn ich die Zeit, die eigentlich der Verbannung oder Auswanderung bestimmt war, in solcher Ruhe zubringen darf, so glaube ich, geschieht mir etwas Außerordentliches. Doch dafür wird der Herr sorgen, dessen Vorsehung alles aufs Beste versehen wird. Ich hab’s erfahren, dass wir nicht ins Weite schauen dürfen. Als ich mir Ruhe in Allem versprach, stand vor der Tür, was ich am wenigsten erwartet hatte. Dann wieder, als ich auf einen unangenehmen Wohnsitz denken musste, wurde mir ein Nest im Stillen hergerichtet wider alles Erwarten. Das Alles ist die Hand des Herrn.
Wenn wir uns ihm anvertrauen, wird er für uns sorgen. Doch nun ist schon fast die Seite voll, mit Sinn und Unsinn. Lebwohl. Grüße, wen du willst. Aus der Akropolis geschrieben.
1536
Nr. 9 - An den König Franz I. von Frankreich.
' In Basel ließ Calvin sein Hauptwerk, die Institutio religionis Christianae, erscheinen und schrieb dazu folgende Dedikationsepistel an Franz I.''
Verteidigung der Evangelischen und ihres Glaubens.
Dem großmächtigen, durchlauchtigsten Herrscher Franz, allerchristlichstem König der Franzosen, seinem Fürsten und Herrn, wünscht Johannes Calvin Frieden und Heil in Christo.
Als ich zuerst Hand an dieses Werk legte, dachte ich an nichts weniger, erlauchtester König, als daran, etwas zu schreiben, was nachher Ihrer Majestät dargebracht werden sollte. Das allein hatte ich im Sinn, einige Grundbegriffe darzubieten, in denen Alle zu wahrer Frömmigkeit herangebildet werden könnten, die von einem religiösen Sehnen ergriffen sind.
Allermeist für unsere Franzosen habe ich mich dabei angestrengt. Dass unter ihnen sehr Viele nach Christo hungern und dürsten, merkte ich, aber nur ganz Wenige sah ich, die auch nur mit geringer Erkenntnis Christi ordentlich getränkt waren. Mein Werk selbst bezeugt, was mein Vorsatz war: denn es ist geschrieben, einfache, ungebildete Leute zu belehren. Da ich aber merkte, wie in Ihrem Reiche die Unvernunft einiger arger Menschen so mächtig wurde, dass kein Raum mehr ist für die gesunde Lehre, da schien es mir der Mühe wert, mit demselben Werke zugleich den einfachen Leuten Unterweisung zu geben und vor Ihnen ein Bekenntnis abzulegen, damit Sie die Lehre kennen lernen, gegen die jene Unvernünftigen in solcher Wut entbrannt sind, dass sie heutzutage mit Feuer und Schwert Ihr Reich in Unruhe bringen. Denn ich scheue mich nicht, zu bekennen, dass ich in diesem Werk geradezu die Hauptsache der Lehre behandle, von der die Feinde schreien, mit Kerker, Acht und Bann, ja mit dem Feuertod sei sie zu bestrafen, zu Wasser und zu Land müsse man sie ausrotten. Ich weiß wohl, im welchen entsetzlichen Anklagen Man Ihr Ohr und Herz erfüllt hat, um Ihnen unsere Sache ganz verhasst zu machen, aber in Ihrer Güte müssen Sie doch erwägen: wenn die Anklage genügt [eine Sache zu verurteilen], so kann weder in Worten noch in Taten irgendwie die Unschuld bestehen. Gewiss, wenn Ihnen jemand, um Sie gegen uns einzunehmen, darlegt, die Lehre, von der ich Ihnen Rechenschaft abzulegen wage, sei ja bereits durch die Stimmen aller Stände verurteilt, durch viele gerichtliche Urteile zu Schanden gemacht, so sagt er damit nichts Anderes, als dass unsere Lehre teils durch die Parteimacht unserer Gegner mit Gewalt niedergeworfen, teils durch Lügen, Ränke und Verleumdung hinterlistig und betrügerisch unterdrückt worden ist. Denn Gewalttat ist es, dass man Bluturteile über unsere Sache fällt, ohne sie zu kennen; Betrug ist es, dass man uns, ohne dass wirs verdienen, verschwörerischer Übeltat beschuldigt. Damit nicht jemand glaube, zu Unrecht beklagten wir uns darüber, so können Sie selbst, edelster König, uns bezeugen, ob nicht täglich vor Ihnen von unserer Sache mit lügenhafter Verleumdung berichtet wird, sie habe kein anderes Ziel, als den Königen das Zepter zu entwinden, alles Recht und Gericht über den Haufen zu werfen, alle ständische und politische Ordnung zu stürzen, Frieden und Ruhe des Volkes zu stören, alle Gesetze aufzuheben, alle Herrschaft und Besitz zu zerstückeln, kurz alles drunter und drüber zu bringen. Und doch hören Sie in der Tat nur das Geringste. Denn entsetzliche Dinge werden unter dem Volk [über unsere Lehre] verbreitet. Wären sie wahr, die ganze Welt müsste mit Recht diese Lehre und ihre Urheber verurteilen als wert des tausendfachen Kreuzes- und Feuertodes. Wer kann sich wundern, dass der Hass der Menge gegen unsere Sache entflammt ist, wo man so feindseliger Anschuldigung glaubt? Das ist der Grund, weshalb man über uns und unsere Lehre Verdammung einmütig denkt und handelt. Von dieser Leidenschaft erfasst, sprechen die Richter die Vorurteile, die sie von Hause mitbrachten, als Urteile aus, und glauben schon dann ihre Pflicht in aller Ordnung getan zu haben, wenn sie niemand aufs Schafott führen lassen, es sei denn, er sei durch eigenes Bekenntnis oder durch kräftige Zeugenaussagen überführt. Welches Verbrechens überführt? Nun eben, sagen sie, dieser schon im Voraus verdammten Lehre. Und mit welchem Rechte verdammt? Es wäre doch eben das Wesen der Verteidigung, diese Lehre nicht zu verleugnen, sondern sie als die wahre zu erweisen. Aber so wird auch die Möglichkeit, davon auch nur das leiseste Wörtlein zu sagen, uns abgeschnitten.
Daher ists keine unbillige Forderung von mir, dass Sie, unbesiegter König, volle Kenntnis unserer Sache erhalten, die bisher nur verwirrt und ohne alle Rechtsordnung, mehr mit ohnmächtigem heißen Hass als mit dem gesetzlich sich ziemendem Ernste behandelt, oder besser in jeder Weise übertrieben worden ist. Glauben Sie aber nicht, dass ich dabei an die Verteidigung meiner Person allein dächte, um freie Rückkehr ins Vaterland für mich zu erlangen. Wenn ich ihm schon anhänge mit aller einem Menschen ziemenden Liebe, so kann ich es, wie die Verhältnisse jetzt sind, ohne große Beschwerde entbehren. Vielmehr die gemeinsame Sache aller Frommen, ja die Sache Christi selbst führe ich, die in Ihrem Reiche ganz zerrissen und zertreten, wie verloren daliegt, und das weit mehr durch die Tyrannei gewisser Pharisäer als mit Ihrem Wissen. Darzustellen, wie das gekommen ist, nützt nichts; gewiss ist, dass sie darnieder liegt. Denn das haben die Gottlosen erreicht, dass die Wahrheit Christi, wenn sie nicht, vertrieben und zerstreut, hinstirbt, doch wie begraben und unbeachtet bleibt, dass die arme, kleine Kirche entweder durch grausames Morden weggerafft ist, oder in die Verbannung gejagt, oder durch Drohen und Schrecken mutlos gemacht, den Mund nicht mehr aufzutun wagt. Und auch jetzt noch stemmen sie sich mit ihrer gewohnten, unsinnigen Wut fest gegen die schon wankende Mauer und werfen sich noch auf die Trümmer, die ihr Werk sind. Keiner tritt dabei hervor und hält solchem Wüten seine Verteidigung entgegen. Es sei denn, dass Solche, die der Wahrheit besonders günstig scheinen wollen, meinen, man müsse dem unvorsichtigen Irrtum unerfahrener Leute verzeihen. So reden diese bescheidenen Leute; unvorsichtigen Irrtum nennen sie, was sie wohl kennen als die sicherste Wahrheit Gottes; unerfahrene Leute heißen sie die, deren Geist Christo doch nicht so verächtlich gewesen sein muss, da man wohl sieht, dass er diese Leute der Geheimnisse seiner himmlischen Weisheit wert erachtet hat. So sehr schämen sich alle des Evangeliums. Ihre Sache aber ist es, huldreichste königliche Majestät, Ohren und Herz nicht abzuwenden von einer gerechten Verteidigung, besonders da es sich um etwas so Wichtiges handelt, nämlich, wie Gottes Ehre auf Erden unverletzt bleiben soll, wie Gottes Wahrheit ihre Würde behalten soll, wie Christi Reich ihm wohl gefügt und geschützt unter uns bleiben soll. Die Sache ist wert Ihres Gehörs, wert Ihrer Kenntnis, wert Ihres Schiedsspruchs. Wenn wenigstens die Überzeugung einen wahren König ausmacht, dass er sich als Gottes Diener erkennt in der Verwaltung seines Reiches. Denn der ist nicht König, sondern ein Räuber, der nicht zu dem Zweck regiert, dass er damit Gottes Ehre diene. Ferner betrügt sich sehr, wer langes Glück erwartet für sein Reich, wenn es nicht mit Gottes Zepter, d. h. seinem heiligen Wort, regiert wird; da nicht hinfallen wir die göttliche Prophezeiung, in der es heißt: Wenn die Weissagung aus ist, so würde das Volk wild und wüste. (Spr. Sal. 29, 18.) Von dem Bestreben [uns gerecht zu werden], darf Sie die Verachtung unseres geringen persönlichen Wertes nicht abhalten.
Wir sind uns freilich wohl bewusst, wie armselige und verworfene Menschlein wir sind: vor Gott arme Sünder, im Ansehen der Menschen ganz verächtlich, wenn man will, der Abschaum und der Auswurf der Welt, oder wenn einen noch geringern Namen findet; so dass nichts bleibt, mit dem wir uns vor Gott rühmen könnten, es sei denn allein seiner Barmherzigkeit, die wir zur Hoffnung unserer ewigen Seligkeit ohne all unser Verdienst erlangt haben; bei den Menschen aber bleibt so wenig an uns (es sei denn an unserer Schwäche), dass es nur anzudeuten schon die höchste Schande ist. Aber unsere Lehre muss über allen Ruhm der Welt erhaben, von keiner Macht übertroffen stehn, weil sie nicht unser ist, sondern des lebendigen Gottes und Christi, den der Vater zum König gemacht hat, dass er herrsche von einem Meer zum andern und von den Flüssen bis an die Enden der Erde. Und so herrscht er auch, dass er die ganze Erde mit eisernem Stab und mit der Kraft seines Erzes, mit dem Glanz seines Goldes und Silbers, mit dem Stab seines Mundes schlägt und zerbricht wie irdene Töpfe, wie von der Herrlichkeit seines Reiches geweissagt haben die Propheten (Dan. 2, 34 ff., Jes. 11, 4, Ps. 29).
Die Gegner geben aber vor, fälschlich nähmen wir Gottes Wort für uns in Anspruch, ja, wir seien seine schlimmsten Verderber. Ob das aber nicht bloß boshafte Verleumdung, sondern sogar unerhörte Unverschämtheit sei, können Sie nach Ihrer Weisheit beim Lesen unseres Bekenntnisses selbst beurteilen. Doch ist ein Weniges auch hier davon zu sagen, was Ihnen zu diesem Lesen den Weg ebnen kann. Paulus, der wollte, dass alle Prophezeiung dem Glauben gemäß sei (Röm. 2, 7), hat damit den allergenauesten Maßstab gegeben, an dem die Auslegung der Schrift gemessen werden soll. Wenn man also nach dieser Norm des Glaubens von uns Rechenschaft fordert, so ist der Sieg in unseren Händen. Denn was passt besser und genauer zum Glauben, als zu erkennen, dass wir aller Tugend bloß seien, damit Gott uns bekleide? leer an allem Guten, damit er uns fülle? wir Knechte der Sünde, damit er uns freimache? wir blind, damit er uns Licht gebe? wir lahm, damit er uns gehen lehre? wir gebrechlich, damit er uns stütze? uns aller Stoff zum Rühmen genommen, damit er allein hoch gerühmt sei und wir uns seiner rühmen? Da wir solches und ähnliches sagen, wenden die Gegner ein und beklagen sich, dadurch würden umgestürzt irgendeine dunkle so genannte natürliche Erleuchtung, erfundene Vorbereitung aufs Gute, freier Wille und zum Seelenheil verdienstliche Werke, samt ihren Überverdienstlichkeiten, weil sie es nicht ertragen können, dass das Lob und der Ruhm alles Guten, aller Tugend, Gerechtigkeit und Weisheit bei Gott allein bleibe. Und doch lesen wir nicht, dass die getadelt werden, die allzu viel aus dem Quell des lebendigen Wassers geschöpft haben, wohl aber werden die hart gescholten, die sich selbst Brunnen gegraben haben, löcherige Brunnen, die kein Wasser halten können (Jer. 2, 13). Wiederum was kann besser zum Glauben stimmen, als sich getrösten, Gott sei unser gnädiger Vater, da wir Christum erkannt haben als Bruder und Versöhner? als alles Heil und Glück fest von dem zu erwarten, dessen unsagbar große Liebe zu uns so weit gegangen ist, dass er seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns dahingegeben (Röm. 8, 32)? als in sicherer Erwartung des Heils und ewigen Lebens Ruhe zu halten, daran denkend, dass uns Christus vom Vater gegeben ist, in dem solche Güter verborgen sind? Da legen sie nun Hand an uns und schreien, solche Glaubenssicherheit sei Anmaßung und Vermessenheit. Aber da wir uns nichts zumessen, Gott aber Alles, werden wir dadurch nicht alles eiteln Selbstruhms beraubt, bloß damit wir lernen, uns Gottes zu rühmen? Was weiter?