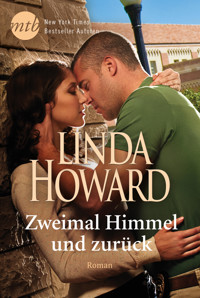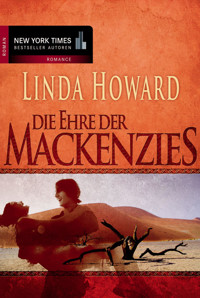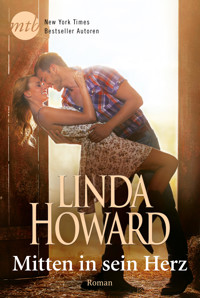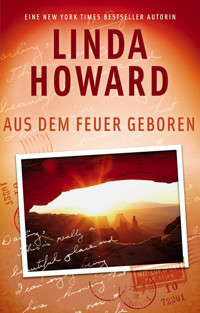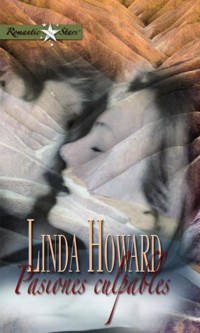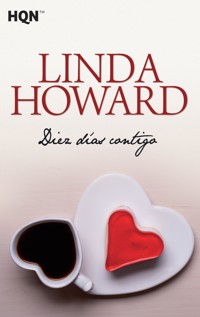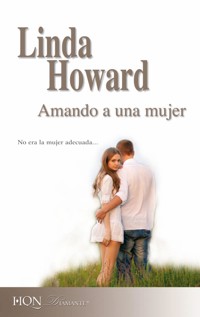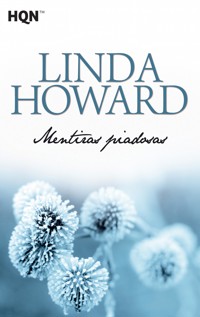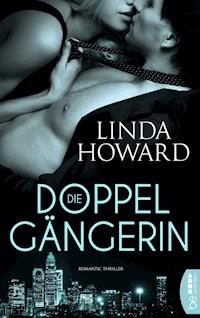
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Blair hat ihr Leben fest im Griff: Sie ist jung, attraktiv und leitet seit Jahren erfolgreich ihr eigenes Fitnessstudio. Bis sie eines Abends auf dem Parkplatz hinter dem Studio Zeugin eines Mordes wird und die Ereignisse sich überschlagen. Das Opfer ist Nicole Goodwin, die Blair in Aussehen und Auftreten penetrant kopiert hat. War Blair etwa das eigentliche Ziel des Anschlags? Und ist der Täter immer noch hinter ihr her? Schnell wird klar: Blair schwebt in großer Gefahr. Gemeinsam mit Lieutenant Jefferson Wyatt Bloodsworth, einem unverschämt gut aussehenden Ex-Footballprofi und ehemaligen Liebhaber, macht sich Blair auf die Suche nach dem Täter. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Blair und Wyatt sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht - aber manchmal ziehen sich Gegensätze eben einfach an ...
Rasante Wortgefechte, jede Menge Spannung und heiße Erotik!
Der erste Teil der Blair-Mallory-Reihe von Linda Howard jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Epilog
Widmung
Die Geschichte um Blair Mallory geht weiter!
Über dieses Buch
Blair hat ihr Leben fest im Griff: Sie ist jung, attraktiv und leitet seit Jahren erfolgreich ihr eigenes Fitnessstudio. Bis sie eines Abends auf dem Parkplatz hinter dem Studio Zeugin eines Mordes wird und die Ereignisse sich überschlagen. Das Opfer ist Nicole Goodwin, die Blair in Aussehen und Auftreten penetrant kopiert hat. War Blair etwa das eigentliche Ziel des Anschlags? Und ist der Täter immer noch hinter ihr her? Schnell wird klar: Blair schwebt in großer Gefahr. Gemeinsam mit Lieutenant Jefferson Wyatt Bloodsworth, einem unverschämt gut aussehenden Ex-Footballprofi und ehemaligen Liebhaber, macht sich Blair auf die Suche nach dem Täter. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn Blair und Wyatt sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht – aber manchmal ziehen sich Gegensätze eben einfach an ...
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Die Doppelgängerin
Romantic Thriller
Aus dem Amerikanischen von Christoph Göhler
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2004 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »To Die For«
Originalverlag: Ballantine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2005 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Blanvalet Verlag, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: skiserge1 | tankist276
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4500-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Die meisten Menschen finden Cheerleading albern. Wenn die wüssten ...
Das typisch amerikanische Girl, das bin ich. Wer sich die Fotos in meinem High-School-Jahrbuch anschaut, sieht ein Mädchen mit langen blonden Haaren, sonnengebräunter Haut und einem strahlenden Lächeln über blendend weißen Zähnen, bezahlt mit Tausenden von Dollar für Spangen und Bleichmittel. Die weißen Zähne natürlich, nicht die Haare und die Haut. Ich hatte die unerschütterliche Selbstsicherheit einer Teenager-Prinzessin aus der oberen Mittelschicht; mir konnte nichts Schlimmes zustoßen. Immerhin war ich Cheerleader.
Ich gebe es zu. Quatsch, ich bin stolz darauf. Wir Cheerleader werden oft für hirntote Schnepfen gehalten, aber nur von Leuten, die selbst nie Cheerleader waren. Ich verzeihe ihnen ihre Ahnungslosigkeit. Cheerleading ist harte Arbeit, es ist ein anstrengendes Zusammenspiel von Geschick und Kraft, und es ist nicht ungefährlich. Immer wieder kommt es dabei zu Verletzungen, manchmal sogar zu Todesfällen. Vor allem die Mädchen sind gefährdet; die Jungs sind die Werfer, die Mädchen werden geworfen. Im Fachjargon heißen wir »Flyer«, was totaler Blödsinn ist, weil wir natürlich nicht fliegen können. Wir werden geworfen. Und die Mädchen, die geworfen werden, sind diejenigen, die auf den Kopf fallen und sich den Hals brechen können.
Na gut, den Hals habe ich mir nie gebrochen, aber dafür den linken Arm und das Schlüsselbein, und einmal renkte ich mir das rechte Knie aus. Die Zerrungen und Prellungen habe ich nie gezählt. Aber ich kann exzellent balancieren, habe schöne, straffe Beine und kann immer noch einen Rückwärts-Flickflack und einen Spagat machen. Außerdem habe ich das College über ein Cheerleading-Stipendium finanziert. Ist das ein cooles Land, oder was?
Also, ich heiße jedenfalls Blair Mallory. Ja, ich weiß. Ein echt zickiger Name. Er passt zu Cheerleading und blonden Haaren. Aber ich kann nichts dafür; meine Eltern haben mich so getauft. Mein Vater heißt auch Blair, darum muss ich mich wohl glücklich schätzen, dass sie bei meiner Taufe nicht einfach ein Junior hinter seinen Namen gesetzt haben. Ich glaube nicht, dass ich zur beliebtesten Schülerin unserer High School gewählt worden wäre, wenn ich Blair Henry Mallory Junior geheißen hätte. Blair Elizabeth reicht völlig, vielen Dank. Ich meine, in Hollywood geben die Leute ihren Kindern Namen wie Homer, ohne Witz. Wenn diese Kinder irgendwann erwachsen werden und ihre Eltern umbringen, sollten sie meiner Meinung nach allesamt auf Notwehr plädieren und freigesprochen werden.
Was mich zu dem Mord bringt, den ich gesehen habe.
Na schön, das tut es nicht wirklich, aber immerhin ist es einigermaßen logisch. Die Verbindung, meine ich.
Und echten amerikanischen Cheerleadern stoßen sehr wohl schlimme Sachen zu. Immerhin war ich verheiratet, oder etwa nicht?
Auch das hat irgendwie mit dem Mord zu tun. Ich heiratete Jason Carson direkt nach dem College und hieß daraufhin vier Jahre lang Blair Carson. Natürlich war es dumm von mir, jemanden zu heiraten, bei dem sich der Vorname auf den Nachnamen reimt, aber hinterher ist man immer schlauer. Jason war ein Vollblutpolitiker: im Studentenrat, im Wahlkampfkomitee für seinen Vater, einen Abgeordneten im Parlament von North Carolina, oder für seinen Onkel, den Bürgermeister – bla bla bla. Jason sah so fantastisch aus, dass manche Mädchen echt ins Stottern kamen. Blöd, dass er das genau wusste. Er hatte dichtes, sonnengeküsstes Haar (ein poetischer Ausdruck für blond), gemeißelte Gesichtszüge, dunkelblaue Augen und einen durchtrainierten Body. Ähnlich wie bei John Kennedy jun. Der Body, meine ich.
Zusammen waren wir das Reklamepaar für blondes Haar und ein blendendes Gebiss. Und mein Body war auch nicht ohne, wenn ich mal so sagen darf. Mussten wir da nicht heiraten?
Vier Jahre später entheirateten wir uns wieder, zu unserer beiderseitigen großen Erleichterung. Schließlich hatten wir außer unserem Aussehen nichts gemeinsam, und ich glaube nicht, dass sich allein darauf eine Ehe gründen lässt, oder? Jason wollte unbedingt ein Kind, damit wir wie die typisch amerikanische Familie aussahen, während er auszog, um der jüngste Kongressabgeordnete aller Zeiten in North Carolina zu werden, was mich, falls es jemanden interessiert, stinksauer machte, weil er bis dahin um keinen Preis ein Baby wollte, und plötzlich sollte ich eins bekommen, nur weil es sich im Wahlkampf so gut macht? Ich sagte ihm, er könne mich mal lecken. Nicht, dass er mich nie zuvor geleckt hätte, aber diesmal meinte ich woanders, klar?
In der Scheidungsvereinbarung habe ich ihn richtig abgezockt. Vielleicht sollte ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben; ich meine, aus feministischer Sicht ist das nicht gerade der Königsweg. Auf eigenen Füßen stehen, es aus eigener Kraft schaffen und so weiter und so fort. Dabei glaube ich tatsächlich an all das, aber ich wollte Jason leiden lassen. Ich wollte ihn bestrafen. Wofür? Dass ich ihn dabei erwischt hatte, wie er an Silvester mit meiner jüngsten Schwester Jennifer rumknutschte, während die restliche Familie im Wohnzimmer war und fieberhaft dem Footballspiel folgte. Jenni war damals siebzehn.
Also, auch wenn ich wütend bin, weiß ich ganz genau, was ich tue. Als ich sie im Esszimmer stehen sah, schlich ich auf Zehenspitzen davon und holte eine der Einwegkameras, die wir damals benutzten, um die Feier für Jasons Wahlkampf zu dokumentieren – der Kandidat im Kreise der Familie, alle fröhlich um einen Tisch versammelt, auf dem sich sämtliche Arterien verstopfende Süßigkeiten häufen, während im Fernsehen das Footballspiel läuft. Er bevorzugte die Fotos von unseren Familienfeiern, weil meine Familie viel besser aussieht als seine. Jason ließ nichts aus, was seinem Wahlkampf genutzt hätte.
Jedenfalls schoss ich ein echt gutes Bild von Jason und Jenni, mit Blitz und allem, damit er wusste, dass ich ihn am Sack hatte. Was hätte er tun sollen? Mir hinterherjagen, sich vor den Augen meines Vaters auf mich hechten und mir die Kamera aus der Hand reißen? Wohl kaum. Zum einen hätte er dann einiges zu erklären gehabt, und natürlich konnte er nicht darauf zählen, dass ich seine Story stützen würde. Zum anderen hätte ihn mein Vater mit einem Tritt in den Fernseher befördert, wenn er es gewagt hätte, seiner Prinzessin und weiblichen Stammhalterin ein Haar zu krümmen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Daddys Augenstern bin?
Also reichte ich die Scheidung ein, und Jason gab mir alles, was ich verlangte, und das unter einer einzigen Bedingung: Dass ich ihm das Foto und das Negativ von ihm und Jenni gab. Na klar, warum auch nicht? Schließlich hatte ich sicherheitshalber mehrere Abzüge machen lassen.
Vielleicht meinte Jason, ich sei zu blöd dafür. Es ist ein schwerer Fehler, die Skrupellosigkeit deiner Gegner zu unterschätzen. Auch aus diesem Grund wird es Jason in der Politik nie weit bringen, schätze ich.
Außerdem erzählte ich Mom, dass sich Jenni von Jason hatte küssen lassen. Es glaubt doch wohl niemand, dass die kleine falsche Möchtegern-Lolita ungeschoren davongekommen wäre, oder? Nicht, dass ich Jenni nicht lieben würde, aber sie ist unser Nesthäkchen und glaubt, ihr steht alles und vor allem jeder zu, den sie sich in den Kopf gesetzt hat. Ab und zu muss man sie in die Schranken weisen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich auch ihr Name reimt: Jenni Mallory. Eigentlich heißt sie Jennifer, aber niemand nennt sie so, deshalb zählt das nicht. Ich weiß nicht, was mich so an Namen stört, die sich reimen, aber ich sollte mich unbedingt von solchen Leuten fernhalten. Trotzdem habe ich Jenni verziehen, weil sie meine Schwester ist. Jason würde ich nie im Leben verzeihen.
Und so knöpfte sich Mom Jenni vor, die mich unter Tränen um Verzeihung bat und versprach, von nun an ein artiges Mädchen zu sein oder zumindest mehr Geschmack zu beweisen, während meine zweite Schwester Siana, die damals Jura studierte, die Verhandlungen mit Jason übernahm. Der Name »Siana« soll angeblich die walisische Form von »Jane« sein, aber ganz unter uns: In Wahrheit bedeutet der Name »männerfressende Hyäne mit niedlichen Grübchen«. Das ist Siana nämlich.
Nachdem die Mallory-Frauen erst in Aktion getreten waren, ging die Scheidung in Rekordzeit über die Bühne, ohne dass Daddy je mitgekriegt hätte, warum wir eigentlich so sauer auf Jason waren. Nicht, dass es ihn besonders interessiert hätte; wenn wir sauer auf ihn waren, dann war er schon unseretwegen ebenfalls sauer auf ihn. Ist er nicht ein echter Schatz?
In der Scheidungsvereinbarung bekam ich von Jason einen goldenen Abschiedskuss, tausend Dank. Und das rote Mercedes-Cabrio natürlich, aber das Geld war wichtiger, denn das legte ich an. Ich kaufte mir eine Muckibude. Ein Fitnesscenter. Schließlich soll man die eigenen Talente nutzen, und ich weiß, wie man sich in Form hält. Siana schlug vor, ich sollte das Studio »Blairs bezaubernde Busenbude« nennen, aber ich wollte nicht das falsche Publikum anlocken und auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir Schönheitsoperationen durchführen. Mom kam irgendwann auf »Great Bods«, das gefiel uns allen, und so wurde das ehemalige »Halloran’s« umgetauft.
Für die Umbauten und Renovierung musste ich ganz schön abdrücken, doch als das Studio fertig war, schrie es laut: »Luxus!« Die Spiegel glänzten, die Fitnessgeräte waren vom Allerfeinsten, die Toiletten, Garderoben und Duschen waren komplett erneuert worden, wir hatten zwei Saunas und einen Pool einbauen lassen und die Räume um einen Massageraum erweitert. Ein Great-Bods-Mitglied konnte zwischen Yoga, Aerobic, Tae Bo oder Kickboxen wählen. Wer beim Yoga nicht genug Aggressionen abgebaut hatte, konnte anschließend nach nebenan gehen und Arschtritte verteilen. Außerdem legte ich großen Wert darauf, dass alle meine Angestellten in Erster Hilfe und Herzdruckmassage ausgebildet waren, weil man nie wissen kann, ob sich nicht ein übergewichtiger Schreibtischhocker mit überhöhtem Cholesterinspiegel zu viele Gewichte auf die Hebebank packt, weil er, um seine Sekretärin zu beeindrucken, über Nacht seinen Teenager-Body zurückhaben will, und schon ist es passiert: Er bettelt geradezu um einen Herzinfarkt. Außerdem wirkt so was in einer Anzeige echt professionell.
Das viele Geld und die Erste-Hilfe-Kurse zahlten sich aus. Schon einen Monat nach der Eröffnung lief das Great Bods wie geschmiert. Die Kundinnen und Kunden konnten für einen Monat oder ein ganzes Jahr Mitglied werden – natürlich mit Rabatt, wenn sie für ein Jahr bezahlten, was nur geschickt ist, weil man sie damit am Haken hat und die meisten von ihnen dann regelmäßig kommen, wenn sie ihr Geld nicht zum Fenster rauswerfen wollen. Viele Autos auf dem Parkplatz machen schon von außen einen guten Eindruck, und wie wichtig der erste Eindruck ist, weiß wohl jeder. So oder so vermehrten sich meine Mäuse wie die Karnickel. Es war ein echt prickelndes Gefühl, vom Scheitel bis runter zu den Legwarmers – die einige Ahnungslose für passé halten mögen, weil sie keinen Dunst haben, wie eine Frau ihre Beine zur Geltung bringen kann. Ganz oben auf der Liste stehen natürlich High Heels, aber Legwarmers kommen gleich dahinter. Ich trage beides. Natürlich nicht gleichzeitig. Also bi-hitte!
Das Great Bods ist von sechs bis einundzwanzig Uhr geöffnet, sodass die Mitglieder den Besuch problemlos in ihren Tagesablauf einplanen können. Die Yogastunden liefen anfangs nicht so recht, weil sich nur ein paar Hausfrauen eingeschrieben hatten, aber dann bestellte ich beim Studentendienst ein paar knackige, gut aussehende College-Footballer, die ich eine Woche lang gegen Bezahlung mitturnen ließ. Die Hantelstemmer und Tae-Bo-Typen, allesamt kleine Möchtegern-Machos, wollten natürlich auch das machen, was meine jungen gut aussehenden Burschen so in Form hielt, und die Frauen drängten in meinen Kurs, um mit denselben jungen Burschen in einem Raum zu sein. Bis zum Ende der Woche hatten sich die Teilnehmerzahlen vervierfacht. Nachdem die Machos erst gemerkt hatten, wie anstrengend Yoga wirklich ist und wie viel es bringt, blieben die meisten dem Kurs treu – genau wie die Frauen.
Habe ich erwähnt, dass ich im College auch Psychologie belegt hatte?
Seither sind ein paar Jahre vergangen: ich bin inzwischen dreißig und stolze Eigentümerin eines erfolgreichen Unternehmens, das mich in jeder Hinsicht auf Trab hält und zugleich einen hübschen Gewinn abwirft. Das rote Cabrio habe ich gegen ein weißes eingetauscht, weil ich nicht mehr ganz so auffallen wollte. Es ist nicht schlau, als junge Singlefrau zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Außerdem wollte ich irgendwann ein neues Auto. Ich liebe diesen Geruch. Ja, ich weiß, ich hätte einen Ford oder so kaufen können, aber Jason hätte sich in den Hintern beißen können, weil ich in einem Mercedes-Cabrio rumfahre und er es nicht darf, da das schlecht für sein Image wäre. Wahrscheinlich wird er mich bis an sein Lebensende um diesen Mercedes beneiden. Hoffentlich.
Jedenfalls parkte ich das Cabrio nicht vorn auf dem Kundenparkplatz, weil ich nicht wollte, dass der Wagen ständig Schrammen oder Beulen abbekam. Ich hatte stattdessen für die Angestellten auf der Rückseite des Studios einen geteerten Privatparkplatz mit einem eigenen, viel praktischeren Eingang anlegen lassen; mein reservierter Stellplatz – extrabreit, damit ich immer bequem aus- und einsteigen kann – befindet sich direkt vor der Tür. Chefin zu sein hat was für sich. Nachdem ich aber eine großzügige Chefin bin, habe ich entlang der gesamten Rückwand des Studios ein langes Wellblech-Vordach anbringen lassen, unter dem wir alle parken können. So kommen wir ohne nass zu werden zu unseren Autos oder ins Studio. Bei Regen weiß man so was zu schätzen.
Ich bin die Chefin, aber ich halte nichts davon, meine Angestellten zu knechten. Abgesehen von dem Privatstellplatz fordere ich keine besonderen Privilegien ein. Na ja, dass ich die Gehaltsschecks unterschreibe, gibt mir wohl einen gewissen Vorteil, und bei allen finanziellen und besonders wichtigen Entscheidungen habe ich das letzte Wort, aber ich kümmere mich auch um meine Leute. Wir haben eine attraktive Firmen-Krankenversicherung, Zahnbehandlung eingeschlossen, ich zahle nicht schlecht – außerdem dürfen die Angestellten an ihren freien Tagen gegen zusätzliche Gebühr Privatstunden geben –, und ich gebe mehr Urlaub als gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund habe ich einen mehr oder weniger festen Stamm an Personal. Natürlich gibt es Wechsel, das Leben geht weiter, manche Leute ziehen weg und so, aber nur selten geht jemand, weil er oder sie woanders ein besseres Angebot bekommen hat. Eine gewisse Kontinuität beim Personal ist gut fürs Geschäft. Die Kunden haben dann das Gefühl, dass sie ihre Trainer und Lehrer kennen.
Um neun Uhr machen wir zu, und ich schließe abends gewöhnlich selbst ab, damit meine Angestellten heim zu ihrer Familie fahren oder sich mit ihren Freunden treffen oder sonst was unternehmen können. Das soll nicht heißen, dass ich keine Freunde hätte, mit denen ich mich treffe. Stimmt schon, ich habe nicht mehr so viele Dates wie kurz nach meiner Scheidung, aber das Great Bods nimmt viel Zeit in Anspruch und ist mir auch wichtig, darum geht bei mir das Geschäft vor. Und ich bin kreativ bei meinen Verabredungen: am liebsten treffe ich mich zum Mittagessen, was sehr praktisch sein kann, wenn der Typ doch nicht so toll ist wie erhofft, weil ein Mittagessen nach einer Stunde vorbei ist. Man trifft sich, man isst etwas, man geht wieder in die Arbeit. Auf diese Weise muss ich mir den Typen nicht krampfhaft vom Leib halten, wenn ich nichts mit ihm anfangen kann, und brauche mir auch keine Ausrede zu überlegen, warum ich ihn nicht mit in die Wohnung nehme. Mittagessen ist ein super Konzept, datemäßig gesehen. Falls er mir doch gefällt, eröffnen sich weitere Optionen, wie zum Beispiel ein echtes Date am Abend oder am Sonntag, wenn das Great Bods zu hat.
Jedenfalls schloss ich in der fraglichen Nacht – ich habe doch erwähnt, dass ich einen Mord beobachtet habe, oder? – wie gewöhnlich alle Türen ab. Ich war ein bisschen spät dran, weil ich noch etwas Gymnastik gemacht hatte; man kann nie wissen, ob man nicht unerwartet einen Rückwärts-Flickflack vorführen muss. Weil ich dabei ziemlich ins Schwitzen gekommen war, hatte ich noch geduscht und mir die Haare gewaschen, bevor ich meinen Kram zusammenpackte und mich auf den Weg zum Hinterausgang machte. Ich schaltete alle Lichter aus, öffnete die Tür und trat nach draußen unter das Vordach.
Ach, Moment, ich greife vor. Erst muss ich noch das mit Nicole erklären.
Nicole »ich bin die Nikki« Goodwin war der Stachel in meinem Fleisch. Sie kam vor etwa einem Jahr ins Great Bods und trieb mich vom ersten Tag an zum Wahnsinn, auch wenn mir das erst nach ein paar Monaten bewusst wurde. Nicole hat so eine rauchige Kieksstimme, die alle starken Männer schwach werden lässt. Ich hingegen hätte ihr am liebsten die Luft abgedreht. Was finden die Typen nur an diesem nachgeäfften Marylin-Monroe-Gefiepe? Die meisten Typen jedenfalls. Außerdem war Nicole ständig und zu jedem zuckersüß; es ist ein Wunder, dass bei einer derartigen Überdosis Zucker nicht jeder wie ein Superball durchs Zimmer hüpfte. Wenigstens hatte sie die Haare-um-die-Finger-kringel-Masche nicht drauf.
Aber auch nur, weil ich das nicht mache – außer ich will jemanden auf den Arm nehmen, meine ich. Normalerweise bin ich professioneller.
Kurz und schlecht, Nicole war eine sklavische Nachäfferin. Und ausgerechnet mich äffte sie nach.
Erst kamen die Haare. Von Natur aus waren ihre Haare mausbraun, aber keine zwei Wochen, nachdem sie bei uns Mitglied geworden war, wurde sie goldblond und bekam helle Strähnchen. Genau wie ich. Damals fiel es mir nicht auf, weil ihre Haare kürzer waren als meine; erst später, als sich ein Detail zum anderen fügte, ging mir auf, dass sie die gleiche Haarfarbe hatte wie ich. Dann fing sie an, die Haare zu einem hohen Pferdeschwanz zu bündeln, damit sie ihr beim Trainieren nicht im Weg waren. Und wer hatte wohl auch einen so hohen Pferdeschwanz, wenn sie trainierte?
Ich schminke mich kaum, wenn ich ins Studio gehe, weil das nur Zeitverschwendung ist; sobald ein Mädchen richtig ins Schwitzen kommt, hat keine Schminke eine Chance. Außerdem habe ich gute Haut und hübsche dunkle Brauen und Wimpern, weshalb es mir nichts ausmacht, mit nacktem Gesicht herumzulaufen. Allerdings habe ich eine Schwäche für eine Glistening Lotion, die meiner Haut einen sanften Schimmer verleiht. Nicole fragte mich, welche Lotion ich nehme, und ich dumme Kuh verriet es ihr. Ab dem nächsten Tag schimmerte auch Nicoles Haut.
Ihre Sportsachen wurden meinen immer ähnlicher: ein Gymnastikanzug und Legwarmer, wenn ich wirklich Sport treibe, und Yogahosen, wenn ich mich ums Geschäft kümmere. Nicole begann einen Gymnastikanzug und Legwarmer zu tragen und ansonsten in Yogahosen rumzuhüpfen. Und ich meine hüpfen. Ich glaube nicht, dass sie einen BH besaß. Leider gehörte sie zu den Frauen, die einen tragen sollten. Meine männlichen Mitglieder (ich liebe diesen Ausdruck) schienen an dem Spektakel Gefallen zu finden, aber mir wurde von dem Gewackel und Geschaukel so schwindlig, dass ich ihr immer angestrengt in die Augen sah, wenn ich mit ihr reden musste.
Dann kaufte sie sich ein weißes Cabrio.
Es war zwar kein Mercedes, sondern ein Mustang, aber trotzdem – es war ein Cabrio und es war weiß. Wie peinlich kann so jemand eigentlich werden?
Vielleicht hätte ich mich geschmeichelt fühlen sollen, aber das tat ich nicht. Es war nicht so, als hätte Nicole mich so toll gefunden und aus lauter Bewunderung kopiert. Im Gegenteil, ich glaube, sie konnte mich nicht ausstehen. Wenn sie mit mir redete, war das Saccharin in ihrer süßen Art immer ein bisschen zu deutlich herauszuschmecken, klar? In Nicole-Sprech bedeutete: »Ach, Schätzchen, das sind echt supergeile Ohrringe!« in Wirklichkeit: »Ich will sie dir aus den Ohren reißen und nur ein paar blutige Fetzen dranlassen, du Schlampe.« Ein anderes Mitglied im Club – natürlich eine Frau – meinte einmal sogar, nachdem sie Nicole mit hüpfenden Brüsten und wackelndem Po von dannen scharwenzeln sah: »Die Frau würde dir liebend gern die Kehle aufschlitzen, dich mit Benzin übergießen, anzünden und im Rinnstein liegen lassen. Und am allerliebsten würde sie wiederkommen, nachdem das Feuer ausgegangen ist, und auf deiner Asche tanzen.«
Na? Ich bildete mir das also nicht nur ein.
Weil ich einen möglichst bunt gemischten Club haben wollte, musste ich praktisch jeden Bewerber aufnehmen, was im Grunde kein Problem war, obwohl ich manchen eher haarigen Kandidaten am liebsten vorab zur Elektrolyse geschickt hätte; aber zum Ausgleich gab es eine Klausel im Mitgliedsvertrag – den jeder Bewerber bei der Aufnahme unterzeichnen musste –, dass die Mitgliedschaft nicht verlängert wurde, wenn sich mindestens drei andere Mitglieder beschwert hatten, weil der oder die Betreffende störendes oder belästigendes oder schamloses Verhalten gezeigt hatte.
Da ich Profi bin, hätte ich Nicole nicht rausgeworfen, nur weil sie mir tierisch auf die Nerven ging. Es fiel mir schwer, professionell zu bleiben, aber ich konnte mich beherrschen. Da Nicole Nicole war, provozierte, beleidigte oder verärgerte sie praktisch jede Frau, mit der sie zu tun hatte. Sie veranstaltete regelmäßig eine Sauerei im Umkleideraum und überließ es den anderen, ihr hinterherzuräumen. Sie lästerte über andere Frauen, die nicht ganz so gut in Form waren, und hielt stundenlang die Geräte besetzt, obwohl jede Trainingseinheit auf dreißig Minuten begrenzt war.
Meist erreichten mich die Klagen in Form von bissigen Bemerkungen, aber hin und wieder wandte sich auch eine Frau mit loderndem Blick an mich und bestand darauf, eine formelle Beschwerde einzureichen. Ich danke all diesen tapferen Frauen.
Als Nicoles Jahresvertrag auslief, waren deutlich mehr als drei Beschwerden eingegangen, darum konnte ich ihr – ganz behutsam natürlich – darlegen, dass sie ihre Mitgliedschaft nicht verlängern konnte und ihren Schrank ausräumen sollte.
Der Aufschrei, den ich mir damit einhandelte, erschreckte wahrscheinlich noch die Kühe im Nachbarort. Sie beschimpfte mich als Miststück, Hure, Schlampe, und das war erst der Auftakt. Die schrillen Beleidigungen wurden immer lauter und lockten praktisch alle im Great Bods an, und ich bin überzeugt, dass sie auf mich eingedroschen hätte, wenn sie nicht genau gewusst hätte, dass ich besser in Form war als sie und sofort zurückgeschlagen hätte, nur ein wenig fester. So gab sie sich damit zufrieden, alles von der Theke am Empfang zu fegen – ein paar Topfpflanzen, die Aufnahmeanträge, einen Becher mit Kugelschreibern – und abzurauschen. Noch in der Tür warnte sie mich, dass ich von ihrem Anwalt hören würde.
Wunderbar. Leck mich. Meine Anwältin würde ihren Anwalt zum Frühstück verputzen. Siana ist jung, aber gefährlich, und sie scheut nicht davor zurück, mit harten Bandagen zu kämpfen. Das haben wir von unserer Mutter.
Die Frauen, die sich versammelt hatten, um Nicoles Zornesausbruch zu verfolgen, applaudierten erleichtert, als die Tür hinter ihr zuknallte. Die Männer sahen ihr belämmert hinterher. Ich war sauer, weil Nicole ihren Schrank nicht ausgeräumt hatte, denn das bedeutete, dass ich sie noch mal ins Haus lassen musste, damit sie ihren Kram abholen konnte. Ich war halb entschlossen, Siana zu fragen, ob ich darauf bestehen konnte, dass Nicole ihren Schrank zu einem fest vereinbarten Termin leerte. Dann konnte ich einen Polizisten herbestellen, der erstens bezeugen konnte, dass sie alle Sachen mitnahm, und zweitens einen weiteren Wutausbruch verhindern würde.
Der Rest des Tages verstrich wie in einem süßen Rausch. Ich war Nicole los! Es störte mich nicht mal, den Saustall zu beseitigen, den sie hinterlassen hatte, denn sie war weg, weg, weg!
Okay. So viel zu Nicole.
Und zurück zu jenem Abend und dem Hintereingang und so weiter und so fort.
Das Licht der Straßenlaterne an der Ecke reichte zwar bis auf den Parkplatz, aber trotzdem lagen überall tiefe Schatten. Es nieselte leicht, und ich fluchte leise vor mich hin, weil der Straßendreck auf mein Cabrio spritzen würde und es außerdem langsam diesig wurde. Regen und Nebel sind keine gute Kombination. Gott sei Dank habe ich keine Locken und muss mir keine Gedanken machen, dass meine Haare bei so einem Wetter verfilzen könnten.
Schließlich will jede Frau so gut wie möglich aussehen, wenn sie Zeugin eines echten Verbrechens wird.
Erst nachdem ich die Tür von außen abgeschlossen und mich umgedreht hatte, fiel mir der Wagen in der hintersten Ecke des Parkplatzes auf. Es war ein weißer Mustang. Nicole wartete auf mich, verfluchte Scheiße.
Augenblicklich angespannt und ein bisschen nervös – immerhin war sie vorhin gewalttätig geworden – trat ich einen Schritt zurück an die Wand, damit sie mich nicht von hinten überraschen konnte. Ich schaute nach links und rechts, weil ich damit rechnete, dass sie irgendwo aus dem Schatten auftauchen würde, aber nichts geschah, weshalb ich wieder auf den Mustang sah und mich fragte, ob sie wohl darin saß und darauf wartete, dass ich wegfuhr. Was würde sie dann tun? Mir nachfahren? Mich von der Straße abdrängen? Mein Auto überholen und auf mich schießen? Zugetraut hätte ich ihr alles.
In dem Regen und Nebel war es unmöglich festzustellen, ob jemand in dem Mustang saß, aber dann sah ich hinter dem Auto eine Silhouette stehen und erkannte blonde Haare. Ich tastete in meiner Handtasche nach dem Handy und schaltete es ein. Sobald sie auch nur einen Schritt auf mich zu machte, würde ich die Polizei rufen.
Dann begann sich die Gestalt hinter dem Mustang schwankend zu bewegen, und ein größerer, dunklerer Schatten löste sich von Nicole. Ein Mann. Ach du Scheiße; sie hatte jemanden mitgebracht, der mich zusammenschlagen sollte.
Ich tippte die ersten zwei Ziffern ein.
Ein lauter Knall ließ mich hochschrecken. Mein erster Gedanke war, dass irgendwo in der Nähe ein Blitz eingeschlagen hatte. Aber ich hatte keinen Blitz gesehen und spürte auch keine Erschütterung im Boden. Dann begriff ich, dass ich höchstwahrscheinlich einen Schuss gehört hatte, der höchstwahrscheinlich mir gegolten hatte, und ließ mich mit einem panischen Quieken hinter meinem Auto auf alle viere fallen. Eigentlich hatte ich laut schreien wollen, aber aus meiner Kehle kam nur dieses Minnie-Maus-Quietschen, das mir unendlich peinlich gewesen wäre, wenn ich mir nicht vor Angst fast in die Hose gemacht hätte. Nicole hatte keinen Schläger mitgebracht; sondern einen Killer!
Ich hatte mein Handy fallen lassen und fand es in der Dunkelheit nicht mehr. Blöderweise musste ich ständig nach allen Seiten Ausschau halten und konnte deshalb nicht richtig danach suchen. Ich strich einfach mit der Hand über den Asphalt und hoffte, irgendwann darauf zu stoßen. Ach du Scheiße, und wenn der Killer gleich rüberkam, um nachzusehen, ob er mich getroffen hatte? Ich meine, ich war zu Boden gegangen, warum sollte er also nicht denken, dass er mich erwischt hatte? Sollte ich mich flach auf den Boden legen und tot stellen? Unter das Auto kriechen? Versuchen, wieder ins Studio zu kommen, und die Tür verriegeln?
Ich hörte einen Motor starten und sah gerade noch rechtzeitig auf, um mitzubekommen, wie eine dunkle, viertürige Limousine die schmale Durchfahrt entlangrollte und hinter der Hausecke verschwand. Dann hörte ich, wie sie an der Einmündung in die vierspurige Parker Street abbremste, kurz anhielt und sich dann in den schwachen Abendverkehr einfädelte. Ob sie links oder rechts abgebogen war, wusste ich nicht.
War das der Killer gewesen? Wenn sonst noch jemand auf dem Parkplatz gewesen wäre, hätte er oder sie mit Sicherheit den Schuss gehört und wäre wohl kaum so seelenruhig weggefahren. Der einzige seelenruhige Fahrer wäre der Schütze selbst, oder? Jeder andere hätte gemacht, dass er wegkam, genau wie ich es liebend gern getan hätte.
Typisch für Nicole, dass sie so eine Flasche angeheuert hatte; der Kerl hatte nicht mal nachgesehen und sich überzeugt, dass er mich erwischt hatte. Aber selbst wenn der Killer abgehauen war, wo war dann Nicole geblieben? Ich wartete ab und lauschte, hörte aber weder Schritte, noch das Motorengeräusch eines Mustangs.
Ich legte mich flach auf den Bauch und linste an den Vorderrädern vorbei. Der Mustang stand immer noch auf seinem Platz, doch von Nicole war nichts zu sehen.
Es kamen auch keine Passanten angelaufen, um nachzusehen, wer da geschossen hatte oder ob jemand verletzt worden war. Das Great Bods liegt in einem belebten Viertel mit kleinen Läden und Restaurants, aber nicht in einem Wohngebiet – und die Läden und Restaurants hatten vor allem die Leute aus den umliegenden Firmen als Kunden, weshalb alle Restaurants um sechs und die Läden nicht viel später zumachten. Wenn jemand, der später aus dem Great Bods kam, auch nur ein Sandwich wollte, musste er mindestens fünf Blocks weit fahren. Bis zu diesem Moment war mir nie bewusst gewesen, wie abgeschieden der Mitarbeiterparkplatz abends war.
Niemand außer mir hatte den Schuss gehört. Ich war allein.
Ich hatte zwei Möglichkeiten. Meine Autoschlüssel waren in der Jackentasche. Ich hatte zwei Schlüsselringe, weil ich für das Studio so viele verschiedene Schlüssel brauchte, dass ich den Bund nicht mit mir herumschleppen wollte, wenn ich Besorgungen machte oder einkaufen ging. Ich würde meinen Autoschlüssel in Nullkommanix finden, konnte die Türen mit der Fernbedienung öffnen und reinhüpfen, ehe Nicole mich erwischte – es sei denn, sie stände genau hinter meinem Auto, was ich für unwahrscheinlich hielt, aber auch nicht ausschließen konnte. Nur kam mir ein Auto und ganz besonders ein Cabrio nicht wirklich sicher vor, solange ich von einer durchgeknallten Psychopathin bedroht wurde. Und wenn sie auch eine Waffe hatte? Ein Leinenverdeck hält keine Kugel ab.
Die andere Möglichkeit war, den großen Schlüsselring aus meiner Handtasche zu angeln, den Türschlüssel zu ertasten, die Tür aufzuschließen und ins Haus zu fliehen. Das würde zwar länger dauern, aber ich wäre dafür hinter dicken Mauern und einer verriegelten Tür.
Na schön, wahrscheinlich gab es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich nach Nicole Ausschau zu halten und ihr eins überzuziehen, und das hätte ich vielleicht auch getan, wenn ich sicher gewusst hätte, dass sie nicht bewaffnet war. Weil ich das aber nicht wusste, wollte ich auf gar keinen Fall die Heldin spielen. Ich bin vielleicht blond, aber ich bin nicht blöd.
Außerdem bricht man sich bei einem Kampf auf Leben und Tod mindestens zwei Fingernägel ab. Das steht fest.
Also tastete ich in meiner Handtasche herum, bis ich die Schlüssel spürte. Der Schlüsselring hatte in der Mitte so ein Dingsbums, damit die Schlüssel nicht rundum kreisen konnten und immer in derselben Reihenfolge blieben. Der Schlüssel zur Hintertür war der erste links von diesem Mitteldings. Ich zog ihn heraus und watschelte dann im Entengang rückwärts zur Tür. Das mag dämlich aussehen, ist aber ein Wahnsinnstraining für Schenkel und Po.
Niemand hechtete sich auf mich. Ich hörte überhaupt kein Geräusch außer hin und wieder ein vorbeifahrendes Auto auf der Parker Street, und das war irgendwie noch gespenstischer, als wenn sie mich kreischend über das Autodach hinweg angesprungen hätte. Nicht, dass ich geglaubt hätte, Nicole könnte so weit springen. Dazu hätten ihre Turnkünste alles, was sie uns im Studio gezeigt hatte, weit, weit übersteigen müssen, und das taten sie bestimmt nicht, weil sie uns andernfalls ständig damit auf die Nerven gegangen wäre. Sie schaffte nicht mal einen Spagat, und wenn sie jemals einen Rückwärts-Flickflack versucht hätte, wären ihr dabei garantiert die fetten Euter ins Gesicht geklatscht.
O Gott, ich wünschte, sie hätte wenigstens ein einziges Mal einen Rückwärts-Flickflack probiert.
Meine Hände zitterten nur leicht – na gut, sie zitterten wie Espenlaub –, aber ich bekam die Tür gleich beim ersten Versuch auf. Ich flog praktisch durch den Türspalt, und ganz ehrlich, ich bereute bitter, dass ich mir nicht etwas mehr Raum gegeben hatte, weil ich nämlich mit dem Oberarm gegen den Türrahmen knallte und mir einen dicken blauen Fleck holte. Aber immerhin war ich drinnen. Ich knallte die Tür zu, legte den Riegel vor und krabbelte auf allen vieren los, weil ich Angst hatte, dass sie durch die Tür schießen könnte.
Nachts lasse ich immer zwei Notlichter brennen, aber die sind beide vorne. Der Schalter für das Licht im hinteren Flur befindet sich natürlich genau neben der Tür, und dorthin wollte ich auf gar keinen Fall zurück. Weil ich nichts sehen konnte, krabbelte ich den Flur entlang und tastete mich an der Damentoilette vorbei – die Herrentoilette war auf der anderen Seite des Flurs – weiter zum Pausenraum und schließlich bis zur dritten Tür vor, die in mein Büro führt.
Ich fühlte mich wie ein Baseballspieler nach einem Homerun. Ich war in Sicherheit!
Nachdem mehrere Mauern und eine verriegelte Tür zwischen mir und dieser Psycho-Schlampe waren, konnte ich endlich aufstehen, das Licht einschalten, nach meinem Telefon greifen und wutentbrannt die 911 eintippen. Wenn sie glaubte, ich würde ihr dafür nicht die Polizei auf den Hals hetzen, dann hatte sie schwer unterschätzt, wie stinksauer ich auf sie war.
2
Genau vier Minuten und siebenundzwanzig Sekunden später hielt auf dem vorderen Parkplatz ein Streifenwagen mit blitzendem Blaulicht. Ich weiß das so genau, weil ich die Zeit gestoppt habe. Wenn ich der Notrufzentrale melde, dass auf mich geschossen wird, dann erwarte ich eine prompte Reaktion der Polizeidienststelle, die ich mit meinen Steuern finanziere. Alles unter fünf Minuten, hatte ich mir zurechtgelegt, war noch okay. In mir haust eine kleine Diva, der ich ab und zu eine knallen muss, wenn sie allzu aufmüpfig wird, denn es ist einfach so, dass die Leute viel schneller kooperieren, wenn man ihnen nicht gleich den Kopf abbeißt (wer hätte das gedacht?), weshalb ich mir alle Mühe gebe, stets so nett zu sein, wie ich nur kann – was meinen Ex allerdings nicht einschließt –, aber wenn ich Angst um mein Leben habe, kann ich für nichts garantieren.
Nicht, dass ich hysterisch gewesen wäre oder so. Ich stürmte nicht aus der Tür und warf mich in die Arme des erstbesten Bullen – auch wenn ich das nur zu gern getan hätte –, aber die beiden Polizisten hatten schon die Hand an der Waffe, als sie aus ihrem Auto stiegen, und ich hatte den bösen Verdacht, dass sie auf mich schießen würden, wenn ich auf sie zugerannt käme. Vom Schießen hatte ich für eine Nacht genug, darum schaltete ich das Licht an und machte die Tür auf, blieb aber im Eingang stehen, wo sie mich sehen konnten und ich gleichzeitig vor allen herumschleichenden Psycho-Schlampen geschützt war. Außerdem hatte sich das Nieseln zu einem richtigen Regen gemausert, und ich wollte nicht nass werden.
Ich war ganz ruhig. Ich hüpfte nicht quiekend von einem Fuß auf den anderen. Na gut, das Adrenalin und der Stress machten sich bemerkbar, und ich zitterte am ganzen Leib und hätte gern meine Mom angerufen, aber ich überspielte das und weinte nicht mal.
»Wir haben eine Meldung bekommen, dass hier geschossen wurde, Madam«, sagte der eine Bulle, als ich zur Seite trat und die beiden reinließ. Sein wacher Blick tastete peinlich genau den leeren Empfangsraum ab, ob nicht irgendwo ein paar bewaffnete Männer lauerten. Er sah aus wie Ende zwanzig, hatte einen Bürstenschnitt und einen kräftigen Nacken, der mir verriet, dass er regelmäßig trainierte. In meinem Club war er aber nicht Mitglied, sonst hätte ich ihn gekannt. Vielleicht würde ich ihn im Studio herumführen können, nachdem sie Nicole hopsgenommen hatten. Hey, eine Geschäftsfrau sollte keine Gelegenheit versäumen, einen neuen Kunden zu gewinnen, oder?
»Es war nur ein einziger Schuss«, sagte ich. Ich streckte die Hand aus. »Ich bin Blair Mallory, Besitzerin des Great Bods.«
Ich glaube, Polizisten treffen nicht oft auf Leute, die sich ihnen formvollendet vorstellen, denn beide sahen mich ziemlich überrascht an. Der andere Bulle war noch jünger, quasi ein Bullenkalb, aber er hatte sich als Erster wieder gefangen und schüttelte tatsächlich meine Hand. »Madam«, sagte er höflich, zog dann ein kleines Notizbuch aus der Tasche und schrieb meinen Namen auf. »Ich bin Officer Barstow, und das ist Officer Spangler.«
»Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.« Ich schenkte ihnen mein strahlendstes Lächeln. Ja, ich zitterte immer noch, aber das ist kein Grund, auf gutes Benehmen zu verzichten.
Da ich ganz offensichtlich nicht bewaffnet war, schienen sie sich etwas zu entspannen. Ich trug ein bauchfreies rosa Tanktop und schwarze Yogahosen und hatte demzufolge nicht einmal eine Hosentasche, in der ich eine Waffe versteckt haben konnte. Officer Spangler nahm die Hand von der Pistole. »Was ist passiert?«, fragte er.
»Heute Nachmittag hatte ich eine Auseinandersetzung mit einer Kundin, Nicole Goodwin« – auch ihren Namen notierte Officer Barstow geflissentlich in seinem kleinen Notizbuch –, »weil ich nach zahlreichen Beschwerden von anderen Mitgliedern ihre Mitgliedschaft nicht verlängern wollte. Sie wurde ausfallend, warf Sachen von der Empfangstheke, beschimpfte mich und so weiter –«
»Hat sie Sie geschlagen?«, fragte Spangler.
»Nein, aber sie wartete auf mich, als ich heute Abend das Studio abschloss. Ihr Auto stand auf dem hinteren Parkplatz, der unseren Angestellten vorbehalten ist. Der Wagen stand immer noch da, als ich die Polizei rief. Ich konnte sie und noch jemanden, ich glaube, es war ein Mann, neben ihrem Auto stehen sehen. Dann hörte ich einen Schuss und warf mich hinter meinem Auto auf den Boden, und wenig später fuhr jemand – ich glaube, der Mann – weg, aber Nicole blieb hier. Ich schlich geduckt zurück ins Haus und rief die Polizei.«
»Sind Sie ganz sicher, dass Sie einen Schuss und nicht etwas anderes gehört haben?«
»Ja, natürlich.« Also bitte. Wir sind hier im Süden; in North Carolina, um genau zu sein. Natürlich wusste ich, wie sich ein Schuss anhört. Ich hatte selbst früher mal mit einem .22er Gewehr geschossen. Grampie – mein Großvater mütterlicherseits – war oft mit mir auf Eichhörnchenjagd gegangen, wenn wir zu ihnen aufs Land gefahren waren. Als ich zehn war, starb er an einem Herzinfarkt, und danach wollte niemand mehr mit mir auf Eichhörnchenjagd gehen. Trotzdem ist es ein Geräusch, das sich mir tief eingeprägt hat, ganz abgesehen davon, dass man es alle paar Minuten im Fernsehen zu hören bekommt.
Also, kein Bulle spaziert völlig unbedarft zu einem Auto hin, in dem möglicherweise eine bewaffnete Psycho-Schlampe hockt. Nachdem sich die Officers überzeugt hatten, dass der Mustang tatsächlich hinter dem Haus stand, sprachen sie in die netten kleinen Funkgeräte, die sie irgendwie an ihrer Schulter festgeklebt hatten – vielleicht mit einem Klettverschluss –, und ziemlich bald darauf kam der nächste Streifenwagen angefahren, aus dem die Officers Washington und Vyskosigh stiegen. Mit De-Marius Washington war ich zur Schule gegangen, und er lächelte mir kurz zu, ehe sein markantes dunkles Gesicht wieder zu einer ernsten Bullenmiene gefror. Vyskosigh war klein und fest und praktisch kahl, und er war nicht von hier, was hier im Süden ein anderes Wort für »Yankee« ist. Für uns erklärt dieser Satz einfach alles, von den Essgewohnheiten über die Kleidung bis zu den Manieren.
Ich musste drinnen warten – aber gern doch –, während sich die vier in die Dunkelheit und den Regen hinauswagten, um Nicole zu fragen, was der verfluchte Scheiß eigentlich sollte.
Ich befolgte ihre Anweisungen so gewissenhaft – was nur zeigt, wie fix und fertig ich war –, dass ich noch an derselben Stelle stand, als Officer Vyskosigh wieder ins Studio kam und mich von Kopf bis Fuß musterte. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Dies war eindeutig nicht der Moment, mich in Gedanken auszuziehen, oder?
»Madam«, sagte er höflich, »möchten Sie sich vielleicht hinsetzen?«
»Ja, gern«, antwortete ich genauso höflich und setzte mich in einen der Besuchersessel. Ich hätte zu gern gewusst, was sich draußen abspielte. Wie lange konnte das noch dauern?
Nach ein paar Minuten trafen noch mehr Streifenwagen mit blitzendem Blaulicht ein. Auf meinem Parkplatz sah es aus wie auf einem Bullenkongress. Herrgott noch mal, reichten keine vier Polizisten aus, um mit Nicole fertig zu werden? Mussten sie allen Ernstes Verstärkung holen? Sie musste noch durchgeknallter sein, als ich geglaubt hatte. Ich habe gehört, wenn jemand durchknallt, entwickelt er übermenschliche Kräfte. Und Nicole war eindeutig durchgeknallt. Im Geist sah ich sie Polizisten durch die Luft wirbeln, während sie langsam auf mich zukam. Ich spielte mit dem Gedanken, mich in meinem Büro zu verbarrikadieren.
Officer Vyskosigh sah nicht so aus, als würde er zulassen, dass ich mich irgendwo verbarrikadierte. Ganz im Gegenteil, ich hatte immer mehr den Eindruck, dass Officer Vyskosigh mich nicht beschützte – wie ich anfangs angenommen hatte –, sondern mich vielmehr bewachte. Als wollte er dafür sorgen, dass ich nichts ... unternahm.
O Mann.
Verschiedenste Szenarien schossen mir durch den Kopf. Wenn er hier war, um zu verhindern, dass ich etwas unternahm, stellte sich natürlich die Frage, was ich nicht unternehmen sollte. Pinkeln gehen? Meine Akten sortieren? Beides war schwer angesagt, darum stand beides ganz oben auf meiner gedanklichen Liste, aber ich bezweifelte, dass sich die Polizei dafür interessierte. Zumindest hoffte ich, dass sich Officer Vyskosigh nicht dafür interessierte, vor allem nicht für den ersten Punkt.
Weil ich diesen Gedanken lieber nicht weiter verfolgen wollte, lenkte ich meine Gedanken brutal zurück in die Spur.
Sie machten sich auch keine Sorgen, dass ich unerwartet durchdrehen, auf den Parkplatz rennen und über Nicole herfallen könnte, ohne dass sie mich daran hindern konnten. Ich neige nicht zur Gewalt, solange man mich nicht extrem provoziert; und vor allem hätten sie, wenn auch nur einer von ihnen einmal aufmerksam hingesehen hätte, bemerken müssen, dass ich frisch lackierte Fingernägel hatte – und zwar in Iced Poppy, Mohnrot mit Glittereffekt, meiner neuesten Lieblingsfarbe. Meine Hände sahen ausgesprochen hübsch aus, wenn ich mal so sagen darf. Nicole war mir definitiv keinen abgebrochenen Nagel wert, darum hatte sie ganz offensichtlich nichts von mir zu befürchten.
Inzwischen ist wohl klar, dass ich geistig endlose Pirouetten drehen kann, wenn ich über etwas nicht nachdenken will.
Und ich wollte auf gar keinen Fall darüber nachdenken, warum Officer Vyskosigh mich bewachte. Auf gar, gar keinen Fall.
Leider sind manche Dinge einfach zu wichtig, als dass man sie ewig ignorieren könnte, und die Wahrheit schnitt blutig durch meinen mentalen Mambo. Der Schreck traf mich wie ein Hammerschlag; ich wurde wirklich in meinem Sessel zurückgeschleudert.
»O Gott. Der Schuss wurde gar nicht auf mich abgefeuert, stimmt’s?«, blökte ich heraus. »Nicole – der Mann hat auf sie geschossen, stimmt’s? Er hat auf sie geschossen und ...« sie getroffen, wollte ich noch sagen, aber im selben Moment blubberte es heiß und ätzend in meiner Kehle hoch, und ich musste mit aller Kraft schlucken. In meinen Ohren begann es zu schrillen, und ich begriff, dass ich gleich etwas sehr Undamenhaftes tun würde, wie aus dem Sessel auf mein Gesicht zu plumpsen, weshalb ich mich eilig vorbeugte, den Kopf zwischen die Knie nahm und mehrmals tief durchatmete.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte Officer Vyskosigh, soweit ich ihn über dem Gellen in meinen Ohren verstehen konnte. Ich schwenkte die Hand, um anzuzeigen, dass ich nicht in Ohnmacht gefallen war, und konzentrierte mich weiter aufs Atmen. Ein, aus. Ein, aus. Ich versuchte mir einfach einzureden, ich wäre im Yoga-Unterricht.
Das Schrillen in meinen Ohren wurde allmählich leiser. Ich hörte, wie die Vordertür aufging und mehrere Leute hereinkamen.
»Ist sie okay?«, fragte jemand.
Ich hob wieder die Hand. »Gleich«, brachte ich heraus, wobei ich allerdings den Boden ansprach. Nach weiteren dreißig Sekunden kontrollierter Atmung hatte ich die Übelkeit zurückgekämpft und setzte mich vorsichtig auf.
Die Neuankömmlinge, zwei Männer, trugen Zivil und zerrten Latexhandschuhe von ihren Fingern. Ihre Sachen waren regennass, und ihre nassen Schuhe hatten feuchte Tapser auf meinem schön glänzenden Boden hinterlassen. Ich entdeckte auf einem Handschuh etwas Rotes, Feuchtes, und im nächsten Moment begann sich alles zu drehen. Hastig beugte ich mich wieder vor.
Okay, normalerweise bin ich keine solche Mimose, aber ich hatte seit Mittag nichts mehr gegessen, und inzwischen war es zehn Uhr abends oder noch später, sodass mein Blutzucker praktisch auf null war.
»Brauchen Sie einen Sanitäter?«, fragte mich einer der Männer.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich hab’s gleich wieder, aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn mir jemand etwas zu trinken holen könnte. Aus dem Kühlschrank im Pausenraum.« Ich deutete ungefähr in die Richtung. »Dort hinten, neben meinem Büro. Es müsste eine Limonade oder ein Eistee drinstehen.«
Officer Vyskosigh wollte sich schon auf den Weg machen, aber einer der beiden hielt ihn zurück. »Moment. Ich will erst noch den anderen Eingang sichern.«
Weg war er, und Officer Vyskosigh blieb bei mir. Der zweite Unbekannte setzte sich neben mich. Seine Schuhe gefielen mir nicht. Ich hatte sie die ganze Zeit vor Augen, weil ich immer noch den Kopf zwischen den Knien hatte. Es waren schwarze Wingtips, das Schuh-Äquivalent zu einem Polyester-Hauskleid. Bestimmt gibt es irgendwo auf der Welt echt gute, edle schwarze Wingtips zu kaufen, aber ich finde sie allesamt schrecklich. Ich weiß echt nicht, was die Männer damit haben.
Jedenfalls waren diese Wingtips so nass, dass tatsächlich das Wasser auf dem Oberleder perlte. Und der Saum seiner Hosenbeine war auch feucht.
»Ich bin Detective Forester«, stellte er sich vor.
Ganz vorsichtig hob ich den Kopf und streckte zitternd die rechte Hand aus. »Ich bin Blair Mallory.« Um ein Haar hätte ich noch gesagt: »Sehr erfreut«, aber das war ich natürlich nicht, jedenfalls nicht unter diesen Umständen.
Genau wie Officer Barstow nahm er meine Hand und schüttelte sie einmal kurz auf und ab. Seine Schuhe gefielen mir vielleicht nicht, aber dafür hatte er einen angenehmen Händedruck, nicht zu fest und nicht zu schlaff. Der Händedruck sagt eine Menge über den Menschen und vor allem über den Mann aus. »Madam, können Sie mir sagen, was hier vorgefallen ist?«
Auch er hatte Manieren. Ich begab mich behutsam wieder in die Senkrechte. Die Gummihandschuhe mit den roten Flecken waren nirgendwo zu sehen, und ich schnaufte erleichtert aus. Dann setzte ich zu einer Wiederholung dessen an, was ich den Officers Barstow und Spangler erzählt hatte; währenddessen kam der andere Zivilbulle mit einer Flasche Eistee zurück und drehte sogar den Deckel auf, bevor er sie mir reichte. Ich hielt kurz inne, bedankte mich und nahm einen tiefen Schluck von dem kalten Tee, bevor ich meine Geschichte zu Ende brachte.
Als ich fertig war, stellte mir Detective Forester seinen Kollegen vor – Detective MacInnes –, und wir wurden wieder förmlich. Detective MacInnes zog einen der Besuchersessel vor, damit er im rechten Winkel zu mir saß. Er war ein bisschen älter als Detective Forester, ein bisschen schwerer, ein bisschen grauhaariger und ein bisschen unrasierter. Aber trotz seines knuffigen Äußeren hatte ich den Eindruck, dass er eher fest als weich war.
»Warum hat die Person, die Sie neben Ms. Goodwin sahen, Sie nicht bemerkt, als Sie durch die Hintertür hinausgingen?«, fragte er.
»Wahrscheinlich, weil ich das Licht im Flur ausgeschaltet hatte, bevor ich die Tür aufmachte.«
»Wie können Sie sehen, was Sie tun, wenn Sie das Licht ausschalten?«
»Ich mache das praktisch gleichzeitig«, erklärte ich ihm. »Ich schätze, manchmal ist das Licht noch einen winzigen Moment an, wenn ich die Tür aufmache, und manchmal auch nicht. Heute Abend hatte ich den Riegel vorgelegt, sobald meine Mitarbeiter heimgegangen waren, weil ich länger bleiben musste und nicht wollte, dass irgendwer zur Tür hereinspaziert kommt. Also hielt ich die Schlüssel in der rechten Hand und habe mit der linken den Riegel zurückgedreht und die Tür aufgemacht, während ich mit dem rechten Handrücken den Lichtschalter gedrückt habe.« Ich bewegte die Hand nach unten, um es ihm zu demonstrieren. Wer was in der Hand hat, macht das eben so. Jeder macht das so. Außer natürlich, man hat keine Hand, aber wer hat die nicht? Klar, manche Leute haben keine, und ich schätze, die haben irgendwelche anderen Tricks, aber ich hatte jedenfalls zwei Hände – ach, vergiss es. Das war wieder einer meiner mentalen Eiertänze. Ich atmete tief ein und rief meine Gedanken zur Ordnung. »Das hängt vom genauen Timing ab, aber jedenfalls ist das Licht oft aus, wenn ich die Tür aufmache. Soll ich es Ihnen vorführen?«
»Später vielleicht.« Detective MacInnes verstand offenbar keinen Spaß. »Was passierte, nachdem Sie die Tür geöffnet hatten?«
»Ich ging raus, schloss von außen ab und drehte mich um. Und da sah ich den Mustang.«
»Vorher nicht?«
»Nein. Mein Auto steht genau vor der Tür, und wenn ich draußen bin, drehe ich mich immer sofort um, weil ich noch abschließen muss.«
Er stellte mir eine Frage nach der anderen, hakte an jedem Detail ein, und ich antwortete mit wahrer Engelsgeduld. Ich schilderte ihm, wie ich mich fallen gelassen hatte, als ich den Schuss hörte, und zeigte ihm die Schmutzflecken auf meinen Sachen. Dabei fiel mir auf, dass ich meine linke Hand aufgeschürft hatte. Ich wünschte, jemand könnte mir erklären, wie etwas, das ich bis dahin nicht bemerkt hatte, auf einen Schlag so höllisch brennen kann, kaum dass ich es doch bemerkt hatte. Stirnrunzelnd besah ich meine Handfläche und zupfte an der losen Haut herum. »Ich muss mir die Hände waschen«, bemerkte ich in die nächste Frage hinein.
Beide Detectives sahen mich mit Bullenblick an. »Das geht nicht«, sagte MacInnes schließlich. »Erst möchte ich die Vernehmung abschließen.«
Okay, super. Schon kapiert. Nicole war tot, wir hatten am Nachmittag gestritten, und ich war allein hier. Sie durften keine Möglichkeit ausschließen, und so wie die Sache aussah, war ich die naheliegendste Möglichkeit, und deshalb wollten sie vor allem mich einschließen.
Plötzlich fiel mir mein Handy ein. »Ach ja, eines noch; ich war gerade dabei, die 911 zu wählen, als ich den Schuss hörte und mich in den Dreck warf, und dabei fiel mir das Handy aus der Hand. Ich habe danach getastet, es aber nicht mehr gefunden. Könnten Sie jemanden unter meinem Wagen nachschauen lassen? Es muss noch dort liegen.«
MacInnes nickte Vyskosigh zu, und der Officer walzte ab, die Taschenlampe in einer Hand. Keine Minute später kam er mit meinem Handy wieder an, das er Detective MacInnes gab. »Es lag mit den Tasten nach unten unter dem Auto«, sagte er.
Der Detective betrachtete das kleine Feld auf dem Handy. Wenn man einen Anruf machen will, leuchtet das Display auf, aber es erlischt bald wieder; nach vielleicht dreißig Sekunden – das ist nur geschätzt, weil ich zwar die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei stoppe, aber noch nie gestoppt habe, wie lange mein Handy leuchtet – wird das Display wieder dunkel, aber wenn man ein paar Ziffern gedrückt hat, bleiben sie auf dem Display stehen. Hier in meinem hell erleuchteten Empfang mussten die Ziffern aber auch ohne Hintergrundbeleuchtung zu erkennen sein.
Ich war müde, ich hatte Todesangst ausgestanden, und mir wurde übel, wenn ich mir bewusst machte, dass Nicole praktisch vor meinen Augen erschossen worden war. Ich fand, sie konnten sich ruhig ein bisschen ins Zeug legen und die erste Möglichkeit – mich – endlich ausschließen, damit ich irgendwohin gehen konnte, wo mich niemand sah und ich mich in Ruhe ausheulen konnte. Darum sagte ich: »Ich weiß, außer mir war niemand hier und Sie haben nur mein Wort, dass sich die Sache so abgespielt hat, wie ich es behaupte, aber könnten Sie die Angelegenheit nicht irgendwie beschleunigen? Mit einem Lügendetektor-Test zum Beispiel?« Das war ehrlich gesagt nicht die beste Idee, weil mein Herz im Schweinsgalopp dahinraste und jeden Polygrafen aus dem Takt gebracht hätte. Also versuchte ich sie wieder abzulenken, nur falls sie fanden, klar doch, mit einem Test am Polygrafen ließe sich der Fall in Nullkommanichts lösen. Ich weiß nicht, ob sie so was machen, und ich wollte es auch nicht wissen. Außerdem habe ich schon Krimis im Fernsehen gesehen und weiß daher, dass sich ziemlich leicht nachweisen lässt, ob jemand eine Waffe abgefeuert hat. »Oder wie wär’s mit so einem Dingsda-Test?«
Detective MacInnes saugte eine Wange nach innen, wodurch sein Gesicht vorübergehend Schlagseite bekam. »›Dingsda-Test?‹«, fragte er vorsichtig.
»Sie wissen schon. An meinen Händen. Um festzustellen, ob ich eine Pistole abgefeuert habe.«
»Ach sooo.« Er nickte wissend und warf seinem Partner, der merkwürdig vor sich hingrunzte, einen kurzen, tadelnden Blick zu. »So einen Dingsda-Test. Sie meinen auf Schmauchspuren?«
»Genau den«, sagte ich. Ja, ich weiß, dass sie sich das Lachen verkneifen mussten, aber manchmal hat das Stereotyp der blöden Blondine auch seine Vorteile. Je weniger bedrohlich ich ihnen erschien, desto besser.
Tja, Detective MacInnes nahm mich beim Wort. Ein Polizist aus der Spurensicherung kam mit einer Köderbox voller Material anmarschiert und nahm einen Schusswaffenfeuertest vor, indem er meine Handflächen mit Fiberglastupfern abrieb und die Tupfer dann in irgendwelche Chemikalien senkte, die sich angeblich verfärben sollten, falls ich Schmauchspuren an der Hand gehabt hätte. Hatte ich aber nicht. Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie meine Hände mit irgendwas einsprühen und dann unter UV-Licht halten würden, aber als ich das dem Spurensicherer vorschlug, meinte er, das sei ein alter Hut. Man lernt doch jeden Tag dazu.
Nicht, dass MacInnes und Forester danach irgendwie lockerer geworden wären. Sie stellten mir immer neue Fragen – ob ich das Gesicht des Mannes gesehen hätte, was für einen Wagen er fuhr und so fort –, während mein Auto, das gesamte Gebäude und die angrenzenden Grundstücke minutiös untersucht wurden. Erst nachdem nirgendwo so etwas wie nasse Kleidung aufgetaucht war, beendeten sie die Vernehmung, ohne dass ich auch nur ermahnt wurde, nicht die Stadt zu verlassen.
Ich wusste, dass Nicole aus nächster Nähe erschossen worden war, weil ich den Kerl hinter ihr stehen gesehen hatte. Da sie direkt neben ihrem Auto am anderen Ende des Parkplatzes im Regen lag und ich die einzig absolut trockene Person hier im Raum war – weshalb sie auch nach nasser Kleidung gesucht hatten, nur für den Fall, dass ich mich danach umgezogen hatte –, war ich folglich auch nicht draußen im Regen gewesen und hatte die Tat nicht selbst verüben können. Es gab keine nassen Schuhabdrücke außer denen der Polizisten, die zur Vordertür reingekommen waren; am Hintereingang war alles trocken. Meine Schuhe waren trocken. Meine Hände waren dreckig – was bewies, dass ich sie nicht gewaschen hatte – und meine Sachen verschmutzt. Mein Handy hatte unter dem Auto gelegen, und im Display waren deutlich die Neun und die Eins zu sehen, die bewiesen, dass ich die Polizei rufen wollte. Kurz und gut, was sie sahen, passte zu dem, was ich erzählte, was nie von Schaden ist.
Ich floh auf die Toilette, wo ich erst ein drängendes Problem löste und anschließend meine Hände wusch. Die Schürfwunde auf meiner Handfläche brannte immer noch, weshalb ich danach in mein Büro ging, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Ich quetschte etwas antibiotische Salbe auf die Wunde und deckte sie mit einem überdimensionalen Pflaster ab.
Ich überlegte, ob ich Mom anrufen sollte, nur für den Fall, dass jemand den Polizeifunk abgehört und sie angerufen hatte, was ihr und Dad einen Mordsschreck eingejagt hätte, aber dann kam ich zu dem Schluss, dass es schlauer wäre, erst die Detectives zu fragen, ob ein Anruf okay war. Ich ging an die Bürotür und schaute kurz raus, aber sie waren alle irgendwie beschäftigt, und ich wollte sie nicht unterbrechen.
Ganz ehrlich, mein Hintern schleifte vor Erschöpfung fast am Boden. Ich war fix und fertig. Draußen schüttete es wie aus Kübeln, das Rauschen machte mich noch müder und das Blinken der Blaulichter bereitete mir Kopfschmerzen. Die Bullen sahen auch müde aus und elend durchnässt, Regenzeug hin oder her. Am hilfreichsten, entschied ich, war jetzt ein starker Kaffee. Welcher Polizist sagt zu einem Kaffee schon nein?
Ich mag Kaffee mit Aroma und habe in meinem Büro immer ein ganzes Sortiment an verschiedenen Geschmacksrichtungen stehen, aber meiner Erfahrung nach sind Männer nicht besonders experimentierfreudig, wenn es um Kaffee geht – jedenfalls die Männer im Süden. Ein Mann aus Seattle hat vielleicht nichts gegen einen Kaffee mit Schoko-Mandel- oder Himbeer-Schoko-Aroma einzuwenden, aber hier unten mögen die Männer im Allgemeinen Kaffee, der nach Kaffee und sonst gar nichts schmeckt. Für meine Gäste mit einem Y-Chromosom halte ich stets eine kräftige, aber milde Frühstücksmischung vorrätig, die ich jetzt aus meinem Vorratsschrank holte und in einen Papierfilter löffelte. Ich gab eine winzige Prise Salz dazu, das die natürliche Bitterkeit des Kaffees dämpft, und staubte nur zum Trotz einen knappen Löffel meiner Schoko-Mandel-Mischung oben drüber. Das war so wenig, dass sie es nicht schmecken würden, aber es würde den Kaffee noch milder machen.
Meine Kaffeemaschine ist so ein Zweitopf-Turbokocher, der in nur zwei Minuten eine Kanne Kaffee fabriziert. Nein, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber wenn ich erst die Maschine einschalte und anschließend pinkeln gehe, dann ist der Kaffee fertig, wenn ich fertig bin, und das heißt, dass es verflucht schnell geht.
Ich schwenkte eine Kanne unter dem Auslauf durch und schüttete mit der anderen Kanne das Wasser in den Tank. Während der Kaffee durchlief, holte ich einen Stapel Styroporbecher, dazu Kaffeeweißer und rote Umrührstäbchen, und stellte alles neben der Kaffeemaschine auf.
Nur wenig später folgte Detective Forester seiner Nase in mein Büro, wo er mit scharfem Blick gleich nach dem Eintreten die Kaffeemaschine entdeckte.
»Ich habe Kaffee gemacht«, sagte ich und nahm einen Schluck von meiner Tasse, einem hübschen, knallgelben Becher mit der lila Aufschrift »VERZEIH DEINEN FEINDEN – DAS TREIBT SIE ZUM WAHNSINN« rund um den Boden. Styropor klebt höllisch an Lippenstift, deshalb nehme ich immer eine richtige Tasse – nicht, dass ich Lippenstift aufgelegt hätte, aber das tut nichts zur Sache. »Möchten Sie auch einen?«
»Hat die Katze einen Schwanz?«, fragte er rhetorisch und stand schon vor der Kaffeemaschine.
»Kommt drauf an, ob es eine Manx-Katze ist oder nicht.«
»Nicht.«
»Dann hat die Katze, jawohl, einen Schwanz. Von tragischen Unfällen einmal abgesehen.«
Er lächelte und schenkte sich einen Becher voll. Bullen müssen telepathische Fähigkeiten besitzen, um sich gegenseitig mitzuteilen, dass es irgendwo frischen Kaffee gibt, denn schon nach wenigen Minuten zog ein nicht abreißender Strom von uniformierten und nicht uniformierten Gesetzeshütern durch mein Büro. Ich stellte die erste Kanne auf die Warmhalteplatte oben auf der Maschine und setzte eine zweite Kanne auf. Bald musste ich die Kannen austauschen und die dritte Ladung Kaffee brühen.
Das Kaffeekochen hielt mich auf Trab und machte den Polizisten die Nacht ein wenig angenehmer. Irgendwann kam ich tatsächlich dazu, eine zweite Tasse zu trinken. Warum auch nicht, schließlich würde ich in dieser Nacht wahrscheinlich sowieso kein Auge zu tun.
Ich fragte Detective MacInnes, ob ich meine Mama anrufen dürfe, und er sagte nicht direkt nein, aber er sagte, er sähe es lieber, wenn ich noch ein wenig warten würde, denn so wie er Mütter kenne, würde sie sofort angerast kommen, und er hätte gern den Tatort zuvor gesichert. Nachdem das geklärt war – er verstand eindeutig was von Müttern –, setzte ich mich an meinen Schreibtisch, trank meinen Kaffee und gab mir alle Mühe, das Bibbern zu unterdrücken, das mich immer wieder aus heiterem Himmel überfiel.
Ich hätte Mom trotzdem anrufen sollen, damit sie angerast kommt und sich um mich kümmert. Die Nacht war übel genug gewesen, oder? Sie sollte noch übler werden.
3
Ich hätte wissen müssen, dass er auftauchen würde. Immerhin war er Lieutenant bei der Polizei, und in einer eher kleinen Stadt wie unserer – mit rund sechzigtausend Einwohnern – war ein Mord kein Alltagsgeschäft. Wahrscheinlich waren alle Bullen, die gerade Dienst hatten, rund um mein Studio versammelt, und dazu so mancher, der eigentlich keinen Dienst hatte.