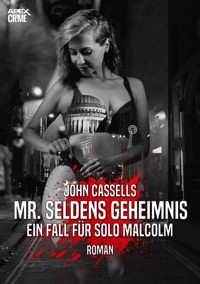5,99 €
Mehr erfahren.
Ich traf am Tag nach dem großen Banküberfall in Toronto ein.
Alle Leute sprachen von nichts anderem. Die Clevenger-Bande war in die Bloor-Street-Filiale der Bank of South-West Manitoba eingedrungen und hatte eine Viertelmillion Dollar erbeutet.
Diesen Morgen war Elmer Bryson seinen Wunden erlegen. Elmer Bryson, der heldenhaft versucht hatte, einem der maskierten Gangster Widerstand zu leisten und dabei von dessen Schüssen durchsiebt worden war.
Es war heute - am 30. Juli - geradezu unerträglich heiß...
Der Roman Die Entscheidung ist gefallen des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1962; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JOHN CASSELLS
Die Entscheidung ist gefallen
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE ENTSCHEIDUNG IST GEFALLEN
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Ich traf am Tag nach dem großen Banküberfall in Toronto ein.
Alle Leute sprachen von nichts anderem. Die Clevenger-Bande war in die Bloor-Street-Filiale der Bank of South-West Manitoba eingedrungen und hatte eine Viertelmillion Dollar erbeutet.
Diesen Morgen war Elmer Bryson seinen Wunden erlegen. Elmer Bryson, der heldenhaft versucht hatte, einem der maskierten Gangster Widerstand zu leisten und dabei von dessen Schüssen durchsiebt worden war.
Es war heute - am 30. Juli - geradezu unerträglich heiß...
Der Roman Die Entscheidung ist gefallen des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1962; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DIE ENTSCHEIDUNG IST GEFALLEN
Die Hauptpersonen dieses Romans
John Hillary: ehemaliger Polizist.
Peter Crandall: sein Freund.
Jean Crandall: Crandalls Schwester.
Lew Clevenger: Anführer der Clevenger-Bande.
Mantilla, Rick, Demastri: Mitglieder der Clevenger-Bande.
Russ Muller: ein seltsamer Nachbar.
Der Roman spielt in Toronto, Kanada.
Erstes Kapitel
Ich traf am Tag nach dem großen Banküberfall in Toronto ein. Alle Leute sprachen von nichts anderem. Die Clevenger-Bande war in die Bloor-Street-Filiale der Bank of South-West Manitoba eingedrungen und hatte eine Viertelmillion Dollar erbeutet.
Diesen Morgen war Elmer Bryson seinen Wunden erlegen. Elmer Bryson, der heldenhaft versucht hatte, einem der maskierten Gangster Widerstand zu leisten und dabei von dessen Schüssen durchsiebt worden war.
Es war heute - am 30. Juli - geradezu unerträglich heiß.
Alle Fenster in unserem großen Greyhound-Bus waren geöffnet; die Ventilatoren liefen auf Hochtouren. Aber selbst mir, der ich doch wahrhaftig Hitze gewohnt war, wurde es zu viel. Mein Jackett und Hut waren durchweicht - reif zum Fortwerfen oder zumindest für die Reinigung. Und dem Burschen neben mir erging es auch nicht besser. Er schien Ungar zu sein oder Tscheche oder irgend so etwas Ähnliches.
Wir hatten nicht viel miteinander gesprochen. Bei solch einer Hitze ist einem jedes Wort zu viel. Nur einmal, als eine Streife der Staatspolizei uns anhielt, hatte er seinen Mund geöffnet.
»Allerhand Arbeit für die Burschen, was? Große Sache!«, hatte er gemeint.
»Tja«, stimmte ich ihm zu. Mehr war nicht dazu zu sagen.
Wir saßen auf der ersten Bank gleich hinter dem Fahrer. Dieser musste unsere weitschweifige Unterhaltung mitangehört haben, denn nach einem Augenblick gab er - ohne sich dabei umzudrehen - auch seinen Kommentar zum besten.
»Der Bankwächter soll heute Morgen gestorben sein, habe ich gehört.«
»Scheußlich«, sagte ich. »Die Zeitungen schrieben schon, dass es ihm sehr schlechtgehen soll.«
»Sie behaupten, es sei die Clevenger-Bande gewesen.«
»Stand auch schon in der Zeitung.« - Vergangene Nacht, als ich im Warteraum in Windsor herumging, hatte ich den Artikel von Anfang bis Ende und noch einmal von vorn durchgelesen. Unter anderem hatte dort gestanden, dass einem der Gangster die Gesichtsmaske heruntergerutscht war und dass etliche Kunden im Schalterraum ihn deutlich gesehen hatten, bevor es ihm gelang, sie wieder heraufzuziehen. Diese wichtigen Zeugen hatten anschließend den Rest des Tages auf dem Polizeipräsidium verbracht, wo sie ihre Aussagen zu Protokoll gaben und über Verbrecheralben brüteten. Schließlich hatten sie - nebenbei: erstaunlicherweise einmal alle übereinstimmend - das Foto eines Ganoven herausgepickt. Dieser - ein Bursche namens Torre - hatte schon einmal wegen eines ähnlichen Deliktes gesessen; und nachdem er erst einmal identifiziert war, fiel es der Polizei nicht mehr schwer, festzustellen, wer hinter dem Raubüberfall steckte.
Eine Million ist immer eine Menge Geld. Andererseits haben die Banken ja Geld genug. Die Sache mit dem Wächter stand auf einem anderen Blatt. - Die Zeitungen hatten ein Bild von seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern gebracht.
Der Fahrer drückte das Gaspedal gleichmäßig und ruhig herunter - der Zeiger des Tachometers stand ohne zu zittern auf 90. Er mochte fast hundert Kilometer gefahren sein, bevor er noch etwas hinzufügte. »Bryson, der Wächter, hat selbst noch zwei Schüsse abgefeuert, bevor er zusammenbrach. Die Polizei glaubt, dass einer der Verbrecher schwer verwundet sein muss.«
»Ich hab’s gelesen, ja. Aber nicht schwer genug, um ihn aufzuhalten.«
»Sie sollen ihn herausgeschleift haben, aber er hat es kaum bis zur Tür geschafft, hat jemand ausgesagt«, brummte der Fahrer.
Damit verstummte er endgültig.
Wir hatten die Großstadt Toronto erreicht. Das Gedränge auf den Straßen erforderte selbst von einem guten Fahrer äußerste Konzentration. Die meisten Passagiere standen auf und suchten ihr Gepäck zusammen. Ich holte meine Geldbörse aus der Hosentasche und kramte Crandalls Brief hervor. Der gelbe Umschlag war fleckig vor Schweiß. Vorsichtig zog ich den linierten Bogen heraus und las ihn noch einmal durch.
16. Mai 19...
Toronto
1412 Avondale Avenue
Lieber John!
Herzlichen Dank für Deinen Brief. Ich habe mich gefreut, wieder einmal von Dir zu hören. Ganz besonders aber über die gute Nachricht, dass Du beabsichtigst, im Laufe des Sommers nach Toronto zu kommen.
Solltest Du Deinen Entschluss wahrmachen, ruf mich bitte an, sobald Du angekommen bist. Du kannst, wenn Du Lust hast, gerne bei mir wohnen. Da ich in den nächsten Wochen einen neuen Anschluss bekommen soll, schreibe ich Dir meine jetzige Nummer gar nicht erst. Du findest mich aber jederzeit im Telefonbuch.
Raff Dich auf und komm! Es gibt eine Menge zu erzählen. In der Hoffnung, Dich bald zu sehen und in alter Freundschaft
Dein
Peter
Ja, so war es. Ich hatte Peter Crandall vor drei Jahren kennengelernt, als wir auf der Empress of Britain gemeinsam eine Kabine bewohnten. Unmittelbar nach der Landung in Kanada hatten sich unsere Wege getrennt. Crandall war mit der Bahn nach Toronto gefahren, um dort - soweit ich es beurteilen konnte - Wurzeln zu schlagen und nicht mehr fortzukommen.
Ich wandte mich westwärts, zunächst nach Calgary. Von dort aus nach Vancouver, dann ging es nach Windsor, anschließend nach Detroit, wo ich mich einen Monat aufhielt, und schließlich landete ich wieder in Sarnia, wo mein Ausflug begonnen hatte. Ich saß, wie immer, ohne einen Cent in der Tasche da. Aber was soll’s - dafür war ich frei und ungebunden; dreißig Jahre jung, vergnügt, gesund und bester Dinge - also, was kostete die Welt? Ich kam herum, lernte Land und Leute kennen und genoss mein Leben. Ich arbeitete immer etwas anderes, versuchte dauernd etwas Neues. Heute war ich Lastwagenchauffeur in Calgary, morgen verdingte ich mich an einer Forellenzucht in Vancouver. In Saskatoon spielte ich den Sparringspartner für Ike Friedman, den kanadischen Schwergewichtschampion, und in Sarnia war ich sogar eine Zeitlang Polizeibeamter gewesen.
Das war natürlich noch nicht alles. Oh, nein! Ich hatte in der Zwischenzeit noch eine Menge anderer Berufe ausgeübt - und das war eins der Dinge, die mir in Kanada so gut gefielen, diese unbegrenzten Möglichkeiten.
Sechs Monate an einem Platz arbeiten und dann weiterziehen - so hatte ich es gehalten. Gewiss, ich war dabei nicht gerade Millionär geworden, aber ich war glücklich und zufrieden. Und ich kam viel herum. Nur in die Nähe von Toronto war ich nicht gekommen; bis auf das eine Mal, als ich des Nachts auf meinem Weg nach Westen dort Station gemacht hatte. Aber es war mir immer bewusst gewesen, dass ich eines Tages wieder dorthin kommen würde - und ich hatte Toronto nie aus den Augen verloren. Peter Crandall hätte mich am liebsten von Anfang an dort festgehalten. Ich glaube fast, er muss schon damals gespürt haben, dass ich ihm fehlen und er sich ziemlich einsam fühlen würde ohne mich. Er hatte jedenfalls sein Bestes versucht, mir das Bleiben schmackhaft zu machen. Als ich seinen Verlockungen nicht erlag, war er ziemlich enttäuscht gewesen. Ich hatte noch oft deutlich sein mageres, blasses Gesicht mit den schmerzlichen Falten, die sich um seinen Mund eingruben, vor mir gesehen, als ich ablehnte.
»Es ist also aussichtslos, John? Du bist fest entschlossen, es nicht wenigstens hier zu versuchen?«
»Ganz aussichtslos, Peter. Mein Entschluss steht fest. Ich habe von allen, die ich gefragt habe, nur eine Meinung gehört: Geh nach Westen, bleibe nicht in Ontario! - Das ist es.«
»Toronto ist die Stadt! Sie nimmt einen ungeheuren Aufschwung - hier liegt das Geld auf der Straße!«
»Ich weiß, Peter. Ich habe mich gründlich orientiert. Fabriken, Straßen, Häuser, alles schießt hier so schnell aus dem Boden wie bei uns zu Hause die Pilze. Aber das ist nichts Für mich. Deswegen bin ich nicht hierhergekommen. Ich bin aus Newcastle fortgegangen, weil ich hinauswollte aus der Großstadt - hinaus in die Weite. Was hat mir Toronto schon zu bieten, was Newcastle nicht auch hätte?« Er hatte tief aufgeseufzt. »Schade, es wäre sehr schön gewesen, wenn du hiergeblieben wärst. Ich fühle mich sehr allein.«
»Du wirst schon darüber hinwegkommen«, hatte ich ihn getröstet. »Das überkommt uns alle manchmal. Aber eins verspreche ich dir - eines Tages werde ich nach Toronto kommen, und dann werde ich dich besuchen.«
Sein düsteres Gesicht hatte sich aufgehellt.
»Na schön, John - aber ich nehme dich beim Wort! Vielleicht gelingt es mir, dich zum Bleiben zu überreden, wenn du das nächste Mal kommst.«
»Was ich bezweifle.«
Ja, so war es damals gewesen, und dabei war es geblieben. Drei Jahre war es jetzt schon her; drei Jahre hatte ich ihn nicht mehr gesehen.
Peter war ein netter Bursche. Er hatte zwar nur die Volksschule besucht, aber er war in Ordnung. Ich hatte oft an ihn denken müssen und darauf geachtet, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Man konnte es zwar kaum als Briefwechsel bezeichnen, was wir da betrieben; aber ich hatte kein Weihnachten verstreichen lassen, ohne ihm eine Glückwunschkarte mit ein paar herzlichen Worten darauf zu schicken. - Und von Zeit zu Zeit, wenn mir plötzlich danach zumute war, auch einmal eine Postkarte. - Gewiss, selten genug und in unregelmäßigen Abständen, aber doch häufig und herzlich genug, um ihn fühlen zu lassen, dass ich noch an ihn dachte.
Diesen Mai hatte ich mich nun plötzlich entschlossen, noch im Sommer nach Toronto zu fahren. Sarnia war an sich kein schlechter Platz, aber meine Dienststunden bei der dortigen Polizei waren unerfreulich und ermüdend. Als ich kündigte, gebrauchte ich dies zumindest als Vorwand - obwohl mir gleichzeitig innerlich klarwurde, dass es wahrscheinlich nur mein Reisefieber war.
Nun gut - und jetzt war ich hier. Heute, am 30. Juli, dem letzten Samstag des Monats. Ich freute mich schon auf das Wiedersehen mit Peter. Und, weiß Gott, wir würden uns eine Menge zu erzählen haben!
Der Reisebus war in eine holperige, unbebaute Straße eingebogen. Der Fahrer zog langsam eine große Schleife und brachte den Greyhound zum Stehen. Die Luft war mit einem Mal kühl und frisch. Alles drängte zur Tür und stieg aus.
Es war ein angenehmes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich setzte meinen Koffer ab und zog mir mein Jackett über. Der Fahrer stand neben der Tür und überprüfte nochmals die Fahrscheine der Passagiere. Als ich ihm meinen reichte, warf er mir einen kurzen Blick zu.
»Gleich vorne rechts im Warteraum geht es zur Toilette. Auf Wiedersehen.«
»Besten Dank«, meinte ich. »Es war eine angenehme Fahrt.«
Ich betrat den Warteraum und sah die von ihm bezeichnete Tür sofort. An den Wänden entlang waren Waschbecken angebracht, die fast alle besetzt waren. Ganz am Ende der einen Reihe war noch eins frei; ich ließ es randvoll mit heißem Wasser laufen und machte mich ans Werk. Nachdem ich mich gewaschen und rasiert hatte, war mir wohler. Ich wühlte ein sauberes, gestärktes Hemd und frische Unterwäsche aus meinem Koffer hervor sowie ein Paar frischgebügelter Popeline-Hosen. Als ich wieder Zum Vorschein kam, fühlte ich mich wie ein König.
Während ich versonnen auf meinen Koffer hinunterblickte, überdachte ich die Lage. Peter hatte mir geschrieben, dass er mich bei sich unterbringen könnte. Hoffentlich tat er es auch! Aber verlassen konnte ich mich natürlich nicht darauf. Ich betrachtete die Situation in aller Ruhe von allen Seiten. Sollte ich meinen Koffer bei der Gepäckaufbewahrung abgeben und mich auf den Weg zur Avondale Avenue machen, oder war es klüger, zunächst einmal dort anzurufen? Schließlich entschloss ich mich, erst zu telefonieren, und machte mich auf die Suche nach einer Telefonzelle. Drüben in der Ecke entdeckte ich eine Reihe von Telefonkabinen. Ich wanderte mit meinem Koffer hinüber, wälzte das dicke Telefonbuch und fand Peters Nummer. Da stand sie, AM 997323. Ich steckte eine Münze in den Automaten und wählte. Nach einem Augenblick hörte ich es läuten.
Ich ließ es eine Minute lang klingeln und meinte das leere Echo des Schrillens in einem ruhigen, verlassen daliegenden Hausflur zu vernehmen. Ich hatte das untrügliche Gefühl, welches einen dann hin und wieder überkommt, dass niemand abheben und antworten würde. Trotzdem wartete ich noch eine Weile, aber alles blieb still. Dann wurde es mir zu dumm. Ich legte wieder auf, holte meine Münze aus der Rückwurfschale und steckte mir eine Zigarette an, um in Ruhe weiter nachzudenken. Ich durfte nicht außer Acht lassen, dass es heute Samstagnachmittag war. Das beste war wohl, es in etwa einer Stunde noch mal zu versuchen; vielleicht hatte ich dann mehr Glück.
Ich ging durch die Gepäckaufbewahrung hinaus auf die Straße. Wenige hundert Meter von der Busstation entfernt, entdeckte ich ein kleines Lokal. Ich setzte mich und bestellte mir ein Bier; es war angenehm kühl hier drinnen, und das Bier kam direkt vom Eis. Ich trank ein paar Gläser und rauchte eine Pfeife dazu. Soweit war ich ganz zufrieden. Ich freute mich auf Peter - es war doch schön, ihn endlich einmal wiederzusehen. Ich sinnierte darüber nach, was er wohl inzwischen gemacht haben würde und was er erreicht haben mochte; wahrscheinlich war er recht erfolgreich gewesen und hatte es zu einigem Geld und Ansehen gebracht! Denn ich hatte ihn immer für einen äußerst tüchtigen, intelligenten und wendigen Burschen gehalten. Ich sah auf die Uhr - es war fast vier. Also trank ich aus, zahlte und ging zur Busstation zurück, um nochmals zu telefonieren.
Abermals hörte ich das entfernte Läuten - aber wiederum bekam ich keine Antwort.
Zweites Kapitel
Vor dem Bücherkiosk stand ein fetter Polizist und starrte müßig in die Gegend. Ich ging zu ihm hinüber, setzte meinen Koffer ab und sprach ihn an.
»Ich bin hier fremd. Könnten Sie mir vielleicht ein ordentliches Hotel sagen, Herr Wachtmeister?«
Er musterte mich abschätzend.
»Wie wäre es mit dem Christlichen Hospiz?«, meinte er dann.
»Ausgezeichnet«, gab ich zurück. »Besten Dank. Wie komme ich dorthin?«
Er erklärte mir umständlich den Weg.
Zwanzig Minuten später hatte ich ein kühles, sauberes Zimmer für mich und saß ohne Schuhe bequem ausgestreckt in einem Armsessel. Am Ende des Ganges hatte ich mehrere Duschräume gesehen. Ich beschloss, mich dort abzukühlen, mich nochmals umzuziehen und essen zu gehen. Danach würde ich ein drittes Mal zu telefonieren versuchen.
Gedacht - getan. Das Duschen war herrlich erfrischend. Mindestens eine halbe Stunde lang hatte ich den eisigen Strom über meine Haut prickeln lassen, bis alle Hitze, Müdigkeit und Enttäuschung wie fortgeblasen waren. Als ich fertig angezogen war, zeigte die Uhr fast sechs. Ich fuhr hinunter und versuchte, in der Halle zu telefonieren.
Wieder dasselbe Spiel. Allmählich begann ich mich zu beunruhigen. Ich verwünschte es, Peters Rat nicht angenommen zu haben, ihm zu schreiben, wann ich in Toronto eintreffen würde.
Ich machte mich auf die Suche, nach einem Restaurant und hatte Glück, ein recht gutes zu finden. Eine Stunde brachte ich mit dem Abendessen zu, dann war die letzte Krume gegessen und ich satt bis obenhin - es blieb nichts mehr zu tun. Ich erkundigte mich nach dem Telefon. Drüben, unter der Treppe, sagte man mir. Irgendein aufmerksamer Kellner hatte sogar einen elektrischen Ventilator dort installiert, der sich automatisch einstellte, wenn man die Tür der engen Kabine schloss.
Ich steckte meine Münze hinein und genoss die kühle Zugluft. Das nun schon altbekannte Spiel wiederholte sich unverändert. Nichts als das monotone tut-tut, tut-tut, tut-tut war zu hören. Ich ließ es klingeln. Vielleicht hielt Peter sich in einem anderen Zimmer auf oder vielleicht war er gerade im Bad. Warum nicht, ich hatte ja Zeit, und es kostete kein Geld.
Ich beschloss zwei Minuten zu warten - ich verlängerte es auf drei. Ich stand da und starrte auf den Sekundenzeiger meiner Uhr, der unablässig und eilig weiterlief. Fünf Minuten - aber das war das Äußerste, sagte ich mir. Wenn er sich dann immer noch nicht meldete - zum Teufel mit Peter!
Ruck - Ruck - Ruck - die fünf Minuten waren um. Ich gab noch eine zu - nur so; ich hatte es ja schließlich nicht eilig, nicht?! Der Zeiger hüpfte. Dahn ganz kurz bevor er die T2 erreichte - knackte es im Hörer; ein leises Klicken.
»Hallo«, sagte eine ferne Stimme.
Sekundenlang war ich stumm wie ein Fisch vor Verblüffung.
»Hallo, wer ist da?«, fragte die Stimme abermals. Es war eine Frauenstimme.
Ich überlegte, ob ich mich wohl in der Nummer geirrt haben könnte... oder falsch gewählt... vielleicht hatte sich Peter ja auch zwischenzeitlich verheiratet, ohne es mir mitzuteilen...
»Hallo, wer ist denn da?«, erklang es zum dritten Mal.
»John Hillary«, sagte ich. »Hillary.«
»Oh?« kam es erstaunt zurück. Nun ja - warum sollte sie nicht erstaunt sein?
»Kann ich bitte Peter Crandall sprechen.«
»Oh?«, fragte sie abermals; allzu groß schien ihr Wortschatz nicht zu sein. Dann schwieg sie und wartete. Ich meinte, im Hintergrund eine Männerstimme etwas sagen zu hören; aber sicher war ich meiner Sache nicht.
»Bin ich vielleicht falsch verbunden?«
»Nein; oh, nein«, sagte sie rasch. »Nein, nein, Sie sind ganz richtig hier - nur - Peter ist nur nicht zu Hause.«
Ich dachte einen Augenblick darüber nach.
»Sind Sie Peters Frau?«
»Nein - seine Schwester.«
Mir fiel wieder ein, dass er mir einmal von einer Schwester erzählt hatte. Aber er hatte - soweit ich mich erinnern konnte gesagt, dass sie noch in England sei.
»Seine Schwester? So! Dann heißen Sie Jean, nicht wahr? Sind Sie nicht Krankenschwester?«
»Stimmt genau!« Ihre Stimme wurde lebhafter.
»Jean, dann sagen Sie doch bitte Peter, wenn er zurückkommt Bescheid, dass John Hillary in Toronto eingetroffen sei. Sagen Sie ihm bitte, ich sei gerade erst angekommen. Ich hatte ihm versprochen, mich bei ihm zu melden, wenn ich einmal nach Toronto käme.«
Ich hörte, wie sie tief Atem holte.
»Oh, natürlich - John Hillary! Jetzt weiß ich Bescheid! Peter hat so oft von Ihnen gesprochen. Wie lange bleiben Sie denn hier?«
»Das hängt ganz von Peter ab. Ich bin nur seinetwegen hierhergekommen.«
»Wieso - wollen Sie damit sagen, dass-Sie nur nach Toronto gekommen sind, um Peter zu besuchen?«
»Genau. Aber machen Sie sich keine Sorgen, er weiß schon Bescheid. Wenn Sie ihm bitte nur ausrichten, dass ich da bin.«
Irgendjemand murmelte etwas, und sie sprach hastig weiter.
»Einen Augenblick, Mr. Hillary. Wo sind Sie denn jetzt? Von wo aus telefonieren Sie?«
»Von einem Restaurant aus«, erwiderte ich. »Ich weiß nicht, wie es heißt; es liegt in der Yonge Street.«
»Und wo wohnen Sie?«
»Im Christlichen Hospiz. Zunächst einmal für einen Tag.«
»Ach, bleiben Sie doch bitte noch einen Moment am Apparat«, bat sie unbeholfen. Einen Augenblick war alles still.
»Hallo - sind Sie noch da, Mr. Hillary?«, fuhr sie dann fort. »Unser Nachbar, Mr. Muller, hätte gerne noch kurz mit Ihnen gesprochen.«
Einige Sekunden später erklang Mr. Mullers sonores Organ; er schien ein recht munterer Bursche zu sein.
»Hallo, Mr. Hillary? Guten Tag, hier spricht Russell Muller - ein Nachbar von Crandalls. Sie ist ganz aufgelöst, weil Sie den guten alten Peter sehen möchten.«
»Warum? Ist ihm irgendetwas zugestoßen?«, erkundigte ich mich besorgt.
»Nein, nein - gar nichts. Er ist nur im Moment nicht da. Das ist alles.«
»Verteufelt, das ist aber Pech!«
Er seufzte tief und mitleidig. »Das findet Jean eben auch. Sind Sie ein guter Freund vom alten Peter?«
»Das nicht direkt. Aber ich bin vor drei Jahren mit ihm auf dem gleichen Auswandererschiff nach Kanada gefahren. Wir teilten eine Kabine. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.«
»Und Sie sind wirklich nur nach Toronto gekommen, um ihn zu besuchen?«
»Ja. Einzig und allein deswegen. Wann erwarten Sie ihn denn zurück?«
»In ein paar Tagen«, erklärte Mr. Muller. »Aber Jean ist völlig durcheinander. Sie meint, dass Peter schrecklich enttäuscht sein wird, Sie verpasst zu haben.«
»Ich bleibe sowieso, bis er zurück ist.«
»Natürlich. Eh, eine Sekunde bitte...« Er schien die Hand über die Muschel gelegt zu haben, denn ich hörte nur noch ein undeutliches, verschwommenes Gemurmel. »Hallo«, ertönte es dann wieder klar verständlich. »Was halten Sie davon, heute Abend hier herauszukommen, damit man alles einmal in Ruhe durchsprechen kann?«
»Ausgezeichnet - eine großartige Idee! Aber ich habe keinen Wagen.«
»Dann hole ich Sie ab und bringe Sie zurück. Wäre es Ihnen recht, wenn ich in einer halben Stunde vor dem Christlichen Hospiz bin?«
»Gut, das würde gehen.«
»Prächtig!«, gab er zurück. »Also passen Sie auf. Man kann dort sehr schlecht parken. Es wäre am einfachsten, wenn ich im Wagen auf Sie warte. Aber woran erkenne ich Sie?«
»Das ist bei mir nicht schwer. Ich bin einsneunzig groß, wiege neunzig Kilo, bin rothaarig und trage einen hellgrauen Anzug. Ich warte draußen auf Sie und werde gut aufpassen.«
»Okay - da dürfen Sie ja nicht leicht zu übersehen sein, bei Ihrer Größe und dazu noch rotem Haar. Also, bis in einer halben Stunde dann. Auf Wiedersehen!« Er legte auf.
Ich ebenfalls. Ich verließ die Zelle und ging an die Bar hinüber. Dort bestellte ich mir noch ein Bier, zündete meine Pfeife an und überdachte die Lage. Ich hatte fest damit gerechnet, dass Peter zu Hause sein würde. Ich hatte gehofft, dass er mich abholen und mit zu sich nehmen würde. Mit einer Schwester hatte ich nicht gerechnet. Wie sie wohl aussah? Ihre Stimme klang ausgesprochen sympathisch; aber was besagt schon eine Stimme am Telefon.
Dann fragte ich mich plötzlich, wo sie wohl den ganzen Nachmittag über gewesen sein mochte? Wieso hatte ich sie erst so spät erreicht? Ich trank mein Bier aus und fand, dass es vollkommen überflüssig war, hier herumzugrübeln. In spätestens einer Stunde würde ich sie sehen. Dann würde ich wissen, wie sie aussah, und sie fragen können, wo sie gesteckt hatte. Viel schlimmer war, dass Peter verreist zu sein- schien. Aber da war eben nichts zu machen. Ich zahlte und ging.
Als ich auf die Straße hinaustrat, hatte die Luft sich etwas abgekühlt; es begann zu dämmern - es war eine der für Kanada in dieser Jahreszeit so typisch lauen, nie ganz dunklen Nächte. Gemütlich schlenderte ich zum Hotel zurück. Ich war guter Dinge und fand, dass sich nun alles doch noch ganz nett anzulassen schien.
Als ich das Christliche Hospiz nach einer Viertelstunde erreicht hatte, war es immer noch zu früh. Deshalb ging ich nochmals auf mein Zimmer, erfrischte mich etwas und füllte meinen Tabaksbeutel auf. Dann begab ich mich nach unten und stellte mich direkt unter die Straßenlaterne, die unmittelbar vor dem Eingang stand. Ich bemühte mich nach Kräften, so auszusehen, als ob ich aufgeregt jemand erwartete. Und ich hatte nicht lange zu warten. Vier Minuten - höchstens fünf.
Ein Wagen scherte aus der zweireihigen Kolonne aus und kam auf mich zu; im schwachen Halbdunkel der Nacht schimmerte er weiß oder perlgrau. Aber es war deutlich zu sehen, dass der Fahrer sich weit aus dem Fenster herauslehnte und jemand suchte. Soweit ich erkennen konnte, war er ein dicklicher, kleiner Bursche; er war hemdsärmelig, doch auf seinem Kopf thronte ein breitrandiger Panamahut mit einem glänzenden Seidenband.
»Mr. Hillary?«, fragte er ungewiss.
»Ja. Ich bin’s. John Hillary.« Erhielt mir die Autotür auf, und ich stieg ein. Als ich sie wieder zugeschlagen hatte, streckte er mir eine große, dichtbehaarte Hand entgegen.
»Guten Abend. Ich bin Russ Muller. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Er hatte einen erstaunlich festen Handgriff.
Bequem in meinen Sitz neben ihm zurückgelehnt, glitten wir hinaus in die Nacht.
Drittes Kapitel
Zunächst schwiegen wir beide. Ich saß einfach da und genoss die Fahrt. Die Nachtluft war weich und lind, und ich empfand sie wie ein angenehm kühles Streicheln. Es war völlig dunkel im Innern des Wagens, nur die Lichter am Armaturenbrett warfen einen matten Schein, der Mullers Gesicht von unten anstrahlte, so dass seine Augen völlig in tiefen, schattigen Höhlen verborgen lagen. Sein Kinn stach kantig und energisch hervor, aber es machte sich schon eine leichte Anlage zum Doppelkinn bemerkbar. Auf einer seiner mächtigen Hände - die mir schon zuvor aufgefallen waren - leuchtete eine grellweiße Narbe mit rötlichen Stichstellen an beiden Seiten.
Gerade, als die Stille drückend zu werden begann, sprach er.
»Sind Sie heute erst in Toronto angekommen, Mr. Hillary?«
»Ja. Heute Nachmittag, irgendwann zwischen drei und vier.«
»Mit dem Flugzeug?«
»Nein, mit dem Greyhound. Ich komme aus Windsor.«
Er verlangsamte die Fahrt und bog nach links ein. Jetzt fuhren wir auf einer größeren, belebteren Straße.
»Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr in Windsor gewesen«, meinte er dann.
»An und für sich lebe ich nicht in Windsor. Ich lebe mal hier und mal da. Vorher war ich in Sarnia.«
»Himmel und Hölle!«, rief er aus. »Kein angenehmer Platz! Dieser verdammte Gummigestank, der dort immer herrscht. Ich bin vor einem Jahr mal kurz oben gewesen. Ich habe den Gestank noch immer in der Nase - er ist einfach nicht wieder loszuwerden.«
»Mit der Zeit gewöhnt man sich daran.«
»Nee, ich nicht!«, verkündete er. »An solchen bestialischen Geruch nicht...«
Wir bogen abermals ab; diesmal in eine schmale, kaum erleuchtete Straße. Muller fuhr jetzt sehr langsam und hielt seine Augen fest auf die Fahrbahn gerichtet. Es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder einmal etwas sagte.
»Verdammtes Pech - mit Peter! Er wird ärgerlich sein, Sie verpasst zu haben.«
»Ja, zu dumm! Aber es ist meine Schuld - ich hätte ihm schreiben sollen, dass ich komme.«
»Ja, das wäre wohl besser gewesen«, stimmte er zu. »Es ist ganz ungewiss, wie lange er fortbleibt. Es kann zehn Tage dauern oder mehrere Wochen. Er befindet sich, soweit ich weiß, auf so einer Art Geschäftsreise - halb geschäftlicher und halb privater Natur.«
Die Straße schien jetzt immer geradeaus, endlos nach Norden zu führen. Toronto war offensichtlich erheblich größer, als ich es mir vorgestellt hatte! Ich machte irgendeine Bemerkung darüber zu meinem stummen Nachbarn, der sie sofort aufgriff.
»Ja«, meinte er, »sie ist mächtig gewachsen in letzter Zeit; groß ist sie geworden und schön! Nach dem Krieg hat sie diesen Aufschwung genommen. Suchen Sie hier Arbeit?«
»Oh, nein, nicht in Toronto.«
Er lachte auf. »Nun, nun, so schlecht ist Toronto auch wieder nicht. Man lebt nicht schlecht hier. Was haben Sie für einen Beruf?«
»Ach, ich habe mich in so ziemlich allem mal versucht. Ich bin Lastwagenchauffeur gewesen und habe als Verkäufer gearbeitet, als Vertreter und zuletzt in Sarnia oben als Polizist.«
»Als Polyp?«, fragte er. »Himmel und Hölle, mit Ihnen ist es aber mächtig bergab gegangen. Wie sind Sie denn auf die ausgefallene Idee gekommen, ausgerechnet Polyp zu werden?«
»Ich musste schließlich essen, nicht wahr, das muss jeder. Die Polizei suchte gerade Leute - also meldete ich mich.«
»Die Polizei sucht immer Leute«, gab er verdrießlich zurück. »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich kann diese Kerle nun mal nicht leiden.«
Ich lachte. »Es muss schließlich auch Polizisten geben.«
»Schön, schön. Ich weiß. Trotzdem - na, ja. Wieso haben Sie dort wieder aufgehört?«
»Ich hatte die Nase voll. Die Dienstzeiten sind zu lang und liegen zu ungünstig. Und außerdem ist das Ganze halb so spannend, wie man denkt, man ist der reinste Bürohengst.«
»Wahrscheinlich«, murmelte er noch, dann verstummte er wieder.