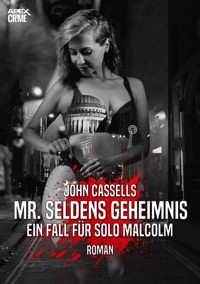5,99 €
Mehr erfahren.
Die Stadt lag im Nordosten. Eines jener trostlosen, grauen Gebilde, wo man sich gegen das Meer zu wehren hat, wo der Wind wie mit Messern schneidet. Eine Gegend, wo man etwas zum Aufwärmen braucht und die Wahl Wein oder Weib vom Geschmack des einzelnen abhängt. Ich kannte sie aus der Kriegszeit. Noch nicht einmal Zwanzig war ich gewesen. Sie hatte mir damals nicht gefallen. Sie gefiel mir auch jetzt nicht. Später erfuhr ich von Bombardierungen - aber zu sehen war nichts mehr davon. Man war größer geworden, ringsherum wimmelte es von modernen Vororten, und die Hotels der Innenstadt prunkten mit Chrom und anderem Quatsch...
Der Roman Solo für einen Detektiv um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym von Bestseller-Autor William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1963; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1964.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JOHN CASSELLS
Solo für einen Detektiv
Ein Fall für Solo Malcolm
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
SOLO FÜR EINEN DETEKTIV
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Die Stadt lag im Nordosten. Eines jener trostlosen, grauen Gebilde, wo man sich gegen das Meer zu wehren hat, wo der Wind wie mit Messern schneidet. Eine Gegend, wo man etwas zum Aufwärmen braucht und die Wahl Wein oder Weib vom Geschmack des einzelnen abhängt. Ich kannte sie aus der Kriegszeit. Noch nicht einmal Zwanzig war ich gewesen. Sie hatte mir damals nicht gefallen. Sie gefiel mir auch jetzt nicht. Später erfuhr ich von Bombardierungen - aber zu sehen war nichts mehr davon. Man war größer geworden, ringsherum wimmelte es von modernen Vororten, und die Hotels der Innenstadt prunkten mit Chrom und anderem Quatsch...
Der Roman Solo für einen Detektiv um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym von Bestseller-Autor William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1963; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1964.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
SOLO FÜR EINEN DETEKTIV
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Die Stadt lag im Nordosten. Eines jener trostlosen, grauen Gebilde, wo man sich gegen das Meer zu wehren hat, wo der Wind wie mit Messern schneidet. Eine Gegend, wo man etwas zum Aufwärmen braucht und die Wahl Wein oder Weib vom Geschmack des einzelnen abhängt. Ich kannte sie aus der Kriegszeit. Noch nicht einmal Zwanzig war ich gewesen. Sie hatte mir damals nicht gefallen. Sie gefiel mir auch jetzt nicht. Später erfuhr ich von Bombardierungen - aber zu sehen war nichts mehr davon. Man war größer geworden, ringsherum wimmelte es von modernen Vororten, und die Hotels der Innenstadt prunkten mit Chrom und anderem Quatsch.
Ich war in der Innenstadt, aber nicht in einem Hotel. Nur in einer Kneipe. Sie hieß Polestar und befand sich in der Nähe der Dockanlagen. Das Lokal selbst war ausgesprochen scheußlich. Niedrige Decke, holzgetäfelte, schokoladenbraune Wände, offener Ziegelkamin mit einem Feuer, bei dem man vor Asche die Kohlen nicht sieht - dreckige, weißliche Asche, wie Mehlstaub überall verstreut.
Aber das Bier war gut. Ich hatte mir schon ein paar Glas genehmigt und sah keine Ursache, so schnell damit aufzuhören.
Ich war aus keinem besseren Grund hineingegangen, als dass ich gehört hatte, Pete Zabora sei hier vor längerer Zeit Stammgast gewesen und ließe sich vielleicht dort wieder einmal blicken. Um genau zu sein: das hatte mich eigentlich in diese Gegend geführt. Dieser Pete Zabora war mit den Leuten um Shawn in Verbindung gewesen, und Shawns Organisation hatte im Londoner Stadtteil Deptford einen hübschen Lagerhauseinbruch gedreht.
Normalerweise wäre ich gar nicht hinzugezogen worden. Ich arbeite immer allein, und da bekommt man keine Firmenaufträge, aber zufällig war für dieses Warenhaus Ringers Detektei zuständig gewesen, und Lew Ringer, ein alter Freund von mir, hatte alle Hände voll zu tun gehabt. Ein Hinweis deutete auf den Nordosten. Dieser Pete Zabora sollte sich angeblich dorthin abgesetzt haben, und Lew wollte Bescheid wissen. Ich war gerade frei und für den Job bekam ich fünfzehn Pfund pro Tag. Lew rechnete mit einer Woche Arbeit. Mehr rückte er nicht heraus, und die Woche war jetzt um. Niemand hatte Zabora gesehen, niemand kannte ihn überhaupt.
Ich glaube kein Wort davon. Für mich trieb er sich in dieser Stadt herum, aber was galt meine Meinung schon?
Ich hatte Ringer angerufen, und Lew, der in erster Linie Geschäftsmann und erst dann Privatdetektiv ist, entschied sich in ungefähr zwei Sekunden.
»Machen Sie Schluss, Solo. Das lohnt sich nicht. So etwas geht immer ins Endlose, und schließlich bleibt überhaupt keine Pinke mehr übrig. Packen Sie Ihren Koffer. Gelegentlich können Sie zum Geldabholen kommen.«
»Aber bald«, sagte ich.
»Passt mir sehr gut«, meinte Lew. »Ich habe die Bücher gern in Ordnung. Da weiß man immer, woran man ist. Die Kasse ist dauernd geöffnet.«
Das war’s. Und an diesem Abend wollte ich per Schlafwagen heimfahren. Mir war das ganz recht.
Die Kneipe war fast leer. Am anderen Ende vertrieben sich drei junge Kerle mit Wurfpfeilen die Zeit. Zwei davon konnten nicht älter als Siebzehn oder Achtzehn sein. Magere kleine Bürschchen mit lackierten Entenschwanzfrisuren und Röhrenhosen, mit glänzenden Lederjacken und Schuhen, wie man sie in den Slums von Neapel findet. Sie hatten Whisky getrunken, seit ich die Kneipe betreten hatte, was vor einer guten halben Stunde gewesen war, und mussten demnach schon ganz beachtlich vollgetankt sein. Ich wunderte mich, dass der Schenkkellner nicht die Bremse anzog, weil er breit genug war, um mit allem möglichen fertig zu werden. Aber so ist es eben. Die meisten scheren sich den Deibel was, wenn der Zaster rollt.
Ich befasste mich mit meinem Bier und überlegte, ob es sich lohnte, nachschenken zu lassen. Einerseits hatte ich genug, andererseits regnete es draußen. Ich musste vier Stunden totschlagen, und hier saß es sich recht gemütlich. Und da kam dieser Typ herein.
Er war ungefähr in meinem Alter, achtunddreißig. Ein bisschen über Normalgröße: sagen wir vielleicht 1.78 Meter, daran konnte nicht viel fehlen. Ziemlich stämmiger Körperbau, dunkles Haar und breite Schultern. Er trug einen alten Trenchcoat, der so nass war, dass das Wasser auf den Boden tropfte. Einen zerbeulten, alten Hut besaß er auch; den nahm er ab und schüttelte ihn aus.
Der Schenkkellner spülte Gläser. Er sah auf und ging langsam auf den anderen zu - ein großer, haariger Kerl, der früher wohl einmal Boxer gewesen sein mochte. Völlig verfettet jetzt, natürlich. Er sagte: »Was trinken Sie?«
»Krug Bitterbier.«
Die Tür ging auf. Noch einmal drei Burschen kamen herein. Gleiches Alter, gleicher Typ, groß, hager, verschlagene Gesichter und unruhige Augen. Von der Sorte, wie man sie vor Tanzpalästen und an Straßenecken findet. Teenager mit Geld in der Tasche, die nicht wissen, wohin damit. Mit Siebzehn finden sie das Leben langweilig. Das feine Produkt des Wohlfahrtsstaats, das die Herren Politiker gern vergessen. Sie waren nicht allein. Hinter ihnen kam einer herein, der Anfang Dreißig sein mochte. Er trug einen langen, grünen Regenmantel mit eng geschnürtem Gürtel; in der Hand hatte er Lederhandschuhe. Er kam herein, blieb an der Tür stehen und sah sich um.
Die drei Burschen hatten die Wurfscheibe im Stich gelassen. Sie wirkten jetzt lange nicht mehr so angetrunken wie vor fünf Minuten. Sie gesellten sich zu den anderen, die eben hereingekommen waren und kreisten den Mann an der Theke ein. Sie machten das ganze ohne Hast, aber man sah, dass sie es ernst meinten. Sie hörten auch zu reden auf. Vielleicht war das so unangenehm. Jedenfalls wurde mir klar, dass es Stunk geben würde.
Der Mann an der Theke kam auch dahinter. Er drehte sich ein bisschen herum, so dass er mit dem Rücken zur Theke stand. Er blieb ruhig, aber ich sah, dass er die Fäuste angewinkelt hatte, und demnach so gefasst war, wie man es in einer solchen Lage eben sein konnte.
Einer der Halbstarken war an die Tür gegangen. Er stand jetzt genau davor, vielleicht einen Meter hinter dem Kerl mit dem langen, grünen Mantel. Er machte als erster den Mund auf, weil jemand die Tür hinter ihm aufstieß und in die Kneipe wollte.
Ein älterer Jahrgang mit grauem Schnurrbart und Gehstock. Er trug eine Nickelbrille, sein Mund stand weit offen.
Er tapste herein, und der Halbstarke sagte: »Raus, Opa. Der Laden ist geschlossen.«
Der Alte blinzelte: »Wieso kann er geschlossen sein?« beschwerte er sich. »Es ist doch erst
Der Bursche pachte ihn bei Arm und Kragen, drehte ihn herum und schob ihn zur Tür hinaus.
»Geschlossen, Opa. Kein Verkauf. Geh zum Fox and Grapes, da gibt es gutes Bier.«
Der Schenkkellner sagte: »Was soll denn das, Kleiner?«
Aber es klang nicht scharf oder zornig, oder wie es hätte sonst klingen können. Es klang besorgt, wie man eben redet, wenn man sieht, dass einem die Bude auf den Kopf gestellt werden soll.
Der Kerl im grünen Mantel sagte: »Das reicht, Jeff. Sie gehen nach hinten und zählen Ihre Bierflaschen, nicht?«
Der Schenkkellner befeuchtete die Lippen mit der Zunge. »Hört mal, ich will keinen Stunk in meinem Laden.«
»Wo?«
»Na ja, in Mr. Urbans Laden«, meinte Jeff. »Sie wissen, wie es ist, Leo, ich...«
Der Kerl im grünen Mantel ruckte mit dem Kopf. »Hauen Sie ab, Jeff. Wir müssen uns mit einem Freund unterhalten. Sie bekommen keinen Ärger, Jeff. Gut fürs Geschäft, in jeder Beziehung. Alle kriegen auf meine Rechnung etwas zu trinken.« Er holte einen glatten, neuen Schein aus der Tasche und faltete ihn in der Mitte zusammen. »Ein Glas nur, Jeff. Nachdem wir uns mit unserem Freund da besprochen haben. Wirklich, Jeff, Sie bekommen keinen Ärger.«
Die jungen Burschen kesselten den Mann an der Theke ein.
Der Freund stand da und beobachtete sie. Man konnte erkennen, dass er einen Ausbruchsversuch vorhatte und sich die ganze Zeit fragte, wie weit er kommen würde, bevor man ihn zu Boden schlug. Weit konnte das nicht sein, wie mir schien. Der Mann sah mir so aus, als hätte er einiges auf dem Kasten. Im fairen Kampf wäre er vielleicht mit je zweien von dieser Sorte auf einmal fertig geworden, aber von einem fairen Kampf konnte hier keine Rede sein.
Der Kerl im grünen Mantel warf den Schein. Er schwebte über die Theke, und der Schenkkellner fing ihn auf. Er faltete ihn auseinander, glättete ihn und steckte ihn in die Tasche. Trotzdem schien er einen Protest für seine Pflicht zu halten.
»Keinen Stunk«, sagte er. »Verdammt, Leo, noch so was und wir verlieren unsere Lizenz. Was soll ich dann anfangen?«
»Regen Sie sich ab«, sagte Leo. »Sie brauchen keine Sorge zu haben. Sie haben einen Fünfer fürs Maulhalten bekommen. Wenn er Ihren sauberen Boden vollblutet, kriegen Sie noch einen.«
Der Schenkkellner stieß eine Tür hinter der Theke auf. Er ging hinauf und schloss sie hinter sich; das gab einen hohlen, hölzernen Klang, dann war es still im Lokal. Jene Stille, wie man sie vor einem Sturm hat. Ich sah, dass der Mann an der Bar die Schultern reckte und sich mit dem Rücken an das harte Holz presste.
Und dann sah der Kerl mit dem grünen Mantel zu mir herüber. Er sagte überhaupt nichts. Er ruckte nur mit dem Kopf, wie man es bei einem Jungen macht oder vielleicht bei einem Bettler, dem man ein Almosen gibt.
Ich blieb sitzen.
Er sah mich an seiner Nase entlang an.
»Raus, Freundchen. Wie wär’s mit einem Spaziergang?«
Ich rührte mich nicht. Vielleicht war ich ziemlich tief im Sitz hinuntergerutscht, vielleicht lagen meine Schultern noch unter der Stuhllehne und alles andere war unter dem Tisch versteckt. Vielleicht merkten sie nicht, dass das ziemlich viel war.
Leo seufzte. »Ein Taubstummer.« Er sah zwei von seinen Halbstarken an. »Soapy, du kümmerst dich mit Ike um den Kerl.«
Einer von den beiden sagte: »Sicher, Leo.«
Er steckte die Hand in die Tasche und holte etwas heraus. Einer von seinen Schatten trat zu ihm. Sie kamen auf meine Ecke zu, teilten sich und blieben zu beiden Seiten des Tisches stehen. Der, den er Soapy genannt hatte, verfügte über eine blasse, von Mitessern übersäte Visage, rotes Haar und blaue Augen. An der linken Brustseite trug er Modeschmuck. Eine Mädchenbrosche, auf der Eva stand...
Er sah auf mich hinunter.
»Sie haben gehört, was Leo gesagt hat, Mister.«
Ich antwortete nicht. Das Ganze war mir weit genug gegangen.
Ich stand auf.
Zweites Kapitel
Eine ganze Menge ging in die Höhe, wenn ich aufstand. Weit mehr, als er erwartet hatte, und sehr wenig davon war Fett - das meiste Knochen. Große Knochen.
Soapy sog pfeifend den Atem ein und sagte: »Menschenskind!« Dabei bewegte er sich. Er hob das Schnappmesser, und das war ein Fehler. Ich beugte mich vor und nahm es ihm weg. Ich steckte es mit der freien Hand in die Tasche. Dann nahm ich die Hand aus der Tasche und langte ihm eine.
Ich rempelte ihn ein wenig an, und er kippte um. Zufällig schlug er mit dem Kopf gegen die Theke, und da lag er, schüttelte den Kopf und jammerte wie ein Kind.
Ich kam hinter dem Tisch hervor. Ike zog sich hastig zurück, und ich ging auf die Tür zu. Dabei fiel mir der Mann an der Theke ein. Ich sah zu ihm hinüber: »Na, was ist?«
»Ich bin dabei«, sagte er. Er ging langsam auf mich zu. Die vier Burschen um ihn herum unternahmen nichts.
Leo kam zu mir herüber und lächelte freundlich. Er war etwa einsfünfundsiebzig, schlank, und machte mir den Eindruck, als wisse er sich überall zu helfen. Er hatte helles Haar und eine glatte, gesunde Haut, der man die Pflege ansah. Hut und Mantel schienen allerhand gekostet zu haben. Die Hand, die er mir entgegenstreckte, wirkte gepflegt. Es war seine linke, und am Mittelfinger steckte ein Ring mit einem zitronengroßen Stein. Eine kleine Zitrone. Er lächelte immer noch, aber seine rechte Hand kramte in seiner Tasche.
»Ich glaube, Sie kapieren nicht ganz.«
»Das können Sie sich schenken. Ich habe solche Sachen schon miterlebt. Mir gefallen sie nicht.«
Er sah mich von oben bis unten an. »Sie sind ziemlich groß, aber kein Kriminaler, sonst würde ich Sie kennen. Stimmt’s?«
»Leicht möglich. Und jetzt ziehen Sie ab, bevor ich mich auf rege.«
»Einsneunzig bestimmt - und gute hundert Kilo«, sagte er. »Ein Mordsmannsbild, was?«
»Einsdreiundneunzig«, sagte ich, »und hundertelf Kilo.«
»Nicht schlecht«, meinte er. »Muss ich mir ansehen. Ich mag große Burschen. Schauen Sie sich an, womit ich arbeiten muss«, er machte eine ausgreifende Handbewegung. »Sie lernen es natürlich noch. Sie werden es lernen. Jeder muss einmal anfangen.«
»Ich habe Augen im Kopf«, sagte ich. »Ein Haufen Halbwüchsiger mit Pickeln im Gesicht. Wieviel wetten wir, dass ich es mit allen sechs zugleich auf nehme?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Ich verliere nicht gern, Kamerad. Solche Chancen sind mir zu riskant. Außerdem wären es bloß fünf. Soapy ist krank.«
Soapy stand wieder auf seinen Beinen. Er lehnte sich an die Theke, und in diesem Augenblick kam der Mann im Trenchcoat bei mir an.
Niemand rührte sich. Ich ließ ihn an meine Seite kommen, dann sagte ich: »So, Leo. Jetzt machen wir den kleinen Spaziergang, von dem vorhin die Rede war, was?«
»Einen Moment mal«, sagte Leo leise. Er holte eine Kroko-Brieftasche hervor und zerrte ein schmales Bündel Geldscheine heraus. »Fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig.« Er kam bis vierzig, dann sah er mich an. »Ich schaffe fünfzig. Was meinen Sie dazu?«
»Und was mache ich dafür?«, fragte ich neugierig.
»Sie gehen spazieren. Nur spazieren.«
»Sie können mich«, sagte ich. Ich ging zur Tür, behielt ihn aber im Auge, weil dieser Leo zu der Sorte gehörte, die nicht viel braucht, um einen Totschläger oder ein Stilett zu ziehen. Als ich die Tür erreichte, stand sie offen.
Leo sagte: »Bedauerlich. Ich schiebe nicht gern etwas auf. Wir sehen uns noch, Kellner. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal Geschäfte, was?«
Kellner war der Mann im Trenchcoat. Er sah zu Leo hinüber. »Ein nächstes Mal gibt es nicht, Starrett. Denken Sie daran.«
»Keine Angst«, sagte Starrett.
Kellner ging hinaus. Ich folgte ihm. Es war dunkel und nass. Der Regen peitschte herunter, als hätte es seit Weihnachten nicht mehr gegossen, und der Wind trieb ihn uns wie feine Nadeln ins Gesicht. Ich zerrte den Hut tiefer in die Stirn und hielt den Kopf geduckt. Kellner war noch neben mir. Ich zerbrach mir den Kopf nicht besonders über ihn, weil ich, offengestanden, fand, dass mich das Ganze nichts anging. Ich war in eine Privatsache hineingeraten. Dieser Starrett wollte Blut sehen - Kellners Blut aber in unserer Welt wird eben kein Pardon gegeben.
Als wir die Straßenecke erreichten, schaute ich mich um. Die Straße war leer. Niemand folgte uns. Das war immerhin etwas. Wir bogen in die nächste Straße ein. Ein dunkler, scheußlich aussehender Schlauch, aber Busse fuhren und andere Fahrzeuge - und es gab Polizisten, alle in glänzenden Regenmänteln. Wir gingen weiter, und nach ungefähr zehn Minuten kamen wir zu einer kleinen Kneipe mit einer großen Neonreklame über dem Eingang.
»Wollen Sie mit reinkommen und sich einen genehmigen, während ich mich bedanke?«, fragte Kellner.
Ich war nicht besonders neugierig darauf, aber ich hatte ja immer noch Zeit totzuschlagen. »Wieso glauben Sie, dass man Sie hier nicht zu fassen bekommt?«, erkundigte ich mich.
»Ausgeschlossen.« Kellner deutete auf das Schild über der Tür. »Die Thistle-Bar. Gehört Jock Mackay. Ein alter schottischer Rugby-Nationalspieler. Beinahe so groß wie Sie. Er hat drei Söhne, und sie arbeiten nachts an der Theke. Mit Schlägereien ist hier nichts zu machen.«
»Schön«, sagte ich. »Dann nichts wie hinein.«
Wir betraten das Lokal. Durch den ganzen Raum zog sich eine Theke; am anderen Ende stand ein offener Kamin, in dem ein Feuer brannte. Kellner ging vorüber. Auf halbem Weg kam man an einer Registrierkasse vorbei; dahinter rauchte ein muskulöser alter Mann Pfeife; auf der Stirn klemmte eine Brille. Er nickte Kellner zu.
Kellner sagte: »'n Abend, Jock.« Wir zogen uns Stühle heran. Kellner bestellte Whisky, und als der Wirt ihn brachte, nickte er mir zu.
»Dann will ich mal. Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich eine Abreibung verpasst bekommen.«
»Guter Whisky«, sagte ich.
Er schwieg eine Weile, dann meinte er: »Dieser Leo Starrett ist ein ziemlich übler Bursche.«
»Das habe ich selbst gemerkt.«
»Er war einige Zeit in den Staaten. Man hat ihn hinausgeworfen. Deportiert, vermutlich. Er kam zurück, um seine Mätzchen hier auszuprobieren. Er kommt auch durch damit. Manche Leute meinen, dass er sich allerhand leisten kann.«
»Noch einen Whisky?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Für mich nicht. Ich rühre Schnaps nur alle heilige Zeiten an. Diesmal dachte ich, du brauchst einen.« Er nahm ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und hielt es mir hin.
»Pfeife«, sagte ich und kramte sie heraus.
Kellner klemmte eine Zigarette zwischen die Lippen, zündete ein Streichholz an, das er von einem kleinen, grünen Heftchen abriss, und sagte: »Ja. So ist er, dieser Starrett.«
Ich setzte meine Pfeife in Brand. Als sie richtig zog, leerte ich mein Glas. »Was sagen Sie zu Bier? Anschließend muss ich mich auf die Socken machen.«
Er sah mich kurz an. »Gut. Aber nur einen Schoppen.«
Ich ließ zwei Halbe bringen. Kellner sog den Rauch tief in die Lungen. Er ließ ihn langsam aus der Nase kräuseln, dann meinte er: »Sind Sie überhaupt nicht neugierig?«
»Eigentlich nicht.«
Er überlegte einen Augenblick. »Fremd hier. Sagen Sie bloß nicht das Gegenteil. Ich bin jetzt zwölf Jahre in der Stadt und habe Sie noch nie gesehen. Bei Ihrer Größe könnten Sie sich schlecht verstecken. Also müssen Sie erst angekommen sein.« Er besah mich gründlich. »Stimmt’s, oder hab ich recht?«
»Stimmt. Ich bin eben erst angekommen und ziehe gleich wieder ab. Um zwölf geht mein Zug, und ich will Ihnen etwas sagen, Kellner, ich bin verdammt froh, dass ich verschwinden kann. Mir hat die Stadt nie gefallen.«
»Sie waren also doch schon mal hier?«
»Während des Krieges. Damals war ich noch jung. Ich fand es scheußlich hier. Es hat sich nichts geändert. Mir ist die Stadt zuwider.«
Er rauchte eine Weile. »Kriminalbeamter?«
»Nein«, sagte ich. »Früher mal, wenn Sie’s interessiert.«
»Und?«
»Ich habe Schluss gemacht. Keine Zukunft.«
»Und was sind Sie jetzt?«
»Privatdetektiv«, erwiderte ich. »Seit sieben Jahren.«
»Bei welcher Firma?«
»Bei mir. Eine Ein-Mann-Firma. Ich heiße Malcolm. Solo Malcolm.«
Er saß eine Weile da, dann sah ich seine Augen glitzern. »Hören Sie, Malcolm, komisch, dass wir beide so zusammentreffen. Im selben Geschäft. Ich arbeite auch als Privatdetektiv.«
»Zufall«, sagte ich. »Kommt vor.« Ich sah auf die Uhr. »Und jetzt machen wir Schluss. Ich muss meinen Koffer am Bahnhof abholen und mich für die Nacht einrichten. Der Schlafwagen wird sicher schon angehängt sein. Was meinen Sie?«
Er drückte seinen Zigarettenstummel aus. »Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass wir beide ein Geschäft machen könnten. Ich arbeite an einer Sache, die ich allein vielleicht nicht hinkriege. Ich brauche Unterstützung.«
Ich schüttelte den Kopf. »Besorgen Sie sich hier jemand, Kellner.«
»Das würde ich tun, wenn es ginge. Bis jetzt habe ich nichts Brauchbares gesehen.«
»Sie wollen mir erzählen, dass es hier keine großen Burschen gibt?«
Er hob die Schultern. »Nicht direkt. Aber sie treten entweder bei der Polizei ein oder man schnappt sie für andere Sachen weg. Außerdem bin ich nicht nur auf Größe aus. Ich brauche Gehirn dazu. Sie kämen mir gerade recht.«
»Nichts für mich, Kellner«, sagte ich.
»Warum nicht?«
»Ich habe in London genug zu tun. Ich arbeite gern da unten. Ich kenne die Leute. Die Leute kennen mich. Ich habe meine Verbindungen. Eine Woche lang habe ich hier versucht, jemanden ausfindig zu machen, aber ich hätte ebenso gut zu Hause bleiben können.«
»Wen suchen Sie?«
»Er heißt Zabora. Pete Zabora.«
»Warum suchen Sie ihn?«
»Lagerhauseinbruch«, sagte ich.
Er dachte nach. »Angenommen, ich unternehme in dieser Sache etwas, könnten Sie eine Woche oder so hierbleiben und mir behilflich sein?«
Ich zögerte. »Nichts zu machen. Ich bin einfach nicht interessiert. Außerdem suche ich diesen Zabora für einen Freund von mir. Ich bekomme fünfzehn Pfund pro Tag dafür. Jetzt ist Schluss damit, und ich möchte in meinen eigenen Laden zurück. Ich war hier. Ich möchte nichts versäumen. Begreifen Sie das?«
Kellner zuckte die Achseln. »Ja, ich verstehe. Fünfzehn pro Tag! Das ist verdammt gut bezahlt. Ihr Freund scheint etwas von Ihnen zu halten.«
»Ja«, sagte ich. »Was glauben Sie?«
»Finde ich auch«, gab er zu. »Fünfzehn pro Tag. Ich könnte vielleicht auch so viel bieten. Würde Sie das locken?«
»Nein... ich will heim. Mir gefällt es hier nicht.«
»Aha.«
Er starrte ins Leere. Er wirkte plötzlich müde. Er sah aus wie jemand, der fertig ist.
»Hat es dieser Starrett auf Sie abgesehen?«, meinte ich. »Liegt es daran, Kellner?«
»Zum Teil. Starrett macht mir kein Kopfzerbrechen. Er ist nur eine Figur - nicht einmal besonders wichtig. Aber hinter Starrett steht ein anderer.«
»Wer?«
Kellner lachte. »Sie würden nichts damit anfangen können. Dazu muss man hier leben und die Verhältnisse kennen.«
Er stand auf und kramte in seiner Westentasche. Er zog eine Karte heraus und hielt sie mir hin. Darauf stand:
David Kellner
Privatdetektiv 37
Sleeter Lane
»Nur zum Einstecken«, sagte er.
»Ich habe auch eine«, sagte ich. »Als ich anfing, ließ ich mir von einem Lohndrücker ein paar hundert Stück machen. Ich habe immer noch welche übrig.«
Ich zog meine Brieftasche heraus, fand eine Karte und sah zu, wie er sie einsteckte.
»Danke, Malcolm. Vielleicht rufen Sie mich an, wenn Sie es sich anders überlegen sollten?«
»Ich überlege es mir nicht anders.«
»Fünfzehn Piepen pro Tag sind ein ganz schöner Brocken.«
»Hören Sie, Kellner, ob ich fünf oder fünfzehn bekomme, spielt kaum eine Rolle, weil am Monatsende sowieso nichts bleibt.«
»Das ist auch wieder wahr«, sagte er. Er streckte die Hand aus. »Viel Glück, Kollege.«
Er ging hinaus.
Ich trank mein Bier aus und tat das gleiche. Eine Stunde später war ich am Bahnhof und erkundigte mich nach meinem Abteil. Und das war’s - wie ich meinte.
Drittes Kapitel
Am nächsten Morgen um acht kam ich in King’s Cross an, und das trotz eines Aufenthalts während der Nacht nördlich von London. Ich besorgte mir eine Tasse Kaffee, dann fuhr ich mit der U-Bahn zu meinem Büro im Adrian Walk. Ich stellte meinen Koffer ab und sah die Post durch. Mehr als ein halbes Dutzend Umschläge waren es nicht, vier davon enthielten Reklame, einer eine Rechnung und der letzte, den ich beinahe ungeöffnet in den Papierkorb geworfen hätte, zwei Fünfpfundnoten von Toby Marsh. Ich hatte sie ihm am Derby-Tag geliehen und ihnen längst Adieu gesagt. Da sieht man’s wieder.
Ich ging ins Bad, machte mich sauber und rasierte mich. Ich war guter Stimmung. Dann rief ich Lew Ringer an und hatte das Glück, ihn gleich zu erreichen.
»Na, Solo!«, sagte er. »Sie sind zurück? Ich war mir da nicht ganz sicher.«
»Ich komme heute vorbei, Lew, um neunzig Piepen zu kassieren. In bar, Lew. Schecks kann ich nicht leiden. Bargeld lacht.«
»Ich leg’ es für Sie weg«, versprach er. »Ich bin nicht da, wenn Sie kommen, weil ich nach Luton, vielleicht sogar nach Bristol muss. Sie können mir Ihren Bericht schriftlich geben. Bringen Sie ihn gleich mit.«
»Gemacht, Lew«, sagte ich und legte auf. Danach rief ich bei Choice Charlie Bendall an und erklärte ihm die Lage.