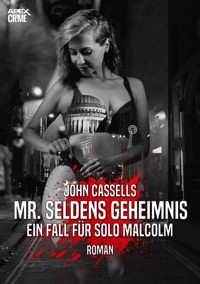5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Privatdetektiv Solo Malcolm ist einem gemeinen Erpresser auf die Schliche gekommen, der die Angst einer jungen Frau schamlos ausnutzt. Doch als Malcolm seine guten Beziehungen zur Londoner Unterwelt spielen lässt, gibt es gleich zwei Tote: Der erste ist Solos Informant, der zweite der vermeintliche Erpresser... Der Roman SCHWEIGEGELD FÜR LIEBESBRIEFE um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1970; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr. Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JOHN CASSELLS
SCHWEIGEGELD FÜR LIEBESBRIEFE
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
SCHWEIGEGELD FÜR LIEBESBRIEFE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Impressum
Copyright © by William Duncan Murdoch/Signum-Verlag.
Published by arrangement with the Estate of William Duncan Murdoch.
Original-Titel: One For The Book.
Übersetzung: Hans-Ulrich Nichau.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
Der Privatdetektiv Solo Malcolm ist einem gemeinen Erpresser auf die Schliche gekommen, der die Angst einer jungen Frau schamlos ausnutzt. Doch als Malcolm seine guten Beziehungen zur Londoner Unterwelt spielen lässt, gibt es gleich zwei Tote: Der erste ist Solos Informant, der zweite der vermeintliche Erpresser...
Der Roman Schweigegeld für Liebesbriefe um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1970; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
SCHWEIGEGELD FÜR LIEBESBRIEFE
Erstes Kapitel
Es begann am Dienstag, dem 4. Dezember. Es war ein Tag, den ich nicht so leicht vergessen werde, weil mir Loren Ritter einen Auftrag verpatzte, mit dem ich gerechnet hatte und den ich dringend brauchte.
Es handelte sich um eine normale Ermittlungsarbeit, die mich aber vier, fünf Monate beschäftigt hätte. Dale Paterson, mit dem ich früher einmal in der Armee gewesen war, hatte sich schon damit befasst. Er war ein zäher Bursche gewesen, aber anscheinend doch nicht zäh genug, denn er wurde eines Morgens mit umgekrempelten Taschen und eingeschlagenem Schädel in einer Seitenstraße gefunden. Er lebte noch, starb aber einige Stunden später in der Notaufnahme des West-Krankenhauses, ohne sein Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Die Zeitungen sprachen von einem Überfall und davon, dass es Dale zufällig erwischt haben müsse. In dieser Formulierung kam es auch in die Akten; aber jene Leute, die anderer Meinung waren, schoben es der Fender-Bande zu. Und so sah es auch aus, selbst wenn die Polizei keine Beweise hatte.
Wie dem auch sei, Loren Ritter hatte mich an jenem Tag um elf Uhr fünfundfünfzig in sein Büro gebeten, und ich war dieser Bitte nachgekommen. Als ich eintrat, saß er hinter seinem großen Schreibtisch. Er war einer von jenen jungen cleveren Managertypen, vierunddreißig Jahre alt, mit einem militärischen Haarschnitt und einem steif wirkenden Anzug, der meinem Großvater schon zu altmodisch gewesen wäre. Er erzählte mir dann alles - alles über Dale, alles über die Arbeit und alles über die Rolle, die mir zugedacht war. Anschließend sagte er: »Die Sache ist also klar, Malcolm. Sie brauchen mich nur täglich über den neuesten Stand Ihrer Ermittlungen zu informieren, mehr nicht. Haben wir uns verstanden?«
»Bis auf eins«, sagte ich.
»Das wäre?«
»Die leidige Geldfrage.«
»Sie erhalten fünfzehn pro Tag.«
»Reicht nicht.«
»Das hat Paterson auch bekommen.«
»Paterson ist tot«, sagte ich, »aber ich lebe.«
Er blieb dabei.
»Gut, dann vergessen wir es«, sagte ich und ging hinaus.
Das war also jenes bewusste Datum, und das war der Grund, weshalb ich es nicht vergessen konnte. Es wurde von Tag zu Tag kälter. Feiner Schnee fiel von einem düsteren, bleifarbenen Himmel; die Dächer waren bereift, und Nebel schwebte über den Straßen.
Wütend verließ ich das Gebäude, in dem sich Ritters Büro befand. Es lag nicht nur am Geld, obwohl ich es brauchte - beispielsweise für die neue Möbelgarnitur und die Teppichauslegeware im Wohnzimmer -, es lag vielmehr an der ganzen Art dieses jungen Emporkömmlings.
»Fünfzehn pro Tag, das ist eine verdammt gute Bezahlung«, sagte er. »Dafür könnte ich ein Dutzend Leute bekommen.«
»Aber keinen Mann wie mich«, entgegnete ich. »Sie wollen für Ihr Geld einen guten Mann haben, und das bin ich, möchte ich betonen. Sie bekommen also etwas für Ihr Geld.«
Aber er blieb stur.
Ich ging den Bürgersteig entlang und dachte an ein, zwei Dinge, die ich ihm noch hätte sagen können, wenn sie mir eingefallen wären. Dann suchte ich eine Kneipe auf, in der es einen Münzfernsprecher gab. Ich rief Jane an, die bei der Stadtverwaltung arbeitete, und hatte sie wenig später an der Leitung.
»Bist du’s, Solo?«
»Persönlich.«
»Hat’s geklappt?«
»Nein. Dieser Ritter ist wirklich ein Schinder!«
Sie kicherte. »Nimm es dir nicht so zu Herzen, Solo. Mit dem, was ich verdiene, kommen wir notfalls aus.«
»Wo jetzt Weihnachten und Neujahr vor der Tür stehen?«
»Wird sich schon etwas finden«, sagte sie. »Es ist ja nicht so, dass du keine Arbeit hast. Du hast nur kein Geld, weil du dir nie etwas auf die hohe Kante legst.«
»Das habe ich schon wer weiß wie lange versucht, aber ich bin nie über den Versuch hinausgekommen. Das wäre also die Situation, Jane. Vielleicht gewinnst du bei der Weihnachtstombola eine Flasche Whisky. Ich gehe jetzt zu Charlie zum Essen. Bis später.«
»Liebling!«
»Scheint niemand in deiner Nähe zu sein«, sagte ich.
»Nur zwei Mädchen.«
»Dann wissen sie jetzt, dass es kein Dienstgespräch war.«
Sie lachte und legte auf.
Ich ging zum Joss House, das Charlie Bendall gehört, einem meiner besten Freunde, der dafür gesorgt hatte, dass ich mich in meiner Anfangszeit als Privatdetektiv über Wasser halten konnte.
Charlie ging mittlerweile auf die Fünfzig zu und hatte Speck angesetzt, doch zu seiner Zeit war er einer der besten Mittelgewichtler des Landes gewesen. Bei handfesten Auseinandersetzungen ist er auch heute noch Klasse, und es wird keinem Menschen einfallen, in seinem Lokal einen Krawall anzuzetteln, wenn Charlie in der Nähe ist. Im Augenblick hielt Charlie sich hinten auf und hob, als ich eintrat, den Deckel von einem Topf. Es roch nach etwas Würzigem, sehr Schmackhaftem.
»Hallo, Charlie«, sagte ich, »was gibt’s denn heute?«
Charlie drehte sich um. »Du bist’s, Solo? Nur herein mit dir. Steak, Nierenpudding, Kartoffelpüree, geröstete Zwiebelringe und Erbsen.«
Ich hängte meinen Mantel auf. »Genau meine Linie, Charlie.« Ich setzte mich an den Tisch und sah zu, wie Charlie zwei Menüplatten füllte. Eine davon servierte er mir, die andere war für ihn selbst bestimmt. Er griff nach dem Pfeffer. »Nur eine Prise mehr, würde ich sagen - un soupçon gewissermaßen.«
»Dieser Urlaub in Frankreich scheint dein Vokabular bereichert zu haben, Charlie.«
»Ich glaube auch«, sagte er. »Hat mir sehr gefallen, Solo. Ich war zum ersten Mal seit 1946 wieder auf dem Kontinent, denn damals hatte ich die Nase restlos voll. Na ja, ich wäre sowieso nicht weggekommen in all den Jahren. Das Lokal, die Kinder und so weiter. Aber jetzt sind sie alt genug, und Belle und ich wollen uns auch mal ein paar sonnige Tage machen.
Mal ein Wochenendausflug nach Paris und dergleichen mehr. Warum auch nicht?«
»Da hast du recht, Charlie. Man ist nur einmal jung.«
»Du solltest mal mitkommen, Solo. Du und deine Herzdame. Es brauchen ja bloß ein, zwei Tage zu sein, wenn wir die sogenannten Feiertage hinter uns haben. Kleine Stippvisite in einem guten Hotel. Man braucht ja nicht gleich in einem Luxusappartement zu wohnen. Na, wie wär’s?«
»Geht nicht, Charlie.«
»Schon was anderes geplant?«
»Ja. Wir kaufen uns zu Weihnachten zwei Lebkuchen und trinken eine halbe Flasche Rotwein.«
»Sieht es so schlimm aus?«, erkundigte sich Charlie mitfühlend. »Wenn ich etwas für dich tun...«
»Nein, nein, Charlie«, sagte ich rasch, denn Charlie würde einem Freund jederzeit sein letztes Hemd geben. »Im Übrigen ist es nicht so schlimm. Ich bin nur schwer geladen - wegen eines Burschen, bei dem ich heute vorsprach. Es handelte sich um einen Auftrag, und daraus wurde nichts.«
»Kenne ich ihn?« Charlie teilte weitere Steaks und Nierenpudding aus.
»Das glaube ich nicht. Er heißt Ritter - Loren Ritter.«
Charlie blickte überrascht auf. »Loren Ritter kenne ich zwar nicht, aber ich kannte seinen alten Herrn. Die waren im Schrottgeschäft, als ich noch ein Junge war. Vor ihm der Großvater, ein Joe Ritter, und sein Vater hieß Len Ritter. Verdiente eine Menge während des Krieges. Geld wie Heu. Ich hörte, der junge Ritter soll ein ausgesprochen cleverer Bursche sein. Ganz gut vorangekommen, wie?«
»Das stimmt. Ritter KG, Ritter und Stutz, Ritter und Daly, Ritter und Sohn, Metallprodukte. Keine Firma ist besonders groß, aber jede wirft Profit ab.«
»Und was ging bei der Verhandlung schief?«, fragte Charlie.
»Wir konnten uns nicht über meinen Wert einigen.«
Charlie nickte weise. »Verstehe. Der alte Ritter war genauso. Rückte nie gern Geld heraus. Was er nur mit seinem Geld hatte? Kann man doch nicht mit ins Grab nehmen, nicht wahr? Nun, zuletzt wurde er wohl klug. Ich wette, es hat ihm in den Resten seiner Seele weh getan, dass er alles, was er zusammengerafft hatte, zurücklassen musste.«
»Vielleicht. Und sein Sohn hat geerbt.«
Charlie goss Bier nach. »Mach dir keine Gedanken, Solo. Diese Clique hatte schon immer die Brieftaschen plombiert. Der alte Joe gab nie gern Geld aus, aber er kassierte umso lieber. Gibt solche Leute. Nicht genug damit, dass sie Geld haben, wollen sie es auch noch den anderen Leuten abnehmen. Der Alte hatte zu seiner Zeit ein paar seltsame Freunde, beispielsweise Ike Catling und diesen Pete Lutter. Kennst du ihn?«
»Er bekam zwölf Jahre wegen eines Überfalls.«
»Genau der. Solche Burschen jedenfalls. Tippy Coleman, Barney Hoyt. Noch ein Schluck Bier, Solo?«
»Danke, Charlie.« Ich stand auf. »Ich muss noch im Büro nach der Post sehen.« Ich nahm meinen Trenchcoat vom Haken und zog ihn an.
Charlie beobachtete mich bewundernd. »Ich sehe, du hast dir ’nen neuen Hut gekauft, seit du verheiratet bist. Liegt das an deiner Frau?«
»Ja. Sie glaubt, das sieht in meinem Alter besser aus.«
»Ich weiß, ich weiß. Meine Belle war genauso, als wir geheiratet hatten. Die Frauen wollen einen immer verbessern. Ich will ja nicht sagen, dass so was verkehrt ist, Solo; aber man muss sich erst daran gewöhnen. Richte deiner Herzdame meine Empfehlungen aus.«
»Ich werd’s ihr ausrichten, Charlie«, sagte ich. »Danke.«
Ich verließ das Joss House, ging in Richtung meines Büros und stellte fest, dass die Luft kälter, dunkler und dicker wurde. Ich bog in den Adrian Walk ein, stieg die Treppe hinauf, öffnete die Tür, nahm die Post aus dem Briefkasten, ging damit in mein Zimmer und warf sie auf den Schreibtisch.
Zwei Postwurfsendungen, eine politische Informationsschrift, zwei Rechnungen und eine Ankündigung der Wohnungsbaugesellschaft, dass man demnächst mit einer höheren Miete zu rechnen habe, weil die Verwaltungskosten gestiegen seien.
Ich nahm an meinem Schreibtisch Platz, stopfte mir eine Pfeife und hatte die Hand gerade nach der Streichholzschachtel ausgestreckt, als das Telefon klingelte.
Zweites Kapitel
Ich nahm den Hörer ab und sagte: »Hier Solo Malcolm.«
Am anderen Leitungsende war eine Frau. »Mr. Malcolm«, sagte sie, »ich habe heute Vormittag schon mehrmals versucht, Sie zu erreichen.«
»Dann haben Sie diesmal Glück, Ma’am.«
»In Ihrem Büro hat sich niemand gemeldet.«
»Ich bin ein Einmannbetrieb«, erklärte ich ihr. »Leider vergaß ich, vor dem Weggehen den Fernsprechauftragsdienst anzurufen. Tut mir leid.«
»Nicht so schlimm.« Sie hatte eine nette Stimme, die auf eine gute Erziehung schließen ließ: kühl, ein wenig distanziert und jeder Satz klar gegliedert. »Kann ich Sie dann jetzt in Ihrem Büro aufsuchen?«
»Ja, Ma’am. Wann können Sie hier sein?«
»In fünf Minuten. Ich halte mich in dem Café in der Branksome Lane auf.«
Das war gleich um die Ecke.
»Gut, ich erwarte Sie«, sagte ich, legte den Hörer auf, steckte die beiden Rechnungen in meine Tasche und warf das andere Zeug in den Papierkorb.
Ich hatte es mir gerade bequem gemacht, als die Türklingel schrillte. Ich ging öffnen.
Sie hatte nicht nur eine nette Stimme, sondern sah auch sehr hübsch aus. Mitte Zwanzig - groß, schlank, blond; blaue Augen, ein ovales Gesicht mit frischem Teint. Sie trug eine Pelzjacke und darunter einen dunkelblauen Rock, der beachtlich teuer aussah.
Ich hielt die Tür weit auf. »Bitte, kommen Sie herein.« Ich führte sie ins Büro und bot ihr einen Stuhl an. Dann nahm ich wieder hinter dem Schreibtisch Platz. Sie zog ihre Handschuhe aus; ich sah Brillanten glitzern, und mehr brauchte ich nicht zu sehen. »Also, Ma’am, darf ich mich nach Ihrem Namen erkundigen?«
Sie blickte auf. »Im Augenblick noch nicht.«
»Und der Grund?«
Sie sagte sehr ruhig: »Nun, ich befinde mich in einer peinlichen Situation und möchte gern wieder heraus. Ich weiß nicht, ob Sie etwas für mich tun können, Mr. Malcolm, oder ob Sie etwas für mich tun wollen. Sind Sie nicht dazu bereit - nun, dann ist es auch nicht nötig, dass Sie wissen, wer ich bin, nicht wahr?«
»So ist es.«
»Gut.«
»Sie haben also ein Problem...«
»Ja.« Ihr Gesicht sah plötzlich müde aus. Sie schloss sekundenlang die Augen. »Es ist wirklich ein Problem. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll.«
»Sehen Sie, Ma’am«, sagte ich, »ich lebe von den Problemen anderer Leute und habe auf diesem Gebiet eine Menge Erfahrungen gesammelt. Meine Erfolgsquote ist verhältnismäßig hoch. Nur eines sollen Sie im Voraus wissen: Es gibt Aufträge, die ich nicht annehme. Scheidungsgeschichten beispielsweise.«
Ihre blauen Augen blickten gelinde überrascht. »Ich dachte, Privatdetektive würden sich damit befassen.«
»Einige befassen sich damit, einige nicht. Ich gehörte zur letzteren Kategorie.«
»Was ist verkehrt mit Scheidungen?«
»An sich nichts. Kommt immer wieder vor. Ich weiß es. Ich habe selbst eine Scheidung hinter mir. Aber die Bearbeitung von Scheidungsfällen ist etwas anderes. Das gefällt mir nicht. Ich schnüffle nicht gern in den Privatangelegenheiten anderer Leute herum. Einige machen das. Ich kann ihnen nur Glück und Erfolg wünschen. Sollte das Ihr Problem sein, wenden Sie sich bitte an eine andere Instanz. Ich kann Ihnen ein paar zuverlässige Adressen geben, wenn Sie Wert darauf legen. Mehr kann ich nicht tun.«
Sie schüttelte den Kopf. »Es handelt sich nicht um eine Scheidung.«
»Gut!«, sagte ich.
Sie sah mich beim Sprechen an. »In gewisser Hinsicht handelt es sich genau um das Gegenteil. Nur keine Scheidung - aber wenn Sie mir nicht helfen können, wird es möglicherweise soweit kommen.«
»Wer ist der schuldige Teil? Sie oder Ihr Mann?«
»Ich. Ich meine, ich war es.«
»Was ist es?«
»Briefe.« Ihre Augen blickten gleichbleibend ruhig.
»Erpressung«, sagte ich, klopfte meine Pfeife aus und begann sie wieder zu stopfen. Sie sagte nichts, während ich mich damit beschäftigte, und hatte nur ihre blauen Augen auf mich gerichtet. Als ich meine Pfeife angezündet hatte, sagte ich: »Sie sind also verheiratet und wollen nicht geschieden werden. Jemand setzt Sie unter Druck. Das interessiert mich allerdings. Ich möchte gern Ihre Geschichte hören, was noch nicht heißt, dass ich den Auftrag annehme. Ich schlage vor, Sie erzählen mir alles. Darum sind Sie ja zu mir gekommen, nicht wahr?«
»Ja.« Sie betonte das Wort, als habe sie meine Frage irgendwie beleidigt.
»In Ordnung. Beginnen Sie also. Moment, noch etwas! Wenn Sie wollen, dass ich mich ernsthaft mit diesem Problem befasse, dann müssen Sie mir die volle Wahrheit sagen. Ich möchte nicht, dass Sie mir wichtige Einzelheiten verschweigen, weil sie Ihnen unangenehm sind oder Ihre Person in keinem sehr günstigen Licht erscheinen lassen. Damit ist uns beiden nicht gedient. Erpressungsfälle sind mir nicht sehr sympathisch, noch weniger die Erpresser selbst. Aber die Aufklärung einer solchen Angelegenheit ist nichtsdestoweniger befriedigend. Wie gesagt, ich muss alles wissen, restlos alles.«
»Das sehe ich ein, Mr. Malcolm.«
»Beginnen Sie.« Ich lehnte mich zurück. »Zigarette?«
»Nein, danke, ich rauche nicht. Ich will Ihnen alles erzählen. Ich glaube zwar nicht, dass Sie anschließend noch viel von mir halten, aber...«
Ich unterbrach sie mit einem Seufzer. »Was hat denn das damit zu tun, Ma’am?«
Sie errötete leicht. »Ich dachte nur, Sie würden mich falsch...«
»Sehen Sie, ich bin kein Moralapostel. Ich bin lange genug auf der Welt, um zu wissen, dass die meisten Leute weder Engel noch Sünder, sondern von beidem etwas sind. Nicht ganz weiß, nicht ganz schwarz, eher grau. Allerdings hat das Grau von einigen schon einen Stich ins Schwarze.«
Sie lächelte. Es war ein Lächeln, das ihr Gesicht erhellte. »Ich danke Ihnen. Nun gut, Mr. Malcolm, hören Sie zu. Ich bin einunddreißig...«
Ich war ehrlich erstaunt und sagte das auch. »Ich hatte Sie auf fünfundzwanzig, sechsundzwanzig geschätzt.«
»Oh, danke, aber das trifft leider nicht zu.« Ihr Gesicht wurde wieder ernst. »Ich bin verheiratet. Ich bin jetzt sechs Jahre mit einem Mann verheiratet, den ich wirklich sehr liebe. Das Dumme ist, dass ich dieses Gefühl noch nicht hatte, als ich ihn heiratete.«
»Wie kam das?«
Sie sah mich frei heraus an. »Ich liebte einen anderen Mann.«
»So heirateten Sie einen Mann, als Sie in einen anderen Mann verliebt waren? Ich wette, Sie haben sich kirchlich trauen lassen. Mit feierlicher Orgelmusik, Kinderchor, Blumengebinden, Brautjungfern, einer weißen Hochzeitskutsche und dergleichen mehr.«
»Nun ja...«
»Feierliches Treue-bis-zum-Tod-Gelübde und so fort?«
»Ja.«
Ich sagte langsam: »Dann möchte ich gern wissen, wem Sie etwas vorgemacht haben: Ihrem Mann, Ihren Bekannten oder sich selbst!«
»Erledigt«, sagte sie ruhig. »Drehen wir die Uhrzeiger noch etwas weiter zurück. Ein Jahr davor kannte ich meinen Mann noch nicht einmal. Ich liebte damals einen flotten Boy, den ich auf einer Party kennengelernt hatte. Wir gingen ungefähr sechs Monate zusammen, verlobten uns, wollten heiraten und...«
»Sein Name?«
»Müssen Sie ihn unbedingt wissen?«
»Ja.«
»Mark Quennell. Er war Amerikaner.« Sie überlegte einen Moment. »Ich war verrückt nach ihm. Er studierte hier. Als er sein Studium beendet hatte, trat er in den Dienst der US- Regierung und nahm einen Posten in Guatemala an.«
»Aber es kam nicht zur Hochzeit.«
»Nein, es kam nicht dazu.«
»Streit?«
»Im Grunde nicht. Er sollte sechs Monate in Guatemala bleiben, und dann wollte er wieder nach England zurückkehren.« Sie hob ihren Kopf. »Nun, er kam nicht mehr zurück, schrieb mir einen Brief und löste die Verlobung auf.«
»Das ist hart«, sagte ich, »aber es kommt nun mal vor.«
»Er heiratete eine andere.«
»Auch das kommt vor.«
»Sie brauchen gar nicht so überlegen zu tun«, sagte sie schroff. »Wäre Ihnen so etwas passiert, würden Sie nicht so reden.«
»Genau das ist mir passiert, Ma’am«, erwiderte ich. »Oder so was Ähnliches. Ich heiratete, als ich fast noch ein Junge war. Nettes Mädchen, gut erzogen und so hübsch, wie man sich nur wünschen kann. Ich war auch verrückt nach ihr - und eines Tages ließ sie mich sitzen. Da war ein anderer Mann, den sie heiraten wollte. Und von mir wollte sie sich scheiden lassen. Das war ein harter Schlag für mich. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem Scheidung ein schmutziges Wort war. Nicht dass das eine Rolle spielte. Aber es spielte eine Rolle, dass ich sie liebte und sie noch lange, lange Zeit liebte.«
»Das tut mir leid«, sagte sie ruhig. Dann: »Was geschah weiter?«
»Die Scheidung ging über die Bühne.«
»Und was taten Sie?«
»Ich setzte mich wochenlang unter Alkohol. Dann riss ich mich wieder zusammen - aber das war nicht so einfach. Ich konnte sie einfach nicht vergessen. So etwas ist nun mal nicht leicht. Nicht, wenn man jemanden geliebt hat und weiß, dass man ihn endgültig verloren hat. Warum muss mir das passieren? fragt man sich. Warum ausgerechnet mir?«
»Ich weiß. Aber Sie kamen darüber hinweg?«
»Man muss darüber hinwegkommen. Das ist nun mal so im Leben. Wir Menschen wären armselige Kreaturen, würden wir nicht von Zeit zu Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass wir eben Menschen sind. Aus dieser Perspektive habe ich die Dinge schon immer betrachtet. Nun ja, ich kam schließlich doch darüber hinweg.«
»Und haben Sie wieder geheiratet?«
»Im vergangenen September.«
»Das freut mich.«
»Mich auch«, sagte ich. »So, nun wissen Sie es.«
Sie lachte plötzlich, obwohl ihr vielleicht nicht danach zumute war. »Ich habe verstanden und werde mir nicht mehr selbst leidtun. Und ich werde Ihnen nichts verschweigen, Mr. Malcolm.«
»Gut«, sagte ich, »aber bitte nicht mehr Mr. Malcolm, sondern einfach Solo.«
»Einverstanden - und ich bin Kit Hallam, die Frau von Tom Hallam. Markham Gardens, Chelsea.«
»So kommen wir schon besser voran«, sagte ich, lehnte mich wieder zurück und hörte zu.
Drittes Kapitel
Sie sagte gefasst: »Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Kurz nach meiner Pleite mit Mark Quennell lernte ich Tom kennen, und er mochte mich. Ich war nicht in ihn verliebt, das wusste ich. Trotzdem heiratete ich ihn. Aber heute liebe ich ihn - sehr sogar.«
»Und da war noch jemand anderes?«
»Ja. Er hieß Johnny Yarrow. Wir waren zusammen auf dem College. Ich kannte ihn schon damals ganz gut und mochte ihn. Ich will nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern Ihnen erzählen, was geschah.
Mein Mann ist - mit normalen Maßstäben gemessen - reich. Als technischer Berater hält er sich oft im Ausland auf. Nun, ein paar Monate nach unserer Hochzeit musste er wieder ins Ausland, diesmal für sechs oder sieben Monate. Ich wollte ihn begleiten, aber das war nicht möglich. Er ging nach Afrika, und zwar in eine ziemlich wilde Gegend, wo noch alles reichlich primitiv war. Ich durfte nicht mit.«
»Traf er diese Entscheidung?«
Sie nickte. »Größere Entscheidungen trifft Tom allein.«
»Wie alt ist er?«
»Einunddreißig.« Sie schwieg einen Moment. »Nun, er ging nach Afrika. Ursprünglich wollte er nur drei Monate wegbleiben, aber dann wurden es sieben, und ich war indessen allein. Ja, es hätte nicht passieren dürfen, aber es passierte.«
»Und wie ging es vor sich?«, fragte ich.
»Ich hatte eine Freundin, die auf der Kunstschule war und sich in einem kleinen Dorf in Cornwall ein Häuschen gemietet hatte. Sie lud mich für ein, zwei Wochen ein und war erst ein paar Tage dort, als ihre Mutter einen Schlaganfall bekam. Sie musste zurück nach Manchester, und ich blieb da. Ich war ungefähr eine Woche in dem Haus, als ich Johnny Yarrow traf. Er wohnte bei irgendeiner alten Tante, die ein eigenes Haus hatte. Ich war einsam, und er war einsam. Wir schlidderten einfach in die Geschichte hinein.«
»Und wie lange dauerte sie?«
»Ungefähr zehn Tage. Er kam herüber, wenn seine Tante zu Bett gegangen war. Angeblich wollte er mit einem Fischerboot hinausfahren... Es war reiner Wahnsinn - aber wer denkt in einer solchen Situation schon an so etwas? Man wird einfach davongetragen, denkt nicht an die Konsequenzen oder ob man falsch oder richtig handelt. Wenigstens war das bei mir so.«
»Und dann reiste er ab?«
»Ja. Sein Urlaub war zu Ende.«
»Und die alte Tante?«
»Sie blieb noch einige Zeit, denke ich, und reiste dann auch ab. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Aber ich sah Johnny. Er arbeitete in Bradford, und ich besuchte ihn, so oft ich konnte. Aber das dauerte nicht lange, weil er im Auftrag seiner Firma nach Australien fliegen musste.