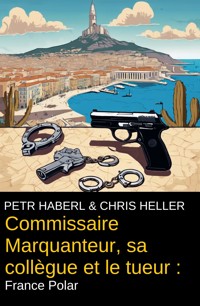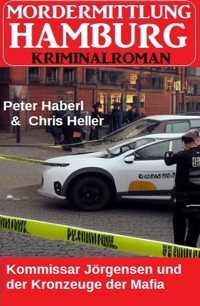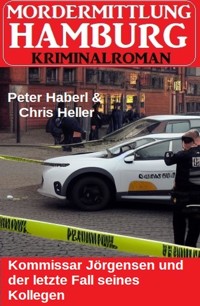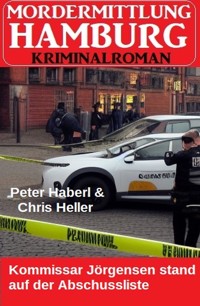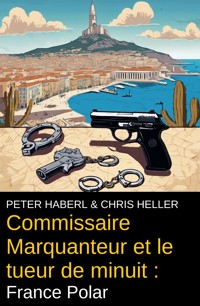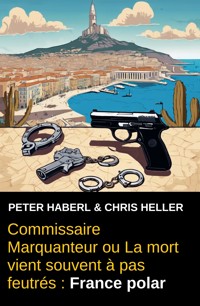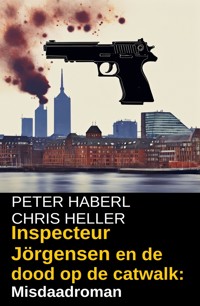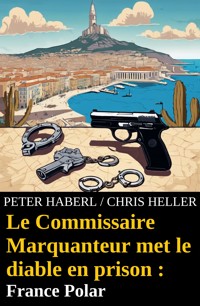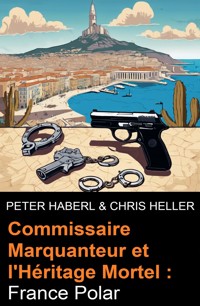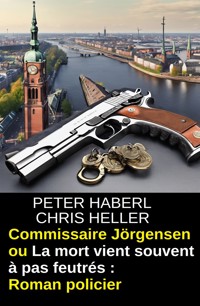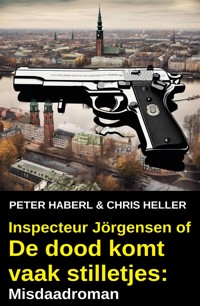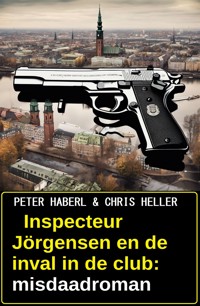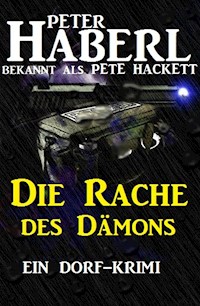
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Rache des Dämons von Peter Haberl Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten. Als Stefanie Brandl stirbt, ist der Arzt, der ihren Tod feststellt, der Meinung, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, denn Stefanie ist verhungert und verdurstet. Ihr Körper ist übersät von Striemen und blauen Flecken. Ihre Eltern, bei denen Stefanie gelebt hat, geben an, dass sie sich diese Wunden selbst beigebracht hat. Hauptkommissar Alfred Rumpler und Oberkommissar Jürgen Lindner aus der Stadt kommen ins Dorf und ermitteln. Da geschieht ein Mord! Hat der Mord etwas mit Stefanies Tod zu tun? Im Dorf treffen sie auf die Überzeugung, ein Dämon gehe um... Titelbild: Steve Mayer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Rache des Dämons
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Die Rache des Dämons
von Peter Haberl
Der Umfang dieses Buchs entspricht 124 Taschenbuchseiten.
Als Stefanie Brandl stirbt, ist der Arzt, der ihren Tod feststellt, der Meinung, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, denn Stefanie ist verhungert und verdurstet. Ihr Körper ist übersät von Striemen und blauen Flecken. Ihre Eltern, bei denen Stefanie gelebt hat, geben an, dass sie sich diese Wunden selbst beigebracht hat. Hauptkommissar Alfred Rumpler und Oberkommissar Jürgen Lindner aus der Stadt kommen ins Dorf und ermitteln. Da geschieht ein Mord! Hat der Mord etwas mit Stefanies Tod zu tun? Im Dorf treffen sie auf die Überzeugung, ein Dämon gehe um...
Titelbild: Steve Mayer
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Es war Nacht, der Himmel war grau bewölkt und die dicke Wolkendecke ließ weder Sternen- noch Mondlicht durch. Den ganzen Tag über hatte es abwechselnd geregnet und geschneit, es war nasskalt, laut Meteorologen aber dennoch viel zu warm für die Jahreszeit.
Das Dorf lag in völliger Finsternis, wie unter einer schwarzen Decke. Es war still - geradezu beklemmend still, eine Stille, die nicht einmal das leise, monotone Säuseln des Nachtwindes zu stören vermochte.
Aus dem Fenster eines Hauses im unteren Teil des Dorfes sickerte vager Lichtschein durch die zugezogenen Vorhänge. Und eine klare, präzise Stimme erklang: „Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe ...“
Ein kreischender Aufschrei unterbrach den Betenden, irgendetwas krachte, als wäre ein schwerer Gegenstand gegen die Wand geworfen worden, ein Aufprall folgte, dann wieder das entsetzliche Kreischen. Es wurde schnell leiser und man konnte ein Klatschen vernehmen, in das sich leises Winseln mischte. Und schließlich erklang wieder die dunkle, selbstsichere Stimme: „... wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute ...“
Wieder gingen die weiteren Worte in einem durchdringenden Kreischen unter, das in ein bedrohliches Fauchen ausartete, und dann schrie jemand mit einer Stimme, die jeden Moment zu brechen drohte: „Fuschani akikhi, fijezipo! Up eximasalu tso luvi, panganuka abuhlinge!” Die letzten Worte hatte der Sprecher geradezu hinausgeheult, und dann war wieder nur herzzerreißendes Wimmern zu vernehmen, in das sich das Klatschen von Schlägen mischte. Und die sonore Stimme sprach weiter; die Worte fielen wie Hammerschläge:
„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen ...“
„At istex muro, sadle itihogo, angalybe kebukisu!”, krächzte und geiferte eine hasserfüllte Stimme. „Puthike, wonke amantu! Puyakathi napho ukekhula sokagidla umazine."
Und aufs Neue war das Klatschen zu vernehmen, jedem Schlag folgte ein gellender Aufschrei, der durch und durch ging, und die stumme Beobachterin, die nicht weit von dem Haus entfernt im Schlagschatten eines Hauses verweilte, bekreuzigte sich hastig. „Herr Jesus Christus, bewahre uns vor der Macht der Hölle“, flüsterte sie. Und sogleich schlug sie ein weiteres Mal das Kreuzzeichen. „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes ...“
„... Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“
Wieder krachte es, ein Klirren und ein Poltern schlossen sich an, ein schriller Aufschrei mischte sich hinein und die krächzende, gehässige Stimme krakeelte aufs Neue: „Ynike uhora fesi Ngiyaliva - Engusuno athundo safety. Lukuya uswi mankho!"
Klatschende Schläge waren zu vernehmen.
Die geheimnisvolle Zuhörerin auf der Straße verstand kein Wort und so hatte sie keine Ahnung, was derjenige, dem scheinbar große Schmerzen zugefügt wurden, hinausgebrüllt hatte. Aber sie wusste, was sich in dem kleinen Haus abspielte. Pfarrer Wilhelm Prechtl und das Ehepaar Brandl praktizierten eine Teufelsaustreibung an deren Tochter Stefanie, von der sie behaupteten, dass sie seit mehreren Jahren von einem Dämon oder vom Satan selbst besessen war. Seit Monaten hatte in dem Dorf kein Mensch mehr die junge Frau zu Gesicht bekommen. Doch zweimal in der Woche ging der Priester in das Haus der Familie Brandl, und dann hörte man ihn beten, Stefanie aber hörte man krächzen, grunzen, kreischen, heulen, wimmern und winseln aber auch mit einer völlig fremden Stimme fluchen, drohen und obszöne Ausdrücke brüllen. Oftmals benutzte sie diese völlig unbekannte Sprache, um ihrer Wut und ihrem Hass Ausdruck zu verleihen. Und man konnte auch das Klatschen der Peitsche vernehmen, mit der sie Helmut Brandl auf Anweisung des Geistlichen züchtigte.
Aus einem Fenster des Gasthauses, das keine zwanzig Meter vom Haus der Brandls entfernt war, schaute Hans Zimmerer, der Gastwirt. Erschüttert lauschte er.
Die Stentorstimme des Priester erklang aufs Neue: „O Gott, rette mich durch deinen Namen, und schaffe mir Recht durch deine Macht! Oh Gott, erhöre mein Gebet, und achte auf die Reden meines Mundes!“
Der Geistliche sprach mit Nachdruck und verlieh den Worten besondere Betonung, das Kreischen und Heulen, das höhnische Grölen sowie die Verwünschungen und Flüche aus dem Mund Stefanie Brandls nicht achtend.
„Herr, steh uns bei“, murmelte Hans Zimmerer ergriffen und erschüttert zugleich. „Und lass nicht zu, dass sich das Böse in unserem Dorf behauptet.“
Eine schemenhafte Gestalt glitt aus der Dunkelheit, näherte sich dem Gasthaus und Hans Zimmerer erschrak so sehr, dass sein Herzschlag fast aussetzte. Er verspürte Schwindelgefühl und fürchtete, im nächsten Moment ohnmächtig zu werden.
„Ich bin es, die Margarethe. Nicht erschrecken. Hörst du es auch Hans? Das geht nun schon seit Wochen so. Und wir schauen zu, ohne etwas zu unternehmen.“
„Großer Gott, hast du mich erschreckt“, raunte der Gastwirt heiser und gerade so laut, dass ihn Margarethe Heider verstehen konnte. „Um ein Haar hätte mich der Schlag getroffen. Was tust du hier? Es geht auf Mitternacht zu.“
„Ich beobachte das seit über einem Monat. Jeden Mittwoch und Samstag unterziehen sie die arme Stefanie dieser brutalen Prozedur. Hörst du das Klatschen? Ich denke, sie schlagen die Ärmste mit einer Peitsche. Was meinst du? Hat unser Pfarrer die Genehmigung des Vatikans, eine Teufelsaustreibung bei Stefanie durchzuführen?“
„Was weiß denn ich! – Horch!“
„Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben, und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer; der Herr ist es, der mein Leben erhält ...“
Auch jetzt wurden die Worte des Priesters wieder von Flüchen und Verwünschungen quittiert, dazu kam eine Reihe unartikulierter Laute, wahrscheinlich Resultat einer Reihe unkontrollierter Wutausbrüche und Ausdruck eines kaum bezähmbaren Hasses.
„Ich sehe Schlimmes auf unser Dorf zukommen“, prophezeite Margarethe flüsternd, mit brüchiger Stimme. „Die dunklen Wolken des Unheils ziehen bereits auf, und wir werden dem Verhängnis machtlos gegenüberstehen.“
Es hatte sehr geheimnisvoll geklungen und der Gastwirt verspürte Gänsehaut. „Was ist das für eine Sprache, die Stefanie immer wieder spricht?“, fragte er leise. „Hört sich an wie – wie ... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Kauderwelsch ist.“
„Wahrscheinlich ein altorientalischer Dialekt“, murmelte Margarethe Heider. „Vielleicht auch die Sprache des Satans und seiner Helfershelfer. Wieso beherrscht Stefanie diese Sprache?“ Ihre Stimme sank herab zu einem kaum verständlichen Raunen, als sie hinzufügte: „Vielleicht ist sie wirklich vom Teufel besessen und es ist gar nicht sie, die in dieser Sprache redet, sondern der Leibhaftige, der in sie hineingefahren ist.“
„Es hat eine Zeit gegeben, in der man sie der Hexerei angeklagt, für schuldig befunden und verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hätte“, murmelte der Gastwirt mit ausgetrockneter Kehle. „Darum müssen wir den Herrn Hochwürden gewähren lassen. Er muss den Teufel aus ihr heraustreiben und ihn aus unserem Dorf verjagen. Er darf hier auf keinen Fall Fuß fassen, denn er ist das Unheil und das Verhängnis. Der Herrgott gebe dem Hochwürden die Kraft und die Ausdauer, die für seinen Kampf mit den Mächten der Finsternis vonnöten sind.“
„Großer Gott, erhöre uns“, stieß Margarethe Heider hervor. „Und – lass diesen Kelch an uns vorübergehen.“
Und da war auch schon wieder die donnernde Stimme des Priesters zu vernehmen: „Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten; vertilge sie nach deiner Treue! Ich will dir opfern aus freiem Trieb; deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut ...“
„Herr der Heerscharen, erhöre sein Gebet“, flüsterte Margarethe Heider, bekreuzigte sich ein weiteres Mal und schlurfte davon. Schon nach wenigen Schritten wurde sie eins mit der Finsternis und Hans Zimmerer konnte sie nicht mehr wahrnehmen. Es war, als hätte die Nacht sie verschluckt.
Auch der Gastwirt zog den Kopf zurück und schloss so leise wie möglich das Fenster, als fürchtete er, dass ihn jemand hören könnte.
2
Stefanie Brandl starb am Sonntag, dem 14. Februar, in den frühen Morgenstunden. Der Arzt, der aus der nahen Kreisstadt gerufen wurde, um den Tod festzustellen, diagnostizierte an dem völlig abgemagerten Körper der jungen Frau Spuren von Misshandlungen und schaltete die Polizei ein. Der Leichnam wurde obduziert und die Feststellungen ergaben, dass Stefanie Brandl in der Tat körperlich misshandelt worden, letztendlich aber verhungert und verdurstet war.
Am 23. Februar, einem Dienstag, trafen Hauptkommissar Alfred Rumpler und Oberkommissar Jürgen Lindner von der Polizeiinspektion der nahen kreisfreien Stadt in dem Dorf ein, in dem Stefanie Brandl gelebt hatte. Rumpler war siebenundvierzig Jahre alt, mittelgroß und sportlich, seine Haare waren dunkel und kurz geschnitten. Lindner war fünf Jahre jünger, blondhaarig und blauäugig. Beide Polizisten waren erfahrene Ermittler und gehörten zum Kommissariat 1 bei der Kriminalpolizei, zuständig für die Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter, Mord, Totschlag, Todesermittlungen, Brand-, Sexual- u. Umweltdelikte.
Das Dorf lag in einer Senke, die von einem schmalen Fluss zerschnitten wurde. Die Sohle der Senke bildeten eigentlich nur das Flüsschen und die Staatsstraße, an der einige Häuser erbaut worden waren. Hinter diesen Häusern stieg das Gelände wieder ziemlich steil an und der Rest des Dorfes klebte an diesem Abhang beziehungsweise erstreckte sich auf der Ebene, bei der der Abhang oben endete. Hier war auch die gelb und weiß gestrichene Kirche mit dem Zwiebelturm errichtet, daneben das alte Schulhaus, hinter dem das Gelände nach Osten hin seicht abfiel und dem kleinen Friedhof, der von einer etwa 1,5 Meter hohen Mauer eingefriedet war, Platz bot. Am Friedhof vorbei verlief die Straße in südliche Richtung. Sie war eine der vier Möglichkeiten, den Ort mit dem Auto zu verlassen.
Die beiden Kriminalbeamten waren aus nördlicher Richtung gekommen. Als sie die steil abfallende Straße zum Fluss hinuntergefahren waren, hatten sie sich schon einen ersten Eindruck von dem Dorf bilden können. Alles sah alt und unmodern aus. Die Polizisten hatten den Eindruck, in der Zeit um hundert Jahre zurückversetzt zu werden. Sogar der kleine Holzturm des Feuerwehrhäuschens mit der Alarmglocke im Gestühl war von der Witterung grau und bedurfte sicher sehr bald der Erneuerung, sollte er nicht bei einem etwas heftigeren Windstoß zusammenbrechen.
Stefanie Brandl hatte mitten im Dorf im Haus ihrer Eltern gelebt. Das Wirtshaus des Ortes war nur drei Häuser weiter und auf dem Parkplatz davor stellten die Kriminalbeamten den Dienstwagen ab.
Es war ein nasskalter, regnerischer Tag, und die unmittelbare Umgebung des Gasthauses mutete an wie ausgestorben. Kein Mensch ließ sich blicken. Die Polizisten schauten sich um und sahen nur die alten Häuser mit den niedrigen Haustüren und kleinen Fenstern, den verwitterten Anstrichen und zum Teil stark bemoosten Ziegeldächern. Von vielen der Fassaden war der Verputz großflächig abgefallen und man konnte die Ziegelwände sehen. Der Art der Ziegel nach zu schließen waren diese Gebäude mindestens hundertfünfzig Jahre alt. Über einigen Haustüren waren in halbrunden Nischen Marienfiguren oder andere geschnitzte Schutzheilige, zumeist der heilige Florian, zu sehen.
Aus den Schlöten stieg Rauch, wurde vom frischen Westwind erfasst und zerfasert. Es roch nach verbranntem Holz.
Die beiden Beamten waren von der Dorfidylle, die sich ihnen bot, seltsam berührt. Sie hatten beide das Empfinden, als hätte hier die Zeit vor hundert oder noch mehr Jahren angehalten. Hauptkommissar Rumpler warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war 9 Uhr 25. „Okay, Jürgen dann wollen wir mal“, sagte er und setzte sich in Bewegung. Gleich darauf klopfte er mit den Knöcheln seiner Hand gegen die Eingangstür des Häuschens, in dem die Familie Brandl lebte. Eine Klingel gab es nicht, und der Hauptkommissar fragte sich sogar, ob dieses Dorf überhaupt mit Elektrizität versorgt wurde oder ob die Bewohner nach Einbruch der Dunkelheit Kerzen und Petroleumslampen benutzen, um für Helligkeit in ihren Wohnräumen zu sorgen.
Kurze Zeit verstrich, dann waren hinter der Tür Geräusche zu vernehmen, ein metallisches Knirschen und ein Knacken, und dann wurde die Haustür aufgezogen. Sie knarrte und quietschte leise in den Angeln. Ein hagerer, gebeugter Mann mit grau melierten Haaren, dessen Alter schlecht zu schätzen war, zeigte sich und schaute die beiden Beamten aus grauen, wässrigen Augen an. Sein Gesicht war von tiefen Linien und Falten zerfurcht und die Haut erinnerte an altes Pergament. „Ja?“ Mehr kam nicht über seine schmalen, blutleeren Lippen.
„Grüß Gott, ich vermute, Sie sind Herr Brandl. Ich bin Hauptkommissarin Rumpler von der Kripo, das ist mein Kollege Oberkommissar Lindner. Haben Sie eine halbe Stunde Zeit für uns?“
„Wieso Kripo?“ Die Stimme Helmut Brandls klang blechern und heiser und er nahm seinen durchdringenden Blick nicht vom Gesicht des Hauptkommissars.
„Es ist wegen Ihrer Tochter Stefanie. Im Zusammenhang mit ihrem Ableben sind einige Fragen aufgetaucht, und auf die eine oder andere dieser Fragen können sicher Sie oder Ihre Gattin Antwort geben. Dürfen wir reinkommen?“
„Meine Tochter war krank – sehr krank, Gott der Herr hat sie schließlich erlöst und zu sich genommen. Es ist kein Fall für die Kriminalpolizei.“
„Das mag Ihre Sicht der Dinge sein, die bisherigen Feststellungen haben jedoch ergeben, dass es möglicherweise keine natürliche Ursache war, die das Ableben Ihrer Tochter zur Folge hatte. Es ist wichtig, dass Sie uns einige Fragen beantworten. Allerdings muss das Gespräch nicht zwingend in Ihrer Wohnung geführt werden, wir können Sie auch in der Polizeiinspektion befragen.“
Helmut Brandl mahlte kurz mit den Zähnen, sein Augen flackerten unruhig, er schaute von Rumpler zu Oberkommissar Lindner, duckte sich ein wenig und murmelte schließlich: „Meinetwegen. Wenn es nicht anders geht, dann kommen Sie herein. Ich glaube aber nicht, dass wir Ihnen auch nur eine einzige Ihrer Fragen beantworten können.“
„Wir werden es sehen“, versetzte Hauptkommissar Rumpler, und als Helmut Brandl die Haustür freigab, trat er in den engen und recht dunklen Korridor des Hauses. Muffiger Geruch empfing den Polizisten; es war der Geruch von Staub, Schimmelpilz und altem Bratfett. Für den Bruchteil einer Sekunde hielt er sogar die Luft an, derart penetrant roch es.
Hinter ihm hüstelte Oberkommissar Lindner.
Von dem Flur führten zwei Türen ab, eine nach links, die andere nach rechts, an seinem Ende schwang sich eine schmale Holzstiege nach oben, wo es wahrscheinlich unter der Dachschräge einen oder zwei kleinere Räume gab. Helmut Brandl forderte die Beamten auf, den Raum zu betreten, in den die linke Tür führte. Es war die Küche, und in ihr war der abgestandene Geruch ganz besonders intensiv. Unter dem Gewicht der Männer ächzte der gescheuerte Dielenboden, einen Bodenbelag oder Teppich gab es nicht. Auch hier mischte sich in den Geruch von Moder und altem Fett der von Harz und verbrennendem Holz.
Auch dieser Raum war düster, die Höhe der Decke betrug höchstens 2,10 Meter, die Einrichtung konnte man als altertümlich bezeichnen. Neben einem Herd, der mit Holz zu feuern war und von dem aus ein verrostetes Ofenrohr nach oben führte, das unter der Decke entlangführte und die ganze Breite der Wand einnahm, bis es an der Seite im gemauerten Kamin verschwand.
Der Ofen war angeheizt, im Raum war es unerträglich warm. In der Mitte stand ein blank gescheuerter Holztisch, um den vier einfache Stühle aus demselben Material gruppiert waren. Auf der anderen Seite der Küche stand an der Wand ein Buffet, dessen Aufsatz grün verglast war. An der Wand hing eine Pendeluhr, deren monotones Ticken den Pulsschlag der Zeit verdeutlichte. Es gab noch einige weitere Küchenutensilien an der Wand über dem Ofen, wie Schöpflöffel und andere Anrichtebestecke, die längst den Glanz verloren hatten oder aus glanzlosem Aluminium bestanden; Zeugnisse einer längst verflossenen Küchenkultur. Und es gab einen Herrgottswinkel mit einer brennenden Kerze. Das Kruzifix war mit zwei Palmkätzchenzweigen geschmückt.
Eine mittelgroße, zierliche Frau, die sich ein Kopftuch über die stumpfen, grauen Haare gebunden hatte und die mit einer blauen Wickelschürze bekleidet war, stand beim Tisch und taxierte die beiden Ankömmlinge. Ihr Gesicht war hager, man konnte fast sagen eingefallen, die Augen lagen in dunklen Höhlen und glitzerten erwartungsvoll, von ihren Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln zogen sich tiefe Labialfalten.
Hauptkommissar Rumpler hatte angehalten, nickte der Frau zu, stellte sich und seinen Kollegen vor und sagte dann: „Seien Sie unserer Anteilnahme am Tod Ihrer Tochter versichert, Frau Brandl. Allerdings sind im Zusammenhang damit einige Fragen aufgetaucht, deren Beantwortung wir uns hier und heute erhoffen.“
3
Sie hatten an dem Holztisch Platz genommen. In dem Zwielicht, das in der Küche herrschte, muteten die Gesichter starr und finster an und die Augen glitzerten wie Glas. Ab und zu knackte im Ofen ein Holzscheit in der Hitze.
Hauptkommissar Rumpler hatte sich auf dem Stuhl zurückgelehnt und die Arme vor der Brust verschränkt. Er sah keinen Grund, sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, und kam sofort auf den Anlass ihres Besuchs zu sprechen, indem er sagte: „Ihre Tochter ist verhungert und verdurstet. Sie wog nur noch siebenunddreißig Kilogramm. Wie kann das sein, wohnte sie doch bis zu ihrem Tod bei Ihnen.“