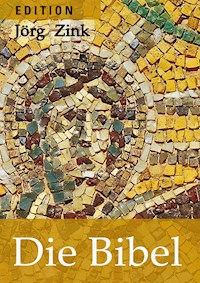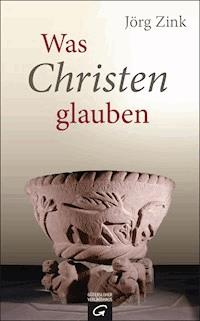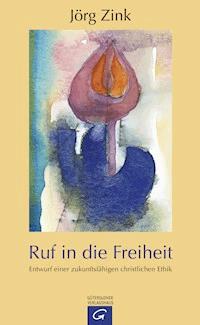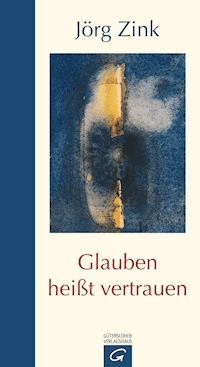7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kreuz Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Zwei große spirituelle Autoren über das, was verbindet: über die konfessionellen Grenzen hinaus stoßen sie zum Kern des christlichen Glaubens vor. Der Benediktiner Anselm Grün, geb. 1945, und de evangelische Pfarrer Jörg Zink, geb. 1922, zeigen Perspektiven eines gelingenden Miteinanders. Beide erreichen ein Millionenpublikum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Anselm Grün und Jörg Zink
Die Wahrheit macht uns zu Freunden
Wie Christen morgen miteinander leben wollen
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© KREUZ VERLAG
in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2009
www.herder.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Bergmoser & Höller Agentur, Aachen
Umschlagbild: Gudrun Bublitz, Stuttgart
Datenkonvertierung (E-Book): le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-7831-8206-4
ISBN (Buch) 978-3-7831-3365-3
Wir blicken zurück
Anselm Grün (AG): Es war wirklich ein Fest. Der erste Ökumenische Kirchentag ging 2003 seinen rauschenden Gang in den Straßen und den Kirchen von Berlin. Es war alles sehr neu. Was da erhofft und in die Welt gestellt wurde, war ungewohnt. Neu war vor allem die plötzliche Selbstverständlichkeit, mit der man empfand, man gehöre doch, trotz aller Unterschiede und Gegensätze, zusammen. Heute, da wir auf den zweiten, vielleicht den dritten oder vierten Kirchentag dieser gemeinsamen Art zugehen, lassen wir uns die Einsicht nicht mehr nehmen, wir Katholiken und Protestanten und sonstigen Christen gehörten in einer freien und dichten Freundschaft zusammen.
Jörg Zink (JZ): Viele gingen durch diese Tage wie durch einen Rausch. Der wurde freilich dann und wann ins Nüchterne und in die Realität heruntergeholt durch die handfeste Erkenntnis, es sei doch an manchen Stellen noch ein weiter Weg bis zu einem wirklich gemeinsamen Leben katholischer und evangelischer Christen.
AG: Wir haben aber beide das Beglückende an diesem Fest stärker erfahren als das gelegentlich Enttäuschende. Wir empfanden, es gebe so viel gemeinsam zu tun für die Menschen unserer Zeit und so viel neu zu fassen an der Lebensweise und den Gedanken in unserer Kirche, dass es sich wohl lohne, die Ärmel hochzukrempeln und gemeinsam anzufassen, was einen energischen Zugriff nötig habe. Um der Zukunft der Kirche willen, um der Kraft ihrer Hoffnung und des Heils der Menschen willen.
JZ: Was aber bei allen Gesprächen zwischen den Kirchen am Ende erreicht werden müsse, sei die Zuversicht, mit der die Menschen unseres Landes, die Menschen an der Basis der Kirchen, ihr Leben übernehmen, gestalten und durchstehen könnten, und der Mut, mit dem sie übernehmen könnten, was ihnen zugemutet ist an Nöten und Ängsten. Denn das ist – jedenfalls nach unserer Meinung – die vordringliche Aufgabe der Kirchen: den Menschen beistehen. Für sie eintreten. Ihnen zu sagen, was den Kern und Auftrag unseres Lebens ausmache, worauf alles hinauslaufe, was in diesen Zeiten getan und bewirkt werden könne und was die Wahrheit sei, von der wir leben.
Was uns dabei immer wieder auffiel, war der Eindruck, wir Christen, gleich welcher Couleur, kämen von viel zu viel her und gingen auf viel zu wenig zu. Wir lebten viel zu viel nach Plan und Vorschrift und wüssten viel zu wenig von offenen, noch nicht festgelegten Wegen. Wir türmten zu viel von oben auf die Erde und erstickten dabei, was aus der Erde wachsen will, aus dem lebendigen Wurzelwerk des Volkes Gottes. Wir achteten noch immer zu viel auf unsere Oberlehrer, Oberrichter und Oberherren und zu wenig auf die Freiheit der Töchter und Söhne Gottes.
AG: Wir beide zählen uns selbst mehr zur Basis der Kirchen als zu ihren Würdenträgern. Wir haben beide nie danach verlangt, irgendeine Führungsrolle in unseren Kirchen zu spielen. Kirchenpolitik ist nicht unsere Sache. Wir fühlen uns beide als schlichte Sprecher des Evangeliums. Wir haben auch nie danach gestrebt, als Wissenschaftler anerkannt zu sein. Wir haben uns beide von jeher – bei mir sind das nun 40 Jahre, bei dir 60 – als die kleinen Stimmen verstanden, durch die die »große Stimme«, wie Nikolaus von Cues sie nennt, die große Stimme Gottes nah bei den Menschen laut werden kann. Wir sahen es auch nie als unsere Aufgabe an, eine bestimmte Position zu vertreten, etwa eine katholische oder protestantische, und wir sprechen auch in diesem Buch nur eben von dem Evangelium, von dem jede Kirche reden wird, die weiß, was sie auf dieser Erde zu tun hat.
JZ: Das bedeutet, dass wir uns an keiner Stelle als Gegner verstehen. Wir sagen manches verschieden, aber wir sagen es in der Freundschaft, die uns verbindet, und in dem Wissen, dass wir beide der einen Kirche verpflichtet sind. Dieser Kirche in ihrer Farbigkeit und Vielfalt, die der »vielfarbigen Weisheit Gottes« entspringt, auch mit ihrer gelegentlichen Müdigkeit und ihrem Versagen, in der aber Feindlichkeit ein Fremdwort ist. Es liegt uns auch nichts daran, ob der eine oder andere von uns in Einzelfragen einen Sieg davonträgt. Wer noch über irgendjemand siegen will, kann – das ist eine der Grundwahrheiten, von denen das Evangelium spricht – für den Frieden nichts tun. Wer noch recht haben will, kann für die Wahrheit nichts mehr tun. Denn die Wahrheit ist immer größer als die Kenntnis irgendeines Menschen. Und wer noch Macht sucht, weckt kein Vertrauen.
AG: Wir haben verabredet, dass wir durch dieses Buch hin eine Grundlinie ziehen wollen, die in einem Gedankenaustausch, einem Dialog zwischen uns beiden besteht. Dass dazwischen immer wieder der eine oder der andere zu irgendeiner aufkommenden Frage einen längeren Essay beiträgt und dass wir manches auch gemeinsam formulieren. Wir stellen uns dabei vor, dass dieses Verfahren den lockeren Stil ergibt, wie er den Gruppen und Gemeinden, die sich zum Beispiel auf den zweiten Ökumenischen Kirchentag in München vorbereiten oder danach von ihm aus weiterdenken wollen, hilfreich sein kann. Niemand muss einfach übernehmen, was wir sagen. Aber vielleicht findet mancher zu seinem eigenen Nachdenken und seiner eigenen Klarheit durch dieses offene Verfahren, mit dem wir von unseren Hinweisen und Einfällen aus Schritt um Schritt weitergehen.
JZ: Und wenn wir uns an dieser oder jener Stelle irren sollten – das können wir niemals ausschließen –, so nehme der Leser dies als Anregung, es genauer und richtiger zu sagen. Denn es scheint uns, solange wir in dieser Welt leben, unverlierbar eigentümlich, dass wir alle irren, dass auch ganze Kirchen an irgendeinem wichtigen Punkt irren, wie auch die geistlichen Weisen und Lehrer in der Geschichte der Kirche, selbst wenn sie zu einem Konzil zusammengetreten sind, immer wussten, sie seien nicht nur von der Wahrheit geführt, sondern auch vom Irrtum begleitet wie von ihrem Schatten.
AG: Und das gewiss bis zu dem Augenblick, in dem uns alle in der anderen Welt das große Licht der Wahrheit empfangen wird.
JZ: Wir fangen also einfach einmal an, ohne genau zu wissen, wohin uns unser Weg am Ende weiterführen wird. Es ist üblich, sich vor solcher Zukunftsoffenheit zu fragen: Wo kämen wir hin, wenn das gelten sollte? Aber wo kämen wir denn wirklich hin, wenn jeder fragte: Wo kämen wir hin? – und niemand ginge hin, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge?
AG: Fangen wir an!
I Drei Liebeserklärungen
1 Anselm Grün: Ich liebe meine katholische Kirche
AG: Ich will mit einer Liebeserklärung beginnen. Wenn man wissen will, wie eine Familie zustande kommt, dann beginnt alles zu allererst mit der Entdeckung einer Liebe. Ich sage also zunächst nicht, ich liebte irgendeine künftige Kirche, von der ich noch nichts sehe, sondern ich liebe meine katholische Kirche. Sie ist mir nah und vertraut und heimatlich.
Ich liebe meine katholische Kirche mit ihrer reichen Tradition, mit ihrer geistlichen Überlieferung, wie sie mir im frühen Mönchtum und in den mystischen Strömungen einer Hildegard von Bingen, eines Meister Eckharts, einer Teresa von Avila und eines Johannes vom Kreuz begegnen. Ich bin dankbar, in diesen geistlichen Strom einzutauchen und daraus zu schöpfen. Und ich liebe meine katholische Kirche wegen ihrer Liturgie, in der ich mich von Kindheit an wohlgefühlt habe. Schon als Kind war ich fasziniert von den morgendlichen Rorateämtern in der Adventszeit und von der Liturgie der Karwoche und der Osternacht. Da hat mein kindliches Herz etwas erfasst, das ich auch heute noch spüre, wenn wir in der großen Abteikirche mit vielen Menschen, vor allem mit vielen jungen Menschen, die Osternacht feiern. Und ich liebe meine katholische Kirche mit ihren Sakramenten, die mich als Priester immer wieder beglückt haben, wenn ich mit den Menschen das Fest des Lebens feiern durfte.
Ich liebe meine katholische Kirche wegen ihrer »Katholizität«, das heißt ihrer umfassenden Weite. Sie hat schon in den ersten Jahrhunderten bewiesen, dass sie fähig war, die religiösen Sehnsüchte der Menschen, die sie damals in ihren Religionen ausgedrückt haben, aufzugreifen und zu verchristlichen. Das, was uns Karl Barth manchmal vorgeworfen hat, dass wir zu viel Religion und zu wenig Glauben hätten, halte ich gerade für einen Reichtum, der mich weit macht und frei und mich mit allen Menschen in ihrer religiösen Sehnsucht verbindet.
Für mich ist die katholische Kirche meine Heimat. Dieses Heimatgefühl hatte ich immer wieder, wenn ich in Kenia oder in Argentinien, in Brasilien oder Mexiko, in Taiwan oder Korea mit den Menschen Eucharistie gefeiert habe. Sobald wir miteinander beten und Eucharistie feiern, entsteht eine Gemeinschaft, die die Grenzen der Völker aufhebt. Und so fühle ich mich überall auf der Erde daheim, wo Eucharistie gefeiert wird.
Ich liebe meine katholische Kirche auch wegen ihrer Versuche, um die rechten Formulierungen zu ringen, den Glauben an Jesus Christus für uns heute angemessen auszudrücken. Manchmal sieht das umgekehrte Bemühen, nämlich die Kontinuität der verschiedenen Aussagen darzulegen, etwas naiv aus. Aber ich spüre darin die Ehrfurcht vor den Formulierungen früherer Zeiten. Sie legen uns nicht fest, sondern fordern uns heraus, immer wieder neu unseren Glauben zu bedenken und ihn so zu formulieren, dass er die Menschen heute anspricht. Dabei hat die Kirche immer den Dialog mit der jeweiligen Philosophie geführt. Ich versuche, diesen Dialog weiterzuführen, indem ich vor allem das Gespräch mit der Psychologie suche, die heute die Philosophie in ihrer Bedeutung für das Denken der Menschen abgelöst hat.
Natürlich leide ich manchmal auch an meiner Kirche, an ihrer Enge, an den Machtstrukturen, an ihrer Unbeweglichkeit. Aber da ich immer um meine eigene Begrenztheit weiß, verspüre ich wenig Lust, die Bischöfe oder den Papst anzuprangern. Die Schwäche gehört wesentlich zur Kirche. Wir leben nicht in einer vollkommenen Kirche, sondern in einer Kirche von Menschen. Und dennoch dürfen wir dankbar sein für die Kirche als den Ort, an dem uns Jesus Christus mit seinem Geist erfüllt. In diesem Wissen um die Schwäche der Kirche bin ich dankbar für viele evangelische Freunde, die mit mir gemeinsam darum ringen, den Glauben heute in einer Weise zu verkünden, die die Herzen der Menschen berührt und in der der Geist Jesu heute wirksam wird.
2 Jörg Zink: Ich liebe meine evangelische Kirche
JZ: Ich möchte Ähnliches auf meine Weise sagen. Ja, ich liebe meine evangelische Kirche. Nicht ganz so, wie ich meine Frau geliebt habe, als sie ein junges Mädchen war, auch nicht ganz so, wie ich sie liebe, da sie nach 60 Jahren gemeinsamen Lebens zu einer gütigen und weisen alten Frau geworden ist. Anders. Aber ich liebe meine Kirche so, wie einer das Haus liebt, in dem er ein Kind war, wie er ein Land liebt, in dem sich sein Leben abgespielt hat, oder eine Heimat, deren Wanderwege er oft und oft unter den Füßen hatte und deren Eigenart ihm vertraut ist.
Ich liebe meine evangelische Kirche, obwohl an den entscheidenden Punkten meines Lebens immer wieder auch ein Katholik seine wichtigen Spuren hinterlassen hat. Ein Mann der französischen Widerstandsbewegung: ein katholischer Priester, der mir das Profil eines vertrauenden Christen in einer schrecklichen Extremsituation vor Augen gestellt hat. Oder Romano Guardini, mein wichtigster Lehrer, der mich durch einen langen Krieg hin geistig begleitet und mich später tief geprägt hat. Oder eine Base, die Generaloberin einer Dominikanerinnenkongregation war und mit der ich viele wichtige Gespräche in tiefer Verbundenheit geführt habe.
Ich liebe meine Kirche in der Schlichtheit ihrer Erscheinung, ihrer Offenheit, ihrer Freiheit und Suche nach der genauen Wahrheit, die für unsere Zeit gilt. Ich liebe sie nach den 60 Jahren, die ich nun für sie lebe und arbeite, und stehe gerne auch zu ihren inneren und äußeren Gefährdungen, Fehlern und Schwächen. Und ich liebe die vielen Menschen in ihr, deren Freundschaft und Nähe mich bis heute begleiten.
Ich liebe ihre Offenheit und Verletzbarkeit, ihren vom Anfang ihres Werdens im 16. Jahrhundert ihr wesenseigenen Verzicht auf äußere Herrschaft. Ich liebe sie als das, was sie im Grunde einzig beansprucht zu sein, nämlich, wie schon gesagt, die kleine Stimme auf dieser Erde, die die große Stimme Gottes nachspricht, die einzig ein Hinweis auf den armen Mann von Nazareth sein will, dem sie als ihren Herrn und Erlöser zu dienen versucht. Ein Hinweis auf die souveräne Gnade und Liebe Gottes, die ihr allein aus der Heiligen Schrift zugesprochen wird. Ein Hinweis auf den Glauben, der von uns gefordert ist, und auch das Vertrauen, das wir dem kommenden Reich Gottes entgegentragen. Ein Hinweis endlich auf den lebendigen Geist Gottes, der in den einzelnen Christen wie auch in ihren Versammlungen sein Leben schaffendes Werk tut.
Das alles freilich kann mich nicht daran hindern, mich in der katholischen Gemeinschaft zu bewegen wie unter Schwestern und Brüdern und mich zu freuen an jedem Zeichen, das mir an den evangelischen Merkmalen der Kirche von dort herüber begegnet. Und ich bin dankbar dafür, dass ich den Geist dieser Freiheit im Lauf meines langen Lebens auch in der katholischen Kirche immer wieder beglückend erfahren habe.
3Wir lieben, was uns verbindet, aber auch viel, was uns unterscheidet
AG: Ich liebe auch alles, was mich aus dem Leben der evangelischen Kirche anrührt. Was mich überzeugt. Was groß und wahr an ihr ist, schön oder stark oder wesentlich. Was uns an ihr den gemeinsamen Weg zeigt, was durch sie mir ein Verstehen eröffnet hat. Gewiss, wir lieben das Besondere an unserer eigenen Kirche. Aber das ist nicht alles. Viel verbindet uns. Im Grunde mehr als uns trennt. Und wir wären Toren, wenn wir immer nur anstarren wollten, was uns falsch erscheint an der anderen Kirche oder der anderen Glaubensweise. Warum soll ein Katholik nicht seinen Glauben mit anderen Empfindungen leben dürfen als ein Protestant? Warum sollte ein Protestant von der Freiheit und der Genauigkeit seines Nachdenkens nicht etwas anderes an Hilfe für sein Leben erwarten als ein Katholik? Warum sollte die Jahrtausende alte Rechthaberei unter den Christen immer den einen vom anderen, und das für Zeit und Ewigkeit, abschotten?
JZ: Ja, warum? Die Besonderheit eines Glaubens ist niemals die ganze Wahrheit. Das Ganze ist eine breite Gemeinsamkeit, der entlang zu denken mindestens ebenso wichtig sein wird, wie die Fahne der eigenen Wahrheit an der Stange aufzuziehen. Es ist unter Menschen immer so gewesen, dass irgendeiner eine Wahrheit ausgerufen hat – ich meine nicht eine angebliche, sondern eine wirkliche –, dass er aber dabei blind wurde für die Wahrheit, die ein anderer sah. Ich habe schon als Kind im grünen Allgäu die Flurbegehungen der katholischen Gemeinde gesehen und mich gefragt: Warum gibt es das bei uns nicht? Ich sehe die Marienandachten katholischer Frauen und frage mich, warum denn Gott, evangelisch gesehen, so einseitig männlich vorgestellt werde, was er, wenn er wirklich Gott ist, ganz gewiss nicht sein kann? Katholische Kinder gehen von Haus zu Haus und malen ihr C+M+B an die Türen. Ich meine nicht, ich persönlich müsste in der Fülle dieser Sitten mitleben. Aber ich finde es schön, wenn ich es sehe. Und ich mache ihnen Mut, ihren Gang von Haus zu Haus weiterzugehen.
Ich liebe aber auch alles, was uns verbindet. Was uns in unserem Land geprägt hat. Die christlichen Überlieferungen, die Kirchen, die in jedem Dorf mitten inne stehen, die Überlieferungen des christlichen Kalenders, seine Feste und Begehungen. Die christlichen Schriften von Denkern und Dichtern, die christliche Kunst in unserem Land aus 1000 Jahren, die Zeugnisse der christlichen Geschichte, der Länder und der Städte. Die Musik, die von der christlichen Überlieferung redet, nicht nur von Bach, sondern auch die vielen Lieder, die uns zwischen evangelisch und katholisch gemeinsam sind; die Wegzeichen, die Friedhöfe, aber auch die Wissenschaft, die liturgischen Spielformen des Glaubens, die Bekenntnisse, die vielen überzeugenden Christen unter den Menschen unseres Landes und seiner Geschichte. Die ganze geistige Welt, in der der christliche Glaube zu Hause ist, seine Riten und Symbole, seine Bilder und Geschichten. Seine Weltdeutung und seinen Gedankenreichtum. Die lange Galerie seiner Heiligen und Weisen und seiner Zeugen.
AG: Es geht mir ähnlich. Ich liebe zum Beispiel, was du noch nicht genannt hast, die Quelle der Wahrheit, die uns gegeben und gemeinsam ist: die Heilige Schrift. Unzählige katholische und evangelische Ausleger bemühen sich gemeinsam, den Reichtum der Schrift für uns heute zu entdecken. Und viele Theologen und Prediger in beiden Kirchen versuchen, uns die Schrift in Predigten und Meditationen so auszulegen, dass die Worte Jesu unser Herz berühren. Ich habe viel von deinen Bibelauslegungen profitiert. Ich habe gerne dein Jesusbuch gelesen und mir von deiner Sicht die Augen öffnen lassen für Aspekte Jesu, die ich bisher nicht so deutlich gesehen habe. Ich selber versuche auch immer wieder, die Bibel im Dialog mit heutiger Psychologie so auszulegen, dass die Menschen die Weisheit erkennen, die uns Gott in der Bibel geschenkt hat. Die Bibel ist und bleibt für mich die eigentliche Quelle, aus der ich schöpfe. Und es ist für mich immer wieder spannend, die Bibel in Gruppen zu meditieren, weil mir die Menschen mit ihren Sichtweisen immer wieder Aspekte des biblischen Textes aufzeigen, die mir bisher verborgen waren.
Was uns verbindet, ist die Kirchenmusik. Ich liebe die Bachkantaten und höre mir jeden Sonntag die zum Sonntag passende an. Ich liebe aber auch Mozart, seine weltliche und seine geistliche Musik. Die Musik überwindet die konfessionellen Grenzen. Sie öffnet allen das Herz für den unbegreiflichen Gott, der mir in der Musik aber immer als der Gott der Liebe begegnet. Ob es Heinrich Schütz, Friedrich Händel oder Philipp Telemann auf evangelischer Seite oder Anton Bruckner, Antonio Vivaldi oder Oliver Messiaen auf katholischer Seite sind, sie gehören uns allen. Und sie verkünden uns allen die Schönheit und Liebe Gottes.
Uns verbinden auch viele Lieder, die wir im Gottesdienst singen. Als ich die Weihnachtslieder meditierte und ihre Geschichte studierte, freute ich mich, wie schon seit dem 16. Jahrhundert die einstmals typisch evangelischen oder katholischen Lieder die Konfessionsgrenzen überwanden. Wenn ein Lied das Herz bewegt, dann lässt es sich nicht mehr nur einer Konfession zuschreiben. Dann will es allen gehören. Ich freue mich auch an typisch protestantischen Liedern. Wenn ich an einem protestantischen Gottesdienst teilnehme, dann stimme ich gerne in die alten Choräle ein. Auf der anderen Seite liebe ich den gregorianischen Choral, weil er die biblischen Worte in einer Weise meditiert, vor der ich immer wieder staune. Und ich kenne viele evangelische Christen, die heute vom gregorianischen Choral genauso fasziniert sind.
Ich liebe die Rituale, die wir in den katholischen Gottesdiensten feiern und die heute auch oft genug in der evangelischen Liturgie übernommen werden. Und ich liebe die Rituale, die evangelische Pfarrer und vor allem Pfarrerinnen neu entwickeln, etwa Salbungs- oder Segensrituale. Da spüre ich, dass wir voneinander lernen und auch in einen guten Wettstreit treten können, damit wir die Menschen in ihrer Sehnsucht erreichen und ansprechen.
JZ: Ich finde es nicht schwierig, dass du in vielem anders denkst als ich und dass du dein ganz andersartiges Leben lebst, sondern ich finde es schön und lebendig, ich sehe es als Reichtum, was sich danach in der Freiheit unseres gemeinsamen Weges ausdrückt.
AG: Wir lieben, was uns verbindet. Was sich uns schwer erschließt, das lassen wir gelten. Wir respektieren es, wir lassen es offen. Wir wissen nur zu genau, dass es die einheitliche und einzige Wahrheit in unserer Menschenwelt nie gegeben hat. Die Wahrheit ist Gott allein. Wir erwischen immer nur einen Zipfel von ihr, solange wir mit unserem kleinen Verstand in dieser Welt stehen. Was uns ungenau bleibt, können wir immer noch lieben. Und wenn wir freundschaftlich genug miteinander reden, kann uns viel davon neu und lebendig aufgehen.
JZ: Ob unsere Zielvorstellungen gleich sind, ob wir auf die eine globale Riesenkirche zugehen wollen oder auf eine Familie von vielen verschiedenen Kirchen, mag zunächst offen bleiben. In keinem Fall geht es um Gleichschaltung oder Uniformierung.
Gleichheit war noch nie ein Merkmal einer lebendigen Kirche. Seit ich selbst mit zwölf Jahren die Uniform eines Hitlerjungen trug, habe ich ein Bild vor Augen, das mich schon damals erschreckt hat: Hitlers Reichsparteitage. Ich sah, wie Zehntausende in breiten braunen Marschkolonnen, im hämmernden Gleichschritt, unter immer den gleichen Fahnen, mit immer den gleichen hämmernden Liedern in der dröhnenden Brust am »Führer« vorbeizogen. Nein und noch einmal nein. Die Kirche hat keinen »Führer« außer dem einen Herrn, dem Bruder Jesus, und wer seinen Weg mit ihm geht, trägt keine Uniform. Die Kirche löscht den Geist des Menschen nicht aus, nicht seine Fantasie, nicht seine Gestaltungskraft, nicht sein Gewissen und nicht seinen Glauben. Sie hütet vielmehr auf ihre stille Weise seine Freiheit. Sie hat viele Farben und viele Gestalten. Sie ist von Herzen zivil.
Die Bibel würde in ihrer bilderreichen Sprache sagen: Die Kirche ist ein Garten. Gott setzte den Menschen in einen Garten, und diesen Garten soll er bauen und bewahren. Der Mensch ist ein Stück Land, sagt Jesus, ein Boden, aus dem etwas wachsen soll. »Du wirst sein wie ein wasserreicher Garten«, sagt Jeremia. Du darfst blühen und reifen und Frucht tragen für die Menschen dieser Erde. Nach meiner Vorstellung ist die Kirche ein Garten, der ohne Zaun und Mauer ins offene Land übergeht. Was wäre das für ein Garten, in dem zwischen jedem Krautkopf und seinem Nachbarn eine Mauer stünde, oder zwischen jedem Beet und dem nächsten eine Wand mit einer Tür mit Sicherheitsschloss und Sicherheitsbeamten?
In einem Garten gibt es nicht nur Salate, sondern auch Erdbeeren und Rosenstöcke. Auf der weiten von Gott geschaffenen Erde gibt es nicht nur die Zedern des Libanon, sondern auch die Tannen des Schwarzwalds und die Dattelpalmen am Persischen Golf. Die aber wollen wir nicht vereinheitlichen, sondern bewahren. Es muss in Südamerika nicht so gelebt und gedacht werden wie in Berlin. Die Kirche darf so vielgestaltig sein, wie die Menschen sind. Ihre Freiheit ist das Geheimnis ihrer schöpferischen Kraft, und wer sie eingrenzen will, bringt sie in die Gefahr der Erstarrung. Paulus spricht einmal von der »vielfarbigen Weisheit Gottes«. Nein, ich finde es schön, dass es außer Katholiken und Protestanten Quäker gibt und Orthodoxe und Pietisten, wenn sie einander gelten lassen. Als Gott die Kirche ins Leben rief, wollte er offenbar eine Gemeinschaft von verschiedenartigen Menschen, die sich miteinander freuen können, miteinander leiden, füreinander sorgen, miteinander nachdenken, miteinander wirken, erfinden und erproben. Gerade indem sie verschieden sind und verschieden ihren Glauben leben, sind sie miteinander eine lebendige, eine schöne, eine liebenswerte Kirche.
Darin sieht Augustin die Vielfalt und die Einheit der Kirche:
»Miteinander reden und lachen
sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen
zusammen schöne Bücher lesen
sich necken
dabei aber auch einander sich Achtung erweisen
mitunter sich auch streiten ohne Hass
so wie man das wohl einmal mit sich selbst tut
manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen
und damit die Eintracht würzen
einander belehren
und voneinander lernen
lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe
die aus dem Herzen kommen
sich äußern in Miene und Wort
und tausend freundlichen Gesten
den Geist in Gemeinsamkeit entflammen
so dass aus den Vielen eine Einheit wird.«
(Augustinus, Confessiones 4,8,13)
II Auf dieser Basis wollen wir miteinander reden
4 Ein Ökumenischer Kirchentag ist ein Gespräch
AG: Ich kann mich an wunderbare Gespräche mit evangelischen Theologen erinnern, in denen ich viel von evangelischer Frömmigkeit und Theologie gelernt habe. Und zugleich habe ich mich gefreut, dass die evangelischen Partner aufmerksam und neugierig auf meine Gedanken zur katholischen Spiritualität gehört haben. Sie waren offen. Wir wollten voneinander lernen. Es war eine große Achtung. Und wir spürten, dass wir uns in unserer Spiritualität und in dem, was uns trägt, sehr nahe sind. Jeder beschreibt seine Erfahrung mit anderen Worten. Es gibt bestimmte katholische und evangelische Sprachspiele und Redewendungen. Im Gespräch verloren diese Redewendungen für den andern an Fremdheit. Wir versuchten zu verstehen, warum man mit diesen Worten seine Beziehung zu Jesus Christus ausdrückte.
JZ: Was in dieser geschichtlichen Stunde nötig ist, ist, dass zwischen Kirchen und Konfessionen das jahrhundertealte Hickhack aufhört und ein Gespräch stattfindet, wie es vor einigen Jahrzehnten begonnen hat. Ein Gespräch, das für ein freies Nachdenken Spielraum lässt. AG: Dabei wird jeder das Recht haben, die Atmosphäre zu schützen, in der er sich zu Hause fühlt. Das Recht auf seine besonderen Meinungen, auf seine Einseitigkeiten, das Recht auf sein Sicherheitsbedürfnis. Das Recht auf seine persönliche Lebensgeschichte.
JZ: Wir müssen, meine ich, noch sagen, was wir eigentlich mit diesem Gespräch bewirken wollen. Auf alle Fälle treten wir hier nicht an, um viele Einzelfragen zu bearbeiten und viele Einzelprobleme zu lösen. Das wird viel besser auf den Ökumenischen Kirchentagen selbst geschehen können. Aber wir wollen hier dazu helfen, dass dieses Gespräch stattfinden und Sinn haben kann.
AG: Als ich mir vornahm, in dieses Gespräch einzutreten, ging mir auf, wie ich trotz aller Liebe zu den Brüdern und Schwestern in anderen Konfessionen doch noch meine Vorurteile in mir habe. Auch wenn ich weiß, dass heute keine Kirche sich über die Fehler und Schwächen der anderen freuen sollte, weil wir alle in einem Boot sitzen, kenne ich doch auch in mir noch Spuren solchen Vereinsdenkens. So wie ein Fußballverein sich über die Niederlage des anderen freut, gibt es auch in mir solche Gedanken: Wir Katholiken sind doch besser als die Protestanten! Oder ich spüre, dass ich trotz allen Strebens, objektiv zu denken, immer noch meine subjektiven Vorurteile habe. Oder ich habe meine empfindlichen Stellen, an denen ich nicht fähig bin, mich gut und offen auf ein Gespräch einzulassen. Es gehört zur Gesprächsbereitschaft, sich diese Schattenseiten einzugestehen.
JZ: Wenn wir unser eigenes Sprechen und unsere unbewussten Vorurteile und Ängste anschauen, dann wird unser Gespräch bescheidener, offener, ehrlicher und zugleich hoffnungsvoller und liebevoller. Indem wir so miteinander reden, erfahren wir zugleich, was eigentlich ein Gespräch unter Christen ausmacht: Wir erfahren uns als Gemeinschaft von Hörenden. Wir hören aus dem Wort des anderen immer auch das Wort Christi heraus. Und wir versuchen, aus dem Geist Jesu heraus zu sprechen und nicht aus unserem so leicht kränkbaren Ego. Die Einheit der Kirche kann man nicht einfach verordnen, aber wir können sie erfahren, wenn wir miteinander im Geist Jesu sprechen.
AG: In dem Gedicht »Friedensfeier« hat Friedrich Hölderlin die wunderbaren Verse geformt:
»Viel hat erfahren der Mensch.
Der Himmlischen viele genannt,
Seit ein Gespräch wir sind
Und hören können voneinander.«
Wenn wir also nicht nur ein Gespräch führen, sondern ein Gespräch sind, dann erfahren wir viel über das Geheimnis des Menschen und über das Geheimnis der Himmlischen, über das Geheimnis Gottes. Dann geht uns etwas auf von der Wahrheit des Menschen und von der Wahrheit Gottes. Doch Voraussetzung, dass wir zum Gespräch werden, ist, dass wir nicht nur aufeinander, sondern voneinander hören. Ich höre vom andern, was er zu sagen hat. Ich nehme mir von ihm etwas. Für Hölderlin ist es eine Kunst, voneinander hören zu können. Im Hören voneinander haben wir teil an der Herkunft des andern, an seiner Geschichte, an dem, was er an Erfahrungen gemacht hat.
JZ: Wir lassen also den andern in unser Herz schauen. Wir brechen uns auf, damit wir aufgebrochen werden für das Größere, das uns miteinander verbinden will.
Denn der Sinn eines Gesprächs besteht ja nicht darin, dass wir einander mitteilen, was wir denken und bei was wir zu bleiben wünschen, sondern darin, dass wir einander verändern und uns voneinander verändern lassen. Viele sind schon ausgezogen, die Verhältnisse zu ändern, und blieben ohne Erfolg, weil sie versäumten, dabei sich selbst mitzuverändern. Daraus könnte man Regeln entwickeln. Zum Beispiel eine erste, die so lautet:
Regel 1: Ich muss den anderen sehen, wie er ist. Ich verzichte auf Schlagworte und Feindbilder. Ich gewähre ihm so viel freundliche Zuwendung, dass ich ihn wahrnehme.
Regel 2: Ich bin bereit, mich selbst zur Disposition zu stellen. Ich bin bereit, mich mit ihm zusammen zu ändern, solange noch nicht gestritten wird und ich noch »mit ihm auf dem Wege« bin. Jeder mag etwas anderes zu ändern haben, aber ändern müssen sich beide.
Regel 3: Der Anspruch, der andere solle sich ändern, ist Gewaltanwendung, wenn ich ihm nicht die Möglichkeit gebe, auch mich zu ändern.
Regel 4: Ich möchte dem anderen helfen, sich und mich zugleich zu ändern. Das ist nur möglich, wenn er sich nicht vor mir fürchtet. Er kann sich sonst einem Weg, den ich ihm zeige, nicht anvertrauen. Ich selbst aber muss mich meinerseits davor hüten, ihn zu fürchten. Angriff heißt immer auch Verhärtung des Gegners. Und Rechthaberei ist immer auch Produktion von Widerstand.
Regel 5: Ich möchte dem anderen helfen, sich und mich zugleich zu ändern. Ich werde also versuchen, ihn genau zu verstehen, und werde ihm deutlich machen, dass ich ihn verstanden habe. Fühlt er sich von mir nicht verstanden, so kann er seine bisherigen Meinungen nicht ablegen, und er kann meine Gedanken und Meinungen nicht für besser halten als seine eigenen.
Regel 6: Wenn ich dem anderen helfen will, sich und mich zu ändern, dann muss ich ihm kleine Schritte gestatten. Eine Totalumkehr in fünf Minuten kann einmal geschehen, aber sie ist selten und nicht ohne Gefahr. Im Normalfall vollzieht sich eine Änderung des Klimas zwischen Menschen oder die Änderung einer Überzeugung in langen Zeiträumen. Aber ich bleibe vor der Ungeduld des Erfolglosen nur bewahrt, wenn ich auch mir selbst kleine Schritte gestatte.
Regel 7: Ich möchte dem anderen helfen, sich und mich zu ändern. Dann aber muss ich ihm den Weg zum Einvernehmen auch dann offenhalten, wenn er in seiner Ablehnung verharrt. Ich darf nicht beleidigt sein, wenn er meine Vorschläge ablehnt. Ich darf das Gespräch nicht abreißen lassen. Wie sonst soll er darauf vertrauen, dass der Weg, den ich ihm zeige, ernsthaft ein Weg auch für seine Zukunft ist, mindestens für sein Verstehen?
Wir sollten, meine ich, solche Regeln, die für uns einzelne Menschen gelten, endlich auch für die große Politik entdecken. Denn alle politische Arbeit ist ein Umgang mit Menschen. Und es könnte sein, dass auch politische Absichten deshalb fehlschlagen, weil man auf die Regeln nicht geachtet hat, nach denen Menschen einander gegenseitig ändern können.
Dazu kommt unter Christen aber noch etwas ganz Entscheidendes. Wir sagen mit Paulus: Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jeder, der mit einem anderen Christen spricht, wird also davon ausgehen, dass in seinem Gegenüber Christus anwesend ist. Oder Gott. Wie immer man die Nähe und Gegenwart Gottes in den Menschen beschreiben will. Die Weise, wie ein interkonfessionelles Gespräch abläuft, ist entweder von dieser geistlichen Tatsache geprägt oder es geht an seinem Thema vorbei.
Das aber bedeutet, dass bei jedem Redewechsel der eine in das Heiligtum eintritt, das der andere ist, das Christusheiligtum in ihm.
AG: Das drückst du sehr schön aus. Im Gespräch treten wir in das Heiligtum des anderen ein. Der heilige Benedikt spricht davon, dass wir im Gespräch genau hinhorchen sollen, ob nicht Christus selber durch den Bruder oder die Schwester spricht. Es geht nicht um die theologischen Argumente, sondern um die geistliche Dimension des Gesprächs. Und die besteht darin, dass Christus selber durch uns spricht. Denn sein Geist ist in jedem von uns. Hans Urs von Balthasar hat das Geheimnis des Gespräches, das um die Wahrheit ringt, so formuliert: »Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt ändere.« Wenn ich auf meinem Standpunkt beharre, bleibe ich bei mir stehen, aber das weite Land der Wahrheit bleibt mir verschlossen. So wünsche ich uns, dass wir im ökumenischen Gespräch immer wieder bereit sind, den eigenen Standpunkt zu ändern, um gemeinsam in das Land der Wahrheit einzutreten, das größer ist als unser jeweiliges Denken und Glauben.
JZ: Es ist wirklich nicht zu übersehen: Ein Schritt ist fällig. Ein Schritt hinaus. Lange genug haben wir in den wohlverschlossenen Gehäusen unserer Konfessionen gelebt. Lange genug waren wir auf allen Seiten überzeugt, bei uns sei die Wahrheit zu Hause, bei allen anderen der Irrtum, die Irrlehre oder die Irreführung. Lange genug waren wir den Gesetzen unserer jeweiligen zufälligen Herkunft gehorsam. Lange genug haben wir sie verinnerlicht, die Trennlinien, die Unterscheidungen, die Abgrenzungen. Nein, ich muss gestehen, dass ich die Rechthaberei der Gruppen und Grüppchen, der großen und der kleinen Kirchen von Herzen satt habe. Mich interessiert, was uns gemeinsam ist. Ich suche nach der geistlichen Wirklichkeit, die wir den »Leib Christi« nennen, die verborgene Wirklichkeit der einen Kirche hinter all ihrem Glanz und Elend. Ich bin überzeugt: Wenn wir wollen, können wir eine, die eine Kirche sein. Wie das zu erreichen ist, darüber müssen wir reden. Dass es fällig ist, darüber müssen wir nicht mehr reden. Es ist überdeutlich.
5 Es geht dabei nicht um Meinungen, sondern um die Wahrheit. Aber wer hat die Wahrheit?
JZ: Jede Religion ist der Überzeugung, was sie aussage, sei die Wahrheit. Natürlich. So kommt es wie selbstverständlich zu dem Streit um die Wahrheit, der das eifersüchtige Gegeneinander der Religionen der Erde wie ihr Schatten begleitet. Wir haben die großen Propheten, die uns die reine Wahrheit vermitteln, sagt die eine. Wir haben die Instanz, die zuständig ist für die Verwaltung der Wahrheit, sagt die andere. Wir haben die Heilige Schrift, die Upanischaden, den Tao te King, den Koran, die Bibel, und das heißt, wir haben die Wahrheit.
Was ist denn Wahrheit? Wahrheit ist nicht eine Sammlung richtiger Lehrsätze. Wenn Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit, dann heißt das: Die Wahrheit ist Gott selbst, repräsentiert durch mich. Heißt das aber nicht, dass keine Kirche den Anspruch erheben kann, die Wahrheit zu besitzen. Wer kann denn Gott besitzen?
Wie kommt denn ein Mensch an die Wahrheit? Der Anfang einer Begegnung eines Menschen mit der Wahrheit kann in irgendeiner Erfahrung liegen. Er liest etwas in einer heiligen Schrift. Er hört das Wort eines Menschen. Er erfährt Gottes Anrede auf irgendeine Weise. Auf eine sinnliche, eine übersinnliche, eine innere. Wie immer. Aber was er danach in der Hand hat, ist nicht die Wahrheit, sondern die Erinnerung an eine Erfahrung der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht sein Besitz. Er hat sie geschaut und er bewahrt, was er geschaut hat. Er bewahrt eine Erfahrung von Wahrheit.
Diese Erfahrung will gedeutet, sie will verstanden werden. Sie will so gefasst werden, dass sie weitergesagt werden kann. Sie muss sich herabstufen in die übrige Erfahrungswelt des Hörenden. Sie muss herabgedeutet werden bis zu den vielleicht bescheidenen Verstehensmöglichkeiten, über die der Mensch verfügt, der sie empfangen hat.
Noch einmal: Ein Mensch, nehmen wir an, macht die erregende oder beglückende Erfahrung, dass Gott zu ihm sprach. Wenn er dieser Erfahrung nun nachgeht, so wird er versuchen, für die Botschaft, die er empfangen hat, eine Deutung zu finden. Dass er danach unterscheidet zwischen seiner Erfahrung und seiner Deutung, ist der Anfang seines Weges zum wirklichen Geschehen.
Alle Deutungen solcher Erfahrungen aber sind gefärbt von der kulturellen Tradition, innerhalb deren ein Mensch seine Erfahrungen macht. Alle haben sie teil an den Entwicklungen, Veränderungen und Umschichtungen, die