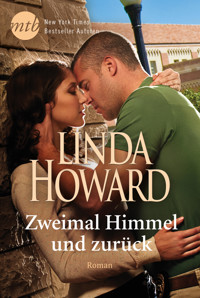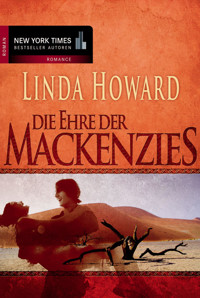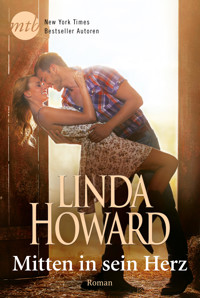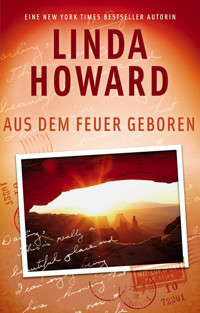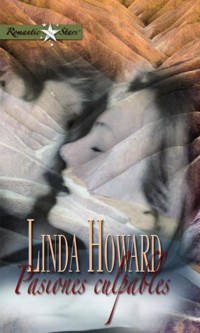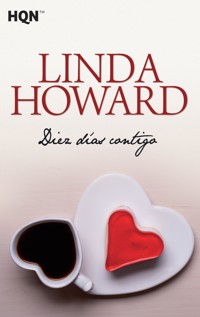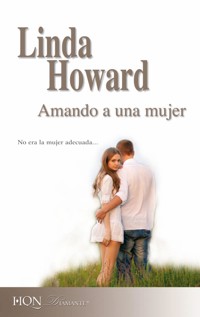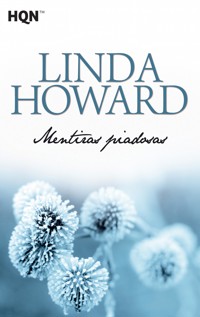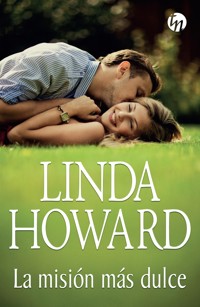5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Ein sagenumwobener Schatz und eine leidenschaftliche Suche am Amazonas.
Jillian Sherwood ist Archäologin - eine sehr gute sogar. Als sie in den Aufzeichnungen ihres verstorbenen Vaters einen Hinweis darauf findet, dass er kurz vor seinem Tod beinahe den sagenumwobenen roten Diamanten gefunden hätte, steht ihr Entschluss fest: Die attraktive junge Frau macht sich kurzerhand auf eine gefährliche Reise in den Dschungel, um das Werk ihres Vaters zu vollenden. Doch dabei ist sie nicht allein. Ihr Bruder, der immer wieder in dubiose Machenschaften gerät, begleitet sie und bringt als Verstärkung einige zwielichtige Gestalten mit. Und dann ist da noch Ben Lewis, ein Abenteurer mit zweifelhaftem Ruf, der Jillian als Führer zur Seite steht. Obwohl zwischen ihnen gewaltig die Fetzen fliegen, können sie sich schon bald nicht mehr gegen das heiße Knistern wehren ...
Erstmals als eBook erhältlich. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Die Doppelgängerin", "Mitternachtsmorde", "Heiße Spur".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Mitternachtsmorde
Über dieses Buch
Jillian Sherwood ist Archäologin – eine sehr gute sogar. Als sie in den Aufzeichnungen ihres verstorbenen Vaters einen Hinweis darauf findet, dass er kurz vor seinem Tod beinahe den sagenumwobenen roten Diamanten gefunden hätte, steht ihr Entschluss fest: Die attraktive junge Frau macht sich kurzerhand auf eine gefährliche Reise in den Dschungel, um das Werk ihres Vaters zu vollenden. Doch dabei ist sie nicht allein. Ihr Bruder, der immer wieder in dubiose Machenschaften gerät, begleitet sie und bringt als Verstärkung einige zwielichtige Gestalten mit. Und dann ist da noch Ben Lewis, ein Abenteurer mit zweifelhaftem Ruf, der Jillian als Führer zur Seite steht. Obwohl zwischen ihnen gewaltig die Fetzen fliegen, können sie sich schon bald nicht mehr gegen das heiße Knistern wehren …
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Ein gefährlicher Liebhaber
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1993 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Heart of Fire«
Originalverlag: Pocket Books, New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2004 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Wilhelm Goldmann Verlag, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © gettyimages: Sean Pavone; © iStock: 1001nights
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6969-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
»Wer is’n das da, Papa?« Jillians kleiner Zeigefinger tippte hartnäckig auf ein Bild in dem Buch, das ihr Vater aufgeschlagen hatte. Sie saß, wie so oft, bei ihm auf dem Schoß, und obwohl sie erst fünf war, liebte sie Geschichten über alte Kulturen und fremde Länder über alles, eigentlich schon, seit sie denken konnte.
»Das ist eine Amazone.«
»Un’ wie heißt sie?« Jillian konnte sehen, dass das dort auf dem Bild eine Frau war. Als sie noch kleiner war, war sie immer durcheinandergekommen, weil sie gedacht hatte, dass nur Frauen lange Haare haben. Aber auf den Bildern in Papas Büchern hatten auch die meisten Männer lange Haare. Doch inzwischen hatte sie einen verlässlicheren Unterschied gefunden: die Brust nämlich. Männer und Frauen sahen da anders aus.
»Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht einmal, ob sie wirklich gelebt hat. Keiner weiß das.«
»Dann is’ sie also erfunden?«
»Möglich.« Cyrus Sherwood streichelte sanft über den Kopf seiner Tochter, fuhr mit der Hand unter ihre dicken, seidigen dunklen Haare, hob sie ein wenig an und ließ sie wieder zurückfallen. Dieses Kind war ihm ein beständiger Quell der Freude. Er wusste, dass es falsch war, ein Kind dem anderen vorzuziehen, aber sie war so außergewöhnlich; ihr Verständnis des Abstrakten ging weit über ihr Alter hinaus. Sie liebte seine Archäologiebände. Eine seiner schönsten Erinnerungen war die, als Jillian mit gerade drei Jahren einen seiner Wälzer hervorzerrte, der sicher fast so viel gewogen hatte wie sie, und wie sie dann den ganzen Nachmittag auf dem Teppichboden gelegen und vollkommen entrückt in dem Buch geblättert hatte. Dieses Kind besaß sowohl kindliche Unschuld als auch eine verblüffend stark ausgeprägte Logik. Nein, seine Süße war alles andere als ein Wirrkopf. Und wenn ihr wesentlichster Charakterzug Pragmatismus war, so war der zweite Sturheit. O ja, er konnte sich gut vorstellen, dass seine geliebte Tochter später mal ein harter Brocken für irgendeinen ahnungslosen Kerl werden würde.
Jillian beugte sich vor, um das Bild genauer in Augenschein zu nehmen. Endlich fragte sie: »Wenn sie erfunden is’, wieso is’ sie dann hier drin?«
»Nun ja, Amazonen gehören zu den mythischen Gestalten.«
»Ach, du meinst so Menschen, über die andere Menschen Geschichten schreiben.«
»Ja, denn manchmal lassen sich Mythen auf wahre Geschichten zurückführen.« Er bemühte sich gewöhnlich, sich einfach auszudrücken, wenn er mit Jillian redete, war aber nie herablassend. Wenn sein temperamentvoller kleiner Liebling mal etwas nicht verstand, dann gab sie keine Ruhe, bis er es ihr erklärt hatte.
Sie zog die zarte Stupsnase kraus. »Erzähl mir was über diese Zonen.« Sie lehnte sich zurück und kuschelte sich auf seinem Schoß zurecht.
Er lachte leise über ihren Ausdruck, küsste sie auf den Scheitel und begann, von dem weiblichen Kriegervolk und seiner Königin Penthesilea zu berichten. Irgendwo im Haus wurde eine Tür zugeknallt, doch die beiden achteten nicht darauf, so vertieft waren sie in ihr Lieblingsthema, alte Kulturen.
Rick Sherwood kam mit für ihn ungewöhnlicher Begeisterung ins Haus gestürmt. Seine übliche Verdrießlichkeit war wie weggeblasen. Die Nägel an den Sohlen seiner Baseballschuhe klackten metallisch auf dem Holzfußboden. Wieder einmal ignorierte er die dringende Bitte der Haushälterin, die Dinger auszuziehen, bevor er das Haus betrat. Menschenskind, was für ein Spiel! Das bisher beste Spiel seines Lebens. Er wünschte, sein Vater wäre da gewesen, um es sich anzusehen, aber er hatte leider zu einer Sprechstunde mit seinen dämlichen Studenten gemusst.
Er war fünfmal am Schlag gewesen, hatte ganze vier Hits gelandet, darunter sogar einen Homerun! Das brachte seinen batting average auf satte 800! Mathe war zwar nicht gerade seine Stärke, aber so viel Rechnerei brachte er zumindest zustande.
Er ging kurz in die Küche, um gierig ein Glas Leitungswasser hinunterzustürzen, wobei ihm in seiner Hast das Wasser vom Kinn tropfte. Gerade als er ein zweites Glas trinken wollte, hörte er Stimmen und hielt inne. Das klang nach seinem Vater.
Ungebremst in seinem Enthusiasmus, trampelte er zur Bibliothek, denn dort steckte der gute Oldie gewöhnlich. Er riss die Tür auf und stürzte ins Zimmer. »Weißt du was, Paps? Ich hatte heute vier Hits, davon einen Homerun! Ich hatte sieben RBIs und hab ein double play gemacht. Das hättest du sehen sollen!« Letzteres sagte er voller Begeisterung, keineswegs vorwurfsvoll.
Professor Sherwood blickte auf und lächelte seinen Sohn an. »Ja, das hätte ich wirklich! Großartig, mein Junge!«
Rick ignorierte seine kleine Schwester. »Deine Sprechstunde hat wohl doch nicht so lang gedauert, wie du dachtest, hm?«
»Sie wurde auf morgen verschoben«, erklärte der Professor.
Rick stand da wie vom Donner gerührt; seine Freude verflog. »Wieso bist du dann nicht zum Spiel gekommen?«
Jillian hatte interessiert zugehört. Jetzt sagte sie: »Ich mag Baseballspiele, Papa.«
Er blickte lächelnd auf sie herab. »Tatsächlich? Na, dann sollten wir wohl zum nächsten Spiel gehen, mein Schatz.«
Das genügte ihr, und die Unterbrechung hatte lange genug gedauert. Sie stocherte mit dem Finger auf das Bild, um seine Aufmerksamkeit wieder in die richtige Richtung zu lenken. »Die Zonen«, forderte sie.
Gehorsam beugte sich der Professor diesem mit heller Stimme hervorgebrachten Befehl, was ihm absolut nicht schwerfiel, waren die Amazonen doch sein ganz persönliches Steckenpferd. Er war heilfroh, dass Jillian Mythen den Vorzug vor Märchen gab, denn sonst hätte er wohl kaum so viel Geduld aufgebracht.
Ricks Glücksgefühl war erloschen, stattdessen loderte heiße Wut in ihm auf. Wieder einmal war er ausgeschlossen, wieder einmal nur wegen dieses Satansbratens. Na und, dann war er eben nicht so schlau wie sie. Aber ein double play brachte sie nicht zustande. Wütend und frustriert stapfte er aus dem Zimmer, bevor er womöglich die Beherrschung verlor und das kleine Biest vom Schoß seines Vaters katapultierte. Der Professor hätte kein Verständnis dafür; sein Sonnenscheinchen war in seinen Augen unfehlbar.
Sonnenscheinchen, von wegen, dachte Rick zornig. Er hasste und verabscheute Jillian seit dem Tage ihrer Geburt, ebenso, wie er ihre Mutter gehasst hatte. Die Mutter war Gott sei Dank vor wenigen Jahren gestorben, aber das kleine Biest war immer noch da.
Alle machten einen Riesenwirbel um sie, weil sie ja soo schlau war. Und ihn behandelten sie wie einen dahergelaufenen Dummkopf, bloß weil er einmal sitzen geblieben war. Na und, dann war er eben siebzehn und würde kurz nach Beginn seines Junior Year an der Highschool achtzehn werden. Er war doch nicht blöd, er hatte sich lediglich nie richtig angestrengt. Wozu auch? Egal, wie viel Mühe er sich gab, alles drehte sich ausschließlich um dieses verwöhnte Balg.
Er trampelte die Treppe hinauf in sein Zimmer, wo er sich die Baseballschuhe runterriss und gegen die Wand schleuderte. Jetzt hatte sie ihm sogar das beste Spiel seines Lebens verdorben. Die Sprechstunde war verschoben worden, der Oldie hätte also eigentlich zum Spiel kommen können, aber nein, er war heimgegangen, um der Nervensäge Geschichten zu erzählen. Das war so ungerecht, dass er am liebsten irgendwas kurz und klein geschlagen hätte. Dieses dämliche kleine Biest zum Beispiel, ja, die hätte er nur zu gerne windelweich geprügelt. Er wollte ihr wehtun, so wie sie ihm wehgetan hatte. Sie hatte ihm seinen Vater gestohlen, sie und ihre blöde Mutter, und das würde er ihr nie verzeihen.
Impulsiv sprang er auf. Geräuschlos – da er nun Socken anhatte – schlich er aus seinem Zimmer und durch den Gang in Jillians Zimmer. Dort stand er erst mal und schaute sich aufmerksam um. Wie alle Kinder hatte sie all ihre Schätze um sich versammelt. Das Zimmer war voll mit ihren Lieblingsbüchern und Puppen und anderen Sachen, deren Wert allein sie kannte. Rick beachtete den Ramsch nicht, er suchte nur eins: ihre Lieblingspuppe, die, die sie mehr mochte als alle anderen, eine abgegriffene Plastikpuppe namens Violet. Ohne die konnte sie normalerweise nicht einschlafen.
Da war sie ja. Rick schnappte sich die Puppe und schlüpfte in sein Zimmer zurück. Dann überlegte er, was er jetzt tun sollte. Am liebsten hätte er die Puppe zertrümmert und die Trümmer auf Jillians Bett verteilt, aber ein Instinkt riet ihm davon ab. Nein, dann würde man ihn beschuldigen, denn sonst käme im Haus ja niemand infrage. Und dennoch: Die Puppe vor ihr zu verstecken genügte ihm nicht. Seine Missgunst verlangte nach mehr, verlangte nach Zerstörung. Ja, er musste und wollte etwas zerstören, das ihr sehr am Herzen lag, selbst wenn er der Einzige war, der es wusste.
Verzerrt lächelnd holte er sein Taschenmesser von der Kommode und öffnete es. Dann setzte er sich aufs Bett und schnitt der Puppe sorgfältig alle Gliedmaßen ab. Jillian würde nicht erfahren, was er getan hatte; sie würde heulen, weil ihre Lieblingspuppe weg war, aber ihm könnte man nichts vorwerfen. Er würde sein Wissen wie einen Schatz hüten, und jedes Mal, wenn er sie ansah, würde er sich ins Fäustchen lachen, weil er es wusste und sie nicht.
1
Mit zornig zusammengepressten Lippen betrat Jillian Sherwood ihre Apartmentwohnung. Die Wohnung war ganz neu, kaum zwei Jahre alt, und normalerweise empfand sie jedes Mal Stolz und ein tiefes Glücksgefühl, sobald sie über die Schwelle trat, denn die Wohnung sah nicht nur umwerfend aus, sie gehörte ihr auch noch. Doch heute war kein normaler Tag, und sie würdigte das kühle, entspannende Interieur keines Blickes. Sie hängte ihre Schultertasche ans Foyertischchen und stapfte hinaus auf den Balkon. Sie war so wütend, dass sie das Gefühl hatte, gleich platzen zu müssen, wenn sie sich noch eine Sekunde länger in einem geschlossenen Raum aufhielte.
Unbeweglich stand sie in der schwülen Hitze des Spätfrühlings von Los Angeles, die Hände auf die hüfthohe steinerne Balkonbrüstung gestützt. Von hier aus hatte man einen wunderschönen Blick über die Stadt, den sie normalerweise genoss, doch heute war sie so wütend, dass sie nichts um sich herum wahrnahm.
Zur Hölle mit diesen engstirnigen Arschlöchern!
Sie hatte alles getan, was sie konnte, hatte es sich verdient, an der Ouosalla-Ausgrabung in Ostafrika teilzunehmen; es war der wichtigste und größte Fund seit Jahrzehnten, und ihr lief buchstäblich das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur daran dachte, dabei zu sein. Nie hatte sie sich etwas mehr gewünscht, als die alte Stadt, die erst kürzlich an der afrikanischen Küste des Roten Meers entdeckt worden war, mit ausgraben zu helfen. Das Projekt wurde von der Frost Foundation finanziert, der Stiftung also, für die sie arbeitete. Sie hatte sich kaum bezähmen können vor Freude, als sie das schriftliche Ersuchen um Teilnahme einreichte.
Und wieso hätte sie auch nicht erwarten sollen, als Mitglied des Ausgrabungsteams ausgewählt zu werden? Ihre Arbeiten waren bis über den grünen Klee gelobt worden, ebenso ihre Ausgrabungsberichte, die in mehreren renommierten Fachblättern veröffentlicht worden waren. Sie besaß einen Doktor in Archäologie und hatte bereits an mehreren kleineren Ausgrabungen in Afrika teilgenommen; ihre Vorkenntnisse wären für eine so wichtige Fundstätte wie die in Ouosalla von unschätzbarem Wert. Nur die Besten kämen dafür infrage, und sie wusste, dass sie zu den Besten zählte. Sie besaß Erfahrung, Enthusiasmus und war ein wahres Arbeitspferd. Außerdem verfügte sie über jenen flinken, praktischen Verstand, der es Archäologen ermöglichte, aus winzigen Fragmenten das Leben in einer längst zurückliegenden Vergangenheit zusammenzupuzzeln. Es gab keinen Grund, sie nicht auszuwählen.
Aber sie war trotzdem übergangen worden, übergangen von jenen Vollidioten, jenen Dünnbrettbohrern, die an der Spitze der Stiftung saßen, denn für diese Leute gab es einen triftigen Grund, sie zu übergehen: Ihr Name war Sherwood.
Der Leiter der Abteilung hatte kein Blatt vor den Mund genommen: Die Tochter vom »Spinner« Cyrus Sherwood wäre kein Prestigeobjekt, egal für welches Ausgrabungsteam. Der Ruf ihres Vaters, wilden Theorien nachzujagen, überschattete ihre solide Leistung und bekannte Zuverlässigkeit.
Es war, als würde sie mit dem Kopf gegen eine Wand anrennen, es war so ungerecht, so scheißungerecht. Ihr Vater war der Meinung gewesen, sie hätte genug Dickköpfigkeit für drei, aber in diesem Fall kam selbst sie nicht weiter. Sie liebte die Archäologie, hatte nie etwas anderes gedacht und gemacht – und würde sich nie mit etwas anderem beschäftigen wollen. Aber die oberen Ränge der von ihr gewählten Karriere blieben ihr aufgrund ihres Namens verschlossen. Ausgrabungen verschlangen gewöhnlich sehr viel Geld, und Sponsoren fielen nicht gerade von den Bäumen. Die Schlacht um die vorhandenen Gelder war mörderisch. Daher konnte es sich kein achtbares Team leisten, sie auf eine größere Ausgrabung mitzunehmen. Schon ihre Anwesenheit genügte, den Wert der Funde in Zweifel zu ziehen, was zum Verlust der Sponsorengelder geführt hätte.
Selbst wenn sie ihren Namen ändern würde, würde ihr das nichts helfen; die Welt der Archäologie war ein Dorf, in dem sie zu viele Leute kannten. Wenn doch nicht alles immer nur Politik wäre! Nur wer bekannt war und einen großen Namen hatte, bekam die Knete. Nein, keiner würde eine schlechte Presse riskieren, indem er sie ins Team aufnahm. Sie war schon auf zahlreichen kleineren Ausgrabungen gewesen, aber alle wirklich wichtigen blieben ihr verschlossen.
Nicht, dass sie ihren Namen geändert hätte, selbst wenn es was genützt hätte. Ihr Vater war ein wundervoller Mann gewesen, ein brillanter Archäologe. Sie hatte ihn von ganzem Herzen geliebt und vermisste ihn selbst jetzt noch, obwohl er schon die Hälfte ihrer achtundzwanzig Jahre tot war. Es machte sie zornig, dass seine zahllosen unschätzbaren Beiträge zur Archäologie ignoriert wurden, bloß weil er ein paar Theorien entwickelt hatte, die er nie hatte beweisen können. Er war während einer Forschungsreise durch den Amazonasdschungel umgekommen, einer Reise, bei der er gehofft hatte, unwiderlegbare Beweise für eine seiner kühnsten Theorien zu finden. Als Scharlatan und Narr war er beschimpft worden, doch nach seinem Tod bezeichneten ihn die mitfühlenderen Seelen lediglich als einen »Irregeleiteten«.
Cyrus Sherwoods Ruf verfolgte Jillian seit dem Studium. Sie hatte daher das Gefühl, fleißiger, gewissenhafter und härter arbeiten zu müssen als jeder andere und es sich nicht leisten zu können, irgendwelchen Träumen nachzuhängen, so wie ihr Vater. Sie hatte ihr Leben der Archäologie verschrieben, hatte sich nie einen Urlaub gegönnt, hatte alle Zeit und Willenskraft auf die Verfolgung ihres Ziels verwandt.
Und alles umsonst.
Die Tochter des »Spinners« Sherwood war nun mal auf keiner bedeutenderen Ausgrabung willkommen.
Sie schlug mit der flachen Hand gegen die Wand. Er war kein Spinner, dachte sie zornig. Er war vielleicht ein Träumer gewesen, ein wenig exzentrisch, aber wenn er zu Hause war, war er ein wundervoller Vater gewesen. Obendrein war er ein verdammt guter Archäologe gewesen. Davon war sie absolut überzeugt.
Bei dem Gedanken an ihn fielen Jillian wieder die Schachteln ein, die Schachteln mit seinen Papieren, die sie nie geordnet hatte. Nach seinem Tod waren die Unterlagen des Professors verpackt und das Haus verkauft worden. Ihr Halbbruder Rick hatte die Schachteln mit in sein schäbiges Apartment genommen, und dort verstaubten sie in irgendeiner Ecke. Er hatte keinerlei Interesse an den Sachen und hatte sie ihres Wissens auch nie angerührt. Als Jillian mit dem Studium fertig war und in eine eigene Wohnung zog, hatte sie ihm angeboten, die Schachteln zu sich zu nehmen, aber Rick hatte abgelehnt – eher deshalb, weil sie sie wollte, so vermutete sie, als aus einem echten Interesse an den Sachen ihres Vaters.
Doch auch hier irrte sich Rick, wie so oft. Natürlich hätte sie die Sachen ihres Vaters nie weggeworfen oder verkommen lassen, doch unbedingt erpicht auf sie war sie ebenso wenig gewesen. Eher im Gegenteil. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jillian den schlechten Ruf ihres Vaters schon leidvoll und unmissverständlich zu spüren bekommen, und sie wollte nichts lesen, das sie möglicherweise selbst glauben ließe, er wäre der Spinner gewesen, als den ihn seine Kollegen regelmäßig hinstellten. Da war es besser, ihn so in Erinnerung zu behalten, wie sie ihn gekannt hatte.
Doch nun überkam sie auf einmal eine brennende Neugier, ein starkes Bedürfnis, ihm wieder näher zu sein. Er war kein Narr! Einige seiner Theorien waren zwar unkonventionell, aber vor fünfhundert Jahren war der Gedanke, die Erde sei rund, schließlich ebenso närrisch gewesen. Ihr Vater hatte zahllose Stunden über Landkarten und Reiseberichten gebrütet, hatte zahllose Spuren verfolgt, um seine Theorien zu untermauern. Und draußen, bei Ausgrabungen, war er superb gewesen, ein Genie, wenn es darum ging, aus den wenigen noch übrigen Scherben eine alte Welt erstehen zu lassen.
Sie wünschte, sie hätte diese Schachteln jetzt hier. Ihr Vater hatte sie von klein auf ermutigt, und genau das fehlte ihr jetzt. Er selbst war nicht mehr da, aber diese alten Unterlagen waren mehr er selbst als die paar Erinnerungsstücke, meist Fotos, von ihm, die sie besaß.
Ein paar Minuten lang war sie unschlüssig. Dies war der schwärzeste Moment ihrer Karriere, so wütend und traurig war sie nicht mehr gewesen, seit sie vom Tod ihres Vaters erfahren hatte. Sie war von Natur aus eine unabhängige Person, aber selbst die unabhängigsten Menschen brauchen manchmal Trost, und dies war ein solcher Moment. Sie brauchte die Nähe zu ihrem Vater, die Auffrischung ihrer Erinnerungen an ihn.
Einmal entschieden, ging sie festen Schrittes zurück ins Wohnzimmer und schlug Ricks Telefonnummer in ihrem Adressbuch nach. Es warf schon ein trauriges, aber nichtsdestoweniger akkurates Licht auf ihre Beziehung, dass sie seine Nummer nicht auswendig wusste. Aber von einer Beziehung konnte sowieso nie die Rede sein, zumindest nicht in einem guten, emotionalen Sinn. Er pumpte sie ab und zu um Geld an, aber gewöhnlich sahen sie sich höchstens einmal im Jahr, was ihnen beiden absolut reichte.
Sie ließ es eine volle Minute lang klingeln, bevor sie auflegte. Sie war Realistin und machte sich nichts vor. Sie wusste, dass es ein paar Tage dauern konnte, bis sie ihn erwischte, also zügelte sie ihre Ungeduld und schlüpfte in ihre Sportsachen. Ein bisschen Sport war gut gegen Stress, und sie liebte eine gute körperliche Kondition. Dreimal pro Woche ins Fitnessstudio, dazu Joggen, das hielt sie fit.
Dennoch griff sie, als sie wenige Stunden später wieder nach Hause kam, erneut zum Hörer und drückte auf die Wahlwiederholungstaste. Zu ihrer Überraschung klingelte es nur einmal, bevor eine brüske, leicht lallende Stimme ein »Ja bitte?« in den Hörer bellte.
»Rick, ich bin’s, Jillian. Bist du heute Abend zu Hause?«
»Wieso?« Nun klang er misstrauisch, ja wachsam.
»Ich würde mir gern mal die Schachteln mit Papas alten Sachen anschauen.«
»Wozu das denn?«
»Ich will sie nur mal durchschauen. Das haben wir nie gemacht, weißt du. Wir wissen nicht mal, was drin ist.«
»Und wieso ausgerechnet jetzt?«
»Es gibt keinen triftigen Grund. Ich bin bloß neugierig.« Instinktiv ließ sie Rick nicht wissen, wie schlecht es ihr ging und wie sehr sie gerade jetzt diese Verbindung zu ihrem Vater brauchte.
»Ich hab nich’ die Zeit, hier rumzuhocken und dir zuzusehen, wie du in Erinnerungen schwelgst«, sagte er grob und überging dabei völlig die Möglichkeit, ihr die Kisten mitzugeben, damit sie sie zu Hause in Ruhe anschauen könnte. Rick gab nie einen vermeintlichen Vorteil über Jillian auf.
»Na gut«, sagte sie wegwerfend, »dann eben nicht. War bloß so eine Idee. Tschüss.«
»Jetzt warte mal«, sagte er hastig. Sie konnte ihn förmlich vor sich sehen, wie die Rädchen in seinem Gehirn ratterten. »Ah ... na ja, dann komm halt rüber. Ach, glaubst du, du könntest mir ein paar Scheinchen leihen? Bin im Moment ein bisschen knapp.«
»Tja, ich weiß nicht«, sagte sie zögernd, denn sie wollte keinen zu eifrigen Eindruck machen, damit er seine Meinung nicht wieder änderte. »Wie viel brauchst du denn?«
»Nicht viel. Ein Hunderter würde reichen.«
»Hundert Dollar!«
»Gut, gut, dann eben bloß fünfzig.«
»Ich weiß nicht«, sagte sie noch einmal. »Muss erst mal sehen, wie viel ich dahabe.«
»Also kommst du jetzt vorbei oder nicht?«, fragte er brüsk.
»Ja, ja, ich komme. Wenn du da bist?«
»Sicher bin ich da.« Er knallte den Hörer auf, dass es in ihrem Ohr klingelte. Schulterzuckend legte Jillian auf. So war es üblicherweise mit Rick. Manchmal fragte sie sich, ob er je merken würde, wie wenig sie seine Mätzchen kratzten.
Sie schaute in ihre Brieftasche, um sicherzugehen, dass sie noch einen Fünfziger hatte, was der Fall war. Doch es war ihr letzter Schein, sodass sie dann ohne Bares wäre, bis sie wieder zum Automaten käme, also frühestens morgen, denn nach Einbruch der Dunkelheit riskierte sie so etwas nicht. Aber ihr Wagen hatte noch genügend Benzin, also würde sie heute Abend auch kein Geld mehr brauchen. Der Einblick in die Papiere ihres Vaters war ihr den Fünfziger wert. Eine derartige Aufmunterung hatte sie bitter nötig. Zum Glück kam sie nur selten in so eine Lage, da sie mit beiden Beinen fest auf der Erde stand, doch manchmal lässt selbst das widerstandsfähigste Pflänzchen den Kopf hängen. Welk war allerdings ein harmloser Ausdruck für ihren Zustand.
Sie machte sich gar nicht erst die Mühe, ihre Sportsachen zu wechseln, da das Auspacken der vierzehn Jahre alten Schachteln sicher eine ziemlich staubige Angelegenheit werden würde. Sie brauchte eine Dreiviertelstunde bis zu Ricks Wohnblock, einem von drei zweistöckigen, in verblasstem Lachs gestrichenen Gebäuden, bei denen schon der Stuck abblätterte. Rick wohnte im Erdgeschoss des linken Blocks. Der Parkplatz war voller mehr oder weniger reparaturbedürftiger Vehikel, deren überwiegende Farbe aus Rostschutzmittel bestand. Die Bewohner dieses Viertels machten, bis auf die Rostschutzfarbe, einen ähnlichen Eindruck.
Sie klopfte an Ricks Tür. Drinnen lief der Fernseher; sonst war nichts zu hören. Sie klopfte noch einmal.
»Is’ ja gut, is’ ja gut«, brummte jetzt jemand, und kurz darauf riss Rick die Tür auf.
Es überraschte sie immer, wie attraktiv und jungenhaft Ricks Züge noch wirkten, trotz Zigaretten, Alkohol und einem insgesamt recht ungesunden Lebenswandel. Doch so langsam merkte man es ihm jetzt an, obwohl er immer noch durchaus gut aussah.
»Hallo«, sagte er. »Hast du das Geld?«
»Ich habe selber nur noch einen Fünfziger, aber den kann ich dir geben, wenn du ihn wirklich brauchst«, sagte sie, während sie dachte: Hallo, mir geht’s gut, wie geht’s dir? Sie konnte seine Fahne riechen. Rick war, selbst wenn nüchtern, nicht gerade ein manierlicher Zeitgenosse, aber wenn er getrunken hatte, fehlte ihm jeder Benimm. Leider war das meistens der Fall.
»Klar brauch ich ihn«, fauchte er. »Hätte wohl kaum nach ’nem Hunderter gefragt, wenn ich das Geld nich’ brauchen würde.«
Sie zuckte mit den Schultern und kramte ihre Brieftasche heraus, die sie so hielt, dass er sehen konnte, dass sie ihm ihre letzten Kröten gab. Siebenundfünfzig Dollar. Die würde sie nie wiedersehen, aber das erwartete sie auch nicht. Sie gab ihm das Geld und fragte: »Wo sind die Schachteln?«
»Da hinten. Im zweiten Schlafzimmer.«
Das zweite »Schlafzimmer« war die reinste Rumpelkammer und hatte garantiert noch nie ein Bett gesehen. Rick benutzte es als Abstellraum für alles, was er aus dem Weg haben wollte, einschließlich, wie es schien, seiner Schmutzwäsche. Die Schachteln standen übereinandergestapelt in einer Ecke. Sie kämpfte sich zu ihnen durch und begann, sich ein wenig Platz zum Auspacken zu schaffen.
»Was suchst du eigentlich?«, wollte Rick wissen. Er klang misstrauisch, als würde er ihren vorherigen Worten nicht glauben.
»Nichts. Ich will die Sachen bloß lesen. Komm, hol zwei Stühle, dann sehen wir uns das Ganze zusammen an, ja?«
»Nee, danke«, sagte er, und sein Blick verriet unmissverständlich, was er von der Idee hielt. »Da hock ich mich doch lieber mit ’nem Bier vor die Glotze.«
»Wie du willst«, sagte sie und griff nach der ersten Schachtel. Es waren fünf; voller Wasserflecken und total verstaubt, was irgendwie passte, da das meiste, was der Professor geliebt hatte, verstaubt gewesen war. Sie setzte sich auf den Boden und begann das braune Paketband abzureißen, mit dem die Schachteln verschlossen worden waren.
Vieles davon waren wissenschaftliche Bücher, die sie nach Themen geordnet um sich herum aufstapelte. Es waren ein paar seltene Ausgaben darunter, und mit diesen ging sie besonders behutsam um.
Es gab Berichte von unterschiedlichen Ausgrabungen, Artikel, die ihn interessiert hatten und die er deshalb aufbewahrt hatte, Karten verschiedenen Alters und mehrere Spiralblöcke, in denen er seine eigenen Aufzeichnungen niedergeschrieben hatte. Diese öffnete sie mit einem leichten Lächeln, denn das schmale Gekrakel ihres Vaters rief wehmütige Erinnerungen wach. Wie viel Freude ihm seine Arbeit immer gemacht hatte! Mit welcher Begeisterung er alte Kulturen neu erstehen ließ! Er hatte seiner Fantasie nie Zügel angelegt, hatte stets in dem Bewusstsein gehandelt, dass sie ihn schließlich zur Wahrheit führen würde, welche für ihn von jeher viel fantastischer gewesen war als die cleverste Lüge.
Seine Leidenschaft für seine Arbeit hatte dazu geführt, dass er den verschiedensten Legenden nachspürte, deren jeder er ein eigenes Kapitel in seinen Notizbüchern widmete. Wie oft hatte sie abends noch zu seinen Füßen oder auf seinem Schoß gesessen und seinen spannenden Erzählungen gelauscht. Sie war nicht mit Märchen groß geworden, oder vielleicht ja doch, bloß dass es Märchen über längst vergangene Kulturen gewesen waren und Schätze, die auf geheimnisvolle Weise verschwanden ... Hatte es sie wirklich gegeben, oder waren sie doch nur ein Produkt der menschlichen Fantasie? Für ihren Vater war selbst die leiseste Aussicht, dass etwas wahr sein könnte, unwiderstehlich gewesen; er war den unwahrscheinlichsten Spuren nachgegangen – wenn auch nur, um seine eigene Neugier zu befriedigen.
Träumerisch blätterte sie in den Notizbüchern und dachte dabei an die Geschichten, die er ihr über jede dieser Legenden erzählt hatte. Ihr fiel dabei auf, dass er die meisten davon als pure Mythen abgetan hatte, denen jede tatsächliche Basis fehlte. Einige wenige Legenden, so schloss er, bargen zumindest die Möglichkeit eines wahren Kerns, obwohl noch mehr Forschung vonnöten wäre und die Wahrheit wahrscheinlich nie ans Licht käme. Das machte sie abermals wütend; wie konnte man ihn als Spinner bezeichnen, wo er doch die Tatsachen sorgsam abgewägt hatte und sich nicht vom Glanz und vom mythischen Potenzial seiner Forschungsobjekte hatte blenden lassen? Aber alles, wovon die Leute redeten, war seine Besessenheit für die Anzar, sein spektakulärster Fehlschlag, und dass die Jagd danach ihn in den Tod geführt hatte.
Die Anzar. Sie hatte lange nicht mehr an diese Legende gedacht, weil sie ihn das Leben gekostet hatte. Er war so begeistert davon gewesen. Als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, an jenem Morgen, bevor er zum Amazonas aufbrach, um der Legende über die Anzar nachzuspüren, war er so selig gewesen, so optimistisch. Sie war eine ungelenke, aufgeschossene Dreizehnjährige gewesen, fast vierzehn, und böse, weil er ihr nicht erlaubt hatte mitzukommen, und weil er ihren Geburtstag verpassen würde, aber er hatte sie liebevoll umarmt und geküsst.
»Nicht böse sein, Schätzchen«, hatte er gesagt und ihr über den Kopf gestreichelt. »In ein paar Monaten bin ich ja wieder da. Ein halbes Jahr höchstens.«
»Du musst doch nicht gehen«, hatte sie trotzig erwidert.
»Das ist aber meine Chance, die Kaiserin zu finden und ein für alle Mal zu beweisen, dass es die Anzar wirklich gab. Du weißt doch, was das bedeuten würde, nicht?«
Sie war mit ihren dreizehn schon erschreckend realistisch gewesen. »Geld«, hatte sie gesagt, und er hatte gelacht.
»Na ja, das sicher auch. Aber bedenke doch, was es bedeutet zu beweisen, dass die Legende wahr ist, das Herz der Kaiserin in Händen zu halten, seine Schönheit der Welt zu schenken.«
Sie hatte nur finster die Stirn gerunzelt. »Pass bloß auf«, hatte sie gesagt und ihm mit dem Finger gedroht. »Der Amazonas ist kein Spielplatz, das weißt du.«
»Ich weiß. Ich werde gut aufpassen, versprochen.«
Aber das hatte er nicht. An diesem Vormittag hatte sie ihn zum letzten Mal gesehen. Die Nachricht erreichte sie drei Monate später, und es dauerte weitere zwei Monate, bis seine Leiche geborgen und zur Beisetzung überführt worden war. Großtante Ruby war gekommen, um sich während der Abwesenheit des Professors um Jillian zu kümmern, damit sie weiter auf ihre Schule gehen konnte. Doch als sein Tod bekannt war, wurde sein Haus schnellstens verkauft, und sie selbst musste in Tante Rubys kleinen Bungalow ziehen. Rick, ihr nächster Verwandter, hatte selbstverständlich keine Lust gehabt, sich einen Teenager aufzuhalsen. Außerdem hatte er seinem Vater nie verziehen, nach dem Tod seiner, Ricks, Mutter noch einmal geheiratet zu haben, und war ausgezogen, sobald er mit der Highschool fertig war. Rick und Jillian hatten sich nie nahegestanden; er konnte sie kaum ertragen. Das hatte sich nie gebessert.
Die Besessenheit ihres Vaters von der Anzarlegende hatte ihn das Leben gekostet und ihres auf den Kopf gestellt – nicht nur, indem sie ihren Vater verlor, sondern auch noch alles, was sie bisher gekannt und geliebt hatte. Noch heute überschattete seine letzte Mission ihre Karriere. Sie blätterte das Notizbuch durch, auf der Suche nach einem Kapitel über diese Legende, die sie selbst so viel gekostet hatte, doch sie fand keines. Sie legte das Notizbuch beiseite und nahm sich ein anderes vor, doch auch in diesem fand sie keinen Hinweis auf den legendären Stamm von Kriegerinnen.
Sie blätterte noch zwei Notizbücher durch, bevor sie es endlich fand. Es lag unter dem dritten, das sie soeben zur Hand genommen hatte. Da stand es, in dicken schwarzen Lettern: Die Zivilisation der südamerikanischen Anzar. Diese Legende war die einzige, der er nachgespürt hatte, der er ein eigenes Notizbuch gewidmet hatte. Ein Kribbeln überlief sie, als sie das Buch aus der Schachtel nahm und behutsam öffnete. Sie fragte sich, ob sie nun begreifen würde, was sein Interesse so sehr gefangen hatte, dass er nicht nur seinen Ruf, sondern letztendlich auch sein Leben dafür riskiert hatte.
Offenbar hatte er viele Fabeln und Legenden aus unterschiedlichen Quellen gesammelt, die alle irgendwelche Hinweise auf die Kaiserin oder das Herz der Könige enthielten. Der Ursprung dieser Fabeln ließ sich nicht mehr feststellen, obwohl Cyrus Sherwood jedem Hinweis aufs Sorgfältigste nachgegangen war. Sie standen weder mit den Inkas noch mit den Mayas in Verbindung und schienen doch einer Hochkultur zu entstammen. Die Fabeln sprachen von der »Stadt aus Stein unter dem grünen Meer, das Land der Anzar«. In verschiedenen Versionen der Fabel war, mit kleinen Abweichungen, von einer großen Kriegerkönigin die Rede, die sich in einen stolzen Krieger aus einem anderen Stamm verliebte, doch dieser fiel bei der Verteidigung der steinernen Stadt vor dem Angriff von »bleichen, geflügelten Dämonen«. Die Kriegerkönigin oder Kaiserin war untröstlich über seinen Tod und schwor über seiner Leiche, dass ihr Herz nie wieder einem anderen gehören würde, weder in diesem noch im nächsten Leben und bis in alle Ewigkeit. Sie wurde steinalt, und als sie starb, verwandelte sich ihr Herz in einen roten Diamanten, den man entnahm und auf den Sarg ihres geliebten Kriegers bettete, auf dass es ihm bis in alle Ewigkeit gehören würde, so wie sie es geschworen hatte. Der rote Diamant besaß angeblich Zauberkräfte, er schützte die Anzar und ihre Stadt unter dem grünen Meer für ewig vor der Außenwelt.
Es war eine Geschichte, wie man sie sich, in endlosen Varianten, überall auf der Welt erzählte, aber sie erklärte nicht das an Besessenheit grenzende Interesse des Professors. Oder ihr eigenes. Jillian hockte sich auf die Fersen und starrte auf das Notizbuch. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, und sie wusste nicht, warum, außer dass ihr Vater diese Legende für wichtig genug gehalten hatte, um ihr ein eigenes Notizbuch zu widmen. Sie wurde von Aufregung gepackt, konnte die Begeisterung und Zuversicht, die aus den Worten ihres Vaters sprachen, selbst nach fünfzehn Jahren noch spüren. Abermals vertiefte sie sich in das Notizbuch.
Fast eine Stunde später fand sie den Code. Fassungslos starrte sie ihn an. Ja, sie erinnerte sich; sie war noch klein gewesen, aber sie erinnerte sich. Schnell nahm sie ihre Handtasche und wühlte darin nach einem Stift. Dann begann sie, den Code zu entschlüsseln. Doch schon nach ein paar Worten faltete sie das Blatt zusammen und stopfte es in ihre Tasche. Sie wollte erst weitermachen, wenn sie völlig ungestört war.
Kein Wunder, dass er so aufgeregt gewesen war.
Sie schwitzte, und ihr Puls raste. Das Herz drohte ihr zu zerspringen, und sie musste all ihre Willenskraft aufbieten, um nicht den Kopf in den Nacken zu werfen und mit einem lauten Siegesgebrüll ihre innere Anspannung zu lösen.
Er hatte es geschafft. Sie wusste es so sicher, wie sie noch nie in ihrem Leben etwas gewusst hatte. Ihr Vater hatte die Anzar gefunden.
Und, bei Gott, das würde sie auch.
2
Ben Lewis lümmelte in seiner Lieblingsbar herum, eine Flasche mit seinem Lieblingswhiskey neben sich auf dem Tisch, seine Lieblingskellnerin auf den Knien. Das Leben ging rauf, und es ging runter; im Moment ging’s mal wieder ordentlich rauf. Mann, es gab einfach nichts Besseres als ’ne gute Pulle Whiskey und ein williges Weib, um einem Mann Freude zu bescheren – zumindest, was ihn anging. Vor allem, was einen Körperteil betraf, der bei ihm praktisch seit der Pubertät stand. Aber dafür war schließlich die süße kleine Thèresa zuständig. Da sie blond und ihr Portugiesisch mit einem grässlichen amerikanischen Akzent behaftet war, vermutete er, dass sie in Wirklichkeit einfach Teresa war, aber das war ihm schnuppe. Was zählte, war, dass sie bald Dienstschluss hatte und ihn dann mit auf ihr Zimmer nehmen würde, wo sie erst mal die nächsten ein, zwei Stunden unter seinem pumpenden Arsch verbringen würde. O ja, solche Aussichten konnten einen Mann schon handzahm machen.
Christus, der Barmann, brüllte, Thèresa solle zusehen, dass sie ihren Hintern hochbekam und sich wieder an die Arbeit machte. Sie zog eine Schnute, dann lachte sie und knutschte Ben kurz und heftig ab. »Ein Dreiviertelstündchen, Loverboy. Hältst du’s noch so lange aus?«
Seine dunklen Augenbrauen schossen in die Höhe. »Glaub schon. Ich bin’s auf jeden Fall wert.«
Sie lachte, ein warmes, sehr weibliches und sinnliches Lachen, voller Vorfreude. »Als ob ich das nicht wüsste! Is’ ja gut!« Letzteres rief sie dem ergrimmten Christus zu, der sie soeben erneut ermahnen wollte.
Als sie sich von Bens Schoß erhob, tätschelte dieser ihr gutmütig den Allerwertesten und widmete sich dann wieder seinem ausgezeichneten Whiskey. Wie jeder vorsichtige Mann saß er mit dem Rücken zur Wand. Die düstere, rauchige Bar war ein beliebter Treffpunkt für die hiesigen Ausländer. Solche Treffpunkte gab es überall, in jeder Stadt und in jedem Land der Welt. Irgendwie kamen die Ausländer immer zusammen, wie Treibgut, das vom Meer angeschwemmt wird. Brasilien war weit weg von Alabama, wo er aufgewachsen war, aber hier fühlte er sich zu Hause. Die Typen, die die Bar bevölkerten, waren Männer, die alles gesehen und sicher alles getan hatten, es aber aus irgendeinem Grund nicht mehr für nötig hielten, auf ihre Rückendeckung zu achten. Er mochte die Kundschaft, die Christus’ Bar frequentierte: Fremdenführer, Flussfischer, Söldner und Glücksritter, sowohl von der aktiven wie von der pensionierten Sorte. Ab und zu flogen mal die Gläser, aber meist war es eine unspektakuläre, gemütliche Höhle zum Abhängen und Entspannen unter Gleichgesinnten, in der man der draußen herrschenden Backofenhitze ein wenig entfliehen konnte.
Wahrscheinlich hätte er sich ebenso gut auf einen der Barhocker setzen können; hier war niemand, der ihn hinterrücks abmurksen wollte, und Christus hatte sowieso immer ein Auge auf ihn. Aber Ben saß nicht deshalb mit dem Rücken zur Wand, weil er ein Messer oder eine Kugel fürchtete, obwohl er in seinem bisherigen Leben auch diesen Gefahren gelegentlich begegnet war. Nein, er saß, wo er saß, damit er sehen konnte, was vorging und wer das Lokal betrat. Man konnte nie zu viel wissen. Er war von Natur aus ein guter Beobachter, was ihm in der Vergangenheit nicht selten die Haut gerettet hatte. Warum also mit einer so nützlichen, lieb gewordenen Gewohnheit brechen?
Als daher die beiden Männer die Bar betraten und ein paar Sekunden stehen blieben, um ihre Augen ans Halbdunkel zu gewöhnen, bevor sie sich einen Platz suchten, stachen sie ihm sofort ins Auge, und das, was er sah, gefiel ihm nicht. Der eine war ein Fremder, den anderen kannte er vom Sehen; ja, er hatte schon viel von ihm gehört, und nichts Gutes. Steven Kates war ein Krimineller, wie er im Buche stand, ohne Moral und Gewissen. Sie waren einander zwar noch nie über den Weg gelaufen, aber Bens Gewohnheit, Informationen zu sammeln, wo immer er sie finden konnte, hatte ihm jede Menge Gerüchte über Steven Kates zugetragen. Doch Kates’ Revier waren die Vereinigten Staaten; was hatte er also hier in Brasilien zu suchen?
Die beiden Männer traten an die Bar. Kates beugte sich vor und sagte leise etwas zu Christus. Der bullige Barmann zuckte wortlos mit den Schultern. Der gute alte Christus konnte, wenn er wollte und ihm die Nase von jemandem nicht gefiel, so verschlossen sein wie eine Auster – ein weiterer Grund, warum seine Bar so beliebt war.
Kates sagte noch etwas, und diesmal knurrte Christus etwas als Antwort. Die beiden Männer besprachen sich kurz, nickten Christus zu und setzten sich an einen leeren Tisch.
Kurz darauf kam Thèresa mit verführerischem Hüftschwung zu ihm. »Diese zwei Typen suchen dich«, murmelte sie und wischte dabei überflüssigerweise den makellos sauberen Tisch ab.
Ben freute sich über die schöne Aussicht, die sie ihm bot. Er konnte es kaum abwarten, dass sie ihre Bluse ganz auszog und er ungehinderten Zugang zu ihren üppigen Brüsten hätte.
»Sie suchen einen Führer für irgend so eine Expedition den Fluss rauf«, fuhr sie schmunzelnd fort, wusste sie doch genau, wo er hinsah und was ihm dabei durch den Kopf ging. Sie zuckte leicht mit den Schultern, wobei ihr die Bluse noch ein Stück weiter runterrutschte und er noch mehr von ihrem prächtigen Ausschnitt zu sehen bekam.
»Ich brauche keinen Job«, sagte er.
»Was brauchst du denn, Loverboy?«, schnurrte sie.
In seinen Augen brannte träge ein sinnliches Feuer. »Ein paar Stunden Ficken, und es ginge mir effektiv besser«, gab er zu.
Sie erschauderte, und ihre spitze kleine rosa Zunge schnellte heraus und fuhr über ihren Kirschmund. Genau das gefiel ihm so an Thèresa: Sie war nicht gerade eine Leuchte, aber sie war warmherzig und sinnlich, allzeit bereit für eine heiße Nummer. Er konnte sehen, dass sie allmählich erregt wurde. Er kannte die Anzeichen so gut wie seinen eigenen Körper, obwohl ein eisenharter Schwanz natürlich viel schwerer zu übersehen war als die subtileren Signale der zarten Weiblichkeit. Thèresa brauchte es regelmäßig, so wie er auch. Und wenn er nicht zur Verfügung stand, dann tat es eben ein anderer, jeder, wenn es sein musste. Die süße Thèresa war nicht wählerisch, sie mochte alle Männer, solange der Schwengel funktionstüchtig war.
Mit einem erwartungsvollen Strahlen machte sie sich wieder an ihre Arbeit.
Ben musterte Kates und seinen Begleiter. Es stimmte: Er brauchte zurzeit keine Arbeit. Er hatte jede Menge Knete auf der Bank, und sein Lebensstil war alles andere als extravagant. Man konnte sich was gönnen und dabei ein Schweinegeld ausgeben, oder man konnte sich was gönnen und es saubillig haben. Er brauchte nur was zum Futtern, ein Bett zum Schlafen, einen guten Whiskey und jede Menge Sex. Mehr verlangte er nicht vom Leben. Der zufriedene Ben Lewis.
Von wegen.
Er war ein Abenteurer, und er hatte eine Nase für Abenteuer, und diese Nase, die ihn fast sein ganzes Leben lang von einem Höllenloch zum nächsten geführt hatte, kribbelte jetzt unwiderstehlich. Wenn ein Schleimbeutel wie Steven Kates seinen Kadaver bis zum Amazonasbecken schleppte, dann musste was Gewaltiges dahinterstecken. Der Amazonas war kein normaler Fluss und eine Expedition darauf nicht gerade ein Picknick im Grünen. Soweit Ben diesen Kates kannte, ließ der andere die Eisen aus dem Feuer holen, während er bequem abwartete, um den armen Teufeln dann im letzten Moment ihre schwer verdiente Beute abzuknöpfen.
Es musste schon was ganz Großes, Lukratives sein, das Kates höchstpersönlich aus der Deckung gelockt hatte.
Ben erhob sich und schlenderte zu ihrem Tisch, aber nicht ohne sich im Vorbeigehen seine Whiskeyflasche zu schnappen. Er setzte sie an den Mund und genoss einen kleinen Schluck auf der Zunge, bevor er ihn die Kehle runterrinnen ließ. Mann, ein verdammt guter Tropfen.
Kates musterte ihn mit kalter Verachtung. Ben zog die Augenbraue hoch und meinte: »Ich bin Lewis. Hab gehört, ihr sucht nach mir?«
Er musste fast lachen, als er sah, was Kates für ein Gesicht machte. Er wusste ganz genau, was der andere sah: einen unrasierten, ungewaschenen Säufer in zerknitterten, dreckigen Klamotten, der sich die Flasche an die Brust drückte, als wolle er sie nie mehr loslassen. Na ja, er hatte sich wirklich in letzter Zeit nicht mehr rasiert, seine Klamotten starrten vor Dreck, von zerknittert gar nicht zu reden, und die Pulle wollte er so schnell auch noch nicht rausrücken. Er war gerade von einem höllischen Trip ins Landesinnere zurückgekehrt, und das Rasieren und Waschen konnte warten, bis Thèresa Zeit hatte, denn sie stieg gern mit ihm in die Wanne. Und dieser Whiskey war in der Tat ein feines Gesöff, das erste, das er seit Monaten zu sehen bekommen hatte. Und wenn er die Flasche auf seinem Tisch stehen ließe, würde sie sich der nächstbeste Bastard schnappen. Er hatte für die Pulle bezahlt, also ging sie dorthin, wo er hinging, basta.
Der andere dagegen schien vor Aufregung fast zu platzen. »Sie sind Ben Lewis?«, fragte er eifrig.
»Jep.« Der Typ sah aus wie Mitte dreißig, vielleicht auch älter, denn seine jungenhaften Züge, die erste Anzeichen von Verlebtheit zeigten, konnten täuschen. Ein Blick genügte Ben, um den Typen einzuschätzen: ein Taugenichts, einer, der sich pausenlos beschwert, dass er im Leben zu kurz kommt, anstatt den lahmen Arsch hochzuhieven und was dagegen zu tun. Und selbst wenn, dann wäre es höchstwahrscheinlich was in der Art von Ladendiebstahl, Bankraub oder so. Sich einen ordentlichen Job zu suchen und zur Abwechslung mal richtig zu arbeiten, fiele einem Kerl wie dem nicht im Traume ein. Ben war selbst nicht gerade der Typ, der von neun Uhr morgens bis fünf Uhr abends irgendwo in einem Büro hockte, aber zumindest hatte er es aus eigener Kraft zu etwas Kies gebracht, ohne ihn jemandem zu klauen.
»Wir haben gehört, dass Sie der beste Führer hier in der Gegend sind«, sagte der andere Mann. »Wir möchten Sie für eine Expedition anheuern.«
»Tatsächlich?« Ben schnappte sich einen Stuhl, drehte ihn herum und setzte sich rittlings darauf, die Arme auf die Lehne gestützt. »Es stimmt, ich bin der Beste, aber ich weiß nicht, ob ich zu haben bin. Bin gerade erst von ’ner Reise zurückgekommen und wollte eigentlich nun mal ein bisschen relaxen, bevor ich wieder auf die Piste gehe.«
Nun wirkte Steven Kates nicht mehr gar so angeekelt. Offenbar überkam ihn die Ansicht, dass ein Mann, der gerade den Dschungel hinter sich gelassen hatte, ruhig unrasiert und dreckig aussehen durfte. »Wir würden Sie gut bezahlen, Mr. Lewis.«
Mr. Lewis? Es war so lange her, dass Ben mit »Mister« angesprochen worden war, dass er sich schon spontan umdrehen wollte, um zu sehen, ob da nicht jemand hinter ihm stand. »›Lewis‹ reicht«, sagte er. »Das müsste eine verflixt gute Bezahlung sein, denn ich bin hundemüde und würde gern mal wieder ein paar Wochen lang in einem richtigen Bett schlafen.« Ein richtiges Bett mit einem Hasen drin.
»Zehntausend Dollar«, sagte Kates.
»Für wie lange?«, wollte Ben wissen.
Kates zuckte die Schultern. »Wissen wir noch nicht. Es ist eine archäologische Expedition.«
Das bezweifelte Ben. Er konnte sich Kates beim besten Willen nicht bei etwas so Wissenschaftlichem wie einer archäologischen Expedition vorstellen. Obwohl – als Tarnung möglicherweise. Das wäre in der Tat interessant. »Und wohin soll’s gehen? Dann kann ich eventuell schätzen, wie lange es dauern wird.«
Der andere Mann holte eine Landkarte von Brasilien raus und breitete sie auf dem Tisch aus. Die Karte war mickrig; tatsächlich sah sie aus, als wäre sie aus einem Atlas rausgerissen worden. Er tippte mit dem Finger auf ein Gebiet weit im Landesinneren und nördlich des Amazonas. »Irgendwo da. Wir wissen’s selbst nicht genau.«
Ben starrte die Karte unter halb gesenkten Lidern an und nahm noch einen Schluck Whiskey. Scheiße, das Zeug war echt gut. Brannte einem richtig die Gurgel weg. Nur die besänftigende Wirkung des Whiskeys hielt ihn davon ab, laut aufzulachen. Das Ganze war einfach lächerlich. Da kamen diese Komiker ernsthaft mit ’ner Karte angewackelt, die sie aus irgendeinem Schulatlas gerissen hatten, und hatten keine blasse Ahnung, worauf sie sich da einlassen wollten. »Das ist unerforschtes Gebiet da oben«, sagte er schließlich. »So weit drin war ich noch nie, und ich kenne niemanden, der’s war.«
»Aber können Sie’s?«, fragte der zweite Mann tief enttäuscht.
Ben schnaubte. »Scheiße, natürlich könnte ich’s. Wer sind Sie überhaupt?«
»Ich heiße Rick Sherwood, und das ist Steven Kates.«
Kates benutzte also seinen richtigen Namen. Anscheinend dachte er, dass ihn hier unten niemand kannte. Das hieß, er fühlte sich sicher.
»Tja, Rick Sherwood und Steven Kates, ich kann Sie schon dorthin bringen. Ich war zwar noch nie da, aber ich weiß, wie man im Dschungel zurechtkommt. Wahrscheinlich macht’s auch nix aus, wenn ich nicht genau weiß, wo ich bin, solange ihr nicht genau wisst, wo’s hingehen soll. Aber mit zehntausend brauchen Sie bei mir gar nicht erst anzufangen. Für das Geld kriegen Sie nicht mal einen halbwegs anständigen Führer. Wir reden hier von zwei, womöglich drei Monaten in der Hölle. Ich kriege zweitausend die Woche, und Sie berappen außerdem den Proviant und die Träger, die wir brauchen. Für mich macht das etwa zwanzig-, fünfundzwanzigtausend und für alles Übrige noch mal etwa zehn Riesen. Also, sind Sie jetzt immer noch so scharf auf Ihre ›archäologische Expedition‹?«
Die beiden tauschten wortlos einen Blick. Seine Betonung der letzten beiden Worte war ihnen entgangen. »Selbstverständlich«, sagte Kates ungerührt.
Jetzt war Ben mehr als neugierig, er war regelrecht fasziniert. Kates hatte nicht mal mit der Wimper gezuckt, was bedeutete, dass egal, was es dort gab, so viel Geld wert war, dass fünfunddreißigtausend Dollar nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellten. Und Kates hatte sich gewiss nicht aus dem brennenden Wunsch heraus entschlossen, seinen Namen in einem Ausgrabungsbericht abgedruckt zu finden. Den Fundort plündern, das schon eher. Vorausgesetzt, es gab so was überhaupt, was Ben bezweifelte. Im Dschungel verschwanden menschliche Spuren ebenso schnell, wie der Mensch sie hinterlassen konnte. Trotzdem, solange er nicht genauer wusste, worum es hier ging, musste er wohl davon ausgehen, dass es dort so was wie eine Ausgrabungsstätte gab. Was anderes gab’s in der Gegend bestimmt nicht. Aber was konnte so wertvoll sein, dass es einen Schleimer wie Kates anlockte? Es gab Hunderte von Geschichten über irgendwelche verlorenen Schätze im Dschungel oder sonst welche Mythen, aber nichts davon war wahr, soweit er wusste. Die Leute waren dauernd auf der Suche nach versteckten Kostbarkeiten, gefunden wurde nie was, bis auf das eine oder andere Schiffswrack. Aber die Leute glaubten nun mal gerne dran – das war eine Binsenweisheit. Er selbst jedenfalls würde nicht sein Geld für eine fruchtlose Suche nach irgendwelchen Goldtöpfen am Ende irgendwelcher Regenbögen verschwenden.
»Und ich krieg mein Geld im Voraus«, erklärte Ben.
»Wie bitte? Sie haben sie wohl nicht mehr alle, was?«, prustete Sherwood empört.
Kates sagte bezeichnenderweise gar nichts, sondern runzelte nur ein wenig die Stirn.
Ben nahm noch einen herzhaften Schluck aus der Pulle. »Ich betrüge meine Kundschaft nicht«, versicherte er. »Sonst würde sie mir bald ausgehen. Umgekehrt kann ich das jedoch nicht behaupten, hab’s am eigenen Leib erfahren müssen. Ich krieg mein Geld im Voraus, oder wir kommen nicht zusammen.«
»Es gibt noch andere Führer, Lewis.«
»Sicher gibt’s die. Aber keinen, der so gut ist wie ich. Es liegt bei Ihnen. Wollen Sie lebend wieder da rauskommen oder nicht? Wie gesagt, ich hab gerade erst ’nen Höllentrip hinter mir. Hätte nichts dagegen, erst mal ein bisschen Urlaub zu machen, bevor ich mich erneut ins Geschirr lege.«
Ben war sich durchaus im Klaren, dass er nicht ganz die Wahrheit sagte, aber bluffen gehörte nun mal zum Job. Wenn diese Dödel nicht wussten, wie man’s machte, war das nicht sein Problem. Es gab in dieser Gegend Indianer, die sich besser im Dschungel auskannten, als das bei ihm je der Fall sein würde. Aber genau diese Indianer konnten auch die größte Gefahr für jeden darstellen, der sich in ihr Territorium vorwagte. Es gab im Dschungel nach wie vor Stämme, die noch nie einen Weißen gesehen hatten, und riesige Gebiete, die noch unerforscht waren. Man konnte nie wissen, was einen dort erwartete. Zumindest hatte es keiner, der dort war, je wieder rausgeschafft, um davon zu berichten. Teufel, soweit er wusste, wimmelte es dort sogar von Kopfjägern.
»Erkundigen Sie sich ruhig«, sagte er und erhob sich lässig. »Wie gesagt, ich brauche den Job nicht, aber Sie brauchen weiß Gott den besten Führer, den Sie kriegen können.«
Wirklich komisch, wie Menschen nach etwas gieren, von dem sie glauben, dass es schwer zu haben ist. Wie nicht anders zu erwarten, überzeugte sie gerade seine Gleichgültigkeit davon, dass er der Beste war.
»Nicht so hastig«, sagte Kates. »Sie sind angeheuert.«
»Na gut«, sagte Ben ebenso lässig wie vorher. »Und wann soll’s losgehen?«
»So bald wie möglich.«
Er seufzte. Verflucht. Er hatte auf ein paar freie Tage gehofft, aber fünfundzwanzig Riesen – und zum Schluss mehr – waren fünfundzwanzig Riesen. »Also gut.« Er warf einen Blick auf seine Uhr. Halb vier. »Treffen wir uns um sieben noch mal hier, dann können wir die Details besprechen.« Dann hätte er wenigstens zwei Stunden mit Thèresa und sich zusätzlich auf Hochglanz poliert.
»Das können wir auch jetzt machen«, sagte Sherwood.
»Sie vielleicht, ich nicht. Also bis sieben.« Ben walzte hinüber zu Thèresa. »Gib mir deinen Schlüssel«, sagte er und knabberte an ihrem Hals herum. »Ich dusche mich schon mal und warte dann im Bett auf dich.«
Lachend fischte sie den Schlüssel aus ihrer Tasche. »Wie du willst, aber ich hatte eigentlich vor, mit dir zusammen in die Wanne zu steigen.«
»Ich hab zu tun, Schätzchen. Wenn ich schon gebadet habe, bleibt uns mehr Zeit im Bett.«
»Wenn das so ist, dann ab mit dir.« Sie zwinkerte ihm zu und küsste ihn. Ben schlenderte davon, verfolgt von drei Augenpaaren, aber nur eines dieser Augenpaare interessierte ihn. Weiber. Wenn die Süßen je rausfanden, wie abhängig die Männer wirklich von ihnen waren, würde das die gesamte Machtstruktur der Welt verändern. Vielleicht waren Männer ja nur deshalb größer und stärker als Frauen. Damit sie überhaupt ’ne Chance hatten.
Rick hatte Jillian angewiesen, für die Lagerung der Sachen, die sie nicht auf die Expedition mitnehmen würden, zu sorgen; dann war er mit Kates verschwunden, um den Führer aufzuspüren, der ihnen empfohlen worden war. Sie war froh, endlich allein zu sein, da sie Dinge zu erledigen hatte, von denen sie nicht wollte, dass die beiden sie erfuhren. Zunächst sorgte sie für die sichere Unterbringung ihrer Sachen. Sie suchte den Hotelmanager auf, der nicht gerade begeistert über ihre Bitte war. Aber da es ohnehin nicht viel war, was sie zurücklassen wollten, und sie für die Lagerung zwei Monate im Voraus bezahlte, ließ er sich erweichen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – sie unterhielten sich in einer Mischung aus Englisch und Portugiesisch – begriff sie, dass er es missbilligte, dass sie als Frau an dieser Expedition teilnahm.
»Viele Männer kommen nie wieder zurück, Senhora«, sagte er bekümmert. Er sah wie der typische Latino aus, klein, untersetzt, glatte, glänzend schwarze Haare und kohlschwarze, funkelnde Augen. »Der Dschungel verschlingt sie, und sie verschwinden auf Nimmerwiedersehen.«
Der Mann war der irrigen Annahme, sie wäre verheiratet, doch Jillian dachte gar nicht daran, ihn entsprechend aufzuklären, denn das hätte ihn nur in Verlegenheit gebracht, und ihr war es egal. Es kam öfter vor, dass man sie eher für Ricks Frau als für seine Schwester hielt, denn sie sahen sich, bis auf die Tatsache, dass sie beide braune Haare hatten, überhaupt nicht ähnlich. Der Hotelmanager war ein netter Kerl, und sie hätte ihm am liebsten tröstend die Hand getätschelt. »Ich verstehe ja Ihre Sorge«, sagte sie, »und ich teile sie. Glauben Sie mir, ich nehme den Dschungel nicht auf die leichte Schulter. Aber ich bin Archäologin und durchaus an raue Bedingungen gewöhnt. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon mehr Nächte in einem Zelt verbracht als im Bett. Seien Sie versichert, ich werde extrem vorsichtig sein.«
»Das hoffe ich sehr, Senhora«, entgegnete er mit unglücklichem Gesichtsausdruck. »Ich selbst würde nicht gehen.«
»Aber ich muss, und ich verspreche Ihnen, wirklich aufzupassen.«
Was die Wahrheit war. Sie kannte die Gefahren, in die sie sich begab, auch wenn sie bisher hauptsächlich in trockenen, heißen Landstrichen gearbeitet hatte. Hier konnten sich sowohl Flora als auch Fauna als tödlich erweisen. Sie hatte alle nötigen Impfungen vornehmen lassen, besaß einen großen Vorrat an Antibiotika und Insektenschutzmitteln, dazu einen mehr als ausreichend bestückten Erste-Hilfe-Kasten. Sie hatte Erfahrung in der Versorgung von alltäglichen Wunden und schützte sich außerdem mit einer Dreimonatspackung Anti-Baby-Pillen, die sie als Antihistamin getarnt in ihrem Erste-Hilfe-Kasten ins Land geschmuggelt hatte.
Sie versuchte nicht, sich vorzugaukeln, dass sie mit allem locker fertig werden würde, was ihnen der Regenwald an Gefahren in den Weg legen würde. Sie würde wachsam sein, aber Unfälle konnte es immer geben, ebenso wie Verletzungen oder Krankheiten. Schlangenbisse zum Beispiel waren eine der Variationen. Sie hatte zwar entsprechende Medikamente dabei, aber nicht gegen jedes Schlangengift gab es ein Gegenmittel. Gefahren drohten ebenfalls von feindlichen Indianerstämmen, denn sie würden ein Gebiet betreten, das unerforscht und niemals kartografiert worden war. Nein, es war unmöglich vorauszusagen, was ihnen alles passieren konnte.
Rasch beendete sie ihre Angelegenheiten mit dem Hotelmanager und verließ das Hotel. Sie hatte ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen: Sie wollte sich eine gute Waffe besorgen. Manaus mit seinen breiten Alleen und dem europäischen Ambiente war schließlich ein Freihafen, da dürfte es nicht allzu schwer werden. Hier gab es so gut wie alles zu kaufen.
Da sie an Los Angeles gewöhnt war, fiel es ihr sicher leichter, die feuchte Hitze zu ertragen, als beispielsweise jemandem aus Seattle; trotzdem, die Dampfhitze setzte einem zu. Dabei war jetzt die beste Jahreszeit – die Wintermonate Juni, Juli und August –, die trockenste Zeit des Jahres also und die Temperaturen daher vergleichsweise erträglich. Nun, »trocken« hieß hier wahrscheinlich, dass es nur etwa einmal am Tag regnete, wenn man Pech hatte, auch zweimal oder gar dreimal. Sie hoffte zwar auf Ersteres, war aber auf Letzteres gefasst.
Sie schlenderte eine Zeit lang durch die Gegend, ohne sich jedoch allzu weit vom Hotel zu entfernen. Und sie hielt die Augen offen. Nach nur zweihundert Metern hatte sie schon sieben verschiedene Sprachen aufgeschnappt. Manaus war eine faszinierende Stadt, mit einem Seehafen, obwohl es zwölfhundert Meilen weit im Landesinneren lag. Die weltmännische Atmosphäre, die so ein großer Hafen mit sich brachte, den selbst Luxusliner frequentierten, gefiel ihr. Vermutlich waren es die Besatzungen und Eigner dieser Schiffe, die für die Sprachenvielfalt verantwortlich zeichneten. Der majestätische Amazonas war ein Gesetz für sich; an manchen Stellen war er so tief, dass noch zirka 15 Meter Wasser unter den Kielen der Luxusliner lagen.
Rick war stark vergrätzt, weil sie darauf bestanden hatte, die Karte für sich zu behalten. Er sprach kaum ein Wort mit ihr, außer wenn er ihr irgendwelche Anweisungen zuknurrte. Aber davon ließ sie sich nicht beirren. Sie war auch und vor allem ihres Vaters wegen zu dieser Expedition aufgebrochen, nicht nur um ihrer selbst willen. Eigentlich sogar mehr seinetwegen. Sie war ein starker Mensch, der für sich selbst eintreten konnte – und für den Ruf ihres Vaters. Wenn es ihr nicht gelang zu beweisen, dass die Legende um die Anzar wahr war, würde man ihn für alle Ewigkeit für einen Spinner halten. Was gleichzeitig bedeutete, dass sie Rick nicht alles anvertrauen durfte.
Sie wünschte, er hätte überhaupt nichts von der Sache mitgekriegt, aber leider war es anders gelaufen. Rick war hereingekommen, als ihr gerade klar geworden war, was sie da in Händen hielt. Wahrscheinlich wollte er überprüfen, dass sie nicht doch irgendwas Wertvolles klaute – und leider war sie nicht in der Lage gewesen, ihre Aufregung zu verbergen. Er hatte den Blick über die um sie verstreuten Papiere schweifen lassen, hatte die Landkarte entdeckt und war ausnahmsweise mal zum richtigen Schluss gekommen, obwohl er es eine »Schatzkarte« nannte.
Tagelang lag er ihr in den Ohren, ihm die Koordinaten zu geben. Doch sie kannte ihren Bruder; er war das, was man früher einen Tunichtgut genannt hätte. Er hätte die Informationen garantiert, lediglich an seinen Profit denkend und keinesfalls an den Ruf des Professors, an den Meistbietenden verhökert. Eine sorgfältige Bearbeitung des Fundorts durch ausgebildete Archäologen sowie die behutsame Verwahrung etwaiger Fundstücke oder deren Übergabe an die brasilianische Regierung, wie es das Gesetz vorschrieb, wären ihm sicher ebenso wenig in den Sinn gekommen. Sie hatte sich dann um einen Sponsor bemüht, aber einfach keinen für dieses Unternehmen gefunden. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte sie sich auch die nötigen Dokumente beschafft. Doch auf all ihre Erkundigungen und Anfragen hatte sie nur Spott und Herablassung geerntet. Ja, sie konnte sich sogar lebhaft ausmalen, was die Leute dachten: Jetzt hat es die Tochter des spinnerten Sherwood ebenfalls erwischt.
Am Ende war es dann Rick gewesen, der Steven Kates ins Spiel brachte. Aus Gründen, die nur er kannte, war Kates bereit, das Projekt zu finanzieren. Jillian hatte darauf bestanden, dabei zu sein, um den Fund so weit wie möglich zu bewahren. Dennoch konnte sie sich eines Gefühls der Bitterkeit nicht erwehren, dass sie, nur wegen der Ignoranz ihrer lieben Kollegen, in eine solche Lage gebracht worden war. Hätte man ihr oder ihrem Vater nur ein Quäntchen Vertrauen geschenkt, dann wäre diese Expedition mit erfahrenen Archäologen und verlässlichen Führern bemannt worden anstelle des skrupellosen Gesindels, das, wie sie befürchtete, Rick und Kates anschleppen würden. Hätte sie nur einen einzigen anderen Ausweg gesehen, sie hätte sich dafür entschieden. So wie die Dinge lagen, musste sie es jedoch nehmen, wie’s kam. Ja, sie war Pragmatikerin, und zwar eine, die auf alles gefasst war. Sie hatte die genauen Koordinaten der steinernen Stadt auswendig gelernt, damit sie sie mitnehmen mussten. Und jetzt würde sie zusätzlich für eine Waffe sorgen.
Eine logische Vorsichtsmaßnahme. Sie konnte mit einer Pistole umgehen, was in ihrem Berufszweig recht nützlich war. Schlangen und andere Gefahren gehörten zum Berufsrisiko. Diesmal, so fürchtete sie, würden die Schlangen wohl eher zur zweibeinigen Sorte gehören, aber das war ein Risiko, das sie eingehen musste. Sie hoffte nur, den Schaden in Grenzen halten zu können; sie würden sie ja wohl nicht gleich umbringen oder im Dschungel aussetzen, wo sie elendiglich zugrunde gehen würde. Zwar war Rick als Mann und Bruder eine herbe Enttäuschung, doch er war kein Mörder. Zumindest hoffte sie, dass er vor drastischeren Maßnahmen zurückschrecken würde. Was Steven Kates betraf, das blieb abzuwarten. Auf den ersten Blick zumindest machte er einen recht zivilen Eindruck. Falls das Gegenteil der Fall sein sollte, nun, sie wäre zumindest auf alles gefasst.