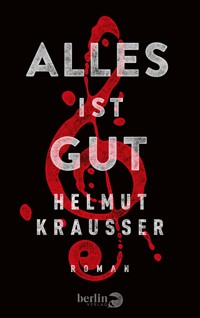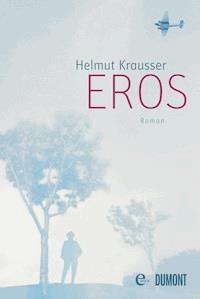
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander von Brücken lernt Sofie in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs kennen. Er ist Spross einer Dynastie von Fabrikbesitzern, sein Vater verkehrt mit den Größen des Nazi-Regimes. Sofies Eltern arbeiten in seiner Fabrik, erst die Enge der Luftschutzkeller führt die Kinder zusammen. Doch einen Kuss von Sofie gibt es nur gegen Geld. Denn Alexander von Brücken ist reich, er bleibt es sein Leben lang. Und ein Leben lang bleibt er besessen von Sofie. „Eros" erzählt die Geschichte einer unerfüllten Leidenschaft. Alexander von Brücken kann sich jeden Wunsch erfüllen, nur den einen nicht. Er nutzt sein Vermögen, um ein anderes Leben zu erkunden, zu begleiten – und zu beeinflussen. 1967, nach dem Besuch des Schahs, geht Sofie in den Untergrund. Als ihre terroristische Zelle plant, von Brücken zu entführen, soll sie den Lockvogel spielen. „Eros" verfolgt zwei Menschen in einem Versteckspiel durchs Deutschland der Nachkriegszeit – bis in die Untiefen einer Terrorszene, die keine Aussteiger duldet, und bis in den Unterschlupf eines Stasi-Plattenbaus. „Eros" erzählt die Jahrzehnte überspannende Geschichte eines Jägers und seiner liebenswerten Beute: ein Roman auf Liebe und Tod. „Viel mehr kann man von Literatur nicht verlangen!" FRANKFURTER RUNDSCHAU
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Helmut Krausser
EROS
Roman DuMont
Von Helmut Krausser sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen: Aussortiert. Kriminalroman Die kleinen Gärten des Maestro Puccini. Roman Die letzten schönen Tage. Roman Einsamkeit und Sex und Mitleid. Roman Nicht ganz schlecht Menschen. Roman Plasma. Gedichte Substanz. Tagebücher
eBook 2012 © 2006 DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln Alle Rechte vorbehalten
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,
niemand bespricht unseren Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
Dorn. Nie Masse.
Minna des Eros
deines Romans –
sondereinsam,
im so rasenden
Daemonenriss
maroden Seins,
das sie normen.
Dann reim es so.
Mein so andres –
o send es mir. An
Nemos Eisrand,
an Nimrods See,
Niemandsrose,
Ordensname: I.S.
Denn Amor seis.
Inge Schulz
Vorabend
Ohne viel von ihm zu wissen, außer dem wenigen, was es hier und da zu lesen gab, und ohne ihn je gesehen zu haben, außer auf schon angegilbten Fotografien, war er mir widerlich. Dennoch reiste ich an, als er mich rief. Wer meiner Kollegen wäre seinem Ruf nicht gefolgt? Alle, ausnahmslos alle hätten sie ihre Neugier gestillt.
Auf der Zugfahrt, die mich zu ihm brachte, war ich ein Mann in zerrütteten Verhältnissen, der einen Mann von sagenhaftem Reichtum besuchen würde, zu einem mir unbekannten Zweck.
Unterlassen Sie die kleinlichen Fragen. Kommen Sie, schrieb er, Sie werden es nicht bereuen, versprochen.
In dieser Formulierung lag Arroganz und Magie. Mir graute vor der Faszination, die sein scheinbar großmäuliges Versprechen auf mich ausübte. Ich schwor, mich nicht kaufen zu lassen, zu keinem Preis – und wußte im selben Moment, daß, wer solche Schwüre leistet, die drohende Gefahr nicht nur spürt, sondern ihr entgegeneilt. Mit der Verlockung ein wenig zu spielen, ja, das nimmt man sich vor. Ein Angebot, gleich welcher Art, zu erhoffen, zu prüfen, schon um Geltungsdrang und Eitelkeit zu füttern, auch dies erlaubt man sich im voraus. Sich aber vorzunehmen, dann, danach, standhaft zu bleiben, grenzt bereits an Selbstbetrug. Diese Sätze schrieb ich in mein Notizbuch, während grauer, aufgewirbelter Schnee die Fenster des Abteils erblinden ließ.
Das letzte Foto, das Alexander von Brücken zeigte, war vor mehr als zwanzig Jahren entstanden. Seither schien es niemandem gelungen zu sein, ihn vor das Objektiv einer Kamera zu bekommen. Es hieß, er lebe zurückgezogen auf seinem Schloß im südlichen Oberbayern, umgeben von wenigen Bediensteten.
Das stürmische Winterwetter steigerte meine Furcht vor ihm und vor mir selbst. Auf dem winzigen Provinzbahnhof angekommen, suchte ich vergeblich nach einem Kiosk, um irgendetwas zu kaufen, vielleicht einen Schnaps. Außer mir entstiegen nur drei angetrunkene ältere Damen dem Zug, in Faschingsverkleidungen, johlend und kichernd. Neidisch sah ich ihnen hinterher. Auf dem Bahnhofsvorplatz wartete ein großer schwarzer Daimler, mit einem Chauffeur, der zu seinem grauen Sacco eine schwarze Trainingshose trug und Turnschuhe. Er machte keinerlei Anstalten, mich zu sich zu winken, saß einfach im Wagen, die Tür halb offen, und hörte Schlagermusik im Radio. Es war Sonntag, halb sechs Uhr abends und schon fast dunkel. Ich mußte lachen. Lachte, beinahe verzweifelt, das zugeschneite Dorf an, dessen Silhouette Mühe hatte, sich aus dem wirbelnden Grau des Sturms herauszuschälen. Ob er, fragte ich den Fahrer, ohne meinen Namen zu nennen, auf mich warte? Er, ein korpulenter, dümmlich wirkender Mensch, nickte und bat mich einzusteigen. Die Lichter aus den Fenstern der umliegenden Häuser schienen mich zu betrachten. Der Wagen legte kaum zweihundert Meter in der Minute zurück, kämpfte sich vorwärts durch die Schneemassen, bog von der Landstraße ab in eine von wenigen Laternen beleuchtete Allee. Ich sah über die rechte Schulter des Fahrers nach vorne, in Erwartung des Schlosses. Und bekam etwas zu sehen, für das die Bezeichnung Schloß prahlerisch war, ein Schlößchen vielleicht, ein zugegeben eindrucksvolles Herrenhaus neogotischen Stils, von einer zwei Meter hohen steinernen Mauer umgeben.
Pforten schwenkten auf, die Räder drehten kurz durch, ein Garagentor hob sich. Die Garage war kaum größer als die einer Doppelhaushälfte, dem Gebäude unangemessen. Der Fahrer parkte, stieg langsam aus und öffnete mir die Tür. Neben ihm stand plötzlich, wie aus dem Nichts, ein älterer schlanker Mann im grauen Zweireiher, mit scharfen, adlerhaften Zügen und hellen, graublauen Augen.
Er stellte sich, ohne mir die Hand zu reichen, als Keferloher vor, Lukian Keferloher, von Brückens Privatsekretär. Kein sehr herzlicher Empfang, sachlich, höchstens. Er entschuldigte sich für das Wetter, erstaunlich, und bat mich, ihm zu folgen, öffnete eine Metalltür und stieg eine steinerne Wendeltreppe voran, zwei, vielleicht drei Stockwerke nach oben. Wir betraten durch eine sehr schmale Tür einen hohen, von elektrischen Kandelabern gedämpft erleuchteten Raum oder besser: Saal, spärlich möbliert, mit holzgetäfelter Decke. Vor den gelbgetönten Fenstern Schneegestöber. Leises Pfeifen im Gebälk, wie ein Kind durch eine Zahnlücke Luft stößt, mit der Unterlippe als Flatterzunge, fast ein wenig anzüglich in den Obertönen, aber die konnten meiner Einbildung entspringen, mich fror. Keferloher deutete in den Saal und schloß kurz die Augen, wohl die knappste Art, eine Verbeugung anzudeuten.
Der Richtung seines halb ausgestreckten linken Arms folgte ich drei Schritte.
So bekam ich ihn zum ersten Mal zu Gesicht. Von Brücken saß in einem wuchtig verzierten Ledersessel, an einem ganz und gar leeren Schreibtisch aus Kirschholz. Erhob sich nicht, um mich zu begrüßen, wiewohl er den Kopf schräg legte, wie in Erwartung einer Qual.
Ich trat mit schnellen Schritten, Selbstbewußtsein demonstrierend, zu ihm hin.
Als würde ihm, spät, aber doch, bewußt, daß der Empfang beleidigend wirken könnte, senkte er den Kopf und hielt mir, ohne sich zu erheben, die rechte Handfläche hin, sie zitterte leicht.
Vor dem imposanten Kirschholztisch stand, beinahe niedlich, eine Art Schemel, auf dem er mich Platz zu nehmen bat. Ich sah ihn an. Frech und tapfer, wie ich es mir vorgenommen hatte. Kühl, leicht herablassend. Und er sah wiederum mich an, anders, als ich es erwartet hatte. Müde, traurig, fast bittend.
Laut Brockhaus war er über siebzig Jahre alt, 1930 geboren. Mein erster Eindruck war der eines entschlossenen Menschen, dessen Zeit immer schon knapp gewesen war, die nun aber, noch knapper geworden, nach äußerster Effizienz verlangte. Ich erwartete von daher, daß er sein Anliegen in schnellen, zackigen Sätzen vorbringen würde, stattdessen musterte er mich, lange schweigend, bevor er seufzend, fast erleichtert murmelte:
»Nun sind Sie endlich da. Danke.«
Ich wußte nichts zu erwidern, fühlte mich geschmeichelt, fühlte mich korrumpiert, nickte, nickte wissend, obgleich es nichts zu wissen gab.
»Sie sind von allen Künstlern, die ich kenne, der beste. Es ist mir, lassen Sie mich das sagen, eine Ehre, Sie hier zu Gast zu haben.«
Ich hätte nie gedacht, daß er einen solch sicheren Geschmack besaß.
»Danke«, antwortete ich knapp und fügte, betont schnell und zackig hinzu: »Ich bin sehr gespannt.«
Seine Lider flatterten, als wäre ihm Staub in die Augen geraten. Er rieb sich das rechte Auge mit einer diskreten Bewegung der zitternden Hand und sah auf den leeren Schreibtisch vor sich. Dann legte er den Nacken zurück und rieb ihn am Sesselleder, was katzenhaft wirkte und ein bißchen – ordinär, habe ich damals spontan gedacht, heute würde ich es gequält nennen.
»Es wird Zeit, etwas festzuhalten. Nicht unbedingt mein Leben, aber die Geschichte einer Liebe. Meiner Liebe. Sie ist bisher unerzählt, muß aber erzählt werden, sonst geht sie verloren und ist nie geschehen. Ich möchte, daß Sie ein Buch für mich schreiben. Einen Roman.« Er machte eine lange Pause, vielleicht hoffte er auf eine schnelle, zackige Antwort. Mein Schweigen mißfiel ihm, er hob, kaum hörbar seufzend, zu einer Erklärung an.
»Was geschrieben steht, ist auf gewisse Art geschehen, es ist mein Weg, etwas sehr Geheimes öffentlich zu machen. Der Mensch, den es betrifft, wird nie davon erfahren, und doch ist es für mich, als würde er es erfahren, wenn Sie es niederschreiben, allein, weil die Welt davon erfährt.« Erneut eine lange Pause, weniger kalkuliert diesmal, er suchte nach Worten.
»Was ich diesem Menschen angetan habe, wird so nicht entschuldigt und nicht ungeschehen gemacht – aber durch die Veröffentlichung des Verbrechens, durch die Bekanntgabe eines Unrechts, glaube ich, mindert sich das Verbrechen doch. Sie haben das einmal gut in Worte gefaßt – das Ungeheuerliche wird ins Statistische transportiert, ich mochte diese Stelle sehr in Ihrem letzten Buch. Sie wissen, welche Stelle ich meine.«
Ich nickte. Er nickte.
»Wie dem auch sei. Ich besitze, aus irgendeinem Grund, Vertrauen zu Ihnen. Sollten Sie den Auftrag zu meiner Zufriedenheit abschließen, werde ich verschwinden. Es wird sein, als hätten wir uns nie getroffen. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Sie können das Manuskript nach meinem Tod veröffentlichen, mit geänderten Namen, nach einer gewissen Zeit, es wird als Produkt Ihrer Erfindungsgabe gelten, vom Makel der Lohnarbeit befreit. Sie werden mir dankbar sein, vertrauen Sie mir auch.«
Seltsames ging vor. Von Brücken war aufgestanden und langsam um meinen Schemel herumgegangen. Seine Stimme war fester und fester geworden, zuletzt war sie von der gewinnenden Art eines Henkers, der dem Delinquenten versichert, er wolle es ihm so einfach machen wie möglich, es helfe ja nichts, man müsse da jetzt durch.
Er verfügte über die Gabe, an manchen Stellen sehr direkt, ja grob zu werden, die Grobheit aber sofort wieder zurückzunehmen, dem Beleidigten aufzuhelfen, bis dieser die Beleidigung nicht nur verzieh, sondern die nachgereichte Entschuldigung beinahe als Auszeichnung empfand. Eine Taktik, die mir von diversen Verlegern her vertraut war.
Sein rechtes Augenlid funktionierte zeitweise nicht mehr richtig, hing schlaff, das Auge halb bedeckend, herab. Ansonsten bot er ein tadelloses Bild, schlank, hochgewachsen, die Gesichtszüge straff und gebräunt. Das granitgraue Haar schuppte ein wenig, hin und wieder wischte er beiläufig über eine seiner Schultern, immer nur über eine von beiden, die flüchtige Bewegung sollte nicht auffallen. Er trug einen betont schlichten dunkelblauen Anzug, ohne Krawatte, darunter ein kragenloses graues Hemd von fast priesterlichem Schnitt.
War es an mir, etwas zu sagen? Von Brücken zog eine Schublade des Schreibtischs heraus, stellte zwei Rotweingläser auf die ins Holz eingelassene Lederfläche.
Ob ich Lust auf einen guten Schluck hätte, fragte er und wartete meine Antwort nicht ab, schwenkte plötzlich eine Flasche in der Hand, die auf dem Boden gestanden haben mußte.
»Ein Petrus 1912. Haben Sie derlei schon mal getrunken?«
Nein, hatte ich nicht. Ich empfand die Frage als protzig bis demütigend, bis ich an seinem Lächeln ablas, daß sie so nicht gemeint gewesen war. Er schenkte beide Gläser halbvoll, reichte mir eines.
»Ich habe diesen Wein vor fast sechzig Jahren schon einmal getrunken, mein Vater ließ mich am Abend des 14. November 1944 einen Schluck davon kosten. Welche Verschwendung, damals. Ich trank, verständnislos, war danach leicht beschwipst, von Genuß konnte indes keine Rede sein. Wissen Sie, ich möchte ungern Metaphern bemühen, aber –«
Er nippte. »Oft scheint mir, daß die meisten Menschen das Leben trinken, wie ich damals als Vierzehnjähriger diesen Wein. Es wird einem gesagt, daß da etwas ganz Besonderes, sehr Kostbares sei, und man gibt sich alle Mühe, nicht undankbar oder zu jung oder ignorant zu erscheinen, aber –«
Er führte den Satz nicht zu Ende. Es war auch nicht notwendig. Notwendiger vielleicht war zu erwähnen, daß jener Wein, der legendäre Petrus von 1912, zwar köstlich schmeckte, aber nicht so überirdisch, wie es seiner Legende entsprochen hätte. Es fällt mir schwer, das so zu sagen, aber – der Wein ließ mich reichlich kalt. Von Brücken las meinen Augen die Enttäuschung prompt ab, schmunzelte und sagte:
»Nicht wahr, es ist nur Wein?«
»Na und?«
Wie störrisch ich gewesen bin. Wie eitel.
Von Brücken stellte ein Tonband auf den Schreibtisch, schaltete es an. Und schaltete es wieder ab.
»Ich bin ungeduldig. Es ist heute abend nicht die richtige Zeit. Lukian wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Falls Sie etwas benötigen, was Sie dort nicht finden – Lukian wird es Ihnen besorgen. Und haben Sie keine Bedenken. Lukian ist gewohnt, Wünsche jeder Art zu erfüllen. Morgen früh werden wir uns hier treffen. Und die Geschichte wird beginnen. Geben Sie dem Wein dann eine zweite Chance. Wenn man die überzogene Erwartungshaltung erst abgelegt hat, hält er, was seine Legende verspricht.«
War das nur auf den Wein bezogen oder wieder metaphorisch gemeint? Der alte Mann lächelte zweideutig. Als sei er die ganze Zeit im Raum gewesen, stand plötzlich Keferloher hinter mir, der Privatsekretär. Ich nickte kurz, bedankte mich, folgte Keferloher ins Treppenhaus, stellte, in meinem Zimmer angekommen, vor mir selbst klar, noch keinerlei Einverständnis signalisiert zu haben. Daß ich hier übernachten würde, war selbstverständlich, schon wegen des Wetters, das allein bedeutete nichts. Vielleicht hätte ich gerne ein paar Worte über das Honorar gewechselt. Von Brücken schien daran keinen Gedanken zu verschwenden. Und warum verschwendete ich daran soviele Gedanken, wenn ich innerlich nicht längst zugesagt hatte?
Ein Roman. Den ich erst veröffentlichen dürfte, wenn von Brücken gestorben war. Den ich aber fertigstellen müßte, bevor er sterben würde, damit er ihn noch lesen könnte. Oder? Interessanter Punkt. Ich würde mich unter keinerlei Zeitdruck setzen lassen. Würde mich allzu feudalistischen Bedingungen strikt verweigern.
Das Zimmer, in das Keferloher mich führte, machte einen angenehm erkerhaften Eindruck, rund, mit kleinen Fenstern in zweieinhalb Himmelsrichtungen. Das Bett war groß, ein Tisch sehr breit, ein Sessel sehr bequem, ein Kühlschrank sehr voll. Der Fernseher konnte neunundneunzig Sender empfangen, es gab etliche Lampen, aus denen man sich passende Lichtverhältnisse herbeikombinieren konnte. Keferloher murmelte, ich könne mich mit all meinen Wünschen an ihn wenden. Er wies auf eine Klingel hin, über dem Bett. Der Koch würde mir jederzeit warmes Essen zubereiten, rund um die Uhr. In einem unsinnigen Reflex anerzogener Bescheidenheit gab ich mich mit dem Vorhandenen völlig zufrieden.
Erster Tag
»Neinnein, Sie müssen nicht hudeln. Schreiben Sie an dem Buch, solange Sie wollen und müssen, ohne Rücksicht auf mich zu nehmen. Ich werde es vermutlich, höchstwahrscheinlich sogar, nicht mehr lesen können, leider, Sie haben dennoch mein vollstes Vertrauen. Ihr Honorar bekommen Sie in jedem Fall, selbst wenn Sie nur leere Seiten abliefern sollten. Ich glaube, unter diesen Bedingungen wird sich Ihr Stolz nicht allzusehr angegriffen fühlen und man kann, ausnahmsweise, den Begriff vollstes Vertrauen wörtlich nehmen. Stimmts?«
Ich nickte. Was blieb mir übrig? Das angebotene Honorar übertraf meine kühnsten Träume, würde mich mein ganzes Leben lang finanzieller Sorgen entledigen. Von Brücken senkte die Stimme.
»Solange ich lebe, sind Sie sicher. Danach könnte es sein, daß …«
»Wie bitte?«
»Daß Sie Schwierigkeiten bekommen. Es wird Personen geben, die nicht wollen … Lukian zum Beispiel. Er weiß, was Sie vorhaben, was wir vorhaben, und er heißt es nicht gut, glaube ich. Er würde es nie laut sagen, aber, wenn ich erst tot bin, wird er mich beerben, wir haben diese Abmachung, die ich einhalten muß und auch einhalten werde. Wenn ich also tot bin, könnte es sein, daß ihm dieses Buch, selbst mit veränderten Namen, mißfällt, wegen der Rolle, die ihm darin zukommt. Ich glaube nicht, daß er … naja, aber vielleicht wird er versuchen, Ihnen das Buch abzukaufen, mit all dem Geld, das ihm dann zur Verfügung stehen wird. Das könnte geschehen. Mein Vertrauen in Ihre künstlerische Eitelkeit, vielmehr in Ihre künstlerische Lauterkeit, ist groß genug, um diese Bedenken halbwegs zu zerstreuen. Dennoch sollten Sie lieber, sobald Sie von meinem Tod erfahren, einen Ort aufsuchen, an dem man Sie nicht so leicht, sagen wir, erreichen kann.«
Er wußte, daß alles, was er sagte, meine Neugier nur vervielfachte, doch las ich in seinen Augen auch ernste Sorge. Nicht um mich, vielmehr um das Buch. Um seine Geschichte.
Draußen war das Schneetreiben zum Stillstand gekommen. Hin und wieder drang Sonne durch die Wolken und gab dem verrußten Saal ein behagliches Flair aus schlaffen, leicht vergelbten Schatten.
Das Tonband lief.
Die letzten Tage des Eispalastes
Stellen Sie sich eine kurzgeschorene, sehr gepflegte Wiese vor. Darauf ein Pavillon im pseudochinesischen Stil, darunter eine sehr gepflegte deutsche Familie im Sonntagsstaat: Der Vater, die Mutter, ich, etwa dreizehn Jahre alt, und meine Schwestern, die Zwillinge, drei Jahre jünger.
Dahinter ein großes Haus, eine große weiße Villa im Sonnenlicht. Es ist hell, eine fast gleißende Helle umgibt jene Menschen. Man sitzt um einen runden zartgrünen Marmortisch. Darauf stehen sechs Eisbecher mit Zitroneneis. Es sind sechs Stück, weil Keferloher zu Gast ist.
Keferloher war es, der in dieser Sekunde unserer Allacher Villa, der riesigen weißen Jugendstilvilla im Norden Münchens, den Namen Eispalast gab, scherzhaft, an jenem Augustnachmittag, an dem er mit meinen Eltern im Gartenpavillon Zitroneneis zu sich nahm und die Farbe dessen, was er aß, verglich mit der Farbe dessen, was er in der Sonne leuchten sah.
»Eispalast!« rief ich, trunken von dem schönen Wort, und meine schwesterlichen Papageien griffen es mit ihren grellen Stimmchen auf: »Eispalast! Eispalast!«
Cosima und Constanze hießen sie, benannt nach Komponistenwitwen. Ich nannte sie meistens Coco Eins und Coco Zwei.
Keferloher war damals geschäftsführender Direktor in den Fabriken meines Vaters, Fabriken für Metallverarbeitung und Vulkanisiermaschinenbau, die ein Jahr nach Kriegsbeginn auf die Produktion von Rüstungsgütern aller Art umgestellt worden waren. Mein Vater betrat die Gebäude so selten wie ungern und ausschließlich zum Zweck der Repräsentation. Das Wort Fabrikbesitzer klang ihm verhaßt, als Beruf gab er stets, sogar bei den Behörden, Architekt an. Ohne je irgendwo ein Diplom abgelegt zu haben. Dennoch zu Recht. Wenn jemand für die Architektur gelebt hat, war es mein Vater; die Frage, ob er Talent besaß oder nicht, rückt in den Hintergrund vor so viel Passion. Er entwarf Kirchen, Brücken, Parkanlagen … Alles für die Schublade. Oder für eine ferne Zukunft – nach dem Krieg.
Im Eispalast waren eine Köchin, zwei Putzfrauen, ein Diener, ein Gärtner und drei Erzieher angestellt. Kein Chauffeur. Das lohnte sich nicht. Papa fuhr immer selbst, wenn er fuhr, auch wenn das unsere Mutter entsetzlich fand. Mama litt unter gelegentlichen Ohnmachtsanfällen. Niedriger Blutdruck. Das war ihr peinlich, aber ansonsten ging es uns gut, mustergültig gut. Ein viertes Kind hätte ihr das bronzene Mutterkreuz beschert; sie legte keinen Wert darauf.
Es ging uns so gut, daß Papa in jedem Jahr Familienfotos knipsen ließ und diese, wie Kunstwerke gerahmt, an die Wendeltreppe zum ersten Stock nageln ließ. Wir waren, glaube ich, tatsächlich eine Art symbolbefrachtetes Kunstwerk für ihn, und wenn eines von uns Kindern sich nicht kunstgerecht gebärden wollte, tadelte er es mehr aus ästhetischen denn aus pädagogischen Motiven.
Meine Schwestern bekamen Klavierunterricht. Ich, weil ich mich wenig musikalisch gezeigt hatte, mußte die Posaune erlernen, ein Instrument, welches mein Vater als »auch mit geringer Neigung bald beherrschbar« ansah. Wenigstens ein Instrument zu beherrschen, sei für jeden Kulturmenschen Bedingung. Ebenso legte er Wert auf alte Sprachen sowie eine fundierte theologische Ausbildung. Nicht, weil er sehr gläubig gewesen wäre, sondern weil er die Theologie für den Nährboden eines, so drückte er sich aus, höheren philosophischen Auseinandersetzungswillens mit der Welt ansah, ähnlich heutigen Eltern, die ihre Kinder wieder zum Konfirmationsunterricht schikken, nur um sicherzustellen, daß aus ihnen später gute Atheisten werden.
Unser Familienleben wurde von meinem Vater raffiniert durchdacht, von meiner Mutter loyal unterstützt. Was sie nicht begriff, machte sie durch Gehorsam und Hingabe gut. Oft beobachtete ich Papa, wie er die Stirn senkte und, von der Auffassungsgabe seiner Gattin frustriert, Ablenkung in einem Teppichmuster suchte, wie er dann Trost dadurch empfing, daß jenes geborene Freifräulein von Hohenstein, ein solches war meine Mama, keiner Anordnung zu widersprechen wagte. Oh, ich begriff, welche Anstrengung meinen Vater jenes Dasein als Oberhaupt einer mustergültigen Familie kostete, begriff auch, welchen Stolz er am Ende eines Tages neben sein Kissen bettete, er, dieser gebildete, künstlerisch veranlagte Mensch, der, nach schlichten Prämissen, alles Wesentliche geschafft hatte, der reich war, geachtet und geschmackvoll, der die Pflicht zum Nachwuchs in Einklang gebracht hatte mit einem Leben in geheimer Überhöhung. Gut, natürlich lüge ich hemmungslos, natürlich begriff ich es damals nicht wie heute, natürlich war ich ein undankbarer Pimpf, der sich unreine Reime auf alle Dinge erlaubte und feist in unbewußtem Wohlstand dahinlebte.
Meine Schwestern hatten Glück. Sie wären geistig ernsthaft nur ausgebildet worden, wäre mir etwas zugestoßen. So konnten sie dumm bleiben und sich an vielerlei kleinen Dingen freuen. Mein Vater machte keinen Hehl aus seiner Geringschätzung des weiblichen Geschlechts, jedoch tat er es als etwas Bedauernswertes ab, was geändert werden müßte, wenn es denn je geändert werden könnte.
Insofern war er mit seiner Gattin recht zufrieden. Zeigte keine Ambition, ihr mehr zuzumuten oder beizubringen als nötig. Mich dagegen behandelte er wie seine liebste Rippe, aus der sein Ebenbild geschnitzt werden müßte. Weihte mich ein in die Mysterien germanischer Hochkultur – was ich damals, unter uns gesagt, todlangweilig fand.
Was mir mein Vater vor allem beibringen wollte, war eine Form der Würde, die in der Größe erhaben, in der Not stoisch reagierte, und sich immer um die eigene Wirkung mehr bewußt war als um das eigene Wohlergehen, ganz und gar auf Äußerlichkeit bedacht, so, als sei der Mensch nichts, ohne Menschen, die ihn beurteilten. Alles, was mein Vater tat, tat er wie unter Beobachtung einer strengen Jury, die Haltungs- und Charakternoten vergab. Individualität schien ihm etwas zu sein, dem man sich erst nach der Vorstellung, quasi in seinen Privaträumen hingeben durfte, selbst dann nicht unkontrolliert. Vielleicht bin ich zu hart im Zusammenreimen meiner Erinnerungen, aber mir meinen Vater ausgelassen vozustellen, von reiner, lärmender Freude beseelt, dazu reicht meine Phantasie nicht hin. Ich glaube, er litt daran, daß er nie auf eigenen Füßen stehen mußte, daß er von der Wiege auf in eine Ordnung hineinwuchs, die zu verweigern es keinen vernünftigen Grund gab. Er mußte nie etwas aus sich machen, mußte nur zum bereits Vorhandenen passen, eine ihm angewiesene Leerstelle ausfüllen. Dies tat er mit Glanz und Bravour, und erst als seine Welt aus den Fugen geriet, fand er sich vor Entscheidungen gestellt, mit denen sein Denken nicht mehr zurechtkam.
Von seinen architektonischen Entwürfen wurde so gut wie nichts verwirklicht, was nichts besagt, da es ihm um die Realisierung seiner Ideen ja gar nicht ging. Seine Kreativität begnügte sich mit Papier, Rechenschieber und Bleistift. Mir, im Gegensatz zu den Papageien, zeigte er manchmal die Skizze eines Theaters, einer Parkanlage, einer Gartenbrücke. Ich war alt genug, um zu begreifen, daß ich diese Dinge noch nicht begreifen mußte, ja durfte, daß ich sie ausschließlich zu sehen bekam, um auf meinen Vater stolz zu sein, nicht, um über sein Werk ein Urteil abzugeben.
Mein Vater war ein Humanist und überzeugter Deutscher. Den Nazis gegenüber keineswegs von blinder Hingabe, dennoch aufgeschlossen, überrascht von ihren Erfolgen. Das deutsche Reich in den Grenzen von ’42 nötigte ihm Vergleiche mit Rom unter Traianus ab. Er fand das auf gewisse Weise großartig, einmal äußerte er, sinngemäß, die Deutschen gäben dem Wort Geschichte seine alte Wucht und Dimension zurück.
Nun ja. Ich übte Posaune. Sehr ungern. Meine Mutter sagte mir, daß es nun mal so sein müsse. Weil es eben ist, wie es ist. Damals klang das logisch. Die Posaune besitzt den Vorteil, daß man lesen kann, während man bläst.
Einmal wurde ich beim Lesen vor lauter Posaunespielen ohnmächtig. Die Papageien rannten in mein Zimmer, nahmen mir das Buch weg, ich kam wieder zu mir, rannte ihnen hinterher. Unten an der Treppe stand mein Vater, mit dem Buch in der Hand. Es war Justine, vom Marquis de Sade. Ich hatte das Buch aus seinem Giftschrank gestohlen. Nun – er hätte mich nie geschlagen. Leibliche Berührung war ihm immer etwas unangenehm. Er verschloß das böse Buch im Giftschrank und redete zwei Wochen nicht mit mir. Vielleicht hatte er Angst vor einer Aussprache. Ich hätte ihn schließlich fragen können, weswegen er dieses Buch besaß.
Mama zeigte Sorge, daß ich von ihr die Neigung zur Ohnmacht geerbt hätte, und ich mußte fortan nicht mehr so viel Posaune üben. Aber mit De Sade war’s aus. Mir blieb nur ein medizinischer Atlas, mit dem Schemen eines weiblichen Körpers darin, der Harnröhre und Leber in derselben Farbe darstellte. Zwei Wochen später dann sagte mein Vater zu mir:
»Denk daran, daß du ein Deutscher bist. Dürer schaut auf dich herab!« Und er zeigte auf einen Druck in der Diele, Dürers Selbstbildnis, mit langem Haar, ich glaube, es war ein Ersatz, weil er Jesus nicht so ganz leiden konnte. Dürer schaut auf dich herab! Das wurde irgendwann, selbst für meine flachen Schwestern, zum geflügelten Wort, über das man heimlich lachte, beim Lachen aber Scham empfand und Verbotenheit. Wie man irgendwann aufs Feld geht und ruft: Gott, du bist ein blöder alter Gauch! Und kein Blitz fährt hernieder, weil Gott gerade nicht hingesehen hat. Dürer dagegen sah immer herab.
Daß ich von drei Privatlehrern unterrichtet wurde, war schlimm und langweilig genug, aber zu allem Übel war es meinem Vater eingefallen, mich, gegen meinen Willen und ohne Angabe von Gründen, vor der Hitlerjugend zu bewahren.
»Hast du eine Ahnung«, fragte er, »was ich unternehmen mußte, um dir das zu ersparen?«
Ich begehrte patriotisch auf, wollte Pimpf sein und in Zelten schlafen, liederschmetternd den Wimpel meines Fähnleins durch Wotans dunkle Wälder tragen. Und ein Fahrtenmesser haben. »Ich will aber! Alle sind dabei!«
Er duldete keine Diskussion, schob mich in die Arme meiner Mutter, die mir dringend riet, zu schweigen, es sei nun einmal, wie es sei, und nichts, was ich täte und sagte, könne die Entscheidung meines Vaters noch ändern.
»Glaub mir«, sagte sie stets, »ich kenne ihn länger als du.«
Sein Steckenpferd war romanische Architektur, speziell jene in Oberbayern, ich glaube, er träumte davon, daß die Architektur irgendwann einmal neoromanische Züge tragen könnte, und er dann ihr staatsbeauftragter Experte und oberpriesterlicher Baumeister werden würde – eine Verrücktheit? Gewiß, aber in Anbetracht der Machtverhältnisse schien überhaupt nichts verrückt genug, um nicht eine gewisse dunkle Hoffnung zu erlauben. Vielleicht stießen die Nazis bei ihm deshalb auf Duldung – sie ließen so gut wie alles als möglich erscheinen, hatten die Welt aus der Bahn geworfen, ein simples Faszinosum des Neuen, das im Rückblick meist unterschätzt wird. Ich glaube, wer damals dachte, der Faschismus sei zwar etwas zu Verurteilendes, sei aber von solch überwältigender Kraft, daß er die Welt in den nächsten Jahrzehnten beherrschen werde, dem kann man nicht plump Dummheit vorwerfen. Wenig hätte gefehlt, und der Lauf der Geschichte hätte demjenigen Recht gegeben. Zu glauben, das Gute habe aus sich selbst heraus siegen müssen, ist Idiotie.
Zur Leibesertüchtigung spielte ich Tennis, dreimal die Woche, mit Volker, dem erstgeborenen Sohn Keferlohers. Er war vier Jahre älter als ich und deshalb als Auskunftsstelle in geschlechtlichen Fragen ungeeignet. Ihm war anzusehen, daß er mit mir Tennis spielen mußte, weil sein Papa der Vize von meinem war. Wir spielten schweigend, jeweils eine Stunde pro Tag. Ich habe im Leben nichts Blöderes gemacht, wenigstens nicht so regelmäßig.
Volker ist später an der Ostfront gefallen.
Der Krieg kam uns näher. Meine Erinnerungen nehmen zu. 1944, im März, wurde das Residenztheater total zerstört, im April Sankt Bonifaz, mit der romanischen Basilika Zieblands, die meinem Vater als Muster historischen Bauens gegolten hatte. Sowie die neuromanische Maximilianskirche, das Hauptwerk des Freiherrn Heinrich von Schmidt. Sogar die Details sind mir noch geläufig. Jedesmal weinte Papa. 1944. Das erste Jahr der Furcht. Vorher war es ein wirklich toller Krieg, ich würde lügen, wenn ich behauptete, es anders empfunden zu haben. Und nun: Phosphor, Feuer, Schrecken. Gelbe, graue, schwarze und braune Schwaden verdüsterten tagelang den Himmel. In nächster Nähe: Straßen, übersät von Splittern und Trümmern. Der Brandgeruch, der Brand- und Mauerschutt in hohen, stinkenden Haufen. Juni und Juli lag der Angriffsschwerpunkt im Norden der Stadt, BMW wurde schwer getroffen, trotz künstlichen Nebelschutzes, die in Allach liegenden Werke von BMW und Krauß-Maffei erlitten leichtere Treffer. Mitte Juli brannte der Chinesische Turm im Englischen Garten, danach erwischte es den Tierpark Hellabrunn. Viele Tiere starben, Zebras, Antilopen, Büffel, Rentiere, Kamele, Bären und Hirsche. Fast alle Münchner Schulen waren beschädigt. Mein zuvor beargwöhnter Privatunterricht stand nun außer Frage. 1944 war das Jahr des stärksten Flakfeuers. Das hellklingende Surren der anfliegenden Maschinen verdichtete sich zu einem ungeheuren Brausen, die zweite Welle, die dritte, vierte. Von nun an gab es Bomben mit Zeitzündern, die in die Häuser einfuhren, in halber Höhe des Hauses oder im Schutt des Einsturzes steckenblieben und dort erst nach sechzig bis achtzig Stunden explodierten. Ich wurde religiös. Ich betete zum Führer, bestraf sie! Ich hatte nie zum Führer gebetet, aber der Haß, den ich beim Anblick der halb zerstörten Stadt empfand, trieb mich dazu, den meines Glaubens Einzigen anzubeten, der die Macht besaß, solche Verbrechen zu bestrafen. Nebenbei: Krauß-Maffei überstand den Krieg fast unversehrt. Möchte man nicht glauben. Und, stellen Sie sich vor, was heute kaum noch jemand weiß: Im Sommer, bis Mitte September, beinahe übereinstimmend mit den Sommerferien, gab es keinen einzigen Angriff. Die Menschen entspannten ein wenig. Dann flogen sie wieder, die Mustang, Lightning, die viermotorigen Stirlings, Mosquitos, Halifax und Lancasters, die Briten kamen in der Nacht, die Amis, mit ihren B17-Fortresses und B27-Liberators, am Tag.
Wir verzärtelten Eispalastbewohner hatten gelernt, mit Volksgasmaske, Feuerpatsche, Löscheimer, Einstellspritze und Verbandskasten umzugehen, wenn nicht in der Praxis, so zumindest in der Theorie. Am nordwestlichen Ende von Allach lag ein Standort der schweren Flakartillerie, mit viel Hitlerjugend im Einsatz, als Meldegänger, Helfer der Feuerschutzpolizei und was weiß ich noch alles. Mir blieb das Meiste erspart.
Und ich begegnete Sofie zum ersten Mal.
Man hörte von Norden die ersten Einschläge, danach erst die Alarmsirenen, so spät war’s inzwischen in Deutschland. In unserer Straße lebten viele, die in den Werken meines Vaters arbeiteten. Diese Straße besaß nur einen einzigen Luftschutzkeller. Meiner Mutter war das gar nicht recht. Mir schon. Inzwischen mochte ich den Luftalarm.
Luftalarm bedeutete, es würde eine Möglichkeit geben, Sofie nahe zu sein.
Von nun an war alles anders. Wenn ich die Sirenen hörte, zuerst war es ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute Länge, später zwei auf- und abschwellende Heultöne von insgesamt acht Sekunden Dauer, eine höllische Musik, aber, wissen Sie was:
Mein Herz juchzte, und wenn es Abend war, juchzte es noch lauter, quiekte wie ein glückliches Schwein, denn – wir würden vermutlich die ganze Nacht im Luftschutzkeller verbringen, ich oben auf dem Stockbett, mit anderen Kindern aus meiner Straße, und wenn ich es ein bißchen arrangierte, würde ich mit ihr, meiner Geliebten, die ganze Nacht in einem Bett zubringen. Welcher Vierzehnjährige kann das von sich behaupten! Wenn eine Bombe in der Nähe explodierte, würde ich einen Vorwand haben, Sofies Hand zu halten. Sie gehörte zu einer jener Familien in unserer Straße, die nicht arg viel zu verlieren hatten, die umso inniger um jenes bißchen beteten. Ich wünschte mir jede Nacht einen Bombenhagel. Oh, wie ich sie liebte! Wie man eben liebt, wenn man es nicht gewohnt ist. Nicht? Sie kennen das? Natürlich. Heute scheint mir, es war da plötzlich eine Liebe in mir, vielmehr der Wille zur Liebe, der, nachdem er sich in mir eingenistet hatte, nach einem Opfer Ausschau hielt, nach dem erstbesten hübschen Mädchen, kann schon sein, nicht? Plötzlich wollte ich nicht mehr zur HJ. HJ – das war für Kleinkinder. Ich hatte ein Ziel, einen Sinn, ein, wenn auch noch vages Gefühl.
Ich erinnere mich an jene Nächte so gut. Meine Mutter, die sich unwohl fühlte zwischen den einfachen Menschen und nicht reden wollte, mein Vater in stoisch ausdrucksloser Haltung. Wir Kinder, in Schuhen und voller Bekleidung, mein Herzschlag, ferne Bombeneinschläge, die schlafende Sofie – sie war so jung und schlank, hatte schon sichtbare Brüste, und ihr Haar, damals mußte es heißen: ihr Zopf – ihr rotbrauner Zopf reichte bis zum Steiß hinab.
Ihr Körper war ein Zauberbild aus wundervollen Biegungen. Dieser riesige, zugleich bodenlos lächerliche Zauber der ersten Verliebtheit.
Wenn Haut zu leuchten beginnt, nur weil sie über den Schädel eines Mädchens gespannt ist, an dem prima vista nichts auszusetzen ist. Diese austauschbare Verliebtheit, die irgendeine Dahergelaufene trifft, sich aber zu solch maßloser Intensität aufschwingen kann und Ekstase – und man Erwachsene für verblödet oder tot hält, weil sie über einen dümmlich grinsen und offensichtlich keine Ahnung von der Liebe haben. Wenn sie schlief, suchte ich nach abgefeimten Tricks, wie ich mir eine Berührung erschleichen könnte, ohne den Verdacht zu erregen, verliebt zu sein. Sie kennen das? Na, wer nicht? Es gab auch ausgedachte Tricks für künftige gemeinsame Bäder im Fluß, gemeinsame Duschen oder Neumondwanderungen im Wald.
Der Traum, einmal ihre nackten Schultern zu sehen. Aber wir – ihre Schultern und ich – gingen ja nicht einmal ins Kino zusammen. Wir lagen zwar des öfteren in einem Bett, aber, so blöd es klingt, nah kamen wir uns nie. Ich summte Liebeslieder, lautlose Liebeslieder, deren Text ich vergessen habe, sang in mich hinein, nächtelang, wurde nicht müde, meine Liebe mit Liedern zu preisen, es war, wie es sein soll, und ich träumte, ganz Deutschland würde explodieren, nur wir zwei lägen, lebendig verschüttet, irgendwo in restwarmer Asche, die Luft ginge uns aus und ich spendete ihr meinen letzten Atem in einem langen Kuß – solches Zeug, ich nehme nichts davon zurück, nein, es war gut so und herrlich.
Ich werde Ihnen Sofie nicht genauer beschreiben. Beschreiben Sie sie, aber so, daß jeder sich angesprochen fühlt. Sie war ja nichts Besonderes, damals bestimmt nicht. Außer für mich.
Sie müssen Farben für Sofie finden, wie kein Maler sie je angerührt hat. Müssen Wörter finden, die Götter den Dichtern nur in stillsten Stunden übereignen, und Sie müssen, ach nein, es ist alles Unsinn, was ich sage, Vermessenheit, nein, schreiben Sie, eine schöne, sehr junge Weiblichkeit, punktum, jeder soll sich genau jene vorstellen können, die er für die Schönste hält, einen gewissen Zauber kann man nur teilen, mitteilen, indem man Feinheiten verschweigt, sehen Sie mich nicht so herablassend an, ich weiß, Sie werden das gut machen, ja.
Echte Freunde besaß ich zwei. An ihre Gesichter kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Dafür an ihre Geschlechtsteile. Alfons hatte einen sehr langen, gekrümmten, fast violetten Penis, Bodo einen eher kurzen, dick und weiß wie Milch. Den Rekord hielt ich mit 21 Sekunden zwischen erstem Anfassen und Abspritzen. Ich hätte es, bei vorheriger heimlicher Stimulierung, sogar schneller geschafft, aber im Wettkampf zu betrügen hielt ich für grob undeutsch. Alfons und Bodo waren meine Freunde in zwei Sommern, dann gingen sie zur HJ. Beide sind gefallen, glaub ich, keine Ahnung. Sie waren plötzlich weg, aus den Augen, aus dem Herzen.
Wissen Sie noch, wie das war? Sein Geschlecht zum ersten Mal dem freien Himmel zu zeigen, bei Nacht, oder, noch erregender, in einem Schlupfwinkel des Tages, noch erregender mit der Möglichkeit, es könne jemand einen dabei entdecken, noch erregender: eine Frau, noch erregender: eine junge, hübsche Frau.
Unser Garten war riesengroß, ein Pavillon stand darin, eine Vogeltränke und eine Laube, in der ich Apatsche war oder mir meinen Penis ansah. So oft, daß ich auf den Tag genau sagen kann, wann ich (20. März 42) den ersten Schimmer einer Schambehaarung an mir bemerkte. Zu dieser Zeit onanierte ich längst, aber beim Höhepunkt kam nur ein Spritzer Urin. Das Sperma folgte ein halbes Jahr später, von einem Abend auf den nächsten war es da, ganz rätselumwoben übergangslos. Ich kostete davon, es schmeckte widerlich, ich war bitter enttäuscht und gab jede Hoffnung auf, daß irgendwann ein Mädchen bereit sein könnte, einen Schwall dieses Saftes zu schlukken. Daß Mädchen dies überhaupt manchmal tun, wußte ich vom göttlichen Marquis.
Jüngere Schwestern zu haben, kann auch von Vorteil sein. Einmal band ich CocoEins an einen Stuhl, dann zog ich ihr den Rock hoch und sah mir alles genau an. Sie heulte und trat, aber das war mir egal. Sie interessierte mich nicht, war noch unbehaart, und wenn da noch keine Haare sind, hatte Alfons gesagt, ist das Loch nur zum Pissen gut. Ich nahm mein Ding heraus, spielte damit herum, nicht erregt, nur aus Angabe, und spritzte auf ihren Bauch ab. Sie staunte. »Was tust du da?« fragte sie, und ich: »Was Indianer mit allen weißen Frauen tun.« Dann band ich sie los, sie rannte gleich zu CocoZwei und erzählte ihr alles, die glaubte es nicht und bat mich, ich solle das in der Garage für sie noch einmal machen, aber als ich sagte, sie müsse sich dafür ausziehen und mir ihr Loch unten zeigen, wollte sie nicht. Wollte nicht! Das war es ihr nicht wert! Komisch, nicht?
Aber zurück zu Sofie. Irgendwann im Sommer 44 halbierte sie ihren Zopf und zeigte ihr Haar manchmal offen, das war – unbeschreiblich. Dieses Haar, ein dunkler Feuerfall in Schmelzgeschwindigkeit, darin zu wühlen, von diesem Mädchen zu kosten, alles, hätte ich, alles! – hingegeben, nichts mehr war wichtig, und hätte man mir Tausende ähnlich beschaffener Wesen gezeigt oder vorbeigebracht – sie wollte ich, keine sonst, nur sie, und ganz, gesamt, mit allem.
Und doch: Meine Liebe hätte irgendeine treffen können, irgendeines der vielen hübschen Mädchen diesseits des Todes.
Der Krieg kam mir gelegen. Wie ein dunkler Freund war er, den man vor seinen Eltern geheimhält, mit dem man sich im Verborgenen trifft und Zeichen vereinbart.
Der dunkle Freund teilte sich anfangs über das Radio mit. Starke Luftverbände werden aus dem Raum soundso gemeldet, das war unser Einstiegscode, und wenn bald darauf Alarm gegeben wurde, bedeutete das, wir müßten im Luftschutzkeller zusammenkommen, es würde eine Möglichkeit geben, Sofie nahe zu sein.
Wie sie auf dem Bett saß, die Arme um eins ihrer Knie geschlungen, unglaublich, daß keine der uralten Frauen im Keller aufstand und ihr diese obszöne Pose verbot. Und das Knie diente ihrer Wange als Kissen, im Schlaflicht ein atemberaubender Schattenriß, wenn es heiß war im Sommer und ihre Beine nackt waren. Ich kam ihr nahe, um sie zu riechen, hätte alles gegeben, um ihre Schenkel küssen zu dürfen, fast ebenso dringend war der Wunsch, mit dieser Silhouette vor Augen zu onanieren. Das war in der Enge des Kellers nicht möglich, höchstens konnte man eine Hand in die Hosentasche stecken und sein Ding ein wenig reiben, nicht genug, um es zum Abspritzen zu bringen. Vielleicht wäre es geglückt, hätte ich vorher einige Nächte lang aufs Onanieren verzichtet, ich probierte es, durchaus, doch spätestens in jeder dritten Nacht verging mir die Geduld, dann tat ich es drei-, viermal hintereinander, rauschende Feste, mit dem Beigeschmack des Verrats. Ja, Verrat. Ich empfand es so, ich betrog ja meine Geliebte mit mir selbst. Ich saß da und machte an mir rum, statt hinzugehn und sie zu erobern, oder ihr meine Liebe wenigstens zu gestehen wie ein Mann – und mannhaft zu scheitern an ihrem Gekicher. Sie schwitzte nie. Ihre Haut wirkte immer kühl und glatt, ihr Atem ging langsam, und ihre Augen waren die traurigsten der Welt, ohne daß ich je eine Träne auf ihren Wangen gesehen hätte.
Sie roch nach gerußtem Holz und Kerzentalg, was dumpfer klingt, als es gerochen hat. Ihre jungmädchenhafte Eitelkeit, dagegen die Armut, die nicht arm aussah, nur wunderbar schlicht – ein berückender Gegensatz, dessen Erotik unmittelbar auf mich wirkte. Sie verzauberte mich mit einfachen Mitteln.
Manchmal, wenn ich nahe bei ihr schlief, stahl ich aus ihrem gelösten Haar eine Strähne und spielte damit, so sanft, daß sie es nicht bemerkte. Ich steckte die Strähne in den Mund und biß darauf herum, stellte mir vor, es wären ihre Lippen. Ich räkelte mich auch auf dem Bett und schob meinen Körper zusammen, so daß mein Kopf auf Höhe ihres Beckens lag. Dann wandte ich meine Nase ihrem höchstens zwanzig Zentimeter entfernten Unterleib entgegen und sog die Luft ein, wollte den Duft ihrer Scham erschnüffeln und bebte dabei vor Angst. Unter feuerrotem Himmel, bei brennendem Deutschland. Ich so hoch oben wie das Nest eines ausgestorbenen Vogels über den Wolken. Es kam vor, daß jemand keine drei Meter von mir entfernt einen hysterischen Anfall bekam, weil die Bomben ganz in der Nähe einschlugen, das nahm ich als Vorwand, um Sofies Hand zu ergreifen. Und wissen Sie, was sie zu mir sagte? Angsthase.
Sie nannte mich einen Angsthasen. Ich sagte, mein Name sei Alex, darauf sie: »Das weiß ich.«
Da war ich sehr glücklich für einen Moment, denn Sofie wußte meinen Namen, allerdings wußte jeder im Keller meinen Namen, ich war der einzige Sohn der ersten Familie am Ort. Und dann hörte ich, wie Sofies Mutter halblaut sagte: »Ich glaub, unsre Sof ist langsam zu alt, um mit dem Sohn vom Herrn Direktor in einem Bett zu sein.« Und ich hörte meine Mutter zu meinem Vater sagen: »Was für Gedanken diese Menschen hier haben. Das ist kein Ort für unsre Kinder. Gibt es keine Möglichkeit …« Aber in diesem Augenblick war eine schwere Detonation zu hören, ich haschte erneut nach Sofies Hand, sie entzog sie mir, sah mich verwundert an. Beim darauffolgenden Alarm plazierte man meine Schwestern als Puffer zwischen uns, und die Papageien machten sich einen grausamen Spaß daraus. Ich sah vom Stockbett aus meinem Vater zu, wie er aus dem Jackett Stift und Notizblock zog und etwas zeichnete, ich konnte nicht genau sehen, was es war, etwas Eiförmiges. Er hatte eine Idee, vielleicht die originellste seines Lebens. Davon später.
Sofie besaß auch eine Schattenseite mit Namen Birgit – ihre beste Freundin. Sie war nie in unserem Bunker, wohnte einige Straßenzüge weiter südlich. Ich lernte Birgit Mitte Oktober kennen, an einem wunderschön sonnigen Herbsttag, ich hatte mir eine Lanze geschnitzt und strich durch die kleinen, vergoldeten Wälder im Norden Allachs, es war übrigens das erste Jahr, in dem ich mich vom elterlichen Grundstück mehr als hundert Meter entfernen durfte. Birgit radelte den Kiesweg am Bach entlang, während ich mit meiner Lanze imaginäre Forellen aufspießte, ein Spiel, das mir genau in diesem Moment zum ersten Mal albern und infantil vorkam. Sie radelte da lang, in ihrer braunen BDM-Uniform, und blieb stehen, ein nicht sehr gut aussehendes dunkelblondes Mädchen mit stark ausgeprägtem Kinn und fleischigen Waden.
»He, du!«
»Was?«
Sie fragte, ob ich Alex sei. Ich sagte ja, da fragte sie: »Der, der in Sof verliebt ist?«
Ich ging zu ihr hin, wurde leise, als könne jemand hören, was wir reden.
»Quatsch.« Ich sagte einfach nur: Quatsch.
»Ach, dann.«
»Was dann?«
»Dann nix.« Sie sprachs und hob sich wieder aufs Rad. Ich rief ihr laut hinterher:
»Hee … Was wärn dann?«
»Dann hätt ich dir was sagen sollen.«
»Was denn?«
»Wozu willstn das wissen, wenn du nicht der bist?«
Gott, hab ich dieses Weibsbild gehaßt. »So halt. Mußt es ja nicht sagen«, schlug ich vor, und sie, eiskalt: »Nee, muß ich nicht.«
Ich werde wohl ein entsetztes Gesicht gemacht haben, mit Augen größer als Fünfmarkstücke.
Und Birgit, die schon drei, vier Meter gefahren war, lachte, als habe sie Mitleid, und hielt nochmal an. »Was solls. Sofie ist um fünf in der Kiesgrube. Wenn du sie treffen willst.«
»In der Kiesgrube? Was macht sien da?«
»Dich treffen. Blödmann!«
Sie radelte davon, und ich konnte mein Glück nicht fassen. Mein Herz pumpte wie wild, meine Hände schwitzten. Das schien einfach zuviel Glück. Es klang bald wie … eine hinterhältige Falle. Oh, ist das ein Pleonasmus? Was meinen Sie? Einerlei. Selbstverständlich ging ich hin. Immer noch mit der Lanze bewaffnet, schlich ich mich zur Kiesgrube. Eine riesige Kies-Lehmgrube, mit drei Kratern, eine recht eindrucksvolle Landschaft, geeignet, ja, wie geschaffen für Schlachten der Mescaleroapatschen gegen Cowboys und Desperados. Weit unten, auf dem Grund des größten Kraters saß – Sofie. Spielte mit Steinen, von denen einige in ihrem Rockschoß lagen. Ich beobachtete die Umgegend. Wir würden da unten offensichtlich allein sein, ganz allein. Ich warf die Lanze weg, lief hinunter, gab Obacht, nicht zu stolpern. Was ich fühlte? Finden Sie bitte Worte dafür! Große Worte! Die Wahrheit ist nun einmal schwülstig, ab und zu. Sofies Haut leuchtete im Spätlicht. Sie trug ein weißes BDM-Hemd, darunter, das konnte man erkennen, bereits einen Büstenhalter. Sie sagte drei Buchstaben, so schnell aufeinander, daß sie ein Wort ergaben.
»Tag.« Das war nun auch eine Wahrheit und gar nicht sehr schwülstig.
»Tag.« Es folgte ein längeres Schweigen, nichts geschah, sie sah sich Steine an.
»Was machstn hier?« fragte ich.
»Und du?«
Ich zuckte nur mit den Schultern. Irgendetwas enorm Schweres saß auf meiner Zunge, ein bleierner Frosch vielleicht, der seine Backen so sehr blähte, daß kaum das schmalste Wörtchen an ihm vorbeikam.
»Ich sammel Steine. Sammelst du auch was?«
»Nö.«
»Steine sind schön. Manchmal. Und billig.«
»Ja?« Wie peinlich war mir dieses Ja! Mein Herz klopfte bis zum Hals, drückte von unten gegen den Kehlkopf, bis der Bleifrosch einmal quakte, jenes entsetzlich peinliche Ja?
»Wieviel Taschengeld bekommst du?«
Diese Frage verblüffte mich, ehrlich gesagt, der Frosch schrumpfte, ich antwortete, wahrheitsgemäß: »Zwei Mark.«
»Im Monat?«
»Woche.«
»Wahnsinn. Ihr seid wirklich reich. Sparst du auf was?«
»Auf was denn?« Ich begriff nicht, worauf sie hinaus wollte. Und Sofie fragte, ohne mich dabei anzusehen: »Möchtest du nen Kuß haben?«
»Von dir?«
Ja, da lachen Sie jetzt, aber genau das habe ich geantwortet. Sofie blickte sich um, meinte, ganz richtig, es sei ja sonst kein Mensch hier. Ich legte den Kopf schräg und nickte, so ungefähr, als ob das zwar sehr weit hergeholt sei, aber man darüber schon mal spaßeshalber nachdenken könne.
»Was wärn Kuß dir denn wert?«
Und ich schwieg. Hilflos, völlig überfordert. Wie kann man einen Kuß von der Geliebten schnöde taxieren? Jede Antwort wäre gottlos gewesen. Indes. Sofie wußte eine schockierende Antwort.
»Fünfzig Mark?«
Etwas in mir, eine kleine heisere Stimme flüsterte: Sie will einen Liebesbeweis.
Bitte sehr, Liebesbeweise sind nun mal kostspielig – aber – fünfzig Mark! Eine ungeheuerliche Summe.
»Das ist … gut.« Irgendwie räusperte ich mein Einverständnis, aber so, daß ich mich immer noch auf ein witziges Rollenspiel hätte herausreden können. Sofie sah mich lächelnd an und fragte, kühl, beinahe geschäftlich: »Morgen? Hier? Selbe Zeit?«
»Mmmhm«, murmelte ich und sie ging, verließ mich, kletterte die steile Wand hoch, sah sich kein einziges Mal nach mir um.
Ich war, auf seltsame Weise ebenso erregt wie verwirrt, in der Geschäftswelt angelangt. Nachts schlich ich mich ins Erdgeschoß, ins Arbeitszimmer meines Vaters, und stahl ihm aus der Schublade drei Zehnmarkscheine. Die restlichen zwanzig Mark besaß ich selbst. Ich wünschte mir beinah, daß er den Diebstahl bemerken würde, ich wollte gezüchtigt werden für meine Untat. Ein großer, großer Liebesbeweis. Aber mein Vater bemerkte nichts. Er war zu sehr beschäftigt mit seiner großen Idee, saß im Wintergarten, brütete über technischen Zeichnungen, von Kerzenlicht umrahmt.
In dieser Nacht war ich glücklich. Ja. Mein Vater übrigens auch. Morgens rief er die Familie zusammen, zeigte uns ein Telegramm, er schien übernächtigt, dennoch euphorisch.
»Familie!«
Diese wuchtige Ansprache gebrauchte er nur, wenn es um etwas ganz Besonderes ging.
»Der Herr Minister hat sich angemeldet. Zu einem Diner, zu einer Arbeitsbesprechung, hier in unserem Haus. In gut drei Wochen, am dreizehnten abends!«
Meine Mutter begann zu klatschen. Wir Kinder schlossen uns zögernd an, ohne zu begreifen, welche Ehre unsrem Haus widerfuhr. Ich sehe noch das stolz leuchtende Gesicht meines Vaters vor mir. Der Architekt, der nun Hitlers Rüstung organisierte, überaus erfolgreich, der Vielbeschäftigte, der Liebling des Führers höchstselbig würde uns besuchen. Damals wußte ich die Bedeutung dessen freilich nicht einzuschätzen. Aber Papa nahm mich, das tat er sonst fast nie, auf den Schoß, strich mir durchs Haar und erklärte, dieser Mann sei ein Titan unsrer Zeit, ein Mann von Stirn und Faust, von Vision und Pragmatismus zugleich. Es sei ein sehr wichtiges Datum für uns alle. Er erwarte von jedem im Haus Kooperation und Disziplin. »Daß mir da ja nicht das Geringste schiefläuft!«
Meine Sorgen waren ganz andere. Die Welt mußte nur so lange standhalten, bis es fünf Uhr nachmittags war, der Rest – egal. Ich radelte zur Kiesgrube. In der Ferne Sirenen. Aktuelle Luftgefahr. Egal. Ich radelte umso schneller, kam zum Krater, rief hinunter:
»Sofie?«
Sie saß tatsächlich dort unten, erwartete mich. In der Ferne Detonationen. Welche Entschuldigung würde ich für meine Eltern erfinden? Egal. Ich stieg hinunter, setzte mich neben dieses sonderbare Mädchen, sie wirkte nicht restlos gelassen, nein, aber auch nicht richtig nervös, ein bißchen eben nur.
Flugzeuge, weit oben am Himmel. Einsetzendes Flak-Feuer.
»Ist das dein erster Angriff im Freien?«
»Ja.«
»Meiner auch.« Sie sagte es, als wäre das angenehm aufregend. Und zum ersten Mal fiel mir etwas ein, das nicht völlig blödsinnig klang.
»Die Flieger haben freie Sicht. Die werfen ihr Zeug nicht in Kiesgruben ab.«
Prompt hörten wir einen ziemlich nahen Einschlag. Rückten unwillkürlich zusammen. Es mag bestimmt unglaubwürdig klingen, aber viel hätte nicht gefehlt, und wir hätten gelacht.
Plötzlich sagte der Frosch auf meiner Zunge: »Ich liebe dich.«
»Doofkopf. Kennst mich ja gar nicht.«
»Trotzdem.«
»Hast das Geld dabei?«
Ich zeigte ihr die Scheine.
»Du spinnst völlig.«
»Wir sind reich. Nutz es doch aus.«
»Ja. Bringen wirs hinter uns.« Sie legte ihre Arme auf meine Schultern. Ich bewegte mich fast gar nicht, wollte sie zu nichts drängen. Hatte ein Küßchen erwartet, wäre damit vollends zufrieden gewesen. Und dann – man muß sich das vorstellen: Über uns ein todbringendes Feuerwerk am Himmel, und Sofie küßte mich, wie eine schon erwachsene Frau einen Mann küßt, dem sie sich hingeben will. Das war so – so überwältigend, das war einer der größten Augenblicke meines Lebens. Aber halt, ich will nicht lügen. Vielleicht ist es für die Geschichte ganz egal, aber als wir uns küßten, war droben das Feuerwerk bereits vorbei, die angreifenden Maschinen hatten abgedreht. Vielleicht ist es egal, vielleicht bedeutete es was. Das sei Ihnen überlassen. Als Sofie und ich, vielmehr unsere Lippen, nur unsere Lippen, sich trennten, wurde gerade Entwarnung gegeben, und sie sagte, sie müsse jetzt heim.
»Wehe, wenn dus irgendwem erzählst …«
Ich gab ihr mein ritterliches Ehrenwort. Und gab ihr das Geld, das ich die ganze Zeit über in meiner Faust festgehalten hatte. Sie steckte die Scheine in ihren Kniestrumpf, sah mich etwas streng, doch wohlwollend an und meinte: »Sei nicht mehr verliebt. Bringt nichts.«
»Wer weiß? Kennst mich ja gar nicht.«
Sie lächelte knapp. Ein wenig grausam. Ich hab es niemandem je erzählt. Nein, nie. Bis jetzt.