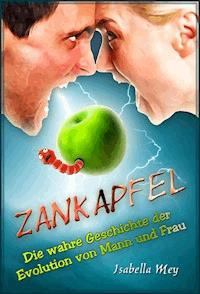0,49 €
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Manchmal bringt eine besondere Gabe mehr Fluch als Segen.
Vor allem wird es dann gruselig, wenn man jemanden wahrnimmt, den man nicht entdecken kann.
Iona, die die Emotionen anderer spürt, fühlt sich schon seit einer Weile von einem diffusen Verlangen verfolgt, wie sie es zuvor noch nie wahrgenommen hat. Umso mehr sorgt sie sich, wer oder was dahinterstecken könnte.
Leseprobe
Uns trennt gerade mal ein einziger Schritt, den der Mann entschlossen überwindet, um mein Handgelenk zu packen. Mit einer fließenden Bewegung schiebt er den Arm hinter meinen Rücken, wobei er mich gegen die Hausmauer presst. Unsere Körper berühren sich auf eine Weise, die jeglicher Beschreibung entbehrt, weil ich mich in diesem Moment vollkommen durchdrungen fühle von seiner Energie, die vor allem erfüllt ist von unbändigem Hunger. Es mischt sich noch anderes hinein, doch das tritt dermaßen in den Hintergrund, dass ich es kaum noch wahrnehme. Vollkommen gelähmt von den mich überwältigenden Energien, lasse ich es geschehen, dass dieser Mann seine Lippen auf die meinen presst.
Und dann passiert etwas, das sich anfühlt wie ein heftiger Sog. Er zieht etwas aus mir heraus, was ich jedoch nicht zu fassen vermag. Ich spüre diese kühlen Lippen, die sich mit den meinigen vereinen und schwebe zwischen einer abstrusen Hingezogenheit gepaart mit ohnmächtiger Fassungslosigkeit.
Was passiert hier mit mir? Was macht dieser Kerl? Wer ist das?
Romantasy für Jugendliche und Erwachsene, empfohlen ab 16 Jahren
Weitere Bücher der Autorin
Sternentanz
Band I - Flüstern der Nacht
Band II - Ruf der Schatten
Band III - Wispern der Dunkelheit
Schattentanz
Band I - Windschatten
Band II - SchattenMeer
Band III - SchattenRiss (Finale)
Lichtertanz
Band I – Die Magie der Glanzlichter
Band II – Die Magie der Goldwinde
Band III – Die Magie der Lichtkristalle (Finale)
Flammentanz
Band I – Funken
Band II – Flammen
Band III – Feuer
Band IV – Brand
Band V – Glut (Finale)
Fabolon
Band I – FarbelFarben
Band II – Goldenes Glück
Band III – StaubNebelNacht
Band IV – RostRoter Rubin
Band V – SchneeFlockenBlüten
In der gleichen Welt: Romantasy
WandelTräume
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nicht Lesen!
Dornbuschwein
Kriselwasser
Überfall
Streiterei
Wachmann
Beobachtet
Laterne
Danksagung und Nachwort
Ode an die Testleser
Lexikon
Karten
Impressum
Sternentanz
Flüstern der Nacht
Isabella Mey
Band I – Auftakt
Nicht Lesen!
Iona, Fabolon, Faresia, 1 Romajan 1211
Warnung: NICHT LESEN! Lege dieses Buch beiseite und vergiss, dass du es jemals gesehen hast.
In dicken roten Lettern prangt dieser Hinweis auf der ersten Seite eines wuchtigen Buches, welches in einem schon recht zerschlissenen Ledereinband steckt.
Ich blinzele.
Aus welchem Grund sollte jemand ein Buch mit einer derartigen Warnung versehen?
Bevor ich jedoch weiter darüber nachsinnen kann, wird meine Verwunderung von einer weit intensiveren Emotion überschattet: Jemand nähert sich, der sich nach kaltem Hass anfühlt, welcher mir eiskalt den Rücken hinunterkriecht. Hinter den meterhohen Bücherregalen kann ich den Urheber dieses Gefühls nicht sehen, umso deutlicher brennt sich der Eindruck seiner Präsenz in meine Eingeweide.
Meine geheime Gabe, Emotionen anderer wahrzunehmen, erscheint mir genauso wenig normal wie ich selbst es bin. Um mit meinem Anderssein nicht permanent anzuecken, versuche ich für gewöhnlich, diese Empfindungen zu ignorieren, was mir mehr schlecht als recht gelingt – vor allem dann nicht, wenn mir ein Gefühl in dieser Intensität entgegenschlägt.
Immerhin ist kalter Hass besser als dieses diffuse Verlangen, welches mich in letzter Zeit häufig begleitet – ein Verlangen, das eindeutig mir gilt und mich zu beobachten scheint. Der heimliche Spion hält sich jedoch so gut verborgen, dass ich ihn bisher nicht entdecken konnte. Umso mehr grusele ich mich davor, seine Anwesenheit zu spüren.
Mit angehaltenem Atem starre ich zum mit dicken grünen Teppichen ausgelegten Flur hinüber, in der Erwartung, gleich dem verhärteten, blassen Gesicht eines Bibliotheksbesuchers zu begegnen. Zwar kann ich nicht bestimmen, aus welcher Richtung der kalte Hass kommt, am gleichbleibenden Raum, mit dem das Gefühl meinen Bauch besetzt, merke ich jedoch, dass der Verursacher an derselben Stelle verweilt.
Durchatmend lehne ich mich in meinem Sessel zurück und schließe die Augen. Dabei versuche ich mal wieder vergeblich, die Besetzung fremder Emotionen abzuschütteln – meine Gabe bringt wesentlich mehr Probleme mit sich als Nutzen.
Was habe ich auch davon, die schlechte Laune meiner Mutter abzubekommen, während sie die schmuddeligen Leute aus dem Leuchtturmviertel bedient? Um keine Gäste zu vergraulen, überspielt sie es jedes Mal durch ein gekonnt freundliches Lächeln. Nicht viel besser ergeht es mir mit dem genervten Unmut meines Vaters, wenn er zum tausendsten Mal dieselben Gerichte zubereiten soll, statt seine eigenen kreativen Kompositionen zum Besten zu geben. Die Leute bevorzugen eben das, was sie schon kennen.
Mit Altersgenossen, die mir etwas vorspielen, gebe ich mich erst gar nicht ab, daher nutzt mir der Einblick ins Gefühlsleben meiner Freunde nur wenig. Für meinen Geschmack bekomme ich wesentlich mehr davon mit als mir angenehm ist. Außerdem lässt mein loses Mundwerk meistens schneller einen dummen Kommentar vom Stapel, als für eine gute Beziehung gesund wäre. Und noch nicht mal bei meinem Ex-Freund Leonido hat mir meine Gabe etwas gebracht. Dieser miese Rockjäger gab mir das Gefühl, die Einzige in seinem Leben zu sein. Nicht einmal ein schlechtes Gewissen hatte sich bei ihm geregt, obwohl er mit Virula dasselbe Spiel trieb. Hätte ich die beiden nicht küssend am Kai überrascht, ich hätte wahrscheinlich bis heute nichts davon bemerkt. Wohl spürte ich bei Leonido immer wieder mal Ängste, doch die Leute fürchten sich ja vor allem Möglichen. Meine beste Freundin Sandrina beispielsweise kämpft mit einer ganzen Reihe an Ängsten: Das reicht von der Dunkelheit über Nageschratten und Spinnen bis hin zur Angst, hässlich auszusehen. Da ich aber lediglich das Gefühl wahrnehme, konnte ich bei Leonido nicht erkennen, wovor er sich fürchtete. Genauso gut könnte er Angst davor gehabt haben, dass ich das mit Virula herausfinde, wie sich um seine Fähigkeiten als Liebhaber zu sorgen. Ein wenig brennt es noch im Herzen, wenn ich an Leonidos verklärten Blick aus seinen rotbraunen Augen denke, die so verboten gut mit der Farbe seines halblangen Haares harmonieren. Er hatte es wirklich drauf, Liebe nicht nur vorzuspielen, sondern das Gefühl sogar bis zu mir zu transportieren. Dabei frage ich mich allerdings schon manchmal, welcher Anteil von mir selbst stammte und welcher davon einfach über mich drüber schwappte.
Plötzlich gerät Bewegung in den kalten Hass. Die Empfindung von stechender Kälte auf meinem Bauch nimmt allmählich ab, während er sich entfernt. Ich öffne die Lider und spähe übers wuchtige Geländer in die große Halle, welche von einer gläsernen Kuppel überspannt wird. Ein Meer an breiten Treppen schraubt sich dort in die Höhe, welche zwischen ausladenden Balkonen in die oberen Stockwerke oder zu weiteren Flügeln des Gebäudes führen. Sämtliche Wände sind zugepflastert mit vollgestopften Bücherregalen, die bis zu den hohen Decken hinaufreichen. Selbst in kleinen Nischen und verwinkelten Ecken wurde noch Platz für Bücher geschaffen. In der Halle sind einige Leute unterwegs, doch noch kann ich niemanden entdecken, der nach kaltem Hass aussieht.
Ich komme sehr oft hierher, um in Büchern zu schmökern. Schließlich muss ich es doch ausnutzen, dass ich nicht weit entfernt von der größten Bibliothek ganz Fabolons wohne. Der Hauptgrund liegt aber darin, dass ich hoffe, hier endlich Antworten zu finden – vor allem darauf, weshalb ich so anders bin. Damit meine ich nicht nur meine Gabe, die Gefühle anderer Menschen zu spüren, da ist noch etwas Diffuses, das ich nicht wirklich greifen kann. Ich weiß, dass ich nicht hierhergehöre und dennoch verstehe ich nicht wirklich, weshalb. Seit ich denken kann, lebe ich bei meinen Eltern im Wirtshaus, welches ausgerechnet auf der imaginären Grenze zwischen dem verruchten Leuchtturmviertel und dem nobelsten Bezirk Faresias steht, in dem es vor Schlössern der höheren Stände nur so wimmelt. Entsprechend gut durchmischt sind unsere Restaurantgäste, wobei sich vor allem Mama mehr adeliges Publikum wünscht. Da selbst die betuchteren Kunden Papas Eigenkreationen meiden, sind ihm die Stände nicht ganz so wichtig. Aber natürlich will auch er keinen Ärger, den es schon manchmal gibt, wenn Reich und Arm aufeinandertreffen.
Eine ganz in Grau gekleidete Frau taucht auf einer breiten Portaltreppe ein Stockwerk tiefer auf. Die Stirn in tiefe Falten gezogen, poliert sie mit ihrem weißen Lappen lustlos das Geländer. Offenbar handelt es sich um eine der Bibliotheksangestellten.
Könnte sie den kalten Hass in sich tragen?
Das erscheint mir zumindest wahrscheinlich. Nicht selten spüre ich Hass und Unzufriedenheit besonders bei den niederen Ständen, die sich stets grau zu kleiden haben.
So gesehen hätte mich das Schicksal weit schlimmer treffen können. Als Wirtsleute gehören meine Eltern dem grünen Stand an, weshalb auch ich ein knielanges hellgrünes Kleid trage, sowie dunkelgrüne Strumpfhosen, die bis zu den Knöcheln reichen sowie Strümpfe und hellgrüne Stiefel aus Seeschlangenleder. In Fabenia herrscht nun mal eine strenge Kleiderordnung, die sich sowohl am Besitz als auch am Beruf orientiert und jedem der neun Stände ist eine Farbe zugeordnet.
Nun wende ich mich wieder dem Buch zu, das ich vor lauter kaltem Hass beinahe schon vergessen hatte.
Der Titel »Das Anderssein« klingt ja schon sehr verheißungsvoll, doch was sollte ich mit dieser Warnung anfangen? Abermals starre ich die roten Lettern an und runzele verwirrt die Stirn.
Warnung: NICHT LESEN! Lege dieses Buch beiseite und vergiss, dass du es jemals gesehen hast.
Eigentlich kann es sich dabei nur um einen Scherz handeln, schließlich bräuchte man ein Buch gar nicht erst verfassen, wenn es nicht gelesen werden soll. Außerdem erregt eine solche Warnung doch erst recht die Neugier auf den Inhalt. Aber vielleicht ist ja gerade das die Absicht des Verfassers gewesen und wenn ich mir den abgegriffenen Ledereinband so anschaue, ging seine Strategie gut auf.
Auf jeden Fall wirkt das Buch ziemlich alt und die Seiten aus dickem Pergament sind an den Ecken bereits leicht ausgefranst.
Gefährlich kann es doch eigentlich nicht sein, ein solches Buch zu lesen, oder?
Mit leicht zittrigen Fingern blättere ich zur nächsten Seite, auf der nun steht:
Du hast es gewagt, das Reich dieses Buches zu betreten! Sei gewarnt, denn nun gibt es kein Zurück mehr.
Ganz gegen meinen Willen spüre ich deutlich, wie sich mein Pulsschlag beschleunigt.
Welches Reich habe ich betreten? Kein Zurück mehr wovon? Was ist das nur für ein verrücktes Buch? Oder vielleicht ist das alles doch nur ein ziemlich dummer Scherz und auf der nächsten Seite lacht mir ein freches Gesicht entgegen …
Tief durchatmend wage ich es, zur nächsten Seite zu blättern, auf der nichts weiter zu sehen ist als ein Symbol. Es sieht aus, als ob darin Tag und Nacht ineinander verfließen: Ein Sternenhimmel, der in einen Strudel aus Licht eingesogen wird. Ich kann nicht verstehen weshalb, aber dieses Bild macht etwas mit mir. Es scheint, als habe sich plötzlich eine Tür in meinem Herzen geöffnet, von deren Existenz ich zuvor nicht einmal etwas ahnte. Kaum gelingt es mir, meinen Blick von diesem Symbol zu lösen, das mich förmlich in sich einzusaugen scheint.
Was geht hier vor sich? Ist dieses Buch etwa magisch verflucht?
Unter erheblichem Widerstand gelingt es mir, die Seite umzublättern. Sie zeigt eine Zeichnung in schwarzer Kohle. Von dem vergilbten Pergament schaut ein Augenpaar zu mir auf, welches es in sich hat. Der Rest des Gesichts ist blass und undeutlich verschwommen gehalten. Doch das wäre gar nicht notwendig gewesen, um den Betrachter auf die Augen zu lenken, deren durchdringender Blick mich beinahe vom Sessel reißt. Und das, obwohl ich mich eigentlich nicht so leicht durch etwas erschüttern lasse. Aber was hier passiert, geht eindeutig über meine Grenzen. Mit donnerndem Herzen schlage ich das Buch zu und lehne mich tief durchatmend zurück.
So etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert und ich habe bestimmt schon viele Tausend Bücher durchstöbert.
Was, vermoxt nochmal, ist das für ein verrücktes Buch? Warum üben simple Kohlezeichnungen eine derartige Wirkung auf mich aus?
Ein tiefer Gong reißt mich aus der Versenkung. Er soll diejenigen in die Realität zurückholen, die über ihrer Lektüre völlig die Zeit vergessen haben, damit sie das Schließen der Bibliothek nicht verpassen. Ohne das Signal hätte hier wohl schon so manch einer, mich eingeschlossen, die ganze Nacht im Gebäude verbracht. Bücher auszuleihen ist hier leider nicht gestattet. Bei »Das Anderssein« kann ich darüber jedoch kein Bedauern empfinden. Ich werfe dem ledernen Einband einen letzten düsteren Blick zu und stopfe das Buch dort ins Regal zurück, wo ich es herausgezogen hatte, und begebe mich auf den Weg nach unten. Vor allem die oberen Abteilungen besuche ich häufiger, befinden sich hier doch die Bücher über alles Magische und Außergewöhnliche. Aber auch im Flügel, in dem Reiseberichte Fabolons und anderer Welten zu finden sind, bin ich häufiger zu Gast. Verständlicherweise wünschen sich meine Eltern, dass ich eines Tages ihr Wirtshaus übernehme, doch schon immer zog es mich in die weite Welt hinaus. Wohin genau, weiß ich nicht, doch in mir tönt ein steter Ruf der Ferne, der ungehört verhallt.
Die Zentralbibliothek Faresias ist nicht nur gigantisch groß, sondern auch uralt, wobei sie im Laufe der Zeit durch immer neue Seitenflügel stetig angewachsen ist. Am Ende grub man sogar weitere Keller aus, die über mehrere Stockwerke in die Tiefe reichen. Dort unten bin ich aber nur selten, viel schöner ist es, auf einem der Balkone in einem bequemen Lesesessel unter dem Licht der Glaskuppel zu schmökern und ab und zu auf das Treppenlabyrinth hinabzuschauen. Dementsprechend lange brauche ich allerdings, um wieder bis zum Erdgeschoss hinabzusteigen. Während ich die massiven Holzstufen hinuntergehe, rückt jedoch der kalte Hass unweigerlich wieder näher. Besonders intensiv trifft er mich, als ich die Frau im grauen Kleid passiere, die gerade ein Buch aus dem Regal zieht. Grimmig murmelt sie dabei vor sich hin: »Schon wieder falsch eingeräumt …«
»Ja, das ärgert mich auch immer, wenn die Bücher falsch drinstecken«, entschlüpft mir ein Kommentar. Ich sollte die Frau einfach in Ruhe lassen, wie alle anderen wortlos das Gebäude verlassen, aber ich kann natürlich mal wieder meinen Mund nicht halten, obwohl es mir viel zu oft nur Ärger einbringt.
Und auch dieses Mal bin ich mir nicht sicher, ob meine Anmerkung wirklich so zielführend war, denn der kalte Hass verwandelt sich urplötzlich in heiße Wut. Die schwarzhaarige Frau mustert mich von oben bis unten. Ihr langes Haar hat sie mittels eines grauen Bandes zu einem unordentlichen Dutt verknotet. Eine grätenförmige Narbe zieht sich über ihre linke Wange bis zum Kiefer.
»Was kommst du mir denn jetzt so? Bist doch auch nicht besser als die anderen mit deinem grünen Kleid!«
»Hab ich gesagt, ich wäre besser als die anderen? Ganz gewiss nicht«, erwidere ich erregt. »Es war nett gemeint, weil ich mich auch immer aufrege, wenn die Bücher falsch einsortiert sind.«
»Ach, verschwinde doch, und lass mich arbeiten …« Sie wendet sich wieder ihrem Buch zu, für das sie das richtige Fach sucht.
Immerhin ist die heiße Wut nun in Frust umgeschlagen, der in meiner Nierengegend einen unangenehmen Druck verursacht.
Ich muss mich schon sehr zusammennehmen, um das Gespräch nicht noch weiterzuführen, doch die Bibliothek wird bald schließen und mein Magen meldet bereits einen ordentlichen Appetit an. »Schönen Abend noch«, verabschiede ich mich.
Zur Antwort erhalte ich lediglich ein entnervtes Schnauben, aber mehr habe ich auch nicht erwartet. Ich wende mich ab und steuere eine weitere Treppe in die Tiefe an. Je näher ich dem Ausgang komme, desto mehr Besucher reihen sich in den Strom nach draußen ein. Eine Gruppe von Kindern in roten Rüschenkleidern mischt sich mit ein paar Gelehrten, die in gelben Anzügen nach draußen drängen. Vor allem vor der Pforte staut sich die Menge, wo die Wachleute jeden Einzelnen genau unter die Lupe nehmen, ob nicht doch jemand verbotenerweise ein Buch eingesteckt hat. Aus diesem Grund ist es auch untersagt, irgendwelche Beutel, Körbe oder sonstige Behältnisse mit hineinzubringen und wer Kleider mit großen Taschen am Leib trägt, muss diese nach Außen stülpen, um passieren zu dürfen. Zum Glück ist keiner mit starken Emotionen unter den Leuten, dennoch sind mir die vielen Menschen in meiner Nähe unangenehm. Vor allem ihr Unmut und die Ungeduld prickelt mir unangenehm in den Beinen, das freudige Schwatzen der Kinder hingegen sprudelt in meiner Brust. Die restlichen Leute scheinen mit sich und ihren Problemen beschäftigt zu sein, was ein gleichmäßiges Summen in meinem Kopf verursacht. Bei all den verschiedenen Empfindungen fällt es mir schwer, mich selbst überhaupt noch wahrzunehmen und ich kämpfe bereits mit dem Gedanken, den Rückzug in die Bibliothek anzutreten, um dann erst rauszugehen, wenn sich die Schlange gelichtet hat. Aber schon von hier aus kann ich das gedämpfte Tageslicht draußen erkennen, welches den Abend ankündigt. Im rechten Flügel der mächtigen, goldbeschlagenen Tür ist eine Pforte integriert, die eher als Durchschlupf bezeichnet werden kann. Dort drängen sich nun alle hindurch, die bereits gemustert worden waren. Da heute ganze sechs Wachleute am Eingang postieren, geht es immerhin rasch voran, weshalb ich mich doch zum Durchhalten entschließe.
Die Menge spült mich einem Wachmann mit Schnauzbart zu, dessen eindringlicher Blick unangenehm von meinen Lippen zu meinen Brüsten hinabgleitet, welche nicht gerade üppig ausfallen. Noch weniger behagt mir das wollüstige Gefühl, von dem dieser Blick begleitet wird.
»Sieht man doch, dass da keine Bücher drinstecken können«, speit ihm mein loses Mundwerk mal wieder vorschnell entgegen, wobei ich meiner eher mickrig ausfallenden Oberweite zunicke.
In seinem schiefen Grinsen zeigt sich jedoch nicht die geringste Scham, als der Blick des Kerls tiefer gleitet. »Da müssten wir schon mal nachsehen …«
Das ist wieder einer der Momente, in denen ich meine Gabe verfluche, denn das von diesen Worten begleitete Lustgefühl will ich nun wirklich nicht spüren müssen. Generell suche ich immer so schnell wie möglich das Weite, wenn mich derartige Gier übermannt, aber hier bin ich ja zwischen anderen Leuten gefangen. In meinem Hirn wirbeln gerade gleich mehrere schlagfertige Antworten umher, als ich von hinten leicht geschupst werde.
»He! Geht’s bald weiter? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, beschwert sich jemand.
Schließlich schaltet sich dann doch mein Hirn ein, sodass ich mich für die Spaß-Variante entscheide: Ich lache unecht, als habe der Wachmann lediglich einen Scherz getrieben. Ganz ernst kann er ja wohl auch kaum gemeint haben, dass ich mich hier vor allen Leuten entkleiden sollte, auch wenn sein Gefühl dahinter sehr wohl dazu passte.
Da lichtet sich gerade vor mir die Menge, sodass ich mich nun einfach weitertreiben lasse. Zum Glück werde ich jetzt nicht weiter aufgehalten und kurz darauf stehe ich im Freien. Eine halbkreisförmige Treppe ergießt sich hier wie ein Teppich aus Meereswellen in den Park hinab. Das darin eingearbeitete Mosaik aus Kieseln verschiedener Blautöne vervollkommnet diesen Effekt. Die riesenhaften Parkbäume überschatten einige Flügel der Bibliothek, die mittlerweile dermaßen angewachsen ist, dass sie nun beinahe ein Viertel des gesamten Parkgeländes einnimmt. Und das will etwas heißen, denn dieser Park umfasst sogar einen kleinen See, mehrere Restaurants und einen Abenteuerkletterparcour für Kinder. Ich mag es besonders, wenn gegen Abend die vielen Laternen und Lampions angezündet werden, die hier überall herumhängen. Schon erspähe ich den ersten Parkwächter, der mit seiner langen Zündstange von Laterne zu Laterne läuft, um diese mit Licht zu versorgen. Im Hintergrund zeichnen sich die Zwiebeltürme der Schlösser dunkel vom Abendhimmel ab. Der Wind trägt die Musik von Straßenmusikanten herüber, die ich schon öfters in der Gegend gehört habe. Einmal waren sie auch in unserem Restaurant zu Gast und letzten Monat spielten sie in der Tanzhalle, wo ich manchmal mit meinen Freunden den Abend verbringe.
Da, plötzlich spüre ich es wieder, dieses diffuse Verlangen. Irritiert schaue ich mich nach allen Seiten um. Gemeinsam mit mir strömen mehrere Leute aus der Bibliothek, während im Park eine Mutter ihren kleinen Sohn mit sich fortzieht, der aber unbedingt noch an einer roten Blume zupfen muss. Ein Greis im grünen Gewand hockt dösend auf einer Bank, den Kopf in den Nacken gelegt. Sein weißes Haar spart kaum noch etwas von der Haut seines Gesichts aus. Niemanden davon halte ich für den Urheber dieses Gefühls, doch die zurechtgestutzten Büsche und uralten Bäume könnten gute Verstecke für jemanden bieten, der nicht gesehen werden will. Was mich dabei besonders irritiert, ist die Art des Gefühls, wie ich es sonst noch nirgends erlebt habe. Es unterscheidet sich deutlich von der gierigen Wollust des Wachmanns oder anderer Kerle, denen ich lieber aus dem Weg gehe, und doch kann ich nicht fassen, worin genau sich dieses Verlangen begründet.
Statt geradewegs das Park-Tor anzusteuern, wende ich mich nach rechts, um die Bibliothek zu umrunden. Schließlich gibt es in jeder Himmelsrichtung einen Ausgang. Mit eiligen Schritten marschiere ich den gepflasterten Weg entlang, dem See entgegen.
»He, Iona! Warte doch mal!«, ruft mir da plötzlich jemand von hinten zu. Diese Stimme kenne ich nur zu gut. Ich fahre herum und sehe, wie Leonido auf mich zu rennt.
Könnte er der Verursacher dieses diffusen Verlangens gewesen sein?
Im Moment kann ich es jedenfalls nicht spüren, aber das muss ja nichts zu bedeuten haben. Auch mein Beobachter könnte sich von Leonido gestört fühlen.
»Was willst du denn hier?«, erkundige ich mich misstrauisch.
»Dachte ich’s mir doch, … dass ich dich hier finde …«, keucht er.
»Mich? Bist du sicher, dass du mich nicht mit Virula verwechselst? Sie trägt das dunkelblonde Haar doch ähnlich wie ich.«
Dieser Seitenhieb musste sein, schließlich fühle ich mich durch seinen Verrat noch immer verletzt. Wenn ich diesen heimlichen Spion nicht in meiner Nähe gespürt hätte, wäre ich einfach fortgegangen, aber so ist es mir eigentlich ganz recht, dass ich jetzt nicht mehr alleine unterwegs bin.
Leonidos Aufregung und Angst prickeln gleichermaßen in meiner Brust.
»He, es tut mir leid«, keucht er atemlos, als er vor mir zum Stehen kommt. »Die Hormone sind einfach mit mir durchgegangen, aber du musst mir glauben, ich habe dich immer geliebt und das hat sich auch nicht geändert.«
»Weißt du was, das glaube ich dir sogar. Aber was ändert das?«
Leonido streift sich das Haar aus dem Gesicht und schenkt mir einen dermaßen liebevollen Blick aus seinen rotbraunen Augen, dass ich mich wirklich zusammennehmen muss, nicht wieder wegzuschmelzen. Vor allem überkommt auch mich nun ein Herzschmerzgefühl, bei dem ich kaum mehr unterscheiden kann, welcher Anteil davon mir selbst entspringt.
Wenn er nur nicht so vermoxt gut aussehen würde …
»Du hast mir schon immer viel mehr bedeutet, als alle anderen …«, sagt er weich, wobei er eine Hand ausstreckt, um eine meiner Haarsträhnen hinter mein Ohr zu streichen. Er berührt sanft meine Wange, was dort ein von Sehnsucht erfülltes Prickeln hinterlässt.
Nachdem ich mit Leonido vor etwa zehn Tagen im Streit auseinandergegangen bin, hat er sich nicht mehr bei mir blicken lassen, was mir einigermaßen Zeit gab, über den Schmerz hinwegzukommen. Doch als er nun vor mir steht, fühle ich mich wieder in alte Gefühle zurückgeworfen.
Ich schlucke den dicken Kloß runter, der sich in meinem Hals festzukleben droht. Außerdem will sich da gerade eine Träne anbahnen, was ich jetzt wirklich nicht gebrauchen kann, daher weiche ich hastig zurück.
»Klar, das erzählst du jeder, stimmts?«, gifte ich ihn an. »Virula und welche anderen meintest du eigentlich sonst noch? Wie viele sind es denn insgesamt?«
»Nein, das verstehst du falsch.« Er schüttelt vehement den Kopf. »Natürlich hatte ich Frauen vor dir und das mit Virula war ein Ausrutscher. Aber keine hat mir so viel bedeutet wie du.«
»Natürlich, und deswegen hast du dich ja auch zehn Tage lang nicht gemeldet. Warum denn jetzt plötzlich wieder?«
»Na ja, ich habe mich halt geschämt. Außerdem hast du mir doch klargemacht, dass du mich nicht mehr sehen willst. Das musste ich auch erst mal verdauen«, sagt er nun fest, wobei sich sein Ausdruck leicht verhärtet.
»Und was sagt Virula zu deinem Wandel?«
»Das mit Virula ist endgültig vorbei.«
»Aha, und warum?«
Unbehagliche Scham und Schuld drücken auf meine Bauchmitte, während Leonido den Blick zum See hinaus abwendet. »Ist doch nicht wichtig, oder? Jedenfalls ist es vorbei.«
»Lass mich raten, Virula hat auch keine Lust, eine von vielen zu sein, deshalb hat sie die Beziehung beendet. Und da du nicht so gerne alleine bist, kommst du jetzt wieder zu mir«, erkenne ich bitter.
»So darfst du nicht denken, Iona. Ich liebe dich wirklich.« Wenigstens schaut er mir dabei tief in die Augen.
Ja, das beherrscht er wirklich gut …
»Das Problem ist, dass sich diese Liebe auf ziemlich viele weibliche Wesen verteilt, wie mir scheint. Wäre ja eigentlich gar nichts Verwerfliches, sofern alle Beteiligten Bescheid wissen, aber mein Ding ist so eine Beziehung nun mal nicht.«
Nun ist es pure Angst, die das Gefühl von Lähmung in meinem Oberkörper verursacht.
»Dann eben nicht. Aber du wirst schon sehen, dein Hochmut wird dich nochmal zu Fall bringen, Iona Sternentanz«, speit er mir nun verletzt entgegen. »Was für ein idiotischer Name übrigens. Und von so einer unscheinbaren Restauranttochter werde ich mich sicher nicht noch einmal demütigen lassen.«
Mit diesen Worten wendet er sich ab und marschiert eilig davon.
»Jetzt zeigst du wenigstens mal dein wahres mieses Gesicht, Leonido Wattas!«, rufe ich ihm zornig nach.
Das zornig-eklig-schale Gefühl im Bauch ebbt ab, je weiter er sich von mir entfernt. Dafür kehrt eine dumpfe Leere bei mir ein, die auch nicht besonders erhebend ist.
Natürlich weiß ich, dass Leonido mich nur deshalb so niedergemacht hat, um sich selbst über seine Unsicherheit zu erheben. Nicht selten habe ich dieses Phänomen immer wieder beobachtet, dass Leute andere nur deshalb runtermachen, um sich selbst besser zu fühlen. Und trotzdem schmerzt es mich, was er mir an den Kopf geworfen hat.
Bin ich wirklich so unscheinbar? Und ist Iona Sternentanz tatsächlich ein lächerlicher Name? Iona oder Sternentanz oder beides?
Mit meinen achtzehn Jahren habe ich eher eine zierliche Statur, schmale dünne Finger und auch die weiblichen Rundungen fallen eher dürftig aus. Bislang hatte ich damit kein Problem.
Oder doch?
Grüne Augen und dunkelblondes langes Haar sind zwar nichts Außergewöhnliches, aber schon alleine durch mein loses Mundwerk kann man mich wohl kaum als unscheinbar bezeichnen. Und da sich Leonido bestimmt nicht mit missgestalteten Frauen schmücken würde, kann ich ja auch nicht hässlich sein. Als Makel könnte man noch meinen linken Eckzahn anführen, der zur Hälfte abgebrochen ist, als ich als Kind die Treppe runtergefallen und mit dem Oberkiefer gegen einen Pfosten geknallt bin.
Während der Name Iona mittelmäßig verbreitet ist in Faresia, habe ich vom Familiennamen Sternentanz außerhalb unserer Sippe noch nie etwas gehört. In der Familienchronik steht, dass meine Vorfahren aus dem hohen Norden in die Hauptstadt kamen. Und meine Bibliotheks-Recherchen ergaben, dass man sich unter den nordischen Völkern sehr viel mit Astrologie beschäftigt. Auch haben die Nordländer vielfältige Rituale, Gesänge und Tänze, um die Energie der Sterne einzufangen und ins Leben zu integrieren. Gerne würde ich das alles mal mit eigenen Augen sehen, doch ich zweifele allzu oft daran, ob ich es überhaupt schaffen werde, Faresia jemals zu verlassen. Ich sehe mich schon, wie ich als alte Greisin noch immer im Restaurant meiner Eltern die Gäste bediene.
Das Restaurant … Meine Schicht beginnt gleich!
Mit eiligen Schritten steuere ich das Tor an. Immerhin ist jetzt nichts mehr von dem diffusen Verlangen zu spüren, als ich den Park verlasse und auf die Straße hinaustrete, wo Laternen die großen weißen Pflastersteine ausleuchten. Einige Geschäfte sind noch immer geöffnet, vor allem die Lokale und der Laden für Luxuslampen. Im Gegensatz zu den engen und verwinkelten Gassen des Leuchtturmviertels ist die Straße hier so breit, dass ein ganzes Wohnhaus darin Platz fände. Außerdem patrouillieren in der Umgebung der Nobelbauten regelmäßig die Wachen der oberen Stände. Wie überall in der Stadt werden die meisten Hauswände von steinernen Trögen gesäumt, in denen Pflanzen wachsen. Fast auf jedem größeren Platz gibt es einen Brunnen und mindestens einen Marnussbaum, dessen Früchte vor allem bei den niederen Ständen begehrt sind.
Auch heute hängen wieder jede Menge Lampions in den Zweigen des Baumes am Leuchtturmplatz. Er liegt zwar nicht direkt am Leuchtturm, wurde aber wohl so genannt, weil es sich dabei vom Leuchtturm aus um den nächstgelegenen Platz handelt.
Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Restaurant meiner Eltern, aber jetzt beschleunige ich doch meinen Schritt, weil ich es schon wieder spüre, dieses diffuse Verlangen. Im Lauf schaue ich mich um, aber die wenigen Leute auf der Straße scheinen zu sehr mit sich selbst beschäftig zu sein, um für dieses Gefühl infrage zu kommen.
Vermoxt nochmal, von wem stammt das?
Dornbuschwein
Iona, Fabolon, Faresia, 1 Romajan 1211
Unser herausgeputztes Restaurant mit den violett-blauen Fensterläden und frischem kalkweißem Anstrich sticht aus den umliegenden, eher gewöhnlichen Wohnhäusern heraus – nicht nur wegen den Sternen, die auf den Läden leuchten, sondern auch aufgrund der beiden runden Türme rechts und links. Sie dienen jedoch vor allem der Zierde, da sie so schmal sind, dass man im Inneren gerade mal senkrecht an einer Leiter emporklettern kann, um die Aussicht schließlich durch ein winziges Fenster zu genießen. Man kann dort oben aber weder stehen noch sitzen.
Über der Tür prangt ein großes Schild mit dem gleichen Sternenhimmel-Hintergrund wie er auch auf den Fensterläden zu sehen ist. Neben der Silhouette einer Balletttänzerin steht in weißen Lettern darauf geschrieben: Sternentanz. Ich finde ja, unser Haus wirkt eher wie ein Miniatur-Märchenschloss, als wie ein Restaurant. Würde man durch die großen Fenster nicht die vielen Tische sowie die Bar im Inneren erspähen können, würde man wahrscheinlich eher von einem Tanz- oder Nachtlokal ausgehen. Während das Nobelviertel mit seinen breiten Straßen hinter mir liegt, verengt sich die Gasse vor mir in meinem Blickfeld immer mehr, bis die Häuser am Ende von beiden Seiten beinahe zusammenzuwachsen scheinen. Die schummrige Beleuchtung der wenigen Laternen, ausgetretene Bodenplatten, abgebröckelter Putz und Häuser, die teils recht willkürlich übereinandergestapelt wurden, vollenden den schmuddelig chaotischen Eindruck des Leuchtturmviertels. Hier hausen fast ausschließlich Angehörige des niedersten Standes, welche entweder als Bedienstete arbeiten, betteln oder ihren Lebensunterhalt auf kriminelle Weise beschaffen.
Ich befinde mich gerade im Begriff, das Wirtshaus zu betreten, zuvor schaue ich mich abermals nach allen Seiten um, da noch immer dieses unangenehme Gefühl des diffusen Verlangens an mir haftet. Da meine ich plötzlich, eine hektische Bewegung an der nächsten Hausecke zu erhaschen.
Ob das mein Spion war? Na, der kann was erleben, mich ständig zu belauern!
Hier bei meinem Elternhaus fühle ich mich so sicher, dass ich nun so schnell wie möglich zu der besagten Ecke eile, um dahinter zu spähen. Aber vor mir erstreckt sich nichts weiter als eine völlig menschenleere Gasse – wenn man von dem zahnlosen Bettler mal absieht, der dort immer hockt und mir prompt sein Schälchen entgegenstreckt.
»Später, Zarino. Du weißt doch, die Leute lassen sicher wieder jede Menge Reste übrig. Da kannst du dir nachher raussuchen, was du magst.«
Der Alte nickt lächelnd und murmelt etwas, das ich nicht verstehe. Seine Dankbarkeit umspült warm mein Herz. Der Bettler erinnert mich ein wenig an meinen Großvater, dessen Mund fast genauso zahnlos aussieht, lediglich sein Temperament ist ein anderes. Eigentlich ist es ein Unding, dass Zarino in seinem Alter auf der Straße hockt, um zu betteln. Meine Mutter meint aber, wir können nicht alle Welt bei uns aufnehmen. Nur weil mein Opa eben noch Familie hat, die sich um ihn kümmert, kann er drinnen sitzen und Zarino hockt draußen auf der Straße.
Immerhin hat sich das diffuse Verlangen mal wieder aufgelöst, als hätte es nie existiert, was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass mein Spion das Weite gesucht hat. Genauso gut ist es möglich, dass seine Emotionen derart abgeflaut sind, dass ich sie aus den anderen in meiner Umgebung nicht mehr herausfiltern kann. Seufzend wende ich mich um und starte einen neuen Versuch, das Restaurant meiner Eltern zu betreten. Dieses Mal hindert mich nichts mehr daran, die große Glastür nach innen zu drücken und das Parkett aus violettem Schiefernholz zu betreten. Da sich Mama ja um die edleren Gäste bemüht, legt sie viel Wert auf eine detailreiche Dekoration. So gleicht die gesamte Decke einem Sternenhimmel, nicht bei finsterer Nacht, sondern auf violett-blauem Untergrund – so wie der Himmel eben aussieht, nachdem unser Zentralstern, die Farella, gerade hinterm Horizont verschwunden ist und dort noch einen hellen Lichtstreif hinterlässt – was im Fall unseres Wirtsraumes an der Wand neben der Treppe der Fall ist. Dort befindet sich über der Garderobe für die Mäntel edler Herrschaften die dunkle Silhouette eines Gebirges an der Wand. Die letzten Farellastrahlen blinzeln noch darüber hinweg, wobei der Effekt durch Leuchtsteine verstärkt wird, die an dieser Stelle in die Wand eingearbeitet wurden. Im Übrigen bestehen auch die vielen tausend Sterne an unserer Zimmerdecke sowie jene auf den Fensterläden aus kleinen Leuchtsteinen, was besonders imposant aussieht, wenn wir an Musikabenden die übrigen Lampen dimmen. Im normalen Betrieb ist das aber leider nicht möglich, weil die Gäste schließlich genau sehen wollen, was sie aufgetischt bekommen. Heute sind etwa ein Drittel der Tische besetzt, aber erfahrungsgemäß geht der Betrieb um diese Zeit gerade erst richtig los.
Kaum habe ich einen Fuß in den Gastraum gesetzt, trällert mein Opa bereits ein fröhliches Lied: » Iona, mein Herzchen, du kommst so spät, dass mein Scherzchen mir schon fast verloren geht.« Er sitzt wie immer auf seinem Sessel, der ein wenig an einen Kindersitz in größeren Ausmaßen erinnert, mit seinem integrierten Tisch, den Fußstützen und den gepolsterten Seiten. Mein Großvater kann sich nämlich oft nicht mehr richtig aufrecht halten, sodass ihn sein Sessel stützt. Papa hat den Sitz extra für seinen Vater anfertigen lassen. Auch bei der Nahrungsaufnahme muss man Opa hin und wieder helfen, denn mit den zwei einzelnen Schneidezähnen, die oben und unten noch vorhanden sind, und den zittrigen Händen fällt ihm das Essen schwer – im Gegensatz zum Reden, das er trotz fehlender Zähne überraschend deutlich zustande bringt. Erstaunlicherweise scheinen die körperlichen Gebrechen meinen Großvater Gravik aus der Familie Sternentanz nicht im Mindesten zu bekümmern und ich kann ihn nur immer wieder für seine Lebenslust bewundern.
Und auch heute zaubert mir sein fröhlicher Gesang, aber vor allem die erheiterte Emotion dahinter, ein Lachen ins Gesicht. »Wie geht’s, Opi?«
»Hervorragend! Danke der Nachfrage, mein Herzchen.« Dann senkt Gravik jedoch verschwörerisch die Stimme, wobei er verstohlen Richtung Küche schielt. »Könntest du mir noch etwas von diesem leckeren Dornbuschwein besorgen?«
»Das wird Mama aber gar nicht gefallen …«, antworte ich kopfschüttelnd und doch kann ich mein breites Grinsen nicht zurückhalten. »Aber ich werde mal sehen, was ich für dich tun kann.«
»Du bist die Beste, mein Herzchen«, erwidert Gravik strahlend, woraufhin sein Blick zu den neuen Gästen wandert, die gerade eintreten: Ein Paar, er mit kurz geschorenem bläulich-schwarzem Haar, sie dunkelblond mit Rotstich, genau wie die ältere Dame an ihrer Seite, wobei es sich vermutlich um ihre Mutter handelt.
»Ach, täusche ich mich oder tritt da gerade die Liebe meines Lebens zur Tür herein?«, flirtet mein Großvater mal wieder aus kratziger Kehle drauf los, als sei er ein junger Rockjäger. Das Gesicht der Dame, der dieses Kompliment zuteilwurde, ist bereits von einzelnen Fältchen gezeichnet, doch im Vergleich zu meinem Großvater wirkt sie blutjung. Sie schüttelt irritiert den Kopf und doch nehme ich die verlegene Röte ihrer Wangen und ein warmes, etwas beschämtes Gefühl bei ihr wahr.
»He, Gravik, du kannst es auch nicht lassen, mit den jungen Damen zu flirten«, stichelt der Mann, dessen Gesicht mir bekannt ist, weil er schon öfter bei uns zu Gast war.
»Ach, hört doch auf, ihr Männer!«, beschwert sich die ältere Dame verlegen. »Ihr wisst genau, dass meine besten Jahre längst hinter mir liegen …«
»Aber sag doch nicht so was, Mama.« Die rothaarige Partnerin des Mannes schüttelt den Kopf. »Du siehst doch noch immer blendend aus.«
»Und mein Großvater flirtet zwar häufig, aber nicht mit jeder«, muss ich einwerfen. Doch sofort beiße ich mir auf die Lippe, weil mir aufgeht, dass ich den ersten Teil besser ausgespart hätte, aber weil die Worte mal wieder schneller raus waren, als Gedankenblitze zucken können, ist’s für diese Einsicht bereits zu spät.
Statt auf meinen Kommentar einzugehen, legt sich mein Großvater jetzt erst richtig ins Zeug. »So schöne leuchtend blaue Augen, die mich verzaubern bis in meine Träume …«, flötet Gravik.
»Ach, lasst uns lieber einen freien Tisch suchen«, meint die Dame und steuert einen Platz in der Nische rechts neben dem Tresen an, möglichst weit weg von meinem Großvater.
»Du hast sie beschämt, Opi«, flüstere ich, als sich die drei außer Hörweite befinden.
»Macht nichts, mein Herzchen, du wirst sehen, tief in ihrem Inneren liebt sie mich auch. Das Kätzchen ist nur viel zu scheu, um es mir zu zeigen.«
»Hm, na, vielleicht …«
»Sei gegrüßt, Gravik!« Ein Mann in grauem Anzug tritt ein und hebt die Hand zum Gruß.
»Ah, sei gegrüßt Trando«, freut sich mein Großvater. »Wie läuft die Arbeit in der Reederei?«
»Ganz gut. Ich bin ja froh, dass ich nicht bei den Litanias arbeite, die Bootsbauer bei denen haben’s echt nicht leicht.«
Nicht umsonst sitzt mein Großvater immer neben der Eingangstür, denn dort kann er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und jeden Gast persönlich begrüßen. Insgeheim denke ich mir manchmal, dass in seiner herzlichen Art der eigentliche Grund dafür liegt, weshalb unser Restaurant so beliebt ist, auch wenn mein Papa es natürlich seinem Essen und meine Mutter ihrer Dekoration zuschreibt.
»Iona! Warum stehst du dort draußen rum? In der Küche wartet jede Menge Arbeit auf dich«, schallt es plötzlich durch den Gastraum.
Beladen mit mehreren Tellern eilt Meonore, meine Mutter, aus besagter Küche in den Speisesaal. Wenn es erlaubt wäre, würde sie sicherlich ein Kleid mit Sternenhimmelstoff tragen, doch in unserem Stand dürfen wir nur grüne Farben verwenden. So begnügt sich Mama mit einem hellgrünen Kleid. Darüber trägt sie eine dunkelgrüne Schürze, auf der die gleiche Stickerei einer Tänzerin unterm Sternenhimmel zu sehen ist, wie auf unserem Schild über der Tür. Die vielen guten Speisen, mit denen sie täglich in Berührung kommt, haben sich in ihrer etwas rundlichen Figur niedergeschlagen, genau wie in dem pausbackigen Gesicht, als fett kann man sie aber wirklich nicht bezeichnen. Ein dickes grünes Stoffband, welches sie in ihren dicken Zopf hinein geflochten hat, hält das Haar zusammen.
»Ich komme ja schon …«, seufze ich. Geschirr spülen und Gäste bedienen gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben, aber gerade während des großen Ansturms am Abend und um die Mittagszeit kommen meine Eltern ohne meine Hilfe kaum zurecht. Ansonsten arbeite ich meistens am Vormittag im Restaurant, putze die Tische und den Boden. Dafür habe ich den Abend nach dem großen Ansturm dann frei.
»Mailina, wie schön du das Haar heute trägst«, freut sich Gravik über den nächsten weiblichen Gast, während ich die Küche ansteuere. Hier schlägt mir bereits der heiße Dampf aus den Kochtöpfen entgegen, sodass ich zunächst zum Fenster laufe, um frische Luft hereinzulassen.
»Puh, wenn man dauernd im Dampf steht, merkt man ihn schon gar nicht mehr«, meint Handrich, mein Vater, woraufhin er mir meine Schürze zuwirft. Die gute Seite daran, dass er keine Haare mehr auf dem Kopf trägt, ist, dass er keine Kochmütze benötigt. Einmal beschwerte sich tatsächlich ein Gast über ein Haar in der Suppe, doch verstummte er daraufhin ziemlich kleinlaut, als der Koch persönlich das Malheur begutachtete. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Haar des Gastes selbst handelte.
Leider bin ich jetzt so spät dran, dass keine Zeit mehr bleibt, um etwas zu essen. Um den größten Hunger zu stillen, stopfe ich mir ein paar Nüsse in den Mund, bevor ich die Schürze anlege und mich neben meinen Vater an die Spüle stelle.
Papa rührt in einem großen Kochtopf, aus dem es herrlich nach Fischsuppe duftet. »Wie wars in der Bibliothek?«, erkundigt er sich.
Ich versenke die schmutzigen Teller in einem Wassertrog und schlucke die Nüsse hinunter. »Ein komisches Buch gabs da …«, plappere ich drauf los. »Auf der ersten Seite stand, dass man es nicht lesen und besser wieder vergessen soll.«
»Und lass mich raten …« Schlürfend kostet Papa von seiner Suppe. »Du hast es trotzdem gelesen.«
»Nicht ganz. Aber ich musste unbedingt weiterblättern. Es ging einfach nicht anders, dieser dumme Satz hat mich zu neugierig gemacht.«
»Kann ich verstehen, jetzt bin ich auch neugierig. Was stand denn drin in dem Buch?«
»Na, ist ja schön, dass ihr hier so ein gemütliches Schwätzchen haltet, aber wo bleibt der Katuffelauflauf?«, beschwert sich meine Mutter beim Hereinkommen. Sie deutet auf die leere Ablage neben der Tür, wo eigentlich die fertigen Speisen auf die Abholung warten sollten. »Die Gäste werden schon ungeduldig.«
Hendrich wirft einen dicken Holzscheit ins Feuer unter dem steinernen Backofen und öffnet die Tür, um mit zwei Topflappen eine der Schalen herauszufischen.
»Schon fertig!« Er pustet den heißen Dampf weg, stellt die Schale ab, um den Inhalt in einen gewölbten Teller zu schaufeln. Bevor er ihn jedoch meiner Mutter reicht, drückt er ihr einen Kuss ins Haar.
Mama schnaubt genervt, doch an ihrer warmen Emotion spüre ich, dass sie ihn für derartige Gesten liebt. Und wie jedes Mal, wenn so etwas passiert, frage ich mich, weshalb Menschen etwas ganz anderes vorspielen, als das, was sie fühlen. Meine Mutter reißt ihrem Mann den Teller aus der Hand. »Vergiss nicht das GemüseSoufflé«, ruft sie noch mit einem Blick zurück, während sie zurück in den Gastraum eilt.
»Jaja, jaja, Madame …«, brummelt Papa, was sie allerdings nicht mehr hören kann. Er nimmt die Fischsuppe vom Feuer und schnippelt das Gemüse klein, welches er sich bereits zurechtgelegt hat. Ich dagegen kratze die Reste aus der leeren Auflaufform, um mich daran etwas satter zu essen, bevor ich sie im Spültrog versenke.
»So, jetzt will ich aber endlich wissen, was in diesem Buch drinstand«, hakt Papa nach.
»Ach, ich denke, es war nur ein dummer Scherz, weil es nichts als Bilder waren: Ein Kreis in dem ein Sternenhimmel von einem Licht aufgesogen wurde und auf der nächsten Seite gab es eine Kohlezeichnung von einem Augenpaar.«
Im Nachhinein kommt es mir ziemlich albern vor, dass ich mich von diesen Bildern so habe irritieren lassen.
Was war da bloß mit mir los gewesen? Vielleicht lag es ja an diesem kalten Hass, der mich viel zu sehr aus dem Konzept gebracht hat.
»Mehr nicht?«, brummt Hendrich ehrlich enttäuscht, ein Gefühl, das sich wie ein ausgeleertes Wasserglas im Kopf anfühlt. »Dann war es wohl wirklich nur ein Scherzbuch.«
»Ja, wahrscheinlich«, brumme ich, während ich versonnen die Gabeln mit einem Tuch abreibe. Doch es fühlt sich absolut falsch an, wenn ich das so sage. Irgendeine Bewandtnis hat es mit diesem Buch Das Anderssein und beim Gedanken daran drängt es mich, abermals hineinzusehen. Dabei fällt mir wieder der Hinweis auf der zweiten Seite ein:
Du hast es gewagt, das Reich dieses Buches zu betreten. Sei gewarnt, denn nun gibt es kein Zurück mehr.
Und allmählich dämmert mir, was damit gemeint sein könnte: Dieses Buch fesselt mich auf eine Art, dass es mich immer wieder zu ihm zieht, um hineinzusehen.
Aber was passiert dann? Wo wird das enden? Es sind doch einfach nur Zeichnungen darin, oder?
Allerdings verfügt dieses Buch ja noch über sehr viel mehr Seiten und ich habe gerade mal vier davon gesehen. Wer weiß, was da sonst noch drinsteht. Und damit hält mich die Neugier wieder so fest in ihrem Klammergriff, dass ich mir vornehme, morgen unbedingt noch einmal die Bibliothek aufzusuchen.
»Mach Schluss für heute, Iona«, sagt Papa, nachdem der große Ansturm endlich vorüber ist. »Mir war doch gerade so, als hätte ich Sandrina draußen gesehen. Wollt ihr wieder zum Tanzen gehen?«
»Ja, in der Singtadelle.« Aufatmend hänge ich die grüne Schürze an den Haken und trockne meine aufgeweichten Hände im Stoff.
Wie alle Restaurants legt auch das unsere alle zehn Tage zwei Ruhetage ein – mit den Betreibern in der Umgebung gibt es Absprachen, sodass man sich damit abwechselt. Jedenfalls sind wir morgen und übermorgen mit der Restaurantschließung dran, was für mich stets besondere Freudentage sind. Am Morgen des freien Tages kann ich lange ausschlafen, daher unternehme ich am Vorabend immer etwas mit meinen Freunden, die sich derzeit lediglich auf Sandrina beschränken. Virula und Leonido fallen ja jetzt weg.
»Ach, in deinem Alter hat man noch so viel Energie. Ich dagegen bin einfach nur noch müde und freue mich auf mein Bett«, meint Papa augenzwinkernd. »Vielleicht können wir an den freien Tagen als Familie etwas gemeinsam unternehmen. Was meinst du?«
»Ja, vielleicht …« Ich bin schon nicht mehr ganz bei der Sache, weil ich bereits nach Sandrina Ausschau halte, die gerade den Gastraum betritt.
»Na dann, viel Spaß«, wünscht mein Vater, während ich durch die Küchentür in den Gastraum gehe.
»Die liebreizende Sandrina betritt unseren Sternentanz«, freut sich mein Großvater über den Besuch meiner Freundin, die mir gerade jedoch den Rücken zudreht.
»Hallo Gravik.« Wie so oft zieht Sandrina ihre Bürste aus der Tasche, um sie durch das leicht gewellte hellblonde Haar zu ziehen. Dabei begutachtet sie kritisch ihre Reflektion in der Fensterscheibe.
Lediglich drei der fünfzehn Tische sind noch besetzt, von denen ein leises Geschirrgeklapper und Gemurmel ausgeht. Meine Mutter gönnt sich ihre wohlverdiente Verschnaufpause hinter dem Tresen, wo sie Honig von einem Holzlöffel in ihren Kräutertee hinabfließen lässt – ein Ritual, das häufig das Ende ihres Arbeitstages einläutet.
»Hallo Sandrina!« Meine Freundin lässt ihre Bürste sinken, sodass wir uns in die Arme fallen können. Dabei achte ich darauf, ihr Haar nicht zu berühren, weil sie sonst sofort wieder anfangen würde, es wie wild zu bürsten.
Sie hat so einige Macken, aber was ich besonders an ihr schätze ist, dass sie alles offen zeigt und nichts vorspielt.
»Können wir los?«, will sie wissen, als wir uns wieder voneinander lösen. Sie mustert mich von oben bis unten. »Bist du fertig?«
»Ich zieh mich nur noch kurz um. Wenn wir schon mal ausgehen, muss ich nun wirklich nicht nach all den Speisen riechen.«
»Klar, ich warte hier.« Sie hockt sich an einen leeren Tisch, auf dem noch einige Gräten vom Mahl des vorherigen Gastes zurückgeblieben sind.
Im Vorübergehen stecke ich Gravik heimlich ein kleines Fläschchen zu, das meinen Opa zum Strahlen bringt, bevor ich auf der Holztreppe am Ende des Gästeraums nach oben verschwinde.
Das bisschen Dornbuschwein kann ihm nun wirklich nicht schaden, denke ich mir.
Hier im ersten Stock gehen von dem sechseckigen Flur drei Gästezimmer ab, die wir aber nur an Freunde und gute Bekannte vergeben, sowie das Bad und ein Arbeits- und Lesezimmer. Überall in Bodennähe sind Leuchtsteine in die Wand eingelassen, die gerade mal so viel mattes Licht spenden, dass man nicht stolpert. Es gäbe auch Laternen im Treppenhaus, aber wer will schon jedes Mal extra eine entzünden, wenn man nur kurz durchgeht?
Erst im zweiten Stock befinden sich die privaten Räume unserer Familie. Damit sich kein Gast versehentlich dorthin verirrt, gelangt man nur über eine abschließbare Tür hinein. Auch Gravik hat hier oben sein Schlafzimmer, aber seit er mit diesen motorischen Schwierigkeiten kämpft, nutzt er es nicht mehr. Dafür haben meine Eltern für ihn unter der Treppe im Gastraum ein herunterklappbares Bett eingerichtet.
Ich wende mich meinem eigenen Zimmer zu, das im Gegensatz zu dem meiner Eltern zum Leuchtturmviertel hin ausgerichtet ist. Das kommt mir gelegen, weil es einfach spannender ist, über die verwinkelten Dächer und Holzbrücken hinwegzuschauen, die die obendrauf gebauten Häuser miteinander verbinden. Und jetzt am Abend verschwindet der ganze Verfall in der Finsternis und im schummrigen Licht der Laternen, das sich mit unzähligen mehr oder weniger hell erleuchteten Fenstern abwechselt. Vor allem, als ich jünger war, hatten meine Eltern immer Angst, wenn ich draußen mit meinen Freunden spielte, weil die Leuchtturmgegend doch ziemlich verrucht ist. Sandrina war zu ängstlich für Ausflüge dort hin, deshalb habe ich mich nicht selten heimlich alleine hineingeschlichen, um die vielen Treppen, Stege und Wege zu erkunden – ein herrliches Labyrinth, wenn man als Kind auf Entdeckungstour gehen will. Und da dort ebenfalls viele Kinder unterwegs waren, habe ich mir nichts groß dabei gedacht, jedenfalls nicht, bis mir eine Straßenbande auflauerte und mich in einen Kanal warf.
Blinzelnd versuche ich die unliebsamen Kindheitserinnerungen abzuschütteln und öffne meinen Kleiderschrank, wo Grün die eindeutig vorherrschende Farbe darstellt. Nur für den einzigen Festtag im Jahr, das Sternenfest, an dem andere Farben erlaubt sind, hängt hier ein Sternenhimmelkleid – wie könnte es anders sein. Ich wähle das ärmellose, knielange Kleid mit den Muschelstickereien darauf aus. Dazu eine dunkelgrüne Jacke wegen der kühlen Nacht und meine geschnürten Tanzschuhe. Die Kleidung deponiere ich zunächst auf meinem blauen Lesesessel. Was mir noch an meinem Zimmer gefällt, sind die Verwinkelungen und Erker. Selbst wenn die Wände überwiegend senkrecht angelegt sind, ragen bereits Dachelemente bis in dieses Stockwerk hinein, sodass der äußere Teil meiner hohen Zimmerdecke abgeschrägt ist. Meine Terrasse ist zwar gerade mal so groß, dass ein Stuhl und zwei Kübel mit jungen Pafelbeerbäumen darauf Platz finden, dennoch liebe ich es, dort oben zu sitzen und das Treiben in der Tiefe zu beobachten.
»Ich trödele mal wieder zu viel«, rufe ich mich kopfschüttelnd zur Eile auf. »Sandrina wird sicher schon ungeduldig.« Selbstgespräche sind bei mir keine Seltenheit. Wenn niemand da ist, mit dem ich mich unterhalten kann, muss ich eben selbst dafür herhalten.
Neben dem großen, in die Wand eingelassenen Spiegel steht ein Wassertrog auf dem Waschtisch. Nachdem ich meine Kleidung abgelegt habe, wasche ich mir erst einmal den Küchendampf vom Gesicht und erfrische mich unter den Achseln, sowie zwischen den Brüsten. Ausgerechnet in diesem Moment werde ich abermals von diesem diffusen Verlangen überfallen. Reflexartig presse ich mir das bereitliegende Handtuch gegen den Oberkörper und erstarre. Schon gestern kam es mir so vor, als würde mich dieser Unbekannte sogar in meinem eigenen Zimmer beobachten.
Das geht nun wirklich zu weit!
Irritiert starre ich zur Terrassentür, die obendrein einen Spalt offensteht.
War ich das gewesen?
Im Grunde ist das nichts Ungewöhnliches, doch allein die Ungewissheit, ob sich nicht doch ein Eindringling Zutritt verschafft haben könnte, verunsichert mich.
»Nur ruhig, Iona«, versuche ich, mich unter Keuchen zu beschwichtigen. »Bestimmt hockt der Kerl irgendwo im Leuchtturmviertel am Fenster. Ja, das wird es sein. Sicher wohnt er dort drüben und kann direkt in mein Zimmer hineinschauen …«
Mit noch immer gegen meine Brüste gepresstem Handtuch tippele ich zur Terrassentür, schließe sie zu und ziehe den dicken Sternenvorhang davor. Tatsächlich ebbt das Gefühl des diffusen Verlangens sofort ab.
»Ha! Er hockt also tatsächlich dort drüben!« Es sollte triumphierend klingen, doch meine leicht zittrige Stimme verrät meine Unsicherheit.
Was will dieser Kerl von mir?
Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es sich um ein männliches Wesen handelt, etwas anderes käme mir noch rätselhafter vor.
»Oder könnte es sich etwa um ein Farbelwesen handeln!?«, fällt mir spontan ein.
Hier auf dem Planeten Fabolon leben schließlich einige energetische Wesen der Farbmagie. Sie ernähren sich von den Emotionen der Menschen, wobei jede Farbe einem bestimmten Gefühl entspricht. Und natürlich ist ein dunkles Wesen, welches sich beispielsweise von Angst ernährt, immer bestrebt, genau dieses Gefühl bei den Menschen zu erzeugen. Das gleiche gilt für Gier und Wut, aber es existieren auch welche, die sich von Freude und Glück ernähren. Generell sind Farbelwesen jedoch selten und bisher ist mir noch nicht ein einziges begegnet.
»Das würde zumindest erklären, dass sich dieses Verlangen so anders anfühlt, als bei den menschlichen Kerlen«, rede ich mal wieder mit mir selbst, während ich nun in meine frischen Sachen schlüpfe. Diese Version behagt mir zwar auch nicht besonders, doch fühlt es sich nun etwas besser an, überhaupt eine Erklärung gefunden zu haben.
Fertig angezogen begutachte ich mich im Spiegel. Ich lächele mir zu, wobei mein halber Eckzahn gefährlich hervorsticht, sodass ich rasch wieder die Lippen aufeinanderpresse. Durch die Küchendämpfe hängen meine dunkelblonden Haare ziemlich schlaff herunter, doch auch das Bürsten bringt da keine wirkliche Verbesserung. Für eine ausgiebige Wäsche bleibt mir keine Zeit mehr, deshalb binde ich in aller Eile einen Zopf und damit das Ganze etwas festlicher aussieht, flechte ich hellgrüne Bänder mit hinein. So gefalle ich mir schon besser, allerdings sticht jetzt das herzförmige Muttermal unter meinem Ohrläppchen mehr hervor, als mir lieb ist.
Egal!
Noch ein letztes Mal lächele ich meinem Spiegelbild zu – die leuchtend grünen Augen habe ich wohl von meiner Mutter geerbt, auch wenn ihr Grünton doch mehr ins Grau hineinreicht – dann wende ich mich ab und eile zurück in den Gastraum.
»Gravik! Woher hast du diesen Dornbuschwein?«, höre ich bereits auf der Treppe die erhobene Stimme meiner Mutter, wobei ein zorniges Prickeln meinen Bauch kitzelt.
»Hihi! Ein liebevoller Gast …«, er hickst. »… erwies mir die Gnade …«, kichert Großvater.
Ich nehme die letzten Stufen. Meonore hebt die kleine leere Dornbuschweinflasche in die Höhe. Die Gäste sind inzwischen alle verschwunden, nur Sandrina hockt noch auf ihrem Platz und schaut zu mir herüber, während man aus der Küche das Klappern von Topfdeckeln hört.
»Wenn ich den erwische … Wer war es?«
»Hihi!«, lacht Gravik hicksend. »Verrat ich nicht! Hihi!«
Doch unwillkürlich wandert Mamas Blick zu mir, als ich mich nähere. »Iona! Hast du ihm etwa diese Flasche zugesteckt?«
Da Lügen so gar nicht mein Ding ist, antworte ich: »Ja, hab ich und ich weiß auch nicht, was daran schlimm sein soll. Opi freut sich immer so sehr über den Wein.«
»Iona, aber denkst du dabei auch mal an uns? Ja, natürlich, Gravik freut sich, aber wir dürfen uns die halbe Nacht lang mit seinem Gesang rumschlagen.«
»Als ob ihr das im zweiten Stock überhaupt mitbekommen würdet …«, entgegne ich.
»… und letztes Mal ist er aus seinem Bett gefallen«, redet sie zornig weiter.
»Das passiert ihm auch ohne Dornbuschwein.«
»Jetzt streitet doch nicht«, mischt sich nun mein Vater in die Diskussion ein. Er vergräbt die Hände in seiner Schürze, um sie von Gemüseresten zu befreien, während er aus der Küche tritt. »Es ist nichts weiter Schlimmes passiert und meinetwegen können wir Papa hin und wieder das Vergnügen gönnen.«
»Fall mir doch nicht noch in den Rücken.« Mama stemmt die Hände in die Hüften, wobei ihre Wut in meinem Bauch noch mehr zu brennen beginnt.
»Mein Schatz, ich verstehe schon, dass dir die Arbeit allmählich zu viel wird, aber jetzt haben wir erst einmal zwei Tage Ruhe, in denen du dich erholen kannst«, sagt Papa liebevoll und zieht Meonore in seine Arme, wo plötzlich alle Anspannung von ihr weicht.
»Vielleicht hast du recht …«, seufzt sie. »Ich denke manchmal, ich bin zu ehrgeizig. Bei mir muss alles immer perfekt sein …«
»Damit überforderst du dich aber, Liebes …« Papa küsst sie auf die Stirn, dann wendet er sich Sandrina und mir zu. »Ich wünsche euch viel Spaß, ihr zwei! Und lasst euch nicht zu schnell von den jungen Kerlen einwickeln.«
»Schon vergessen, wir sind erwachsen und können auf uns selbst achtgeben«, kontere ich.
»Ach wirklich? Wie schnell die Zeit doch vergeht …«, lacht Papa, wird jedoch von lautem Schnarchen übertönt. Mit in den Nacken gelegtem Kopf hängt Gravik schlafend in seinem Sessel.
»Also hat sich auch dieses Problem erledigt«, meint Papa und nickt in Richtung seines Vaters. »Er ist ganz friedlich eingeschlummert.«
»Welch ein Glück«, seufzt Mama.
Wenn nur alles so leicht zu lösen wäre, denke ich und richte meinen Blick zum Fenster hinaus, wo die Laternen helle Lichtflecke aufs Pflaster werfen. Und in mir steigt eine ungute Ahnung auf, dass da noch so Einiges auf mich zukommen wird.
Kriselwasser
Iona, Fabolon, Faresia, 1 Romajan 1211
Sandrina und ich müssen noch ein ganzes Stück laufen, um zur Singtadelle zu gelangen. Aber wenigstens führt uns der Weg am Kai entlang, wo wir an den in den Wellen schaukelnden Booten vorübergehen. Ich liebe diese Stimmung hier in der Nähe des Wassers, wo alles nach Reise und Abenteuer riecht. Nachdem wir den Hafen mit den gigantischen Nobelschiffen hinter uns gelassen haben, folgen nun die schmaleren Stege, an denen kleinere Fischer-, Segel- und Bringboote aufgereiht sind. Auch die Hafenanlagen sind einfacher gestaltet, je weiter wir Richtung Norden wandern, obwohl das Leuchtturmviertel im Süden anschließt. Selbst hier, im noblen Teil Faresias, leben natürlich auch einfache Leute, die ihr Geld mit Fischfang, Handel, Gastronomie, Handwerk und Transportdienstleistungen verdienen.
»… Warum bist du denn heute so schweigsam?«, wundert sich Sandrina, die mir schon seit einer ganzen Weile irgendetwas über ihre gehässige Nachbarin erzählt hat, welche seit Kurzem im Stockwerk darüber eingezogen ist.
»Ach, es ist heute so viel passiert, was ich nicht verstehe. Da war dieses Buch in der Bibliothek …« Bevor ich ihr jedoch die ganze Geschichte erzählen kann, quiekt meine Freundin erschrocken auf, wobei sie sich gegen mich drängt, um sich an meinem Arm festzuklammern. Ihre Panik rinnt eiskalt durch mich hindurch, bis in die Zehenspitzen hinab, wobei ein Beben in meinem Leib vibriert.
»Was ist denn?«, frage ich irritiert, wobei ich einen tiefen Atemzug nehme, um die unangenehme Empfindung so gut wie möglich abzustreifen.
»Ha-hast du das gesehen?« Mit zitternder Hand deutet Sandrina zur hinteren Ecke eines Fischereiladens, wo statt einer Markise die algendurchsetzten Netze über den geschlossenen Fensterläden zum Trocknen hängen. Hinter der Hausecke verliert sich eine enge Gasse in der Finsternis. »Da-da war ein Schatten. Ga-ganz flink …«
Obwohl ich verzweifelt versuche, das Gruselgefühl abzuschütteln, schwappt es unweigerlich von Sandrina zu mir herüber. Normalerweise bin ich überhaupt nicht schreckhaft, aber sowohl die Sache mit dem Buch als auch dieser diffuse-Verlangen-Spion haben mich verunsichert, sodass es mir heute wesentlich schwerer fällt als sonst, sowohl meine Freundin als auch mich zu beruhigen. Im Vergleich zu dem regen Treiben am Tage sind jetzt nur noch wenige Leute unterwegs. Im Licht einer Laterne werkelt jemand an seinem Segelboot und im ersten Stock eines Wohnhauses schaut eine Frau aus dem Fenster, um die Ursache für den Schreckensschrei zu erkunden. Als sie nichts weiter Interessantes entdecken kann, schließt sie die Läden. Auch mein Puls beruhigt sich allmählich wieder, während die Furcht abflaut.
»Sie ist weg, oder?«, haucht Sandrina.
»Wer denn jetzt? Ich habe gar niemanden gesehen.«
»Die Nageschratte natürlich.«
»Ach so, eine Nageschratte …«, stöhne ich.
»Ja, was hast du denn gedacht? Du weißt doch ganz genau, dass ich mich schrecklich vor diesen Biestern fürchte. Sie sind so flink und mir stellen sich jedes Mal alle Haare auf, wenn ich nur eine von ihnen sehe«, beschwert sich Sandrina über meine Erleichterung. »Ich verstehe gar nicht, wie man sich nicht vor ihnen fürchten kann. Man sagt, mit ihren scharfen Zähnen können sie sogar Drachenlederschuhe durchbeißen und unsere neue Nachbarin hat beobachtet, wie drei von ihnen an unserer Hauswand hochgekrabbelt sind, bis durch ihr Küchenfenster.«
»Na, ob das mal stimmt …«, brumme ich. »Du sagst doch selbst, dass sie euch ständig Lügengeschichten auftischt.«
»Ja, aber das mit den Nageschratten glaube ich schon. Warum sollte sie so etwas erfinden?«
»Da fallen mir ganz spontan schon mal zwei Gründe ein: Entweder, um dir Angst einzujagen oder um den Preis für ihre Miete zu drücken.«
»Hm, vielleicht hast du recht … Zum Glück geht jetzt ja auch gerade der Mond auf, da ist es nicht mehr ganz so düster am Kai.« Sie deutet zum Wasser, wo sich die obere Rundung des großen blassen Mondes spiegelt. Der kleineblaue Mond steht bereits hoch am Himmel, doch spendet er nicht so viel Licht. Hier in der Gegend der Flussmündung ist der Tebro so breit, dass man ihn schon für das Meer halten könnte, da man das andere Ufer kaum erkennt. Sogar kleine Wellen spült das ansonsten ruhige Wasser gegen die Kaimauer.
Ich weiß, dass Sandrina den Mond erwähnt, weil sie sich vor der Dunkelheit mindestens genauso fürchtet wie vor Nageschratten oder davor, sich mit fremden Männern zu unterhalten. »Ach ja, was war denn jetzt mit diesem Buch?«, fällt ihr das Ursprungsthema wieder ein.
Während wir unseren Weg fortsetzen, erzähle ich meiner Freundin alles über dieses seltsame Buch, muss jedoch feststellen, dass die Sache auf Sandrina weit weniger unheimlich wirkt als auf mich.
»Ich würde das alles nicht so ernst nehmen. Ein Buch mit Kohlezeichnungen eben, in das ein Witzbold vorne seinen dummen Kommentar reingeschrieben hat …«
»Ja, wenn man es so sieht …«, brumme ich ein wenig enttäuscht über ihre Reaktion. Dagegen scheint sie sich über Leonidos Verhalten noch mehr aufzuregen als ich selbst, als ich ihr von unserer Begegnung berichte.
»Dieser gemeine Rockjäger!«, regt sie sich auf. »Weißt du eigentlich, dass er versucht hat, sich bei mir einzuschmeicheln, nachdem das mit euch beendet war? Ich wusste nicht, ob ich dir das erzählen sollte, weil du ja am Anfang noch so schlimmen Liebeskummer hattest, aber ich denke, jetzt kannst du wirklich froh sein, dass du ihn los bist.«
»Echt? Bei dir hat er es also auch versucht? Eigentlich wundert es mich ja nicht. Er scheint ja wirklich wahllos zu sein …« Sofort muss ich schlucken, weil ich mal wieder viel zu schnell dummes Zeug geredet habe. »Ähm, ich meine das natürlich nicht gegen dich, sondern eher so, dass Leonido so ziemlich jede recht ist, die einigermaßen gut aussieht – nicht so wie wir beide natürlich, aber, ach du weißt schon, was ich meine, oder?«
»Ähm, ja, so ungefähr …« Sandrina schielt mich mit gerunzelter Stirn schief von der Seite an.
»Auf jeden Fall hast du Recht, ich kann froh sein, dass das mit uns zu Ende ist.« Und doch bin ich nicht zu hundert Prozent über ihn hinweg, das merke ich an dem Stich im Herzen, immer wenn ich solche Sätze ausspreche, wie diesen gerade eben.
Eigentlich gäbe es noch mehr zu erzählen, zum Beispiel über diesen Spion mit dem diffusen Verlangen. Weil ich jedoch allzu oft die Erfahrung gemacht habe, dass Leute negativ auf die Offenbarung meiner Gabe reagieren, lasse ich das lieber bleiben. Mittlerweile sind wir auch schon fast da, was unter anderem daran zu erkennen ist, dass der Trubel am Kai deutlich zugenommen hat. Bei der Singtadelle handelt es sich um ein uraltes Reedereigebäude, welches weit bis ins Wasser hineinragt. Bei der Renovierung wurden überdimensionale Fenster eingebaut, durch die man gut die Lichteffekte im Wasser sehen kann. Heute wollen sie sogar ein Feuerwerk zünden. Drinnen wurden auf mehreren Ebenen stabile Holzböden verlegt, die sich optimal zum Tanzen eignen. Da sich drum herum keine Wohnhäuser, sondern lediglich Läden und Märkte befinden, beschwert sich nur selten jemand über die laute Musik, welche schon jetzt bis zu uns herüberweht. Sowohl in meinem Bauch als auch in den Beinen kribbelt es vor Aufregung, denn heute werden die Trijaner auftreten, die beste und berühmteste Musikgruppe ganz Fabenias. Dementsprechend üppig fällt das Eintrittsgeld aus, aber obwohl meine Eltern keinem adeligen Stand angehören, verdienen wir gut mit dem Restaurant und außer dem Bibliothekseintritt habe ich ja sonst kaum Ausgaben. Sandrina gehört ebenfalls dem grünen Stand an, wie auch alle Handwerker, Händler und Restaurantbesitzer, weil sie mit ihren Eltern als Schneiderin arbeitet. Es versteht sich von selbst, dass meine Kleider ausschließlich Kreationen meiner besten Freundin sind.
»Waaa! Hörst du das? Die Trijaner haben doch nicht etwa schon angefangen.« Vor lauter Panik, zu spät zu kommen, legt Sandrina einen Schritt zu, sodass ich bei dem Trubel Schwierigkeiten bekomme, mitzuhalten.
»Ach, Quaritsch!«, rufe ich ihr hinterher. »Das müssen die Melikans sein. Genau diese Melodie habe ich heute schon vor der Bibliothek gehört.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: