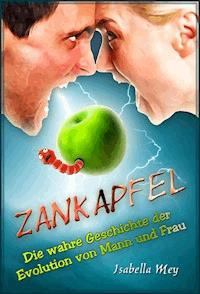0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein gefühlvoller Fantasy-Liebesroman mit einem Hauch Erotik
Inea führt ein ganz normales Leben. Ihre Welt gerät jedoch immer mehr aus den Fugen, als sie Dinge wahrnimmt, die andere nicht sehen.
Obendrein begegnet ihr ein Mann, der eine geradezu beängstigend übernatürliche Anziehung auf sie ausübt.
Leseprobe
Starke Finger packen meine Handgelenke und ziehen mich mit übermenschlicher Kraft und einem solchen Schwung in die Höhe, dass ich regelrecht auf meinen Retter zufliege. Er fängt mich auf, hält mich fest. Ich liege in seinen Armen, spüre seinen Körper dicht an meinem und sofort durchflutet mich eine Wärme, wie ich sie nie zuvor gefühlt habe. Meine Knie verwandeln sich in Wackelpudding, was mich unwillkürlich dazu bringt, mich an ihm festzuklammern, meine Arme um ihn zu schlingen. Verwirrt und benebelt von diesem unbekannten Gefühl, verharre ich in völliger Unfähigkeit, mich zu bewegen. Mein Herz hämmert gegen meine Brust, im Gleichklang zu seinem, dessen Wummern ich ebenfalls spüren kann.
Weshalb nur fühlt sich die Umarmung eines völlig Fremden dermaßen himmlisch an?
Im nächsten Augenblick jedoch löst sich der Mann von mir, hält mich an den Armen fest und mustert kritisch mein Gesicht. In seinen Pupillen lodert das dunkle Feuer eines schwarzen Turmalins.
Oh Gott, es ist der gruselige Typ, der mich vom Kai aus angestarrt hatte!
Mir wird schwindelig.
»Wer bist du?«, will er wissen.
Seine Stimme vibriert in meinem Inneren, der Ton seiner Worte bringt eine Melodie in mir zum Klingen.
Was ist das? Um Himmels willen, wer ist dieser Mensch und was macht er mit mir?
Seine Erscheinung sollte mich ängstigen, aber da ist keinerlei Furcht, im Gegenteil. Nirgendwo sonst habe ich mich so geborgen gefühlt wie in seiner Nähe. Völlig überwältigt von diesen Emotionen, versagt meine Stimme. Ich starre ihn nur an wie einen Alien. Der Fremde mustert meinen Hals, schüttelt dann ungläubig den Kopf.
»Verdammt, wer bist du?«
Die Sammlung enthält alle fünf Flammentanz-Bände
Band I - Funken
Band II - Flammen
Band III - Feuer
Band IV - Brand
Band V/Finale - Glut
Romantasy mit einem Hauch Erotik, ab 16 Jahren
Weitere Bücher der Autorin
Lichtertanz
Band I – Die Magie der Glanzlichter
Band II – Die Magie der Goldwinde
Band III – Die Magie der Lichtkristalle (Finale)
Schattentanz-Trilogie
und viele mehr...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Spiegelproblem
Kindergarten
Beata
Lord der Schatten
Schifffahrt
Verfolgung
Funken
Der Namenlose
Noch einmal Beata
Das Date
Außer Kontrolle
Lilianas Geheimnis
Leyla
Verbindung
Aufeinandertreffen
Funkenzauber
Suche
Kampf
Immer nur Inea
Markus
Rückkehr
Danksagung der Autorin
Ode an meine Testleser
Glossar
Der Rat der Zwölf
Impressum
FLAMMENTANZ
Funken
Isabella Mey
Band I
Der Schlüssel zum Glück liegt nicht darin,
sich den perfekten Moment zu erschaffen,
sondern darin,
die Perfektion eines jeden Moments zu erkennen.
Das Spiegelproblem
Inea
Ich gähne herzhaft und strecke alle Glieder von mir, um die Müdigkeit aus meinen Knochen zu vertreiben. Die Sommersonne schickt ihre Strahlen durch die hohen Fenster der alten Villa, bis in mein Bett hinein. Ich blinzle verschlafen, als mein Blick einen Gegenstand fixiert, der dort absolut nicht hingehört. Erschrocken springe ich auf die Füße, schwanke jedoch bedenklich, da mein Kreislauf noch immer untertourig läuft.
Wer, verdammt noch mal, hat diesen Spiegel hier hereingebracht?
Es ist nicht meine Art, zu fluchen, aber das bringt mich völlig aus der Fassung. Nicht ohne Grund habe ich sämtliche Spiegel letztes Jahr in den Keller verbannt. Wie auf der Hut vor einem wilden Tier umschleiche ich die Spiegelfläche und taste mich ohne hineinzusehen zur Rückseite vor.
Warum muss es auch noch dieser schrecklich große und viel zu schwere Standspiegel sein? Sicherlich stecken mal wieder die Zwillinge dahinter!
Man sollte nicht meinen, dass sie ihr 20. Lebensjahr bereits überschritten haben, bei dem Blödsinn, der den beiden immer im Kopf herumspukt!
Ich stemme meinen Hintern gegen die Rückseite und packe die linke sowie die rechte Seitenstange. Dann schiebe ich den Spiegel Stück für Stück um die eigene Achse, so lange, bis sich die Gefahrenseite der Textiltapete zuwendet.
Das wäre geschafft!
Doch mein Puls rast noch immer auf 180.
Ich will mich nicht schon wieder für verrückt halten, das ertrage ich nicht!
Aber die Erinnerung drängt sich unvermeidlich in mein Bewusstsein und damit auch die Angst und die unangenehme Frage, ob sich das Ganze wiederholen könnte – ob mein Spiegelbild noch immer …
Ich schüttle mich, will das alles nur noch vergessen.
Dieser Spiegel muss verschwinden. Noch heute! Ich werde ein ernstes Wort mit meinen WG-Mitbewohnern reden müssen.
Noch immer heftig erregt, stülpe ich mir den Bademantel über das Nachthemd und schlurfe in meinen flauschigen Hausschuhen über den kunstvoll mit verschiedenfarbigen Holzsorten verzierten Parkettboden auf den Flur hinaus. Aus dem Esszimmer vernehme ich das schelmische Lachen der Zwillinge Max und Moritz.
Nein, das ist kein Witz!
Ich habe mich schon mehr als einmal gefragt, unter welchen psychedelischen Drogen die Eltern der beiden standen, als sie auf die Idee kamen, ihre Söhne Max und Moritz zu taufen. Ob es an diesem Omen lag oder ob der Zufall dem Schicksal gleich zwei Streiche spielen wollte, lässt sich schwerlich beurteilen, jedoch stehen die Zwillinge ihren lausbübischen Namensvettern von Wilhelm Busch in nichts nach. Zum großen Bedauern der beiden sehen sie sich als zweieiige Zwillinge zwar ähnlich, aber eben wie gleichaltrige Brüder, nicht wie ein Ei dem anderen. Allerdings wurden beide Jungs von ihren Eltern mit tiefblauen Augen sowie dunkelblondem Haar gesegnet, welches stets in allen Richtungen absteht. Da Max und Moritz zudem die gleiche Frisur und die gleiche Kleidung tragen, erkennt man die kleinen Unterschiede im Gesicht meist erst auf den zweiten Blick.
Ich schiele zur Tür hinein, als Max gerade einen köstlich duftenden Kaffee hinunterkippt, während Moritz, der ihm gegenüber am Esstisch sitzt, die Schale seines Frühstückseies zu kleinen Krümelchen zusammenklopft.
»Hey, ich kann ja nachvollziehen, dass du Kalzium als lebenswichtiges Mineral zu schätzen weißt, aber ist es dafür wirklich notwendig, die Eierschale komplett zu pulverisieren?«, neckt Max seinen Bruder, während er die Tasse zurück auf ihren Untersatz befördert.
»Haha, warte es nur ab! Dir wird gleich die Ehre zuteil, Zeuge des überaus grandiosen Sitake-Eiertricks zu werden. Achtung!«
Ich habe den Schock mit dem Spiegel weder verdaut noch vergessen, aber den Sitake-Eiertrick will ich noch sehen, bevor ich die beiden Jungs zusammenfalte. Sitake ist übrigens der Familienname der Zwillinge.
So bleibe ich im Türrahmen stehen und beobachte Moritz, der nun die dünne Eihaut samt der zerbröselten Schale spiralförmig – gleich einer Apfelschale – pellt, bis sie in einem langen Band von seiner Hand herabbaumelt.
»Tadaaa!«, triumphiert Moritz und Max applaudiert überschwänglich.
»Bravo, Bruderherz! Damit hast du das Eierschälen komplett revolutioniert! Kein Mensch wird sich mehr damit begnügen, seinem Frühstücksei den Kopf abzuschlagen. Nein, das Komplettweichklopfen, kombiniert mit dem quälend langsamen Abschälen der inneren Haut, übertrifft jede Eier-Foltermethode in ihrem Sadismus!«
Max trieft so dermaßen vor Pathos, dass ich den Spiegel für eine Sekunde tatsächlich vergesse und lauthals lospruste. Augenblicklich wenden sich beide Blondschöpfe in meine Richtung.
»Ineachen! Sag, hast du meinen revolutionären Sitake-Eiertrick mitverfolgt?«
»Ja. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, mein Ei jemals wieder auf eine andere Art zu pellen«, antworte ich schmunzelnd, während ich mich zu den Zwillingen an den einladend gedeckten Frühstückstisch hocke.
Kaum berührt mein Hinterteil den Stuhl, fühlt sich Max auch gleich dazu aufgefordert, mir ein Ei vor die Nase zu setzen. Ich seufze tief, denn mir ist weder nach Späßen noch nach Essen zumute. Zu sehr sitzt mir der Schock mit dem Spiegel im Nacken.
»Sagt mal, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, mir den Standspiegel ins Zimmer zu stellen?«
Beide Zwillinge schütteln übertrieben empört die Köpfe.
»Aber Ineachen, was denn für einen Spiegel?«, fragt Moritz dermaßen theatralisch, dass jedem Einfaltspinsel klar sein müsste, dass er ganz genau weiß, wovon ich rede.
Mir entfährt ein weiterer tiefer Seufzer. Wie sollten die beiden auch ahnen, dass dies für mich nicht einfach ein normaler Scherz ist? Und den Grund kann ich ihnen schon gar nicht nennen.
»Ich habe ein psychologisches Problem mit Spiegeln. Die Dinger standen nicht umsonst im Keller. Klar?«
»Ein psychologisches Problem?«, fragen die Zwillinge wie aus einem Mund und starren mich dabei an, als hätte ich ihnen gerade mein Outing als Lesbe offenbart.
Oje, ein psychologisches Problem vorzuschieben, war wohl keine besonders glorreiche Idee, aber wie sonst sollte ich meine Spiegelphobie sinnvoll begründen?
»Ja, aber ich will nicht drüber reden!«, wehre ich sofort ab.
Doch so können das die beiden natürlich nicht stehen lassen.
Was habe ich auch anderes erwartet?
»Aber Inea-Mäuschen, wie kann das sein? Ich meine, wenn dir deine grünen Augen zu groß, deine vollen Lippen zu rot oder deine perfekte Figur zu elegant sein sollte, könnte ich die Spiegelphobie ja noch einigermaßen nachvollziehen, aber wegen einer einzelnen zu groß geratenen Sommersprosse so ein Aufheben zu machen …«, lässt sich Max gespielt empört über mich aus.
Ich schüttle erneut seufzend den Kopf.
»Ich habe doch überhaupt keine Sommersprossen!«
»Na ja, vielleicht ist ja genau das dein Problem«, folgert Moritz mit erhobenem Zeigefinger.
»Ach, vergesst es doch einfach! Es liegt nicht an meinem Aussehen. Ich bin zufrieden mit mir.«
»Gehe ich dann recht in der Annahme, dass die Ursachen in einer frühkindlichen Entwicklungsphase verborgen liegen? Sind deine Eltern nicht bei einem Hausbrand ums Leben gekommen, als du noch ein Baby warst? Könnte ein Spiegel die Ursache für das Feuer gewesen sein?«
Bei aller Freundschaft, aber das geht mir nun eindeutig zu weit!
»Man weiß nicht, was den Brand ausgelöst hat!«, entgegne ich nun ziemlich patzig. »Lasst es gut sein, okay?«
Innerlich bebe ich. Ich habe zwar keine Erinnerung an meine Eltern, aber auf dieses sensible Thema reagiere ich äußerst empfindsam. Außerdem erinnert es mich schon wieder an das Spiegelproblem, weil ich nicht weiß, wer ich bin, und auch nicht weiß, wer meine Eltern waren und ob es vielleicht an ihnen lag, dass mir diese Dinge passieren mussten.
Aber das Schlimmste ist: Ich kann mit niemandem darüber reden. Ich habe es damals getan, habe mich meinem Ex-Partner Sven anvertraut – mit dem Ergebnis, dass er mich in die Psychiatrie einweisen lassen wollte. Und jetzt ist er einfach weg, für immer fort!
»Für wie viel Uhr hat sich eigentlich die neue Flamme angekündigt?«, wechselt Max abrupt das Thema und reißt mich damit aus meinen Gedanken.
Spätestens nach meiner patzigen Antwort ist den Zwillingen dann doch klargeworden, dass das Spiegelproblem-Thema bei mir auf der Schwarzen Liste steht. Innerlich atme ich erleichtert auf, mich endlich wieder den alltäglichen Dingen widmen zu können.
»Sie wollte um 16 Uhr vorbeikommen«, erkläre ich.
Die geräumige Wohnung in der alten Villa am Berghang von Eppstein im Taunus war das Einzige, was mir meine Eltern hinterlassen haben. Noch vor einem Jahr habe ich hier mit meinem Partner Sven gelebt, aber um die Leere nach seinem Verschwinden mit Leben zu füllen, habe ich kurzerhand eine WG gegründet – für mich allein ist die Wohnung sowieso viel zu groß. Ohne Mitbewohner würde ich mich recht einsam und verloren in den hohen stuckverzierten Räumen fühlen. Immerhin belegt die Wohnung mit ihren sechs geräumigen Zimmern das gesamte Stockwerk. Drei davon bewohnen Max, Moritz und ich, während wir das Ess- und das Wohnzimmer gemeinsam nutzen.
Bleibt noch ein weiteres Zimmer, das bisher noch keinen geeigneten Mieter gefunden hat. Natürlich gab es schon einige Bewerber für das noble Villenzimmer; wenn man jedoch in einer Wohngemeinschaft zusammenlebt, muss man schließlich gut miteinander auskommen. Deshalb bin ich zugegebenermaßen recht wählerisch, und natürlich sollte die Kandidatin oder der Kandidat auch die Zustimmung der Zwillinge finden. Für heute Nachmittag hat sich eine Bewerberin für das Zimmer angekündigt und ich bin schon sehr gespannt darauf, ob sie in unsere WG passen könnte.
»Wie sieht sie eigentlich aus? Hast du dir ein Foto zuschicken lassen?«, will Moritz wissen.
»Nein, habe ich nicht. Schließlich geht es hier nicht um Partnervermittlung.«
»Ach, man könnte doch durchaus das eine mit dem anderen verbinden, findet ihr nicht?«, entgegnet Moritz.
»Das fehlte noch, dass wir hier Paare bilden und dann der Bruderstreit zwischen euch ausbricht, weil ihr euch beide in die Neue verliebt«, gebe ich zu bedenken.
»Musst du alles immer so schwarzsehen, Ineachen? Wir teilen natürlich alles gerecht auf«, erklärt Moritz todernst und Max pflichtet seinem Bruder eifrig nickend bei.
Da muss ich jetzt aber doch lachen.
»Auch die Frauen teilen, ja? Da müsst ihr erst einmal eine finden, die sich auf so etwas einlässt.«
»Was? Wieso? Sie kann zwei Prachtkerle auf einmal haben! Wer könnte da widerstehen?«
»Na ja, zum Beispiel die geschätzten 99 Prozent der Frauen, die von einer monogamen Partnerschaft träumen.«
»Ach, dieser Spießerkram von vorgestern … Außerdem, wer redet denn gleich von einer festen Beziehung? Wir wollen doch nur unseren Spaß! Stimmt’s, Brüderchen?«
Der Angesprochene weitet übertrieben die Augen und nickt dabei so heftig mit dem Kopf, dass mir schon alleine vom Zusehen schwindelig wird.
Ich verdrehe die Augen und seufze.
Zum wievielten Mal heute? Ich sollte eine Seufzer-Strichliste führen … Ob diese Kindsköpfe jemals erwachsen werden? Aber ich will mich nicht beklagen, denn ihre heitere Art tut mir gut, bringt Freude und Lebendigkeit in meinen Alltag.
Uns trennen gerade mal vier Jahre – ich habe mein 26. Lebensjahr vollendet, die Zwillinge sind 22, aber hin und wieder fühle ich mich in die Rolle ihrer Mami gedrängt, die ihre ungezogenen Söhne in die Schranken zu weisen hat. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich als Erzieherin im Kindergarten den ganzen Tag lang diese Rolle übernehme und dann zu Hause einfach damit fortfahre. Von der neuen Mitbewohnerin erhoffe ich mir daher eine echte Freundin auf Augenhöhe, mit der ich auch über ernstere Themen sprechen kann, und sicherlich werde ich sie nicht nach Kriterien auswählen, die sie zum Lustobjekt der Zwillinge degradieren.
Inzwischen hat Moritz für mich die Aufgabe übernommen, mein Ei nach dem Sitake-Eiertrick zu pellen, und jetzt hockt es nackt im Eierbecher und lacht mich mit seinem Senfgesicht an, das einer der Zwillinge draufgemalt hat.
»Komm, iss mich doch endlich, Ineachen!«, brabbelt Moritz mit verstellter Stimme, während er das Ei mit dem Zeigefinger sanft niederdrückt, als würde es tatsächlich mit mir sprechen.
Da muss ich herzhaft lachen. Wenn es die beiden nicht hinbekommen, einem gute Laune zu machen, dann schafft das niemand! Und endlich verspüre ich auch ausreichend Appetit, um das kleine Frühstückskunstwerk zu verzehren. Ich gönne mir noch eine Tasse Kaffee und ein Vollkornbrötchen mit Käse und Gurkenscheiben darauf, die jemand in einem rätselhaften Muster zugeschnitten hat.
»Sollen das Kleeblätter sein?«, frage ich mit Blick auf die zerschnippelten Gurkenstücke.
»Ihr Frauen denkt doch immer nur an das Eine: Blumen und Pflanzen! Dabei ist Max schlichtweg am kläglichen Versuch gescheitert, ein Pärchen bei der Kopulation herauszuarbeiten.«
Fast hätte ich mich an meinem Essen verschluckt. Ich kann gerade noch ein lautes Losprusten verhindern.
»Aber ihr Männer denkt nicht immer nur an das Eine, oder was?«, entgegne ich lachend, nachdem ich mein Essen hastig hinuntergewürgt habe.
»Ha! Sie ist drauf reingefallen!«, mokiert sich Max über mich. »Aber du hast es richtig erkannt. Es sollten tatsächlich nur simple Kleeblätter werden.«
Die antike Standuhr setzt zum 7-Uhr-Gong an und lässt mich erschrocken zusammenfahren. Ich bin definitiv spät dran. Noch während ich aufspringe, schlucke ich den letzten Bissen hinunter.
»Du bist spät dran, Inea-Mäuschen!«, kommentiert Max das Offensichtliche.
»Gut erkannt!«, rufe ich ihm noch auf dem Weg durch den Flur zu.
Dann bin ich auch schon im Bad verschwunden und sperre die Tür hinter mir ab. Für heute muss eine Katzenwäsche genügen. Ich wende mich dem Waschbecken zu.
Im nächsten Augenblick jedoch lähmt ein eisiger Schauer meinen gesamten Körper und ein dünner Aufschrei entweicht meiner Kehle. Aus dem Spiegel, der gestern noch nicht da war, blickt mir etwas entgegen, das nicht ich bin!
Ich zittere, will mich sofort abwenden, es wieder vergessen, verdrängen – und doch hält das Bild meinen Blick gefangen, bringt mich bis in die innersten Eingeweide zum Beben.
Was zur Hölle ist das? Was stimmt nicht mit mir?
Jemand drückt die Klinke herunter, doch die Tür bleibt verschlossen.
»Inea-Mäuschen? Geht es dir gut?«, fragt eine besorgte Stimme, die zu Max gehören könnte.
Da endlich bringe ich es fertig, meinen Blick vom Spiegel zu lösen – doch das, was ich dort sah, hat sich tief in mein Bewusstsein hineingebrannt, und ich weiß, dass es mich noch lange bis in meine Träume hinein verfolgen wird. Mit zittrigen Fingern öffne ich die Tür und blicke in das schuldbewusste Gesicht meines Mitbewohners.
»Sorry, den hatte ich ganz vergessen«, bekennt Max und zeigt zum Badspiegel.
»Bringt die Dinger bitte sofort wieder in den Keller zurück!«, entgegne ich bebend.
Ich stütze mich am Türrahmen ab und atme tief durch, um wieder zu mir zu kommen.
»Klar, Inea-Mäuschen, wie die Herrin wünscht.«
Auch Moritz taucht nun im Flur auf, geht mit Max ins Bad und hilft ihm, den Spiegel aus der Verankerung zu heben. Ich schirme meine Augen mit der Hand ab, angle mir nur die Bürste und verschwinde damit ins Wohnzimmer. Hier kann ich meine tiefschwarzen, langen Haare gefahrlos von Knötchen befreien.
Die Zwillinge halten mich jetzt sicher für total übergeschnappt. Wenn ich ihnen jedoch erzähle, was ich tatsächlich im Spiegel sehe, würde sich das allerdings noch um ein Vielfaches potenzieren.
Ich atme tief durch, umklammere die Bürste wie einen Rettungsring und versuche, das Zittern unter Kontrolle zu bringen. Doch das Spiegelbild tanzt vor meinem inneren Auge, treibt mich schier in den Wahnsinn.
Ich bin nicht normal! Das kann unmöglich normal sein!
Zumindest habe ich jetzt die Antwort auf meine innerlich gestellte Frage, ob das Problem noch immer besteht: Ja, es ist sogar noch viel schlimmer als vor einem Jahr.
Himmel, wo soll das nur enden?
»Du kannst rauskommen, Inea-Mäuschen!«, höre ich Max rufen.
»Diese Wohnung wird mit dem heutigen Tag zur spiegelfreien Zone erklärt!«, verkündet Moritz, als wäre er ein Marktschreier, der seine Äpfel anpreist.
Sicher noch immer käseweiß wie ein Laken, schlurfe ich in meinen Flausche-Hausschuhen an den Zwillingen vorbei, die mich mustern wie eine außergewöhnliche Rarität, und begebe mich abermals ins Bad.
»Danke«, hauche ich tonlos und schließe die Tür.
Ich erledige eilig meine Morgentoilette, bin aber nicht bei der Sache, sodass sich versehentlich ein paar meiner Haare in der Zahnbürste verheddern, die ich dann mühsam wieder aus meinen Zahnzwischenräumen herausfädeln muss.
Wie es die Zwillinge fertigbringen, bei ihrem sprunghaften Lebensstil immer so früh aufzustehen und dabei auch noch frisch und ausgeruht auszusehen, zählt wohl zu den größten Mysterien dieser Erde – wenn man von meinem Spiegelproblem einmal absieht …
Nicht schon wieder dieses Thema! Verschwinde endlich aus meinem Kopf!
Ich schüttle mich heftig, was die Bilder natürlich nicht vertreibt. Im Gegenteil, sie scheinen mich umso hartnäckiger zu verfolgen, je mehr ich versuche, sie wegzudrängen – ungefähr so, wie wenn man sich permanent bemüht, nicht an ein rosa Nilpferd zu denken und es genau aus diesem Grund doch immer wieder tut.
Vielleicht sollte ich aufhören, gegen diese Bilder anzukämpfen, sie einfach akzeptieren als einen Teil von mir? Aber wie soll das denn gehen?
Alleine bei der Vorstellung graust es mich. Ich schüttle mich erneut.
Nach der Morgenwäsche kehre ich in mein Zimmer zurück und blicke erleichtert zur Wand, vor der mich nun kein Spiegel mehr bedroht. Ich schlüpfe in meine frische Wäsche sowie in Jeans, grünes Top und Jeansjacke. Ja, man merkt mir meinen kleinen Jeans-Tick an – nur eines von vielen Dingen, mit denen meine bornierten Nachbarn nicht zurechtkommen.
Ich schultere meine Jeanstasche und eile zur Wohnungstür – jetzt bin ich wirklich sehr spät dran.
»Tschüss, ihr beiden!«, rufe ich meinen Mitbewohnern zu und haste die Treppe hinunter – leider viel zu stürmisch, denn beinahe renne ich dort meinen Nachbarn samt Lebensgefährtin über den Haufen. Ich kann gerade noch so weit ausweichen, dass ich lediglich einen Stapel Akten aus seinen Armen mitreiße, der in hohem Bogen durch die Luft fliegt. Die einzelnen Blätter segeln flatternd herab, um sich dann gleichmäßig über die Stufen zu verteilen.
Das hat mir gerade noch gefehlt!
»Können Sie nicht aufpassen?!«, fährt mich die stets überheblich klingende Stimme meines Nachbarn an.
»Entschuldigung«, sage ich mit ehrlichem Bedauern – auch wenn sich meine Sympathie für Herrn Leon Friedrich Steinberg in Grenzen hält.
Außer meiner gehören ihm alle Wohnungen im Haus: Im Erdgeschoss befindet sich seine Anwaltskanzlei, das Stockwerk darüber bewohne ich, den zweiten Stock teilt er sich mit seiner Lebensgefährtin Tina Besset und das Dachgeschoss dient ihr als Kosmetiksalon. Natürlich entzückt es ihre betuchten Kundinnen nicht besonders, dass sie in dieser altehrwürdigen Villa so viele Stufen hinaufsteigen müssen, denn über einen Aufzug verfügt das Gebäude nicht. Mehr als ein Mal hatte mir mein Nachbar Leon Friedrich Steinberg daher ein Angebot für den Kauf meiner Wohnung unterbreitet. Aber diese Wohnung ist das Einzige, was mir von meinen Eltern geblieben ist, und ich fühle mich wohl darin, wenn man von den Arroganz-Attacken der Nachbarschaft einmal absieht.
Da ich trotz allem ein netter Mensch bin und dieses Desaster mit den Akten in meinen Verantwortungsbereich fällt, fange ich sofort an, die herumliegenden Blätter wieder einzusammeln.
»Was tun Sie da? Rühren Sie das nicht an!«, schimpft Herr Steinberg aufgebracht.
Ich hebe abwehrend die Hände. Er macht sich nun selbst fluchend an die Arbeit, seine Akten einzusammeln. Da es für mich hier nichts mehr zu tun gibt, steige ich die Treppe weiter hinab.
»Hast du gesehen, wie sie wieder rumläuft? Was werden deine Klienten davon halten, wenn sie sie in diesem Aufzug vor der Kanzlei zu Gesicht bekommen? Du solltest an deinen guten Ruf denken, Leon!«, höre ich Tina Besset lästern. Dabei gibt sie sich keinerlei Mühe, ihre Worte vor mir zu verbergen.
»Sicher, Schnucki. Bedauerlicherweise steht es mir nicht zu, eine Kleiderordnung für dieses Haus zu verhängen …«
Der Rest seiner Antwort geht in dem Poltern der hinter mir ins Schloss fallenden Tür unter. Dieses arrogante Gehabe gehört bestimmt zur Strategie, mich aus dem Haus zu ekeln. Wenn allerdings ein echter Nachbarschaftskrieg ausbrechen sollte, begeben sich die beiden auf deutlich dünneres Eis als ich, da ich keine Kunden zu verlieren habe, meine Nachbarn aber sehr wohl. Das beruhigt mich ein wenig, da ich mir kaum vorstellen kann, dass es die beiden so weit eskalieren lassen würden.
Kindergarten
Inea
Ich darf zwar ein kleines Auto mein Eigen nennen, aber da ich ansonsten keinen Sport treibe und es nicht allzu weit ist bis zur Kita, schwinge ich mich an diesem Morgen auf mein Fahrrad. Auch das Wetter gibt mir heute grünes Licht, denn am Himmel zeigt sich nicht ein einziges Wölkchen. Zuerst fahre ich unter Dauerbremsen den Steilhang zum Ortskern von Eppstein hinab, radle dann am Bahnhof vorbei und ab hier führt ein schöner Radweg am Schwarzbach und dann am Dattenbach entlang, sodass ich nicht dem Verkehr der Hauptstraße ausgesetzt bin. Die Kita, in der ich arbeite, befindet sich ebenfalls am Hang im Ortsteil Vockenhausen. Da meine Tante diesen Kindergarten leitet und ich selbst hier schon als kleines Mädchen getobt und gebastelt habe, ist dieser Ort zu meinem zweiten Zuhause geworden, und für mich bestand nie ein Zweifel daran, dass ich hier auch einmal selbst arbeiten würde.
Mit dem Spiegelproblem komme ich jetzt sogar besser zurecht als erwartet. Ich lasse die Bilder einfach auftauchen, vorüberziehen und wieder verschwinden und denke dann über etwas anderes nach. Auch wenn ich weiß, dass die Sache nicht ausgestanden ist, fühlt sich dieses Problem in meinem Alltagstrott auf einmal so irreal an, dass es sich im Moment gut in der Schublade mit der Aufschrift »belanglose Einbildungen« verstauen lässt.
Das letzte Stück zur Kita schiebe ich mein Rad, da es hier wieder höllisch steil wird. Ich stelle es vor dem Gebäude ab und entsichere per Knopfdruck die Türblockade, die heimliche Abenteuerausflüge der Kinder verhindern soll.
Mein erster Weg führt in den Mitarbeiterraum. Hier kann ich Jacke und Tasche in meinem Spint verstauen. Meine Tante Liliana sitzt am Gemeinschaftstisch und strahlt mir freudig entgegen, als ich eintrete.
»Hallo Liebes! Bei dem schönen Wetter bist du doch sicher mit dem Rad gekommen, stimmt’s?«
»Ja, bin ich. Die Bewegung am frühen Morgen tut mir gut und macht mich wach für die Arbeit.«
»Möchtest du noch einen Tee mit mir trinken? Ich habe eine ganz besonders belebende Mischung kreiert.«
»Würde ich gerne, aber ich bin schon reichlich spät dran …«
»Darum brauchst du dich nicht zu sorgen. Lissi ist bereits in der Gruppe und Benedikt ist auch schon da.«
Ich nicke erleichtert, denn ich hatte ganz vergessen, dass wir ja seit letzter Woche einen Praktikanten haben – obwohl diese Bezeichnung in die Irre führen könnte, denn Benedikt liegt mir zwei Jahre voraus, hat sich als Künstler mit seinen futuristischen Skulpturen einen Namen gemacht und entdeckte wohl auf der Suche nach dem Lebenssinn seine soziale Ader, weshalb er jetzt in unserem Kindergarten dieses Praktikum absolviert. Mit ihm weiß ich meine Gruppe aber in guten Händen. So kann ich dann doch noch ein wenig mit meiner Tante plaudern. Liliana hat mich nach dem Tod meiner Eltern zu sich genommen und wie eine Tochter aufgezogen, wobei sie selbst nie eigene Kinder hatte.
Ich nippe an dem dampfenden Getränk, das mir meine Tante eingeschenkt hat.
»Mmmh, wie machst du das nur? Der Tee ist so köstlich und würzig, dass ich das Blut in meinen Adern pulsieren fühle! Du solltest deine Mischungen patentieren lassen, damit könntest du viel Geld verdienen«, schwärme ich.
Liliana bedenkt mich mit einem freudigen Lächeln. Man sollte nicht meinen, dass sie ihr 50. Lebensjahr bereits hinter sich gelassen hat, denn ihre Haut wirkt noch immer frisch und nahezu makellos. Nur die langen silberweißen Haare zeugen von ihrem fortgeschrittenen Alter. Neben eigenen Teekreationen und der Pflanzenzucht hat sie außerdem ein Faible für Glitzer, was in dem kräftig grün schillernden Lidschatten und dem intensiven lila Glitzerlippenstift zum Ausdruck kommt. Es fehlen nur noch Efeuranken, die sich über ihren Körper und durch ihr Haar schlingen, dann wäre sie die perfekte Märchengestalt. Durch Lilianas mitfühlende und liebevolle Art sind die Kinder ganz vernarrt in meine Tante, und selbst die Eltern, die ihr ungewöhnliches Auftreten anfangs kritisch beäugten, erlagen früher oder später ihrem Charme. Ich selbst hätte mir keinen besseren Mutterersatz wünschen können.
»Du wirkst ein wenig blass heute, Liebes. Geht es dir gut?«
Okay, manchmal kann es auch ziemlich lästig sein, wenn Ziehmütter ein viel zu gutes Gespür für ihre Ziehtöchter entwickeln … Dabei hätte ich mich meiner Tante so gerne anvertraut, vor allem, weil sie meine Eltern kannte. Und vielleicht weiß sie etwas, das das Dilemma aufklären könnte. Aber nach dem Erlebnis mit Sven habe ich viel zu große Angst davor.
»Mir geht’s gut. Es kann sein, dass ich einfach nicht genug geschlafen habe heute Nacht«, weiche ich aus und schlürfe den heißen Tee in mich hinein – etwas zu hastig, sodass ich mich verbrenne und heftig zu husten beginne.
Liliana legt ihre Hand auf meinen Arm, während mich ihre himmelblauen Augen intensiv mustern. »Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt – du weißt, du kannst mir alles erzählen.«
Man kann ihr einfach nichts vormachen. Da hilft nur noch ein radikaler Themenwechsel.
»Nein, es ist alles in Ordnung! Wie entwickelt sich eigentlich die neue Zuchtrose, die du mir kürzlich gezeigt hast?«
Liliana besitzt in ihrem Garten ein kleines Treibhaus, in dem sie die bizarrsten Züchtungen heranzieht – ihr großes Steckenpferd und das einzige Thema, mit dem man sie dazu bringen kann, alle anderen Angelegenheiten zu vergessen. Glücklicherweise verfehlt meine Frage auch dieses Mal ihre Wirkung nicht.
»Die Rose gedeiht prächtig – ein wahrer Schatz! Und sie duftet einfach himmlisch«, schwärmt sie mit leuchtenden Augen. »Eine weitere Kreation dieser Art habe ich gerade ausgesät. Ihre Blütenblätter sind von rot-weißen Schlieren durchzogen, sodass die Blumen an ein Himbeer-Sahne-Dessert erinnern. Außerdem trägt sie keine Stacheln.«
»Das klingt wirklich vielversprechend. Wie war das noch? In der Botanik spricht man bei Rosen von Stacheln und bei Kakteen von Dornen, richtig?«, erinnere ich mich.
»Stimmt genau! Du hast sehr gut aufgepasst, mein Schatz«, bemerkt meine Tante anerkennend. »Aber jetzt rate einmal, welchen Namen ich dieser Zuchtrose geben werde.«
Sie lächelt vielsagend, doch erst, als zwei weitere Schlucke des Tees meinen Magen erreichen, fällt der Groschen.
»Äh, du denkst dabei doch nicht etwa an Inea, oder?«
Zu Lilianas Lächeln gesellt sich ein Funkeln in den Augen. »Doch, die Rose soll Inea heißen. Was hältst du davon?«
Im ersten Moment weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich fühle ich mich geschmeichelt.
»Das ist so lieb von dir, Liliana! Aber meinst du wirklich, ein himmlisch duftendes Himbeer-Sahne-Dessert passt zu meinem Typ?«, frage ich lächelnd.
»Warum denn nicht, Liebes? Wenn du allerdings einen violetten Kaktus bevorzugst, den hätte ich auch noch anzubieten«, scherzt sie und zwinkert mit ihren leuchtend grünen Lidern.
»Nein, da ist mir doch die Rose lieber«, erwidere ich lachend.
»Ich meine, da diese Art nicht einmal spitze Stacheln besitzt, passt sie perfekt zu dir, mein Schatz.«
»Hm, aber ich glaube, manchmal könnte es auch ganz nützlich sein, welche zu haben …«
»Ach was! Du bist genau richtig, wie du bist. Und schau nur, wie sehr unsere Kinder dich lieben.«
»Ja, das stimmt schon, aber die Welt besteht schließlich nicht nur aus Kindern.«
Ich denke dabei an meine Nachbarn, denn ab und zu wünsche ich mir schon, es den Zwillingen einmal gleichzutun und ihnen mit schlagfertigen Sprüchen Kontra zu geben. Nur ist das überhaupt nicht meine Art. Vielmehr verspüre ich stets den Drang, Kompromisse zu finden und Provokationen zu ignorieren. Das bedeutet nicht, dass ich mir alles gefallen lasse, aber Angriffe auf meine Person laufen bei mir meist ins Leere. Ich denke, es bringt mir auch nichts als Stress, wenn sich Gefechte immer weiter hochschaukeln.
»Ach, sorge dich nicht. Du wirst sicherlich auch irgendwann einen Mann finden, der zu dir passt.«
Da hat Liliana wohl etwas missverstanden, doch dies ist kein Thema, das ich vertiefen möchte.
»Darauf habe ich gar nicht angespielt, sondern eher auf meine Nachbarn«, protestiere ich.
»Das weiß ich doch, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es da jemanden gibt, der immer einen ganz verklärten Ausdruck in den Augen bekommt, wenn er dich ansieht …«
Ich stelle die Tasse, die ich gerade zum Trinken anheben wollte, wieder zurück auf ihren Untersatz und starre Liliana mit offenem Mund an.
»Ach ja? Wer soll das denn sein?«, frage ich erstaunt.
Meine Tante lächelt spitzbübisch. »Na, wenn du das bisher nicht gemerkt hast, dann verrate ich auch nichts. Außerdem denke ich, so langsam wird es Zeit für deine Gruppe.«
Na toll! Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.
Mein Blick wandert zur lila Glitzeruhr an der Wand.
»Du hast recht. Ich muss los.«
Ich erhebe mich und Liliana begleitet mich zur Tür.
»Wie macht sich denn Viola inzwischen? Sie hat doch letzte Woche ziemlich viel nach ihrer Mama geweint, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt. Die Eingewöhnung fällt ihr recht schwer. Ich muss gleich mal sehen, wie Benedikt mit ihr zurechtkommt.«
Liliana nickt. Wir verabschieden uns und dann begebe ich mich zu meiner Pinguin-Gruppe. Sina und Tobi stürmen sofort begeistert auf mich zu und schlingen ihre dünnen Kinderarme um meine Beine. Ich streichele ihnen liebevoll über die Köpfe. So einem Empfang kann selbst die schlechteste Laune nicht standhalten.
Benedikt, der in der Bauecke unter einer Traube an Kindern kaum mehr auszumachen ist, rappelt sich auf und zieht die Augenbrauen hoch.
»Hallo Inea!«, grüßt er mich, während er versucht, sich aus den ihn umschlingenden Kinderarmen zu befreien.
Ich helfe Lissi dabei, die Tische für den Stuhlkreis beiseite zu rücken. Sie nickt mir einen stummen Gruß zu.
»Hallo Lissi! Wie sieht es aus, waren schon alle beim Frühstück?«, frage ich.
»Alle bis auf Viola. Sie traut sich noch nicht allein in den Frühstücksraum. Ich dachte, ich schicke Benedikt mit ihr, sollte er es irgendwann fertigbringen, sich zu befreien.«
Da steht der Belagerte plötzlich direkt neben mir, an jedem seiner Beine baumelt ein menschliches Gewicht, während ein weiteres Kind gerade auf einen Tisch klettert, um den Rücken zu erobern.
»Na, hast du Spaß, Bene?«, lache ich, nicht ohne ein wenig Spott in der Stimme.
Benedikt lächelt gequält und ringt sich ein Nicken ab.
»Du musst ihnen schon Grenzen setzen, wenn es dir zu viel wird«, erkläre ich noch immer grinsend.
Seine graugrünen Augen senden mir einen so intensiven Blick, dass ich innehalte und für einen Moment den Trubel um mich herum völlig vergesse. Dann wendet er sich wieder seinen Gewichten zu.
Oh, was war denn das eben?
Soweit ich weiß, hat er keine Freundin, was verwunderlich ist, denn weder fehlt es ihm an Charme noch sieht er schlecht aus. Und durch seinen Erfolg als Künstler müssten ihm die Frauen eigentlich nur so zufliegen.
»Ich schimpfe nicht gern mit den Kleinen«, gesteht Benedikt.
Noch immer leicht irritiert, antworte ich nicht sofort.
»Das brauchst du doch gar nicht«, antworte ich schließlich. »Du musst es nur sehr bestimmt sagen, damit sie merken, dass es dir ernst ist.« Dann nähere ich mich seinem Ohr und flüstere: »Eine gute Methode ist auch das Durchkitzeln!«
Das lässt sich Benedikt nicht zweimal sagen. Kaum hat er begonnen, die Lasten an seinen Beinen mit den Kitzelfingern zu bearbeiten, flüchten die Kinder lachend in eine Ecke.
»Danke für den Tipp.«
Und als ob die Worte des Dankes noch nicht genug wären, legt er jetzt auch noch seinen Arm um meine Hüfte und drückt mich seitlich an sich. Mir stockt der Atem.
Also habe ich es mir nicht eingebildet und der Blick vorhin sagte doch mehr aus. Oder ist das alles jetzt nur freundschaftlich gemeint? Kann es sein, dass Liliana vorhin von Benedikt gesprochen hat?
Die Kinder haben bereits ihr Urteil gefällt, denn aufmerksam, wie sie sind, haben sie alles beobachtet, tanzen nun freudig durch den Raum und singen:
»Bene liebt Ineeea! Bene liebt Ineeea!«
Sofort lässt Benedikt von mir ab und hebt Viola, das neue Kind, in den Arm.
»Ähm, ich gehe dann mal mit ihr zum Frühstück«, erklärt er und verschwindet eilig mit der Kleinen in den Flur.
Ich lasse mich neben Lissi im Stuhlkreis nieder. Wir rufen die Kinder aber noch nicht zusammen, da wir noch auf Viola warten wollen.
»Möchtest du erfahren, was seine Aura erzählt?«, flüstert Lissi neben mir.
Ich mag meine jüngere Kollegin, aber manchmal ist sie mir ein wenig unheimlich, wenn sie mit diesem Aurazeug oder ihren Visionen ankommt, vor allem deshalb, weil bisher alles exakt zutraf, was sie erzählte. Ihre Feinfühligkeit kommt den Kindern sicherlich zugute, aber ihre äußere Gestalt wirkt blass und leicht zerbrechlich, sodass ich mich manchmal frage, ob sie dem wilden Toben der Kinder gewachsen ist.
»Ich weiß nicht … Vielleicht lieber nicht«, antworte ich schließlich auf ihre Frage.
Lissi bleibt stumm neben mir hocken und mich beschleicht das ungute Gefühl, dass ich sie gekränkt haben könnte.
»Manchmal ist es vielleicht besser, nicht immer alles zu wissen«, versuche ich mich zu erklären.
»Wovor hast du Angst?«
Wenn ich das nur selbst wüsste. Was wäre denn, wenn Liliana von Benedikt gesprochen hat?
»Vielleicht vor einer Wahrheit, die ich dann nicht mehr leugnen kann, weil bisher immer alles zutraf, was du mir erzählt hast.«
Tobi klettert auf meinen Schoß und spielt mit meinen Fingern. Ich drücke den Vierjährigen an mich und streichle ihm durchs Haar. Ich liebe Kinder. Das spüren sie und geben es um ein Vielfaches zurück.
»Na gut, aber ich gebe dir einen Hinweis. Benedikt ist nicht wegen seiner sozialen Ader hier …«
Jetzt bin ich doch neugierig.
»Sondern?«
»Auch nicht meinetwegen …«
»Wegen mir?!«, platze ich heraus.
»Nein, Benedikt gefällt das Gebäude so gut«, scherzt Lissi, was sonst äußerst selten vorkommt, aber meine Überraschung amüsiert sie sichtlich.
»Du meinst also im Ernst, er belegt meinetwegen ein Praktikum im Kindergarten ?«
Meine Kollegin nickt vielsagend.
»Aber ist das nicht reichlich übertrieben? Ich meine, warum fragt er mich nicht einfach, ob wir zusammen ausgehen können oder so?«
»Tja, dafür müsste ich dir etwas erzählen, das in seiner Aura gespeichert ist …«
Ich seufze tief. Da muss ich jetzt wohl durch, denn meine Neugier lässt mich nicht mehr los.
»Na gut. Was gibt seine Aura denn sonst noch her?«
»Zusammenfassend kann man es so interpretieren: Der berühmte Künstler Benedikt Rockshell kann nicht mit Zurückweisung umgehen. Wenn er dich fragen würde, ob du mit ihm ausgehst, bestünde ein gewisses Risiko, dass du ihm einen Korb gibst. Viel gefahrloser kann er sich Stück für Stück an dich herantasten, wenn ihr hier zusammen arbeitet.«
Das klingt einleuchtend, gleichzeitig aber auch irgendwie unglaublich. Ich kenne Benedikt noch von der Schule, er war zwei Klassen über mir, aber mehr als flüchtige Gespräche haben wir damals nie geführt.
»Gibt die Aura auch Auskunft darüber, seit wann er für mich Gefühle hegt?« Jetzt will ich es doch ganz genau wissen.
»Das kann ich nicht sehen, aber meine Intuition sagt mir, dass er schon sehr lange in dich verliebt ist.«
Puh, was für Neuigkeiten!
Es fällt mir allerdings nicht leicht, das zu glauben. Da müsste ja schon ziemlich viel Gefühl im Spiel sein, wenn er deswegen sogar hier arbeitet. Andererseits habe ich durchaus den Eindruck gewonnen, dass ihm der Job Spaß macht.
Und könnte ich mir Benedikt als Partner vorstellen? Wie er mich so angesehen hat und seine Umarmung, das fühlte sich schon gut an …
Schließlich kehrt mein Praktikant in den Gruppenraum zurück – mit einer glücklich grinsenden Viola an der Hand. Unwillkürlich schießt das heiße Blut in mein Gesicht.
Hallo! Ich bin doch keine 14 mehr!, rufe ich meinen erhöhten Puls zur Ordnung. Jetzt sieht Bene mich auch noch so an, dass mir ganz schummerig zumute wird …
»Kommt in den Stuhlkreis!«, ruft Lissi die Kinder zusammen.
Als alle sitzen, singen wir gemeinsam ein Lied, danach erzählt jedes Kind, was es gestern gemacht hat, und schließlich liest Lissi eine Geschichte vor.
Ich bin heute nicht ganz bei der Sache. Immer wieder tausche ich verstohlene Blicke mit Bene aus und wenn ich mich im Kopf mal nicht mit ihm beschäftige, dann drangsalieren mich die Sorgen um das Spiegelproblem.
Heute geschieht, was sonst nie der Fall ist: Ich bin froh, endlich in den Feierabend gehen zu können. Langsam schiebe ich meinen Drahtesel den Hang hinab – alles andere wäre reiner Selbstmord bei dem Gefälle. Erst in der Talsohle schwinge ich mich aufs Rad und fahre am Bach entlang Richtung Eppstein. Rechts und links wuchert das rosa Springkraut und schwängert die Luft mit seinem intensiven Duft.
Als ich schließlich die Auffahrt der Villa erreiche, fällt mir ein fremder Mann auf, der dort in einer Ecke steht und das Haus beobachtet. Nicht nur seine blasse, schmächtige Gestalt sticht mir ins Auge, sondern auch die Kleidung, die er trägt: Er steckt in einem hellen Anzug, dessen Schnitt mich an die Männer in diesen uralten Schwarz-Weiß-Filmen erinnert.
Als ich mein Rad weiterschiebe, treffen sich unsere Blicke. Der Fremde wirkt ertappt, starrt mich an, als wunderte er sich darüber, dass ich ihn fragend mustere.
Was glaubt er denn, wie Leute sonst reagieren, wenn ein altmodisch gekleideter Fremder in ihrer Einfahrt steht und das Haus beobachtet?
»Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich misstrauisch.
»Wer sind Sie?«, will er wissen.
Seine Stimme klingt heiser. Außerdem mag ich es nicht, wenn jemand mit einer Gegenfrage antwortet.
»Die Frage ist doch eher, wer Sie sind und was Sie hier in der Einfahrt meines Hauses treiben!«
Na ja, es ist nur zu einem Viertel mein Haus, aber das muss dieser Kerl ja nicht wissen.
Ich bleibe nun gut zwei Meter entfernt stehen, sodass ich direkt in die eisblauen Augen meines Gegenübers blicke. Sie wirken kalt und leblos und jagen mir einen Schauer über den Rücken.
»Sie tragen keine Kommissura! Warum können Sie mich sehen?«, fragt er mit einer Schärfe in der Stimme, die mich heftig zusammenfahren lässt.
»Was? Wieso?«, stammle ich verwirrt.
Will mir dieser Irre etwa damit verkaufen, dass andere Menschen ihn nicht sehen können? Das ist doch vollkommen krank! Und was soll das sein, diese Kommiss … – keine Ahnung! Oder hängt das vielleicht auch mit dem Spiegelproblem zusammen? Sehe ich nicht nur im Spiegel Dinge, die es gar nicht gibt, sondern jetzt auch auf der Straße? Ich muss hier weg!
Ohne ein weiteres Wort schiebe ich mein Rad neben die Haustür, lasse es einfach gegen die Wand fallen. Ich wage es nicht, mich noch einmal nach dem Fremden umzusehen – den es vielleicht gar nicht gibt –, bevor ich die Tür der Villa hastig hinter mir ins Schloss schiebe.
Der Namenlose, die Begegnung mit Inea aus seiner Sicht, eine Weile vorher
In der Einfahrt steht ein in Weiß gekleideter Mann und beobachtet die Villa. Seinen stechend blauen Augen entgeht nicht das kleinste Detail.
Das Haus wirkt nobel. Es wird sich herausstellen, ob die gesuchte Frau hier lebt. Und wenn ja, ist es noch immer nicht erwiesen, dass sie zu dem Kreis gehört.
Immerhin verfolgt der Namenlose jetzt eine vielversprechende Spur. Viel zu viel Zeit hat er schon mit Frauen vertrödelt, die sich dann doch als leere Hülle herausgestellt haben.
Jemand schiebt ein Fahrrad die Auffahrt herauf.
Diese Frau sieht mich direkt an! Wieso kann sie mich sehen? Die Kombination von schwarzem Haar und grünen Augen lässt sich keiner Magieform zuordnen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, wagt sie jetzt auch noch misstrauisch zu fragen.
Diese Frau sollte er im Auge behalten!
»Wer sind Sie?«
»Die Frage ist doch eher, wer Sie sind und was Sie hier in der Einfahrt meines Hauses treiben!«
Was bildet sie sich eigentlich ein? Was glaubt sie, mit wem sie redet?
»Sie tragen keine Kommissura! Warum können Sie mich sehen?«, fragt der Namenlose scharf.
Entweder gehört sie zu uns, ist eine Abtrünnige oder ein Mensch mit übersinnlichen Fähigkeiten. In jedem Fall werde ich ihr den nötigen Respekt beibringen müssen!
»Was? Wieso?«, stammelt sie nun verwirrt.
Offensichtlich hat sie nichts von dem verstanden, was ich gesagt habe. Das bedeutet, sie kennt ihre Fähigkeiten nicht. Im günstigsten Fall handelt es sich um einen Menschen mit übersinnlicher Begabung.
Doch wenn sie eine Abtrünnige ist, ohne selbst davon zu wissen, muss ich meinen Herrn davon in Kenntnis setzen.
Sie weicht zurück. Schließlich dreht sie sich um und geht davon.
Ha, das hat ihr Angst eingeflößt, so schnell, wie sie vor mir flüchtet! Auch gut!
Beata
Inea
Als ich in die WG zurückkehre, fehlt von den Zwillingen jede Spur. Ich verkrümle mich in mein Zimmer und werfe mich erschöpft aufs Bett.
Was für ein Tag!Erst die Spiegel, dann Flirts mit Benedikt und jetzt ein seltsamer Fremder, der sich darüber wundert, dass ich ihn sehen kann! Das ist doch alles nicht normal – bis auf die Sache mit Benedikt vielleicht.
Ich starre abwesend an die Wand, verfolge das Spiel der Schatten, die die Efeuranken hereinwerfen, welche es gewagt haben, ihre Triebe bis über die Glasscheibe meines Fensters wachsen zu lassen. Ich sollte den Efeu mal wieder zurechtstutzen, aber beim letzten Versuch flatterte mir eine aufgeregte Amselmutter entgegen, die im dichten Laub knapp unter meinem Fenster ihr Nest errichtet hatte. Bis die Jungen ausgeflogen sind, werde ich das Gewächs daher nicht anrühren können, was natürlich auf äußerste Kritik meines lieben Nachbarn stößt, denn um jenen Teil des Hauses, der ihm gehört, wurde der Efeu nahezu millimetergenau zurechtgestutzt. Ich habe mich schon gewundert, dass er so viel Natur überhaupt auf der Außenwand duldet. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass es sich um eine besonders seltene und kostbare Efeuzüchtung handelt – zumindest erwähnte ich das ihm gegenüber einmal beiläufig. Ich glaube, es stimmt sogar, weil ich bisher noch nichts Vergleichbares gesehen habe – kleine, zierliche Blätter mit rötlichen Adern und weißem Blattrand. Ich sollte Liliana einmal fragen, um was für eine Züchtung es sich hierbei handelt.
Da, aus heiterem Himmel, taucht es mal wieder vor meinem geistigen Auge auf: das Bild im Spiegel. Viel lieber hätte ich weiter über Efeu nachgedacht, aber diese Art der Ablenkung funktioniert leider immer nur für kurze Zeit.
Ich überlege, wie ich mich sonst noch ablenken könnte, und greife nach meiner Querflöte. Aber ich bin einfach nicht bei der Sache, spiele irgendetwas und kann mich danach nicht einmal mehr an die Melodie erinnern.
Mein Blick wandert über die selbst gezogenen Kerzen auf meinem Regal. Dieses kreative Hobby entspannt mich meistens wunderbar, aber heute fehlt mir auch dazu der Antrieb.
Das Läuten der Türglocke schreckt mich aus meinen Gedanken.
Wer klingelt denn jetzt? Die Zwillinge haben doch einen Schlüssel …
Wie gerädert klettere ich aus meinem Bett, schlurfe in den Flur und schicke ein »Hallo?« durch die Gegensprechanlage – technisch befindet sich die Villa auf dem neuesten Stand, zumindest so weit es der Denkmalschutz zulässt.
»Hier ist Beata Tegussi!«
O verflixt, die Bewerberin für das freie Zimmer habe ich ja komplett vergessen!
Ich drücke den Summer, um die Haustür im Erdgeschoss zu entriegeln, und eile dann rasch ins Bad, um meine vom Liegen zerzausten Haare wenigstens einigermaßen in Form zu bringen. Ohne Spiegel kann ich aber leider nicht nachprüfen, ob diese Versuche von Erfolg gekrönt sind. Dann haste ich zur Tür und reiße sie auf. Vor mir steht eine junge Frau, im Begriff, den Klingelknopf zu drücken. Ein abgehacktes Läuten schallt durch den Raum, denn sie zieht die Hand sofort zurück, als ich die Tür öffne.
»Hallo, ich bin Inea D’Orayla!«, stelle ich mich höflich vor.
Ich halte ihr meine Hand zum Gruß hin, aber sie sieht nur unschlüssig darauf hinab. Ich mustere Beata ebenso unschlüssig, weil ich ihre Reaktion nicht zu deuten weiß. Dunkle Ränder untermalen ihre Augen, außerdem wirkt sie blass und abgekämpft. Da Beata meine ausgestreckte Hand partout nicht ergreifen will, ziehe ich sie zurück und weiche zur Seite, damit sie eintreten kann.
»Komischer Familienname! Woher stammt er?«, fragt sie.
Ich zucke mit den Schultern.
»Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ergab meine Internetrecherche nicht ein einziges Ergebnis. Wenn es dir nichts ausmacht, können wir uns gerne duzen«, biete ich ihr an, weil mir scheint, dass wir in etwa demselben Jahrgang angehören.
Wäre sie meine Mitbewohnerin, wären wir sicherlich sowieso beim Du, aber im Moment erscheint es mir höchst unwahrscheinlich, dass ich Beata in meine WG hole.
»Von mir aus«, antwortet sie auf mein Du-Angebot und zuckt gleichgültig mit den Schultern.
Du lieber Himmel, welche Laus ist der denn über die Leber gelaufen?
Neben den Zwillingen benötige ich nun wirklich keine Stimmungskanone, aber Beatas Schwermut würde mich hier unweigerlich mitrunterziehen. Da ich dennoch nicht unhöflich sein will, führe ich sie erst einmal herum.
»Dann zeige ich dir am besten zuerst das Zimmer, das vermietet werden soll«, biete ich an.
Ich gehe voraus und öffne eine der überdimensionierten Türen. Wie auch in den anderen Räumen ziert ein kunstvoll verlegtes Parkett den Boden und die Holztäfelung der Wand wird in Hüfthöhe von einer cremefarbenen Textiltapete abgelöst. Da die Fenster zur Hangseite weisen, hat man von hier aus zwar nicht die atemberaubende Aussicht übers Tal, dafür blickt man auf unseren parkähnlichen Garten mit uraltem Baumbestand – welcher nebenbei bemerkt, und zum großen Ärger meiner Nachbarn, ebenfalls zu meinem Erbe zählt. Neben einem hohen Fenster führt das Zimmer sogar über die Terrassentür auf einen Balkon hinaus.
Beata sieht sich lustlos um.
»Ganz schön alter Kram«, bemerkt sie abfällig und deutet auf das schmiedeeiserne Bett und den antiken Sekretär.
»Das stimmt, die Möbel sind ziemlich in die Jahre gekommen. Ich habe das alles von meinen Eltern übernommen, aber mir gefällt auch nicht jedes Stück und ich habe in meinem Zimmer eine gute Kombination aus Alt und Neu zusammengestellt. Die Zwillinge stehen auf das antike Zeug, deshalb haben sie alles so gelassen, doch der neuen Mieterin steht es frei, eigene Sachen zu besorgen und das hier im Keller zu deponieren – dort ist Platz genug.«
Ich verwende bewusst ›die neue Mieterin‹, damit sie nicht auf die Idee kommt, ich hätte mich bereits für sie entschieden.
»Und wer wohnt hier noch?«, will Beata wissen, während sie schon wieder auf den Flur zusteuert.
Als hätten sie Beatas Frage gehört, drängen sich die Zwillinge gerade mühsam durch die Wohnungstür, als wäre dort nicht genug Platz für zwei Personen. Nachdem sie dieses Hindernis endlich überwunden haben, mustern sie neugierig unseren Gast.
»Ah, welche Augenweide beehrt unsere bescheidene Behausung?« Max strahlt Beata an und reicht ihr die Hand.
Wie zuvor bei mir starrt sie nur bewegungslos darauf hinab.
»Pat und Patachon?«, kommentiert sie dann missbilligend.
»Max und Moritz«, korrigiere ich.
»Kommt aufs Gleiche raus«, brummt Beata unbeeindruckt.
So langsam frage ich mich ernsthaft, was sie hier überhaupt will. Das Zimmer scheint ihr nicht zu gefallen und sie gibt sich nicht die geringste Mühe, sich vor den Bewohnern der WG in ein gutes Licht zu rücken. Ihr Benehmen raubt sogar den Zwillingen für einen Moment die Sprache, und das will schon etwas heißen.
»Wenn ich dazu meine professionelle Einschätzung kundtun darf: Der sprichwörtliche Ausdruck ›wie Pat und Patachon‹ bezeichnet scherzhaft das ungeschickt wirkende Nebeneinander zweier Personen mit sehr verschiedenem Körperbau. Da Max und ich jedoch nahezu baugleich erschaffen wurden, trifft Pat und Patachon nur auf den erheiternden Part des Duos zu«, erklärt Moritz mit der Miene eines Uni-Professors.
Beata murmelt etwas Unverständliches und steuert dann die Flügeltür Richtung Wohnzimmer an.
»Die Gemeinschaftsräume?«, brummt sie gelangweilt.
Ich werfe den Zwillingen einen entschuldigenden Blick zu, zucke mit den Schultern und öffne dann für Beata die Tür.
»Hier befinden sich das Wohn- und gleich nebenan das Esszimmer. Diese Räume nutzen wir gemeinsam.«
Beatas Blick wandert kommentarlos einmal quer durch beide Zimmer.
»Und was halten Eure Durchlaucht von den erlesenen Hallen?«
Das miesepetrige Verhalten von Beata scheint Max und Moritz geradezu herauszufordern, sie weiter aufzuziehen. Doch statt einer Antwort wirft sie ihnen nur vernichtende Blicke zu.
»Gibt es hier auch eine Küche mit Herd und Kühlschrank oder braucht man Feuer und Eis?«, will Beata wissen, schon wieder auf dem Weg in den Flur hinaus.
Gemeinsam mit den Zwillingen folge ich ihr und weise ihr anschließend den Weg. Vordergründig mutet die Küche durch die massiven Eichenholzfronten etwas antik an, aber auf den zweiten Blick erkennt man das moderne Innenleben.
»Nein, die Küche befindet sich auf dem neuesten Stand«, erkläre ich und öffne für sie sogar unseren Kühlschrank. Ich zeige ihr den Elektroherd, die Mikrowelle und was man sonst noch so benötigt.
»Wir erwarten von unserer neuen Mitbewohnerin natürlich, dass sie sämtliche Mahlzeiten für uns zubereitet«, erklärt Max todernst, aber Beata straft ihn mit völliger Ignoranz.
Jetzt fehlt nur noch das Bad. Dort befindet sich eine Wanne mit Messingarmaturen und Füßen unten dran. Passend dazu sieht das Waschbecken aus. Nur die Dusche und die Schränke sind neu, harmonieren aber dank der Messingelemente gut mit dem Rest.
»Habt ihr keine Spiegel hier?«
Diese durchaus naheliegende Frage lässt mich zusammenzucken.
»Nein, Spiegel sind hier verboten. Weißt du, wir haben nämlich ein Gespenst im Haus, das allergisch auf diese Dinger reagiert und fürchterlich zu spuken anfängt, sollte es einen entdecken«, erläutert Moritz mit der Ernsthaftigkeit eines Politikers.
»Ich denke, die zwei Hausgeister namens Max und Moritz sind mehr als genug für diese Wohnung«, lässt sich Beata nun tatsächlich einmal zu einem trockenen Kommentar herab.
»Da könntest du sogar recht haben«, pflichte ich ihr grinsend bei und atme innerlich auf, da das Spiegelthema diese spaßige Wendung genommen hat. Beata Tegussi nickt.
»Ich geh dann mal wieder.«
Normalerweise hätte ich die Bewerberin auch noch einige Dinge gefragt, aber da Beata ja sowieso nicht infrage kommt, möchte ich den Besuch nicht unnötig in die Länge ziehen und so geleite ich sie zur Tür, um sie dort zu verabschieden.
»Adios!«, »Goodbye!«, »Ciao!«, »Tschüssi!« Selbst das bayerische »Pfiat di« rufen die Zwillinge ihr noch ins Treppenhaus hinterher, bevor ich die Wohnungstür schließen kann.
»Also, optisch definitiv auf unserer Wellenlänge«, erklärt Max unter heftigem Nicken seines Bruders. »Aber ansonsten wird sie es fertigbringen, dass selbst die Palme im Wohnzimmer in ihrer Gegenwart die Blätter abwirft.«
»Ja, leider … Sehr schade«, pflichte ich ihnen bei.
Zu gerne hätte ich eine nette neue Freundin in der WG begrüßt.
»Na, dann bleibt die Aufgabe der Mahlzeitenzubereitung wohl an dir hängen, Inea-Mausi«, neckt mich Max.
»Ich würde vorschlagen, das erledigen wir wie immer gemeinsam«, entgegne ich und kneife Max neckisch in die Hüfte, sodass er quiekt wie ein Ferkel und sich übertrieben vor Schmerzen krümmt.
Die gute Laune und die witzigen Kommentare, mit denen mich die Zwillinge den ganzen Abend lang überschütten, lässt mich für eine Weile die belastenden Ereignisse des Tages vergessen. Als die beiden dann in ihre Zimmer verschwinden, mache ich es mir im Liegestuhl auf dem Balkon, der vom Wohnzimmer abgeht, gemütlich. Ich habe mich dort auf Entspannung gefreut, allerdings werde ich unfreiwillig Zeugin eines Streits meiner Nachbarn, die im Stockwerk über mir offensichtlich vergessen haben, das Fenster zu schließen.
»… Leon Friedrich! Was fällt dir ein, mir Pralinen zu schenken?! Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, welche Disziplin es erfordert, diese Karottendiät durchzuhalten?«, keift die aufgebrachte Stimme von Tina Besset.
»Aber Schnucki, du bist doch wirklich schlank genug«, versucht sie ihr Partner zu beschwichtigen – doch der Schuss geht nach hinten los.
»Du hast mal wieder keinen blassen Schimmer! Wenn ich auch nur den Hauch einer Chance auf den Preis haben will, dann müssen diese Fettpolster hier schleunigst verschwinden!«
»Aber Schnucki …«
Da ich keine Lust verspüre, mir Herrn Steinbergs Antwort anzuhören, kehre ich ins Haus zurück. Dort durchforste ich das Fernsehprogramm, aber es läuft nichts, was mich interessiert. An irgendeinem Spielfilm bleibe ich dann doch hängen. Zumindest bringt es der Film fertig, mich von meinen Sorgen abzulenken, und das reicht mir im Moment vollkommen aus.
Lord der Schatten
Torin, zur gleichen Zeit auf der Burg Sko’Falkum
Ich fahre die inneren Schilde hoch und zücke mein Schwert. Selbst gegen einen magisch Begabten kann eine banale Stahlklinge manchmal mehr ausrichten als ausgeklügelte Zauberei, außerdem benötige ich Zeit, um den Schwarzen Sog in mir aufzubauen. Der Inkanta steht mir im Treppenaufgang des Burgturms gegenüber und wir belauern uns angriffsbereit.
Zwei eisblaue Augen heften sich an meine Kehle. Ich lasse die Stahlklinge auf ihn herniedersausen, doch bevor ihn mein Schwert berührt, befördert er mich mit einem magischen Wink seiner rechten Hand in die Höhe. Ich schieße durch die Luft und werde gegen die Steinmauer des Treppenaufgangs geschleudert. Damit hat mein Hieb sein Ziel um Längen verfehlt. Ich falle und knalle auf die Steinstufen. Das Adrenalin, das in meinen Adern pulsiert, verhindert, dass ich mich vor Schmerzen krümme, stattdessen springe ich mit einer geschickten Bewegung wieder auf die Füße.
Verdammt! Dieser Lichtmagier beherrscht die Levitation! Ein überaus mächtiger und seltener Zauber!
Unter freiem Himmel angewandt, kann er in seiner Perfektion einen Menschen in die Unendlichkeit des Weltalls befördern, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe meinen Gegner definitiv unterschätzt. Wütend sammle ich Kraft, um zum ultimativen Schlag auszuholen. Nicht umsonst trage ich den Titel ›Dunkler Lord‹, auch wenn das Zeitalter der herrschenden Lords längst der Vergangenheit angehört. Die Magie des Schattens birgt weitaus mehr zerstörerische Gewalt als die des Lichts und erstere wird er jetzt zu spüren bekommen!
»Was willst du, Inkanta?«, zische ich wütend.
»Ist das nicht offensichtlich?«, entgegnet er kalt. »Du kannst mich nicht aus dem Rat verbannen, ohne die Konsequenzen dafür zu tragen!«
Ich schnaube verächtlich.
»Du hast nichts anderes verdient!«
»Die Macht, dies zu entscheiden, sollte keinem Schattenmagier zustehen! Ein Wechsel ist mehr als überfällig!«
Plötzlich entweichen den Händen des Lichtmagiers zwei weiße Strahlen. Dort, wo die Lusire1 auf den Steinboden treffen, steigt Rauch auf. Eine Bewegung in meine Richtung und die Dinger werden meine Haut versengen. Oder sie brennen mich in Stücke und lassen meine Augen erblinden.
Gerade noch rechtzeitig hole ich den Schwarzen Sog aus meinem Innern hervor. Dieser verschlingt alles Licht, alle Wärme und lässt seine Umgebung zu einer finsteren Eiswüste gefrieren. Der Strudel wirbelt um mich herum, absorbiert die Lusire, dehnt sich immer weiter aus.
Die Macht des Todes wird diesem Lichtmagier den Rest geben!
Ich hebe mein Schwert, bereit, ihn ins Nirwana zu befördern.
»Elender Teufelsmagier!«, flucht mein Gegner heiser.
Wie durch eine plötzliche Windböe wird mein Leib fortgefegt, prallt dieses Mal mit voller Wucht gegen die Decke, um abermals auf die Steintreppen darunter zu knallen. Ich kann gerade noch das Schwert von mir strecken, um mich nicht selbst damit aufzuspießen. Ich springe sofort wieder auf die Füße. Die Schmerzen meines geschundenen Leibes gehen im Adrenalin unter. Wenigstens hat mein Schwarzer Sog der Attacke standgehalten, konnte sich jedoch auch nicht weiter ausbreiten. Abgesehen von den schmerzhaften Prellungen bin ich nicht ernsthaft verletzt, so konzentriere mich jetzt darauf, den Strudel weiter zu expandieren. Ich benötige kein Licht zum Sehen, dieser Inkanta aber wird sich vollkommen blind fühlen, sobald er erst einmal in die Fänge des alles verschlingenden Schwarzen Sogs gerät.
Natürlich erkennt er die Gefahr, schleicht langsam rückwärts die Treppe des Burgturms hinauf, seine Hände bereit für den nächsten Levitationsangriff.
Jetzt ist er dran!
Ich kann den Sog nicht nur um mich herum erzeugen, sondern schleudere ihn jetzt blitzschnell die Treppe hinauf. Begleitet von ersticktem Fluchen torkelt mir mein Gegner entgegen. Seine von der Kälte weitgehend gelähmten Muskeln verhindern jegliche Gegenwehr. Vollkommene Finsternis hüllt uns ein, aber ich kann ihn dennoch sehen. Seine eisblauen Augen weiten sich, als die scharfe Klinge meines Schwertes sein Herz durchbohrt. Er sackt zu Boden, bleibt leblos liegen. Die Magie des Schwarzen Sogs verebbt langsam und ich überprüfe die Lebenszeichen des Inkantas – weder Atmung noch Herzschlag sind feststellbar.
Mit dem Lord des Schattens legt man sich nicht ungestraft an …
Begleitet von einem Schwall roten Bluts ziehe ich mein Schwert aus dem leblosen Leib des Lichtmagiers. Aber ich will ihn hier nicht so liegen lassen, sondern werfe ihn mit Leichtigkeit über meine Schulter. Ein Wunder, wie eine solch mächtige Magie in einem dermaßen schmächtigen Körper zu hausen vermag. Blut perlt über meinen schwarzen Umhang, doch ein Zauber verhindert, dass es ihn durchtränkt.
Ich trage den Toten hinunter in den großen Saal. Meine Burg ist die einzige, von der aus ein direktes Portal zur Festung des Rates führt, und dieses lässt sich ausschließlich mit meinem Blut aktivieren. Allen anderen Ratsmitgliedern bleibt nur die Anreise zu Pferd oder mit der Kutsche. Ein direkter Zugang über die Tore wäre viel zu riskant. Sie verbinden Atlatica, die Insel verdichteter Magie, mit der normalen Welt. Bei der Festung handelt es sich um einen gut gesicherten Ort Atlaticas, in der der Rat der Zwölf seine Sitzungen abhält.
Ich lege meine linke Hand in die mit Metallsplittern gespickte Einbuchtung – völlig unspektakulär aussehend, sodass niemand die besondere Bedeutung dieses Mauerabschnitts auch nur erahnen kann. Aber genau über diesen Weg könnte der Eindringling in die Burg gelangt sein. Zwar kann ich mir kaum vorstellen, wie er das fertiggebracht haben sollte, doch genauso unwahrscheinlich ist es, dass er einen anderen Zugang gefunden hat, denn die äußeren Schilde bieten einen wirksamen Schutz – selbst gegen Magier, die durch die Luft zu fliegen vermögen.
Die Splitter ritzen sich in meine Haut, nehmen das notwendige Blut in sich auf, und dann geschieht es: Im Torbogen flimmert ein dünner Film, der gleich der Oberfläche eines Sees zu wabern beginnt. Den leblosen Leib immer noch über der Schulter, trete ich durch das Tor und werde gleich darauf in ein gleißend helles Licht getaucht – unangenehm blendend, insbesondere, wenn man die Magie des Schattens beherrscht. Aber die Tore sind Werke weißer Magie, deshalb lässt sich das nicht vermeiden.
Als das Licht schwächer wird, zeichnen sich die Umrisse des Sitzungssaals vor mir ab. Langsam erkenne ich auch die Gesichter der Ratsmitglieder, die bereits um einen ovalen Tisch herum Platz genommen haben – eine ausgewogene Mischung beider Magierichtungen und Geschlechter. Auch verschiedene Nationalitäten sind hier vertreten und einige von ihnen haben, genau wie ich selbst, ihren dauerhaften Wohnsitz auf Atlatica. Alle starren mir entsetzt entgegen, als ich auf sie zutrete und den Ballast von meiner Schulter gut sichtbar für alle auf dem Tisch ablade.
»Dann wären wir jetzt vollzählig!«, erkläre ich mit scharfem Blick in die Runde.
»Aber was …«, stammelt Ava nach Luft ringend.
Ich schneide ihr das Wort ab. Die blonde Irin verträgt keinen Anblick roher Gewalt. Womöglich liegt dies an ihrer streng katholischen Erziehung. Soweit mir bekannt ist, lebte sie eine Zeit lang in einem Kloster. Aber auf solche Empfindlichkeiten kann ich hier keine Rücksicht nehmen.
»Das passiert jedem, der es wagt, sich mir, Torin Marach von Arkantis, entgegenzustellen!«
Daraufhin herrscht betretenes Schweigen. Das ist gut so, denn Respekt und Furcht vor dem Lord des Schattens bringen die dringend notwendige Ordnung in diesen Haufen.
»Und wer nimmt jetzt seinen Platz ein?«, wagt Alan Nowak nach einer Weile zu fragen.
»Der Nächste auf der Liste … Das wäre Benjamin Curlhair!«
»Der Footballspieler?«, bringt Nikolaj entsetzt hervor.
Ich übergehe seinen Zwischenruf.
»In der folgenden Sitzung werden wir ihn einweihen. Wer setzt sich mit ihm in Verbindung?«
»Ich erledige das!«, prescht Danae Karadima so eilig vor, dass einige in der Runde belustigt grunzen.
»Tz, war ja klar, dass du dich sofort an diesen Footballspieler ranschmeißt.« Leyla winkt verächtlich ab.
Das will die heißblütige Griechin Danae nicht auf sich sitzen lassen.
»Na ja, jedenfalls bin ich es nicht, die dem Lord der Schatten ständig Blicke zuwirft, die Eisblöcke zum Schmelzen bringen könnten!«, kontert sie und mimt völlig übertriebene Augenaufschläge in meine Richtung.
»Schluss jetzt!«, beende ich die Diskussion. »Der Tote muss entkleidet werden, damit wir ihm die Amulette abnehmen können. Außerdem sollte sein Leichnam noch heute verbrannt werden.«
»Lasst dies meine Aufgabe sein, Mylord!«, meldet sich Ilios D’Ardano. Er entspringt einer Sippe weißer Magie, die bereits über viele Generationen hinweg ausschließlich auf Atlatica lebt. Im Gesicht des Lichtmagiers zeichnen sich die Spuren seines hohen Alters ab.
»Gut, dann übernehmt Ihr das. Die Amulettsplitter werdet Ihr dann im Chrometen deponieren!«
»Selbstverständlich, Mylord.«
»Was gibt es sonst für Neuigkeiten?« Ich mustere nacheinander jedes Gesicht, aber erst als ich bei Markus ankomme, erhalte ich eine Antwort.
»Wir haben einen unregistrierten Umbro2 aufgespürt. Seine Mutter behauptet, sie kenne den Vater nicht. Der Mann habe sich nach dem One-Night-Stand nicht mehr bei ihr blicken lassen.«
»Alter?«
»Neunzehn.«
»Das ist bereits der Dritte! Konnte jemand Hinweise auf deren Herkunft ermitteln?«
Es herrscht betretenes Schweigen. Majas Augen blitzen verdächtig, bevor sie eilig den Blick abwendet. Sie ist das Jüngste der Ratsmitglieder, und wie alle Magier weißer Magie zeichnet sie sich durch blaue Augen und blondes Haar aus.
»Maja, was hast du in Erfahrung gebracht?«, frage ich barsch, damit sie nicht auf die Idee kommt, wichtige Informationen zurückzuhalten. Da sie zur jüngeren Magiergeneration gehört, verzichte ich bei ihr auf die förmliche Anrede.
Die Lichtmagierin schluckt hart.
»Mylord, es sieht so aus, als handelte es sich bei dem Vater der Umbro um ein und denselben Mann, der seinerzeit wahllos Frauen schwängerte und … daher die vielen unregistrierten Söhne …«
Davon bin ich ohnehin ausgegangen, denn es ist recht unwahrscheinlich, dass gleich mehrere Schattenmagier auf diese Weise unentdeckt ihr Unwesen treiben. Doch die Frau wirkt seltsam beunruhigt, daher muss noch mehr hinter ihrer Aussage stecken. Ich mustere sie mit durchdringendem Blick.
»Wie kommst du zu dieser Annahme, Maja?«