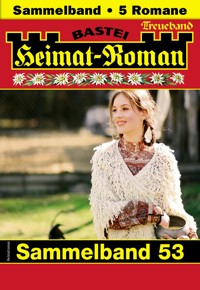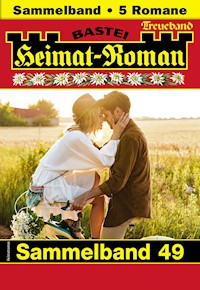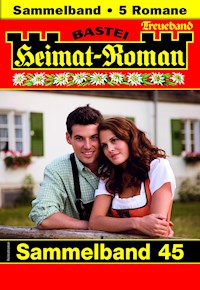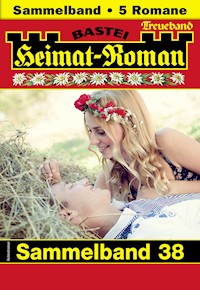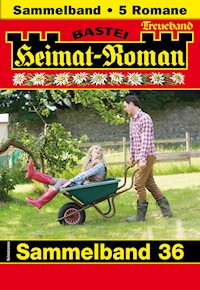5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 231: Das Wunder von St. Martin
Bergkristall 312:
Der Bergdoktor 1819: Eine ganz besondere Freundschaft
Der Bergdoktor 1820: Im Feuer der Eifersucht
Das Berghotel 168: Lauras unbekannte Schwester
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Shutterstock AI
ISBN: 978-3-7517-7938-8
https://www.bastei.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Heimat-Roman Treueband 73
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Alpengold 231
Das Wunder von St. Martin
Alpengold 232
Nach ihrem Fehltritt
Der Bergdoktor 1819
Eine ganz besondere Freundschaft
Der Bergdoktor 1820
Im Feuer der Eifersucht
Das Berghotel 168
Lauras unbekannte Schwester
Guide
Start Reading
Contents
Das Wunder von St. Martin
Als ein Dorf über Nacht berühmt wurde
Von Lothar Eschbach
Barbara Zöllner ist ein modernes, aufgeklärtes, junges Madl. Sie liest keine Horoskope, und sie auch nicht abergläubisch.
Doch dann wird in dem abgelegenen Bergdorf St. Martin, wo sie gerade bei ihrem Großvater zu Besuch ist, angeblich eine »Wunderquelle« entdeckt. Über Nacht wird der kleine Ort berühmt, und die Touristen kommen scharenweise, um das Wunder mit eigenen Augen zu erleben.
Unter ihnen ist auch der junge Wissenschaftler Bernhard Riedmann, der seine Großmutter begleitet. Natürlich ist er skeptisch, was die Wunder betrifft – bis er der bezaubernden Barbara an der Quelle begegnet und die Liebe auf geradezu wundersame Weise sein einsames Herz berührt …
Sie stand ganz oben auf dem abgeflachten Gipfel des zwölfhundert Meter hohen Berges. Die Chronik der herrlichen Barockkirche berichtete von einem Wunder, das der heilige Martin im Jahre 1704 bewirkt haben sollte.
Zwei kleine Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren waren damals von einem Bären angegriffen worden, von einem der mächtigen Tiere, die es damals noch in den oberbayerischen Bergen gegeben hatte. In ihrer Not waren die Kinder auf die Knie gesunken und hatten den heiligen Martin, der ein Ritter gewesen war, um Hilfe angefleht.
Ein Reiter war daraufhin zwischen den Bäumen hervorgesprengt und hatte den Bären mit einem wohlgezielten Lanzenwurf erlegt. Bär und Lanze waren von den Bewohnern des kleinen Bergdorfes gefunden worden, und der mächtige Kopf des Bären sowie die Lanze waren auch heute noch in der Wallfahrtskirche zu besichtigen.
In den Jahren 1712 bis 1714 hatten die Bauern des Bergdorfes mit Unterstützung des Bischofs die Kirche erbaut und ihr Dorf nach dem heiligen Martin benannt.
Seit dieser Zeit kamen die Wallfahrer, und die zahlreichen Votivtafeln berichten von den vielen Heilungen und den erfüllten Bitten, die die Gläubigen auf dem Berg an den Heiligen gerichtet hatten.
In späteren Jahren hatten sich Franziskanermönche hier angesiedelt und ein kleines Kloster gebaut, das wie ein Burghof die Kirche umgab.
Gleich neben dem mächtigen Klostertor befand sich ein kleiner Andenkenladen, in dem der alte Rochus Zollner seine Andenken verkaufte. Bilder vor allem vom Sankt Martin, Rosenkränze und geweihte Kerzen, Ansichtskarten und tausend andere Dinge, die in irgendeinem, manchmal nur recht losem Zusammenhang zum Wallfahrtsort standen.
Rochus Zollner war ein echtes oberbayerisches Original. Selbst so groß und mächtig von Gestalt wie ein Grizzlybär, weißhaarig und mit hellen, zeitweise ärgerlich blitzenden Augen, wenn die Wallfahrer den Laden stürmten und jeder als Erster bedient sein wollte.
Wie eine Festung stand er dann in der Schlacht, die um ihn tobte, gab Antworten auf die vielen Fragen, nannte die Preise und gab auch mal Anekdoten zum Besten, wenn er besonders gut aufgelegt war.
Heute war es ruhig in seinem Laden, denn seit drei Tagen ging ein Dauerregen über den Bergen nieder, der die meisten Gläubigen davon abhielt, den beschwerlichen Weg auf den Berg hinaufzuschreiten.
Da besuchten nur ein paar Unentwegte die Kirche. Vielleicht waren es auch diejenigen, die ein besonderes Anliegen beim heiligen Martin vorzubringen hatten. Und die, das wusste der Rochus aus Erfahrung, gehörten nicht zu den Leuten, die in seinem Laden das Meiste kauften.
Da kaufte mal einer eine Kerze, die er unter dem Standbild des Heiligen anzünden wollte, oder vielleicht einen Rosenkranz. Aber das war meistens schon alles, was an solchen verregneten Tagen verlangt wurde.
Rochus Zollner verlebte einen geruhsamen Vormittag, und als die Kirchenuhr die elfte Stunde einläutete, ertönte auch das Glockenspiel an der Ladentür.
Rochus brauchte nicht aufzuschauen, um zu wissen, wer seinen Laden betrat. Um elf Uhr war es immer derselbe, der ihn besuchte, das war seit bald dreißig Jahren so.
Es war ebenfalls ein alter Mann, aber gut eineinhalb Köpfe kleiner als Rochus. Alles, was beim Rochus riesig aussah, war bei dem Eintretenden klein, beinahe zierlich.
Nur in einem waren sie sich ähnlich: Auch der Stangassinger-Korbinian hatte schlohweiße Haare und helle, aufmerksame Augen, denen nichts entging, was auf dem Wallfahrtsberg geschah. Da konnte der Andrang noch so groß sein. Der Korbinian behielt die Übersicht.
Eigentlich war er der Totengräber des Friedhofs von St. Martin. Aber im Laufe der Zeit war mehr und mehr daraus geworden. Er war ein Faktotum und gleichzeitig eine Institution. Er sorgte für Ordnung unter den Wallfahrern, wies den Autos und den Omnibussen, die sich den steilen Weg heraufgequält hatten, ihre Plätze an, räumte den weggeworfenen Abfall beiseite und führte auch manchmal die Leute durch die Kirche, um ihnen den Ausbau des Gotteshauses zu erklären und ein paar dazu passende Geschichten anzuhängen.
»Ist er noch hübsch heiß, der Leberkäs?«, brummte der Rochus hinter der Theke hervor. »Hast du auch genug Senf mitgebracht?«
Korbinian legte ein großes Paket auf den Tisch. Es war dick mit Zeitungspapier eingeschlagen, damit er auch warm blieb, der Leberkäs, oder heiß, wie der Rochus gerade gesagt hatte.
»Kannst dir auch mal was anderes einfallen lassen, Rochus. Jeden Tag fragst du mich dasselbe. Und … ist er vielleicht schon mal kalt gewesen?«
»Ich hab halt bloß gemeint«, brummte der Rochus, holte zwei Teller und zwei Messer aus dem Hinterstübchen und fing an, auszupacken. Korbinian setzte sich auf den altersschwachen Hocker. Die beiden Männer begannen ihre Brotzeit, und dazu aß jeder eine frische Laugenbrezel, die der Korbinian aus der Tasche zog.
Fünf Minuten lang fiel kein einziges Wort. Jeder war mit seiner nicht gerade kleinen Portion beschäftigt. Jeder nickte dazu, was so viel bedeutete wie: Gut ist er heute wieder, der Leberkäs. Der Kammerloher versteht schon sein Geschäft. Der Leberkäs ist einfach einmalig!
Aber das sagten sie nicht, weil sie es früher schon tausendmal gesagt hatten. Jetzt nickten sie nur, und der eine wusste vom anderen, was der mit dem Nicken sagen wollte.
Nachdem sie sich die Finger an den Papierservietten abgewischt hatten, die der Rochus aus seinem Bestand zur Verfügung stellte, konnte man zum gemütlichen Teil übergehen.
Aber auch hier galten eiserne Regeln, von denen nur in besonderen Notfällen abgewichen wurde.
Die Unterhaltung eröffnete Korbinian immer mit den Worten: »Hast du gut geschlafen, Rochus? Was hast du geträumt? Oder gibt’s was Neues …?«
An dieser Stelle bestätigte der Rochus meistens, dass er wie »ein Maulwurf« geschlafen habe. Tief und fest halt, und dann begann er meistens einen wirklichen oder einen erfundenen Traum zu erzählen, der immer in irgendeiner Beziehung zum heiligen Martin stand.
Heute wich er allerdings von dem Ritual ab.
»Die Kinder haben gestern Abend angerufen. Heute Abend werden sie hier sein.«
Mit den Kindern waren seine beiden Enkeltöchter gemeint, die neunzehnjährige Barbara, die gerade ihr Abitur gemacht hatte, und die zweiundzwanzigjährige Regine, die Hauswirtschaftslehrerin werden wollte und sich im Frühjahr mit Gustl, dem Sohn vom Gastwirt Kammerloher, verlobt hatte.
Korbinian nickte, mehr war bei ihm auch nicht drin. Denn die Kinder waren auch seine Kinder, zwar nicht nach dem Blut, aber nach dem innigen Verhältnis, das ihn mit den beiden Mädchen verband, die er, als sie noch klein waren, auf seinen Knien geschaukelt hatte und, wie er manchmal stolz verkündete, auch mit großgezogen hatte, wenn sie bei ihrem Großvater waren.
Und das war im Laufe der Jahre oft der Fall gewesen.
Die beiden Männer, der Rochus siebzig, der Korbinian achtundsechzig, stopften sich ihre Tabakspfeifen aus dem Porzellanbehälter, den der Rochus auf die Theke stellte. Gesprochen wurde dabei niemals, weil das Pfeifestopfen auch zu den rituellen Handlungen gehörte.
Erst wenn es gehörig dampfte, war der Rochus an der Reihe. Und das hörte sich dann so an: »Hast du’s wieder im Kreuz, Korbinian? Musst dich einschmieren mit dem Murmeltierfett, das uns der Förster aus dem Allgäu mitgebracht hat. Oder hast du es wieder vergessen?«
»Ich schmier schon«, pflegte Korbinian darauf zu erwidern, dabei verzog er stets das Gesicht, um zu dokumentieren, dass ihm das Kreuz noch allweil wehtat.
Aber heute war es auch bei ihm anders.
»Geschlafen hab ich überhaupt net«, knurrte er. »Gestern Abend ist doch tatsächlich noch der Kammerloher bei mir gewesen und wollt mich beschwatzen.«
»Wegen dem Beinhaus …?«
»Genau, Rochus, du hast’s mal wieder genau getroffen. Er möchte lieber einen Parkplatz neben der Friedhofsmauer anbauen. Er tät ihn sogar zahlen, hat er gesagt. Bloß, damit noch mehr Wallfahrer den Berg rauffahren und bei ihm ihren Schweinsbraten essen. Ist das eine Einstellung, frag ich dich? Als ob der heilige Martin nur dazu da wär, um ihm sein Geldsäckerl zu füllen.«
»Hast ihm deine Meinung gesagt, gell?« Der Rochus schmunzelte, denn Korbinian war dafür bekannt, dass er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt und seine Worte auch gut zu setzen wusste, sodass viele der Mönche meinten, dass an dem Korbinian ein Advokat verloren gegangen wäre.
Korbinian lächelte nur bei solchen Reden, wie er überhaupt meistens lächelte, wenn man etwas über ihn erzählte.
Und man sprach viel über den Korbinian. Nicht nur in St. Martin. Er war weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt. Zum Beispiel sagte man von ihm, dass er laut mit den Toten redete. Und es gab sogar welche, die aus den Gräbern heraus Antworten gehört haben wollten.
Fragte man den Korbinian danach, lächelte er – und schwieg.
»Und weißt du noch was? Der Kammerloher möchte mit dem Abt reden. Er, der bloß in die Kirche geht, damit man sieht, was er für ein gottesfürchtiger Mann ist. Aber da wird er sich schneiden mit dem Parkplatz. Da lass ich mir schon was einfallen«, kicherte er. »Das darfst mir glauben, Rochus, dass der Kammerloher seinen Parkplatz nicht kriegt. Ich aber mein neues Beinhaus. Oder willst du mir sagen, wo ich hin soll mit den Knochen und Köpfen, die ich finde, wenn ich ein frisches Grab ausheben muss? Der Friedhof ist halt nicht größer, als er ist. Da müssen die Toten eben ein bisserl zusammenrücken. Ist das net auch deine Meinung?«
»Mich brauchst du net zu fragen, Korbinian. Ich bin ganz auf deiner Seite. Und auf mich kannst rechnen, wenn wir den Kammerloher abschmettern.«
»Und der Gustl? Wo er doch jetzt mit der Regine verlobt ist?«
»Der Gustl ist schon recht. Das ist ein braver Bursch. Der geht nach seiner Mutter, Gott hab sie selig …«
Die Männer bekreuzigten sich, weil es in den Bergen so Brauch ist, wenn man von einem Verstorbenen spricht.
Rochus griff in das Regal hinter sich, das mit allerlei Flaschen vollgestellt war. Eine davon war bedeutend größer als alle anderen, dafür trug sie auch kein Etikett.
»Magst du einen?«, fragte er, wartete aber die Antwort seines Freundes gar nicht ab, sondern füllte zwei Wassergläser gut halb voll.
Sie tranken nicht, weil es ihnen schmeckte, wie sie sich gegenseitig immer wieder betonten. Für sie war der Obstler reine Medizin, die den Kopf klar und die Beine geschmeidig halten sollte, was sie bisher auch getan hatte.
Den zwei Alten konnte man alles Mögliche nachsagen. Aber wer meinte, dass sie schon leicht verkalkt wären, der irrte sich ganz gewaltig.
Ohne Korbinian und Rochus ging nichts in St. Martin. Nicht im Bereich der Wallfahrtskirche und des Klosters und ebenso nicht in dem Dorf, das sich anschloss und auf gut einen Kilometer Länge den Berg hinunterschlängelte. Sie waren die geheimen Oberhäupter des Berges, zwar ohne jeden Titel und ohne offizielle Machtbefugnis, aber mit einem sicheren Instinkt ausgestattet, der es ihnen ermöglichte, die Geschicke von St. Martin in ihrem Sinn zu leiten und zu gestalten.
»Ja, dann«, sagte der Korbinian und wandte sich zum Gehen.
»Was hast du’s denn so eilig?«, fragte Rochus erstaunt. »Es regnet doch noch immer wie die Pest!«
Korbinian lächelte. »Eben drum, da kommt mir keiner in die Quere, wenn ich die Baugrube für das Beinhaus anfange auszuheben.«
»Ohne Baugenehmigung?«
»Geh zu, Rochus, ist doch alles Kirchengrund. Wenn ich erst mal den Grund ausgehoben hab, wird der Abt den Bauantrag beim Landratsamt schon durchbringen. Weißt doch, wie’s ist. Die geistlichen Herren muss man manchmal vor vollendete Tatsachen stellen. Und den Kammerloher erst recht.«
»Aber zum Kaffee kommst du doch wieder?«, rief ihm der Rochus hinterher. »Ich hab noch ein paar Butterkipferl vom letzten Sonntag. Die müssen wir zusammen wegputzen, bevor die Kinder kommen. Du weißt doch, die Barbara backt so gern. Aber wenn noch was da ist, lässt sie sich mit dem Nachschub Zeit.«
Es klingelte wieder, als der Korbinian den Laden verließ. Rochus räumte alles weg, was von der Brotzeit übrig geblieben war, setzte sich in den Lehnstuhl hinter der Theke und nahm sich die Zeitung vor, die er noch nicht gelesen hatte.
»Hoffentlich kommt niemand«, murmelte er dabei vor sich hin. Denn er ließ sich nur ungern stören, wenn er sich über die hohe Politik informierte. Weil er nicht nur ein sehr weiser Mann und ein erfolgreicher Andenkenhändler, sondern vor allem auch ein politisch sehr interessierter Mensch war.
***
Es war Juli, aber über Nacht waren die Berge noch einmal weiß geworden. Ihre Spitzen glitzerten in den ersten Strahlen der Morgensonne, die wie ein feuerroter Ball am Horizont auftauchte und die Landschaft in helles Licht tauchte.
An den Blättern der Bäume hingen noch dicke Tautropfen, ebenso an den Grashalmen, die auf den zweiten, den Sommerschnitt, warteten und teilweise fast achtzig Zentimeter hoch standen.
Regine und Barbara öffneten den Laden, stellten den Ständer mit den Ansichtskarten ins Freie und fingen an, die Regale aufzuräumen.
»Muss das sein?«, brummte Rochus, als er seine beiden Enkeltöchter mit Eimern, Lappen und viel Seife herumhantieren sah. »In einer halben Stunde kommen die ersten Omnibusse«, erklärte er ihnen. »Ich kenne das. Heute ist ausgesprochenes Wallfahrerwetter.«
»Dann muss auch alles blitzblank sein«, beharrte Regine. Sie war die lebhaftere der beiden Schwestern, die sich im Gesicht sehr ähnlich sahen und hauptsächlich durch die Größe und die Figur voneinander unterschieden. Abgesehen davon, dass Barbara auch ruhiger war als ihre Schwester.
»Warst du schon drüben beim Gustl?«, fragte der Großvater.
Regine schüttelte den Kopf. »Warum immer ich? Er hat’s doch genauso weit bis zu uns. Und er weiß ja, dass wir gestern gekommen sind.«
Barbara stellte den Besen beiseite, mit dem sie gerade den Vorplatz gekehrt hatte. Sie war gut zehn Zentimeter größer als ihre Schwester und hatte eine Figur, die Regine zu vielen Seufzern veranlasste.
»Ich weiß nicht, wie du das machst«, lautete ihre immer wiederkehrende Rede. »Du kannst essen, was du willst, und nimmst kein Gramm zu. Und ich spare mir jeden Bissen vom Mund ab und werde immer runder.«
Großvater Rochus stand mit verschränkten Armen im Eingang seines Ladens und blickte wohlgefällig auf seine Kinder . Prächtige Madeln waren das, die mit beiden Beinen im Leben standen und sich vor keiner Arbeit scheuten, wie sie eben wieder einmal bewiesen.
»Macht nix, Regine«, tröstete ihr Großvater. »Als angehende Lindenwirtin darfst schon ein paar Pfunde mehr wiegen als deine Schwester.«
»Aber ich mag net!«
»Eine Wirtin, die bei uns heroben schlank ist, die zählt nix bei den Gästen. Da brauchst du schon ein bisserl Ansehen. Und dazu gehört bei einer Wirtin auch ein bisserl ein Bauch.«
»Großvater!« Es war ein Schrei der Empörung und des Entsetzens zugleich, mit dem ihm Regine antwortete. »Wenn du so was noch mal sagst, esse ich keinen Bissen mehr bei dir. Oder willst du mich wie einen Ball den Berg hinunterkullern lassen?«
»Da kommt dein Gustl«, flüsterte ihr Barbara zu. »Schau hin, er hat sogar ein Sträußerl für dich in der Hand.«
Regine lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals, obwohl sie sich noch vor einigen Minuten sehr reserviert gezeigt hatte. Aber sie liebte ihn halt, ihren Gustl. Und der Gustl liebte seine Regine. Die Zwei hatten als Kinder schon im Sandkasten miteinander gespielt. Und wenn der Kammerloher damals scherzhaft zu seinem Sohn sagte: »Die Regine, das wird mal deine Frau!«, da hatte der Gustl vor lauter Wut, weil er die Madeln, wie er sagte, überhaupt net ausstehen konnte, angefangen, die Regine mit Sand zu bombardieren.
»Grüß dich, Großvater Rochus«, sagte Gustl, als er näher kam. »Grüß dich, Bärbel«, neckte er seine zukünftige Schwägerin, die auch prompt reagierte.
»Ich heiß net Bärbel. Du weißt genau, dass ich’s net leiden kann, wenn mich jemand Bärbel ruft.«
»Eben«, entgegnete Gustl lachend und strich sich über seinen blonden Schnauzbart. Er war das, was man in den Bergen einen »sauberen Burschen« nannte, der aber feingliedriger war als sein grobschlächtiger Vater.
Regine und Gustl setzten sich auf eine der abseitsstehenden Bänke, die im Innenhof des Klosters überall für die müden Wallfahrer aufgestellt waren.
Barbara half inzwischen ihrem Großvater, alles an Ort und Stelle zu rücken, was sie vorher beim Putzen umgestellt hatten.
»Wird’s dir net allmählich zu viel, Großvater?«, fragte Barbara. »Wie lange willst denn den Laden noch machen? Du hättest es doch viel schöner, wenn du zu uns nach München kommen würdest. Die Mutter hat erst gestern wieder gemeint, dass wir dir tüchtig zureden sollen.«
»Eure Mutter spinnt«, knurrte Rochus. »Mich kriegen keine zehn Pferde in euer Sündenbabel mit all dem Dreck und Gestank. Und außerdem – was sollte ich denn den ganzen Tag machen? Da tätet ihr mich schnell unter die Erde bringen. Und dann muss ich mich ja um den Korbinian kümmern. Der Korbinian ist ohne mich aufgeschmissen. Der findet sich ja überhaupt net mehr zurecht in der Welt, wenn er mich net hat.«
Barbara schmunzelte. »Und du nicht ohne den Korbinian. Was habt ihr denn wieder ausgeheckt miteinander, dass ihr gestern Abend immer die Köpfe zusammenstecken musstet?«
»Wir?«, fragte Rochus mit der Entrüstung eines unschuldigen Kindes. »Überhaupt nix! Wir hecken nie was aus. Es sind immer die falschen Umstände, die uns ins schlechte Licht setzen. Und überhaupt …« Er grinste. »Was geht das denn dich an, du Küken. Du hast ja noch die Eierschalen hinter den Ohren.«
»Gott sei Dank, Großvater …«
»Was heißt denn da Gott sei Dank, he? Möchtest du vielleicht ledig bleiben und eine alte Jungfer werden? So, wie du ausschaust, wird dir das nicht gelingen.«
Barbara wurde rot. »Was du immer hast, Großvater. Ich hab grad erst das Abitur gemacht. Da denkt man wirklich noch net ans Heiraten.«
»Hast du wenigstens einen Freund?«, wollte der Großvater wissen, der sich immer brennend für solche Dinge interessierte.
»Keine Zeit, aber wenn ich am ersten November auf die Universität geh, findet sich bestimmt ein Freund für mich ein. Ich werde dich jedenfalls sofort davon unterrichten.«
»Das möchte ich mir auch ausgebeten haben«, erwiderte der Großvater. Dann horchte er zur Tür hinaus. »Die streiten doch, Barbara! Hörst du nix?«
»Warum sollen sei nicht auch mal streiten«, erwiderte Barbara gleichgültig. »Immer bloß turteln und Busserln geben, das wird auf die Dauer doch langweilig.«
»Du redest wie der Blinde von der Farbe, du Küken, du. Aber horch mal! Die streiten wirklich!«
»Dann lass sie. Aber bevor du vor Neugier platzt, kannst natürlich rausgehen und nach dem Grund fragen. Die Regine sagt’s dir bestimmt. Die Regine redet gern, wenn der Tag lang ist.«
Sie redete nicht, sie weinte, als sie plötzlich völlig aufgelöst in den Laden gestürzt kam.
»Der Gustl ist wie sein Vater. Immer will er recht behalten, und immer geht’s ums Geld.« Sie setzte sich auf den Schemel, auf dem sonst der Korbinian zu sitzen pflegte, und heulte wie ein Schlosshund.
»Ich will ihn überhaupt nimmer sehen, den Kerl, den greislichen. Und wenn er sich mit dem Korbinian anlegen will, dann löse ich die Verlobung. Ich find allweil noch einen, der zu mir passt. Es muss net unbedingt der Sohn vom Lindenwirt sein.«
Großvater Rochus zog seine Regine hoch und nahm sie in seine Arme. Sie bettete ihren Kopf an seine breite Brust, wie sie es schon als Kind getan hatte, wenn ihr etwas gegen den Strich gegangen war, oder sie sich beim Spielen wehgetan hatte.
»Na, na, mein kleines Madel«, versuchte der Großvater sie zu trösten. »So schlimm wird’s net sein mit dem Gustl. Wenn mich meine alten Augen net im Stich gelassen haben, bist du ihm noch vor Kurzem um den Hals gefallen.«
»Das war aber, bevor er so eklig geworden ist. Weißt du, was er über den Korbinian gesagt hat?«, schluchzte sie. »Dass er ein ganz ein ausgeschamter Heimlichtuer ist, nach dessen Pfeife alle im Dorf tanzen müssen. Grad der Korbinian, der keiner Fliege was antun kann.«
Die Barbara, die trotz ihrer Jugend über mehr Menschenkenntnis verfügte als ihre leichtgläubige Schwester, lächelte skeptisch. Sie mochte den Korbinian genauso gern wie Regine. Aber sie hatte längst herausbekommen, dass die zwei Alten, der Großvater und der Korbinian, zwei ausgefuchste Halunken, allerdings im besten Sinne, sein konnten. Und das mit dem Beherrschen der Dorfbevölkerung war keineswegs so abwegig.
»Und deswegen hast du dich mit dem Gustl gestritten«, stellte Barbara sachlich fest. »Das sind aber zwei Paar Stiefel, meine liebe Regine. Hier ist der Korbinian, für den du eingetreten bist, und dort ist dein Verlobter. Das musst du voneinander trennen, sonst wirst du noch viel öfter Streit mit deinem zukünftigen Ehemann bekommen.«
»Ehemann? Puh, wenn ich so was schon höre! Das ist doch kein Mann, der Gustl! Der ist ja bloß das Sprachrohr seines Vaters. Mir hat er grad noch im rechten Moment die Augen geöffnet. Ich will keinen Mann, der nach der Pfeife eines anderen tanzt. Auch wenn der andere sein Vater ist.«
Die Diskussion wäre bestimmt weitergegangen, und die Gemüter hätten sich noch mehr erhitzt, aber da kamen die ersten Wallfahrer in den Laden.
Auf einmal herrschten eitel Freude und Sonnenschein. Die Mädchen rannten von einem zum anderen, priesen an, was überhaupt nicht angepriesen zu werden brauchte, weil es sich erfahrungsgemäß von selbst verkaufte, und packten Geschenke ein, wobei der Großvater genug mit dem Kassieren und mit dem Wechselgeld zu tun hatte.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Ein Omnibus folgte dem anderen. Da war um elf keine Zeit für den Leberkäse, und Korbinian hatte auch gar keinen gekauft, weil er die Lage gut abschätzen konnte.
Er warf nur einen kurzen Blick auf die Menschen, die sich vor der Tür des Ladens zusammendrängten und so taten, als ob sie beim Rochus Zollner etwas geschenkt bekämen. Er zwinkerte der Barbara kurz zu, die einem Mann gerade einen Wanderstock verkaufte, der draußen im Freien in einem Korb stand, und trollte sich wieder.
Kurz nach zwölf war der größte Ansturm vorbei. Da tröpfelte die Kundschaft nur noch in den Laden. Die meisten saßen jetzt beim Lindenwirt und stärkten sich nach den Anstrengungen der Wallfahrt, denn es gab immer ein paar Leute, die die Wallfahrt zum heiligen Martin in selbstzerstörerischer Qual beendeten.
Da gab es nämlich außerhalb der Klostermauern und außerhalb des gesamten Kirchengrundes noch ein kleines, sehr steiles Bergerl , zu dem ein Kreuzweg, ein sogenannter Kalvarienberg, führte.
Und wenn jemand glaubte, ausgesprochen viele und schwere Sünden abbüßen zu müssen, oder ein Anliegen hatte, das besonders bedeutsam für ihn war, dann konnte es passieren, dass er alle vierzehn Kreuzwegstationen auf den Knien zurücklegte.
Dann bekam der Bruder Krankenpfleger eine Menge Arbeit und der Korbinian ebenfalls. Denn oft schon hatte man einen besonders eifrigen Wallfahrer den Kalvarienberg hinuntertragen müssen.
»Mahlzeit«, sagte der Großvater und schloss die Ladentür. »Ich hab Hunger wie der Bär vom heiligen Martin.« Er wandte sich an die Regine, die immer, wenn sie beim Großvater zu Besuch war, den Küchendienst übernahm. Schließlich hatte sie auf der Haushaltungsschule auch ausgezeichnet kochen gelernt. »Was gibt’s denn heute, Regine?«
»Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gurkensalat.«
»Wiener Schnitzel«, wiederholte der Rochus und schloss die Augen, denn das war sein Leib- und Magengericht. »Dann lasst uns schnell raufgehen, weil ich sonst vor lauter Hunger die Uhr nicht mehr erkennen kann.«
Barbara lachte über seine Sprüche und konterte: »Wozu brauchst du eine Uhr, Großvater? Hauptsache ist doch, dass das Schnitzel recht groß ist und über den Tellerrand hängt. Oder stimmt’s net …?«
»Es stimmt«, antwortete er lachend und hatte es so eilig, in den ersten Stock zu kommen, wo seine Wohnung lag, dass er beinahe über die ersten Stufen gestolpert wäre.
***
Korbinian arbeitete hinter der Kirchhofsmauer. Er musste die Grube für das neue Beinhaus ziemlich tief ausheben, damit das Dach nicht über die Friedhofsmauer ragte. Er hatte schon gut eineinhalb Meter tief gegraben, als der Spaten auf einen harten Widerstand stieß.
Zuerst dachte er an einen großen Stein, der ihm im Weg liegen könnte. Aber es war kein Stein, es war irgendetwas aus Eisen, völlig verrostet, aber in den Umrissen noch gut zu erkennen.
Vorsichtig arbeitete er weiter, bis ihm klar wurde, dass er auf eine Kassette oder auf einen eisernen Kasten gestoßen war.
Das Ding war unheimlich schwer, und als er es endlich aus dem mit Kies vermischten Lehm herausgebuddelt hatte, war klar zu erkennen, was er vor sich hatte: eine Geldkassette.
Korbinian blickte sich suchend um. Niemand hatte gesehen, wie er seinen Fund ausgebuddelt hatte. Er stellte den Kasten auf den Boden der Grube, schaufelte Sand darüber und legte auf den so entstandenen Berg noch den Spaten.
Dann ging er hinüber zur Klosterpforte und läutete.
Der Bruder Pförtner öffnete ihm. Er war ein hagerer Mönch, der schon über dreißig Jahre im Kloster lebte. Ein stiller, ruhiger Mann, der wenig sprach und immer so aussah, als ob er Magenschmerzen hätte.
Als er den Besucher erkannte, zwang er sich zu einem Lächeln.
»Mei, der Korbinian«, sagte er. »Ist jemand gestorben, dass du in deiner Arbeitskluft daherkommst?«
Korbinian schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, Bruder Hieronymus, dass ich die Grube für das Beinhaus ausheb. Und da hab ich was gefunden, das ich gleich dem Herrn Abt zeigen möchte. Meinst du, dass ich ihn sprechen kann?«
Bruder Hieronymus ließ ihn eintreten. Aber er konnte es sich nicht verkneifen, einen missbilligenden Blick auf Korbinians Schuhe zu werfen. Denn der Marmorboden in der Eingangshalle war gerade erst gebohnert worden.
»Setz dich so lange aufs Bankerl! Ich schau mal, ob sich der Pater Konrad vielleicht ein bisserl hingelegt hat. Er ist halt schon recht wacklig auf den Beinen, unser ehrwürdiger Herr Abt.«
Das war eine bemerkenswert lange Rede für den sonst so stillen Bruder Hieronymus. Beinahe lautlos, so, wie es der Ruhe des Klosters angemessen war, ging er davon.
Es dauerte fast zehn Minuten, bis er zurückkam.
»Er wird gleich hier sein, unser ehrwürdiger Herr Abt. Musst dich halt noch ein bisserl gedulden.«
Er verschwand wieder in dem zellenartigen Raum neben der Pforte, und als Korbinian aufstand, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen, sah er Pater Hieronymus auf dem Betschemel knien.
Gleich darauf trat der Abt ein. Er war kaum größer als Korbinian und hatte eine so leise Stimme, dass die Gläubigen ausnahmslos nahe am Einschlafen waren, wenn Pater Konrad einmal predigte.
Er war schon über achtzig und bestimmt nicht gesund. Aber für jeden, der zu ihm kam, wusste er Rat und Hilfe. Er war das, was man in Bayern schon bei Lebzeiten einen »heiligmäßigen Mann« nannte, dem nie ein böses Wort oder ein Tadel über die Lippen kam, auch wenn beides manchmal angebracht wäre.
»Korbinian«, sagte er leise, »das freut mich aber, dass du mich mal besuchen kommst.«
»Ich komme immer gern, Pater Konrad«, erwiderte Korbinian. Man durfte nur Pater Konrad zu dem Abt sagen, weil er von seinen Mitbrüdern nicht herausgehoben werden wollte. Er war in jeder Beziehung ein bescheidener Mann. »Aber heute ist’s eigentlich kein richtiger Besuch. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was ich eben beim Graben gefunden hab.«
»Beim Graben?«, fragte der Abt. Dass der Korbinian die Baugrube für das neue Beinhaus aushob, hatte er längst wieder vergessen.
Korbinian rief es ihm in die Erinnerung zurück.
»Soso, ein Beinhaus. Brauchen wir denn ein neues Beinhaus?«
»Dringend, Pater Konrad. Ganz dringend. Ich weiß ja gar nimmer, wo ich mit all den Knochen hin soll, wenn ich ein Grab ausheben muss. Und die Toten sollen doch bei uns ihre Ruhe haben.«
»Du bist ein guter Mensch, Korbinian. Schad, dass du schon so alt bist, sonst müsstest heute noch in unseren Orden eintreten.«
Das sagte er auch schon seit vielen Jahren. Fast jedes Mal, wenn er mit dem Korbinian sprach. Und der Korbinian antwortete auch immer das Gleiche: »Sehr schade, Pater Konrad, aber so ist es mal auf der Welt. Die richtigen Erkenntnisse kommen einem immer erst im Alter.«
Damit gab sich der Abt zufrieden. Mit kleinen, kurzen Schritten lief er neben dem Korbinian her durch die Pforte, die der Bruder Hieronymus schnell geöffnet und hinter ihnen gleich wieder verschlossen hatte. Es war so, als ob er die Welt nicht einlassen wollte ins Kloster. Draußen wohnte für Hieronymus das Böse, die Verlockung und die Verführung.
Hinter den dicken Klostermauern fühlte er sich sicher, weshalb man den Hieronymus auch nur ganz selten mal außerhalb des Klosters antraf.
An der Baugrube angekommen, stieg Korbinian hinunter und hob die Kassette aus der Grube.
»Oha!«, sagte der Abt und riss die Augen ganz weit auf.
»Ich kann sie öffnen, wenn Sie’s wünschen.«
Der Abt nickte.
Korbinian klemmte den Pickel zwischen Deckel und Kasten. Es gab ein gar nicht lautes, knackendes Geräusch, als er die Kassette aufsprengte.
»Münzen, Pater Konrad. Lauter Münzen«, stieß Korbinian hervor und deutete auf das Geld, das vielleicht drei oder vier Zentimeter hoch darin lag.
»Ja, was machen wir denn damit? Ob das sehr wertvoll ist? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung davon.«
»Goldmünzen scheinen keine dabei zu sein«, antwortete der Korbinian. »Man müsste sie auch erst mal saubermachen, damit man erkennt, aus welcher Zeit sie stammen.«
»Mach das, Korbinian, ich hab ja jetzt alles gesehen. Du wirst’s schon alles recht machen, gell? Ich geh wieder zurück. Es strengt mich halt an, so herumzulaufen.«
»Ist es Ihnen recht, wenn ich die Münzen dem Rochus zeige? Der Rochus weiß immer alles, besonders dann, wenn es sich um alte Sachen handelt.«
Der Abt nickte. Er schien mit seinen Gedanken jedoch bereits weit weg zu sein.
»Zeig nur alles dem Rochus. Und wenn du was weißt, dann kommst halt und erzählst es mir. Wem gehören denn die Münzen? Weißt du das?«
»Die eine Hälfte dem Finder und die andere Hälfte demjenigen, auf dessen Grund sie gefunden wurden.«
Der Abt lächelte. »Das ist schön, das ist sehr schön. Da kann sich derjenige, dem das Grundstück gehört, aber freuen. Wem gehört es denn, Korbinian?«
»Aber Pater Konrad! Der Kirche und dem Kloster natürlich. Hier gehört doch alles der Kirche.«
»Soso …« Er nickte nachdenklich. »Da kann sich der heilige Martin ja freuen, wenn wir ihm das viele Geld in den Opferstock schütten. Grüß dich Gott, Korbinian, und schau nur, dass die Münzen recht viel wert sind, gell?«
Er murmelte im Weggehen noch etwas vor sich hin, was der Korbinian aber nicht verstand. Er war halt schon sehr alt, der Herr Abt. Und manchmal auch sehr vergesslich.
***
Es war auch merkwürdig mit dem Korbinian. Wenn er sich, zum Beispiel, mit dem Abt unterhielt oder mit seinem Freund Rochus, hatte er keinerlei Probleme mit dem Hören. Aber wenn ihn jemand aus dem Dorf etwas fragte oder gar ein Fremder, dann hielt er die Hand hinters Ohr, schüttelte den Kopf und verwies auf seine Schwerhörigkeit, die ihm so arg viel zu schaffen machte.
Als er die verrostete Eisenkassette hinüber zum Andenkenladen seines Freundes trug, begegnete ihm die Maurer-Kathl, die Inhaberin der Poststelle von St. Martin und die größte Ratschen in der ganzen Umgebung.
Klein und klapperdürr, mit dunklen Mausaugen, erspähte sie sofort, dass das etwas Altes war, was der Stangassinger-Korbinian mit sich herumschleppte. Sie kam neugierig näher und schielte auf den Eisenkasten.
»Was hast du denn da gefunden, Korbinian? Einen Schatz?«
Korbinian setzte den Kasten ab und hielt in bekannter Manier die Hand hinters Ohr.
»Was hast du gesagt, Kathl? Regen werden wir kriegen? Aber es hat doch schon genug geregnet!«
»Du bist ein alter Depp«, meinte die Kathl unwirsch. »Und auf deine Tricks mit der Taubheit fall ich dir nimmer rein. Du verstehst mich recht gut, du alter Bazi!«
Korbinian lächelte. Und wie er das machte! Da ging die Sonne auf in seinem Gesicht.
»Bist eine gute Haut, Kathl. Kümmerst dich recht um die alten Leute im Dorf. Unser Herrgott wird’s dir mal lohnen.« Er nickte ihr zu, nahm den Kasten hoch, den die Kathl keine Sekunde aus den Augen gelassen hatte, und lief weiter. Dabei murmelte er vor sich hin, aber so laut, dass es die Kathl gut verstehen konnte: »Mein Gott, mein Gott, wenn wir die Kathl net hätten. Sie ist halt eine gar so gute Seele, die Kathl …« Aber dabei grinste er vor sich hin. Nur das konnte die Kathl nicht sehen.
Er setzte sich mit seinem Kasten auf die Bank neben dem Laden und wartete, bis die Leute gegangen waren, die gerade ein paar Andenken einkauften.
Es waren Touristen, die allerhand Schnickschnack kauften, den sie sich gegenseitig mit vielen bewundernden Ausrufen zeigten, als sie aus dem Laden herauskamen.
Korbinian wartete noch etwas, dann ging er hinein, wo er von den beiden Mädchen herzlich begrüßt wurde.
»Was bringst du uns denn da, Onkel Korbinian?«, fragte Regine.
Er öffnete den Kasten und schüttete die Münzen auf die Theke.
»Jesses, das ist ja ein richtiger Schatz«, stellte Regine fest. »Lauter alte Münzen. Aber die muss ich erst mal saubermachen.«
»Nix da«, ließ sich ihr Großvater vernehmen. Das Wort Münzen elektrisierte ihn, denn alte Münzen waren seine Leidenschaft. Er verstand eine Menge davon. »Hm, hm«, brummte er wohlgefällig, legte vorsichtig, als wären sie zerbrechlich, ein paar Münzen auf seinen Handteller und betrachtete sie eingehend. »Sind deutsche«, sagte er. »Die hier ist von 1732. Könnte eine Silbermünze sein. Wahrscheinlich eine badische.«
»Aber die muss man doch erst reinigen, Großvater«, beharrte Regine. »Du kannst sie dann auch viel besser erkennen und einordnen. Wenn ich ein bisserl verdünnte Salzsäure …«
»Regine!«, rief er entsetzt aus. »Du darfst doch net mit Salzsäure an die Geldstücke herangehen. Ich hab hinten in meiner kleinen Werkstatt ein Reinigungsmittel, das völlig unschädlich ist. Damit kann man die Münzen reinigen. Aber vorsichtig, ganz vorsichtig.« Er hob den Kopf und sah den Korbinian an. »Wo hast du denn den Kasten gefunden? Beim Ausheben des Fundaments für dein neues Beinhaus?«
Korbinian nickte. »Mich tät’s net wundern, wenn ich noch was ans Tageslicht befördern täte. Ich weiß net … ich weiß net, ich hab so ein Gefühl, als ob da noch allerhand im Boden steckte.«
Zwei Kunden betraten den Laden. Barbara kümmerte sich um sie. Eine ältere Dame und ein junger Mann. Wie sich später herausstellte, waren es Großmutter und Enkelsohn.
Der junge Mann – er sah nicht gerade wie ein Wallfahrer aus, eher wie ein Sportler – kam interessiert näher.
»Darf man mal sehen?«, fragte er höflich.
Regine machte ihm Platz.
»Oh, alte Münzen! Die sehen ja aus, als ob man sie eben erst gefunden hätte?«
Korbinian überlegte noch, ob er seine angebliche Taubheit ins Feld führen sollte, um allen Fragen zu entgehen.
Aber da antwortete schon der Rochus für ihn.
»Hier, der Herr Stangassinger hat sie ausgegraben. Hinten an der Friedhofsmauer. Sind Sie ein Experte?«
Der junge Mann lächelte. »Ein Experte wohl nicht. Nur ein sehr bescheidener Sammler. Aber das hier …«, er zeigte auf zwei Münzen, die der Rochus in der Hand gehabt hatte, »das sind badische Münzen. Darüber gibt’s gar keinen Zweifel.«
»Richtig, ganz genau«, erwiderte der Rochus strahlend. Der junge Mann war ihm auf Anhieb sympathisch. Das war kein Schwätzer, der sich wichtigmachte. Der verstand etwas davon.
Korbinian, die beiden Mädchen und die Dame waren für den Rochus und den jungen Mann plötzlich nicht mehr vorhanden. Beide beugten sich über die Theke, sodass sogar ihre Köpfe zusammenstießen, fingen an zu sortieren, wobei sie immer wieder Zeit fanden, einander zuzunicken. Ganz selbstverständlich zog sich der junge Mann den Schemel heran und setzte sich. Dass noch vier andere im Laden waren, schienen sie völlig vergessen zu haben.
Barbara beschäftigte sich inzwischen mit der alten Dame, zeigte ihr Seidentücher, die die Dame als Geschenke mitnehmen wollte, und half ihr auch beim Aussuchen der Ansichtskarten.
Es mochte mindestens eine Viertelstunde vergangen sein, Korbinian fühlte sich überflüssig und ging an seine Baustelle zurück, Regine verabschiedete sich in die Küche, um das Essen vorzubereiten, und die beiden anderen standen unschlüssig im Laden herum.
»Berni, jetzt komm endlich«, forderte die Dame ihren Enkelsohn auf. »Wir haben uns doch für heute noch so viel vorgenommen.«
»Unmöglich, Großmama«, erwiderte der junge Mann, ohne auch nur den Kopf zu heben. »Ich kann jetzt unmöglich weg. Ich hab gerade mit dem Herrn Zollner verabredet, dass wir die Münzen zunächst einmal säubern werden, dann wollen wir versuchen, sie einzuordnen. Geh doch ein bisserl spazieren. Schau dir das Kloster und die Kirche an. Und wenn du genug gesehen hast, kommst du halt wieder vorbei.«
Barbara lächelte. Sie kannte die Sammlerleidenschaft ihres Großvaters, der in dem jungen Mann anscheinend seine Ergänzung gefunden hatte.
»Ist gut, in einer Stunde schau ich wieder vorbei«, erwiderte seine Großmutter.
Barbara begleitete sie nach draußen und sagte ihr, was außer Kirche und Kloster noch besonders sehenswert war.
»Wir wohnen in Rottach-Egern«, erklärte ihr die ältere Dame. »Schon seit vierzehn Tagen, und wir haben vor, noch weitere zwei Wochen zu bleiben. Es sind die ersten Ferien, die ich seit langer Zeit wieder einmal mit meinem Enkel verbringen kann.« Sie seufzte. »Aber so geht das bald jeden Tag mit ihm. Immer findet er etwas neues Interessantes. Unsere Pläne geraten völlig durcheinander.«
Sie verabschiedete sich freundlich von Barbara und ging hinüber zur Kirche.
Barbara schlenderte zurück in den Laden, und weil gerade niemand etwas kaufen wollte, holte sie sich einen Stuhl aus dem kleinen Nebenzimmer und setzte sich still in eine Ecke.
Sie betrachtete das Profil des jungen Mannes. Ein sehr markantes Profil mit einer leicht gebogenen, schmalrückigen Nase. Sein dichtes braunes Haar fiel ihm nach vorn in die Stirn. Ab und zu hörte sie halblaute Wörter, die zwischen den beiden Männern gewechselt wurden.
Plötzlich hob ihr Großvater den Kopf. »Wir kommen so nicht weiter. Was halten Sie davon, wenn wir die Münzen erst mal säubern.«
Der junge Mann, den seine Großmutter Berni gerufen hatte, war sofort begeistert.
Sie packten alles zusammen und verschwanden in dem Nebenraum, ohne von Barbara überhaupt Notiz zu nehmen. Gleich darauf hörte sie die beiden herumrumoren, als ob sie das ganze Zimmer ausräumen wollten.
Vom Kirchturm schlug es zwölf.
Barbara schloss den Laden und ging hinauf in den ersten Stock.
»Das Essen ist gleich fertig«, rief Regine ihr zu, als sie an der Küche vorbeiging. »Du kannst den Tisch decken!«
»Für wie viele?«
Regine steckte den Kopf durch die Tür. »Wie meinst du das? Für uns drei natürlich.«
»Großvater bearbeitet mit dem jungen Mann gerade die Münzen. Meinst du nicht, dass wir ihn fragen sollen, ob er nicht mit uns essen mag?«
»Es ist genug da. Es gibt Kalbsgulasch und Semmelknödel. Was ist denn mit der alten Dame?«
»Sie ist spazieren gegangen und wollte nachher wieder vorbeischauen.«
Regine verschwand in der Küche. »Frag ihn halt, ob er Hunger hat!«, rief sie. »Er sieht ganz nett aus, findest du nicht?«
»Ich hab ihn mir nicht so genau angesehen«, schwindelte Barbara. Es war gut, dass niemand sie bei der kleinen Lüge erwischte. Denn sie bekam ganz rote Ohren dabei.
Sie deckte den runden Tisch im Erker, dessen Butzenscheiben die Strahlen der Mittagssonne vielfältig brachen und reflektierten. Barbara gab sich heute besondere Mühe, rückte mal da an den Tellern und passte auf, dass die Bestecke auch mit dem Tellerrand abschlossen.
Bevor sie nach unten ging, ordnete sie vor dem Spiegel im Flur ihre Haare, obwohl es da eigentlich nichts zu ordnen gab. Sie betrat die Stufen leise und zögernd, als ob sie sich Mut machen müsste, die beiden verrückten Sammler zu stören.
Sie räusperte sich laut, als sie das Nebenzimmer betrat.
»Großvater, das Essen ist fertig!«
»Ich hab keinen Hunger, und außerdem haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Du siehst doch, dass wir zu tun haben.«
Der junge Mann blickte nicht einmal hoch. Er hatte sein Jackett ausgezogen und die Ärmel des Sporthemdes aufgekrempelt. Er arbeitete mit einer Bürste in einer großen Schale, in der sich eine undefinierbare Flüssigkeit befand.
Auf einem Handtuch, das auf dem Tisch lag, glänzten ungefähr zehn oder zwölf Münzen, die die Reinigungsprozedur bereits hinter sich hatten.
»Es gibt Kalbsgulasch, Großvater. Ihr könntet doch wenigstens eine kurze Pause einlegen.«
Der junge Mann hob den Kopf.
»Sie sind ebenfalls herzlich eingeladen«, sagte Barbara zu ihm. »Es arbeitet sich nachher auch wieder leichter.«
Großvater Rochus wischte sich die Hände ab.
»Eine Pause könnte uns nicht schaden, Herr Riedmann«, meinte er. Der junge Mann musste sich also in der Zwischenzeit vorgestellt haben. »Es ist vielleicht ganz nützlich, wenn die Münzen eine Weile in der Lösung liegen bleiben. Passieren kann ihnen ja nichts, weil das Zeug das Metall ja nicht angreift. Wir kommen gleich«, sagte er zu Barbara. »In fünf Minuten sind wir oben.«
Barbara nickte und verließ den kleinen Raum, in dem die Männer geheimnisvoll herumhantierten. Barbara fühlte sich sonderbar bedrückt, ohne dass sie zu sagen gewusst hätte, warum.
Im ersten Stock angekommen, teilte sie ihrer Schwester mit, dass der Herr Riedmann mit ihnen essen würde. Dann ging sie ins Wohnzimmer und blickte zum Fenster hinaus.
Und so stand sie auch noch da, als ihr Großvater mit dem Gast hereinkam. Sie unterhielten sich lebhaft miteinander, und Barbara konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Herr Riedmann überhaupt nicht merkte, dass außer ihm und dem Großvater noch jemand im Zimmer war.
***
Im Gasthof »Zur Linde« von Franz Xaver Kammerloher waren die letzten Mittagsgäste eben gegangen. Vater und Sohn hatten kräftig mit angepackt, wie man so sagte, wenn man kaum Zeit zum Schnaufen bekam, und setzten sich an den Stammtisch, um endlich in Ruhe ein Bier miteinander trinken zu können. Denn essen mochten sie nichts. Der Vater, weil er sowieso viel zu dick war und deshalb jede Gelegenheit nutzte, eine Mahlzeit auszulassen, und der Gustl, weil er seit der Streiterei mit der Regine keinen Appetit mehr hatte.
»Warum isst denn nix, Bub?«, fragte sein Vater. »Bist immer noch net drüben gewesen und hast Frieden mit deiner Regine gemacht?«
Gustl schüttelte den Kopf. »Warum soll immer ich derjenige sein, der nachgibt? Sie hätte ja auch rüberkommen können, wo sie eh weiß, dass wir jetzt so viel zu tun haben.«
»Was heißt denn immer? Soweit ich mich erinnern kann, hat’s bis auf gestern noch nie Streit zwischen euch gegeben. Jetzt ziehst du dir ein frisches Hemd an, pflückst ein paar Blumen im Garten und bringst sie ihr rüber.«
Aber Gustl hatte auf stur geschaltet. »Ich mag net …«
»Und wenn ich sag, dass du gehst«, knurrte sein Vater und hieb dabei die Faust auf den Tisch, »dann machst du das auch. Außerdem kannst du gleich mal am Friedhof vorbeischauen. Die Kathl war heute Morgen bei mir und hat erzählt, dass der Korbinian mit dem Ausheben fürs Beinhaus angefangen hat. Einfach so, ohne Baugenehmigung. Das lass ich mir net gefallen. Da geh ich auf die Barrikaden!«
»Und wie möchtest du das anfangen, Vater?«, fragte Gustl und lächelte dabei. Ein bisserl spöttisch und ein bisserl überlegen, was sein Vater auf den Tod nicht leiden konnte.
»Mach dich net lustig über mich«, herrschte er ihn an. »Ich weiß selbst, dass Pater Konrad immer noch der Ausschlaggebende ist. Auch wenn er die ganze Geschichte nimmer übersieht. Ein neues Beinhaus! Dass ich net lach! Mir ist es wurscht, ob meine Knochen mal im Beinhaus landen oder in der Erde liegen bleiben.«
»Du kennst doch den Korbinian, Vater. Dem seine Freunde sind die Toten. Ich kenne viele, die ihn mit den Verstorbenen haben reden hören. Da sammelt er halt jedes Knöcherl ein, das er findet. Für ihn ist das Beinhaus so wichtig wie für dich der Parkplatz.«
»Hol mir noch ein Bier«, brummte der Franz Xaver. »Wenn ich bloß an die Platzverschwendung denke, kommt mir schon die Galle hoch. So ein Schmarren, so ein verdammter! Wir leben jetzt! Wir könnten glatt fünfzig Mittagsgäste mehr haben, wenn der Parkplatz ein bisserl größer wäre. Aber nein, das kümmert ihn ja net, unseren feinen Herrn Totengräber. Der sorgt sich bloß um die, die ganz gewiss keinen Schweinsbraten mehr in der ›Linde‹ essen.«
»Vater«, mahnte Gustl vorwurfsvoll. »So brauchst auch net daherzureden. Denk mal an die Mutter, sie liegt ja schließlich auch draußen auf dem Gottesacker.«
Damit hatte er eine empfindliche Stelle von Franz Xaver getroffen. Seine verstorbene Frau hatte er sehr geliebt. Bei ihr war er so zart und freundlich gewesen, wie man es dem vierschrötigen Mann nicht zugetraut hätte.
»Ist ja schon recht«, antwortete er leise, und weil er seine Rührung verbergen wollte, stürzte er das eben erst gefüllte Glas in einem Zug hinunter.
Als er das Glas absetzte, schien er die Worte seines Sohnes bereits wieder vergessen zu haben.
»Er hätte ja ans alte Beinhaus anbauen können, der Korbinian, das Schlitzohr. Warum muss er mir akkurat meinen Parkplatz wegnehmen?«
»Dein ist gar nichts, Vater. Und den Parkplatz hättest von der Kirche pachten müssen. Und das hätte dich einen Haufen Geld gekostet, bis alles hergerichtet und asphaltiert worden wäre. Da hätten wir viele Tausend Mittagessen zusätzlich verkaufen müssen, bis die Ausgabe hereingekommen wär.«
Die Faust des Lindenwirts fuhr zum zweiten Mal auf den Tisch.
»Da schau her! Du möchtest also auch schon mitreden, was? Noch bin ich der Wirt in der Linde. Und das ändert sich erst, wenn du mit der Regine verheiratet bist.«
»Warum heiratest du denn nicht, wenn du so verrückt auf die Regine bist?«
»Dafür müsste ich dir ein paar hinter die Ohren hauen, du Lauser. Aber ich will dir sagen, warum ich die Regine mag. Erstens kennen wir sie alle beide von klein an, zweitens ist sie ein sehr, sehr tüchtiges Madl, das von ihren Eltern eine gute Ausbildung erhalten hat, und drittens bringt sie einen Haufen Geld mit in die Ehe.«
»Woher weißt du denn das, he? Ich jedenfalls hab mit der Regine noch nie übers Geld geredet. Weil ich sie nämlich bloß heirate, weil ich sie lieb hab, verstehst du?«
»Vom Rochus, natürlich. Unter uns Erwachsenen spricht man auch mal über das Profane, weil das nämlich genauso wichtig ist für eine gute Ehe. Dann stellen wir hinten auf die Wiese ein richtiges Hotel zum Übernachten hin, wenn die Regine ihr Heiratsgut mitbringt. Und so habt ihr es mal leichter, als deine Mutter und ich es gehabt haben.«
Gustl wehrte ab. »Da lach ich ja. Schwerer werden wir’s haben, weil wir uns net bloß mit den Gästen rumärgern müssen, sondern auch mit dem vielen Personal, das wir dann einstellen müssen.«
»Erzähl mir nix«, fuhr der Lindenwirt gleich wieder auf. »St. Martin ist ein sehr aufstrebender Wallfahrtsort. Immer mehr Leute täten auch gern ihre Ferien bei uns verbringen, wenn es genügend Übernachtungsmöglichkeiten gäbe. Unsere paar Zimmer reichen da überhaupt net aus. Da muss eine großzügige Planung her, da muss gebaut werden, dass die Leut bloß so einfallen bei uns, wenn sie ihre Sünden auf dem Kalvarienberg abgebetet haben. Und jetzt ist Schluss mit der Rederei! Du holst jetzt die Blumen und entschuldigst dich bei der Regine.«
»Und was ist mit dem Korbinian? Soll ich dem vielleicht auch ein paar Blümerl bringen mit einem schönen Gruß von dir?«
Der Lindenwirt verzog das Gesicht, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte.
»Da siehst du es, wie es mir geht. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Selbstverständlich schaust du erst nach dem Korbinian. Und die Blümerl pflückst du hinten im Klostergarten. Die haben schönere als wir, und brauchen tun sie die eh net, die Mönche. Und gell, Gustl, dass du mir ja die Augen aufmachst. Die Kathl hat so was angedeutet, als ob der Korbinian was gefunden hätte beim Graben. Schaust halt mal. Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist noch was übrig geblieben von dem Wunder mit dem heiligen Martin. Man liest ja immer wieder in der Zeitung über Wunderheilungen und solche Sachen.«
»Was hat denn das mit dem Korbinian und seiner Baugrube zu tun, Vater?«
»Schauen sollst, Bub, weiter hab ich nix gesagt.« Er lächelte hintergründig. »Wenn ich schon den Parkplatz net krieg, den ich so dringend brauch, könnte doch der heilige Martin wenigstens ein kleines Wunder wirken für das Dorf. Verstehst mich noch immer net?«
Gustl schüttelte den Kopf.
»Dann wirst nie ein richtiger Wirt werden, Bub. Als Wirt muss man Ideen haben und an Wunder glauben. Und wenn es keine Wunder gibt, dann muss man vielleicht ein bisserl nachhelfen. Verstehst mich jetzt?«
»Da will ich dich gar nicht verstehen, Vater. Mit solchen heiligen Dingen treibt man keine Scherze. Mich kannst jedenfalls net dafür haben.«
Franz Xaver blickte ihm stirnrunzelnd nach.
»Ist halt noch arg brav, der Bub. Wird sich noch ändern müssen, wenn er mal das Geschäft führt. Schließlich lebt der Gasthof ›Zur Linde‹ von den Wallfahrern. Grad wie der Rochus auch.«
***
Korbinian sah den Gustl über den Klostergarten kommen und an der Friedhofsmauer entlangschleichen. Er kümmerte sich nicht um ihn, sondern schaufelte weiter in seiner Grube, behielt den Gustl dabei aber immer im Auge.
Er murmelte vor sich hin, und erst als der Gustl näher herangekommen war, sodass er ihn verstehen konnte, wurde er deutlicher und lauter.
»Man möcht’s net für möglich halten«, brummelte er kopfschüttelnd. »Aber da muss mal was gewesen sein früher.«
Gustl riskierte einen Blick über die Mauer, blieb dabei aber immer in gehöriger Deckung, weil er der Meinung war, dass der Korbinian ihn noch nicht bemerkt hatte.
Korbinian hatte in einem kleinen Stück die Umrisse einer Mauer freigelegt. Aber man konnte erkennen, dass an dieser Stelle mal ein Bauwerk gestanden haben musste. Ein sehr kleines nur, vielleicht eine Familiengruft oder so etwas Ähnliches, denn der Korbinian förderte auch menschliche Knochenreste zutage, Teile eines reich verzierten Stabes, der einem Bischofsstab nicht unähnlich sah.
Gustl machte ganz große Augen, und auf einmal, er glaubte seinen Augen nicht trauen zu können, sammelte sich Wasser in der Grube. Langsam, aber stetig stieg es höher und höher. Korbinian musste eine Quelle angestochen haben.
In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke. Korbinian sah nach oben, Gustl von der Friedhofsmauer hinunter.
»Hast du das gesehen, Gustl?«, fragte Korbinian. Man merkte seiner Stimme an, dass er selbst überrascht war, ausgerechnet an dieser Stelle auf eine Quelle gestoßen zu sein. Nun glaubte er nicht mehr, dass die Mauerreste zu einer Familiengruft gehörten. Eher war es die Einfassung einer Bergquelle. Der Stab, der wahrscheinlich gar kein Bischofsstab war, konnte nur mehr oder weniger zufällig an diese Stelle geraten sein. Und die menschlichen Knochen sagten hier an der Friedhofsmauer noch weniger aus. Bestimmt waren die Gräberreihen über die jetzige Einfriedung hinausgegangen, denn in St. Martin hatten auch Menschen gelebt, bevor die Kirche gebaut worden war.
»Meinst du, dass das was zu bedeuten hat?«, fragte Gustl aufgeregt. »Läuft das Wasser jetzt einfach den Berg hinunter?«
Korbinian schüttelte den Kopf. »Das glaub ich net. Du siehst ja, es ist kaum mehr geworden. Vielleicht müsste man noch ein Stücken tiefer graben, dass sie so richtig anfängt zu sprudeln. Aber gell, komisch ist’s schon, dass ich akkurat an der Friedhofsmauer eine Quelle ansteche. Wer weiß, vielleicht war das früher da heroben die einzige Wasserstelle. Vielleicht läuft das Wasser in einer unterirdischen Ader vom Kalvarienberg herunter.«
Korbinian tauchte die Hand in das Wasser und führte sie zum Mund.
»Wie schmeckt’s denn?«, wollte Gustl wissen.
»Gut schmeckt’s, und narrisch kalt ist’s. Aber was Besonderes kann ich am Geschmack net feststellen. Magst du mal probieren?«
Gustl kletterte über die Mauer, sprang auf der anderen Seite hinunter und probierte das Wasser.
»Hm, ich kann auch nix feststellen. Schmeckt halt wie Wasser«, erwiderte der Gustl.
»Da siehst es«, lächelte der Korbinian, »so lösen sich die Probleme ganz von allein. Ich kann hier nicht das Beinhaus hinstellen und dein Vater nicht den von ihm gewünschten Parkplatz. Für mein Beinhaus reicht der Platz daneben alleweil aus. Ich werde das neue Beinhaus halt ein paar Meter weiter nach rechts hinstellen. Aber man könnte auch sagen, dass es fast ein Wunder ist, das der heilige Martin gewirkt hat. Vielleicht mag er den Parkplatz net so dicht an der Friedhofsmauer haben, damit die Toten net gestört werden.«
»Aber dein Beinhaus scheint er auch net zu wollen«, konterte Gustl. »Oder was meinst du dazu?«
Korbinian wiegte unschlüssig den Kopf hin und her.
»Ich weiß es nicht, Gustl. Ich weiß nur, dass da der Herr Abt eine Entscheidung treffen muss. Man könnte die Quelle sicher auch wieder zuschütten. Vorher ist ja an dieser Stelle auch nix gewesen. Und wahrscheinlich täte dann das Wasser so weiterfließen, wie es sonst auch geflossen ist.«
»Das darfst du net tun, Korbinian«, erwiderte der Gustl ganz aufgeregt. »Wer weiß, was das zu bedeuten hat mit der Quelle. Man kann ja net wissen, aber vielleicht ist es eine richtige Heilquelle, eine St.-Martins-Quelle, die uns der Heilige und Schutzpatron unseres Dorfes geschenkt hat?«
»Glaubst du das?«, fragte Korbinian misstrauisch.
»Glaubst du’s denn nicht …?«
Korbinian zuckte die Schultern. »Ich weiß net, was ich glauben, und was ich nicht glauben soll. Du warst ja dabei, wie es plötzlich angefangen hat zu sprudeln. Aber das ist halt so, wenn man eine Quelle ansticht. Ich kann darin nix Besonderes sehen. Und ein Wunder schon gar net!«
Gustl war sehr nachdenklich geworden. Hatte der Vater nicht behauptet, dass der Korbinian ein Schlitzohr sei? Und war es nicht merkwürdig, dass ausgerechnet in dem Moment die Quelle anfing zu sprudeln, als er, der Gustl Kammerloher, dem Korbinian zusah?
Aber woher konnte der Korbinian andererseits wissen, dass der Gustl genau in diesem Augenblick daherkommen würde? Korbinian war bestimmt ein ganz schlauer und raffinierter Kerl. Trotzdem kamen dem Gustl sehr große Zweifel, ob der Korbinian – sozusagen auf Kommando – eine Quelle sprudeln lassen konnte.
»Was machst du jetzt, Korbinian?«
»Aufhören zu graben. Ich geh jetzt zum Pater Konrad und frag ihn, ob ich die Quelle wieder zuschütten soll.«
»Damit tät ich an deiner Stelle noch ein bisserl warten, mit dem Zuschütten, meine ich. Wer weiß, vielleicht hat’s doch was zu bedeuten.«
»Ist schon recht, Gustl, so eilig hab ich’s auch wieder net mit der Quelle. Gell, dein Vater wird sie auch anschauen wollen. Wo’s akkurat an der Stelle zu sprudeln angefangen hat, wo mal die vielen Autos parken sollten.« Er zwinkerte dem Gustl zu, verständnisinnig und pfiffig zugleich. Nur konnte sich der Gustl keinen Reim darauf machen. Aber irgendetwas hatte es schon zu bedeuten. Da war er sich ganz sicher.
Korbinian tat nie etwas, ohne einen Grund dazu zu haben. Auch wenn man das nicht immer gleich durchschauen konnte.
***
Die Geschichte mit der Quelle sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Nicht nur unter der einheimischen Bevölkerung, vor allem die Wallfahrer sorgten für ihre Verbreitung. Und es dauerte auch nicht lange, da tauchten die ersten Gerüchte über die Heilkraft des Wassers auf.
Ein alter Mann, der jahrelang an Asthma gelitten und schon viele berühmte Ärzte wegen seines Leidens aufgesucht hatte, behauptete plötzlich, kaum noch Beschwerden zu haben. Und er schrieb das der Heilkraft der Quelle zu, von deren Wasser er mehrmals hintereinander getrunken hatte.
Auf dem Klosterberg, wie die Wallfahrtsstätte auch manchmal genannt wurde, herrschte eine ziemliche Aufregung. Fast alle Patres und Brüder unter der Führung von Korbinian unterzogen die Quelle einer eingehenden Besichtigung. Gerüchte schwirrten in der Luft herum, und einige Wallfahrer, die eigentlich nur einen Tagesausflug nach St. Martin geplant hatten, entschlossen sich, zwei oder drei Tage zu bleiben.
So auch der junge Herr Riedmann mit seiner Großmutter. Nur war es bei ihnen nicht die Quelle, die sie zum Bleiben veranlasste. Es waren die Münzen, die den jungen Mann in ihren Bann schlugen und nicht mehr losließen, bis er sie – zusammen mit Rochus Zollner – genau bestimmt hatte nach Wert, Alter und Herkunft.
Barbara freute sich, obwohl ihr Bernhard Riedmann keinerlei Aufmerksamkeit schenkte. Sie war einfach glücklich, weil er dablieb, auch wenn sie nur wenige Worte mit ihm wechselte.
Immer mehr Leute kamen den Berg herauf. Es waren durchaus nicht nur Wallfahrer, es waren auch viele Neugierige, die unbedingt die Quelle sehen wollten, die so plötzlich angefangen hatte zu sprudeln.
Zusammen mit zwei Helfern aus der Gemeinde brachte Korbinian eine Umzäunung an, nachdem der Abt entschieden hatte, dass die Quelle bleiben und eingefasst werden sollte.
Zwei Tage später rückte eine Maurerkolonne an, um die Quelle fachgerecht auszubauen. Es entstand ein kleines Becken, in dem das Wasser aufgefangen wurde. Es war kristallklar, und alle Leute, die es tranken, behaupteten hinterher, noch nie in ihrem Leben ein so wohlschmeckendes Wasser getrunken zu haben.
Pater Konrad forderte sogar einen Experten vom Wasserwirtschaftsamt an, der das Wasser untersuchte, um es auf eventuelle Schadstoffe zu prüfen.
Aber es fanden sich keine. Eine genauere Analyse bewies vielmehr das Vorhandensein wertvoller Spurenelemente, wie sie in manchen Heilquellen der Kurbäder vorkamen.
Die Quelle wurde damit offiziell für den Trinkgenuss freigegeben, und St. Martin erhielt innerhalb weniger Tage einen ungeahnten Zulauf.
Der kleine Laden vom Rochus Zollner konnte den Ansturm der Käufer kaum aufnehmen. Rochus musste Bernhard Riedmann die weitere Untersuchung der Münzen allein überlassen, weil Regine und Barbara die Leute alleine kaum noch bedienen konnten.
Bernhard Riedmann und seine Großmutter hatten sich gerade noch rechtzeitig beim Kammerloher einquartiert. Denn nach der Entdeckung der Quelle gab es weder beim Lindenwirt noch bei einem Bauern ein freies Zimmer für die Menschen, die alle in St. Martin wohnen wollten.
Kurz vor zwölf, als der Käuferansturm endlich etwas nachgelassen hatte und Barbara gerade den Laden schließen wollte, kam der Gustl angerannt. Er hielt einen Feldblumenstrauß in der Hand, der nicht aus dem Klostergarten, sondern von den Kammerloherschen Wiesen stammte.
»Ich hab net viel Zeit«, keuchte er, noch völlig außer Atem vom schnellen Laufen. »Bei uns fängt der Rummel jetzt erst richtig an. Aber ich hab halt mal vorbeischauen wollen.« Er blickte in den Laden und erkundigte sich: »Ist die Regine net da?«
Barbara warf einen Blick auf die Blumen in seiner Hand. »Willst du ihr die bringen?«
Er nickte. »Du weißt schon, dass wir neulich gestritten haben. Und bloß wegen dem Korbinian und seinem Beinhaus.«
»Gell, Gustl, da halt ich mich raus. Was du mit der Regine auszumachen hast, das musst ihr schon selber sagen. Sie ist oben in der Küche. Kennst ja den Weg.«
Er hatte es wirklich sehr eilig, stolperte beinahe über die Stufen, fing sich aber noch rechtzeitig und rannte in den ersten Stock hinauf.
Er hörte die Regine in der Küche mit dem Geschirr hantieren. Die Tür stand offen.
Vorsichtig streckte er den Arm aus, sodass nur der Blumenstrauß zu sehen war.
»Bist mir noch bös, Regine?«, fragte er leise.
Sie ließ vor Schreck den Kochlöffel fallen, mit dem sie gerade die Bratkartoffeln wenden wollte.
»Mein Gott, Gustl, hast du mich aber …«
»Was hab ich …?«, fragte er, drückte ihr die Blumen in die Hand und sah sie bittend an. »Hast etwa grad an mich gedacht, weil du gar so blass geworden bist?«
»Ich bin überhaupt net blass. Ich dank dir schön für die Blumen. Meinst du, dass damit zwischen uns alles wieder vergessen sein soll?«
»Meinst du das nicht?«, fragte er, und seine Stimme klang ein wenig ängstlich.
Regine legte den Strauß auf den Küchentisch und stellte sich vor den Gustl hin.
»Du weißt doch, dass wir den Korbinian gernhaben. Warum musst gerade du auf ihm herumhacken? Es genügt doch, wenn dein Vater recht eklig zu ihm ist.«
Er legte ihr die Hände auf die Schultern.
»Jetzt reden wir über uns und net über den Korbinian. Ich wollt bloß wissen, ob du mir noch bös bist?«
»Nein …«
»Dann kannst mir also auch ein Busserl geben. Oder ist das zu viel verlangt?«
»Schafskopf«, flüsterte sie lächelnd. Und dann küssten sie sich. Dass dabei die Bratkartoffeln etwas dunkler wurden, als es angebracht war, merkte die Regine erst, als sie anfingen, angebrannt zu riechen.
»Um Gottes willen, da siehst du, was du angerichtet hast!«
»Nix ist«, beruhigte er sie. »Unten sind sie halt ein bisserl brauner als sonst. Da schmecken sie ein bisserl kräftiger. Mein Vater sagt immer, Bratkartoffeln müssen ordentlich braun sein. Dann trinken die Leut mehr, weil sie schärfer sind.«
»Aber wir sind hier nicht in einer Wirtschaft.« Gustl bekam noch einen Kuss. »Und jetzt gehst. Der Großvater sitzt schon drüben im Zimmer und wartet auf das Essen.«
»Sehen wir uns heute Abend?«