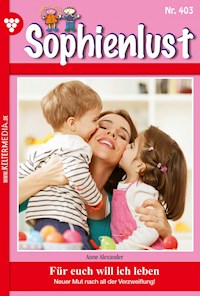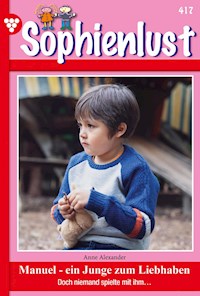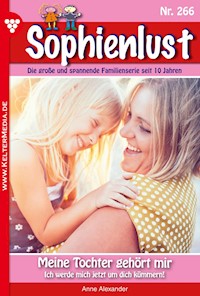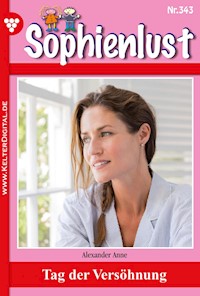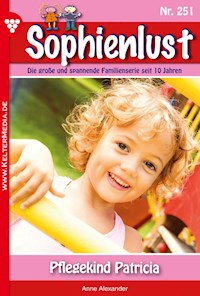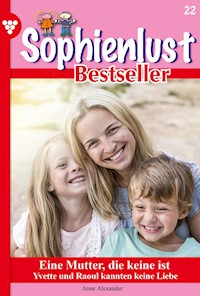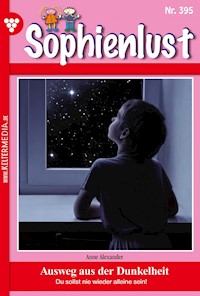Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Bestseller
- Sprache: Deutsch
Der Sophienlust Bestseller darf als ein Höhepunkt dieser Erfolgsserie angesehen werden. Denise von Schoenecker ist eine Heldinnenfigur, die in diesen schönen Romanen so richtig zum Leben erwacht. Das Kinderheim Sophienlust erfreut sich einer großen Beliebtheit und weist in den verschiedenen Ausgaben der Serie auf einen langen Erfolgsweg zurück. Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem später einmal, mit Erreichen seiner Volljährigkeit, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. »Wildmoos!« verkündete der Busfahrer laut. Dann wandte er sich der hinter ihm sitzenden Frau zu und sagte: »Sie müssen hier aussteigen.« Müde erhob sich die Angesprochene. »Danke«, erwiderte sie, stand auf und zog ein etwa sechsjähriges Mädchen, das neben ihr am Fenster gesessen hatte, mit sich. »Sind wir endlich da?« fragte die Kleine. »Ja, Nicole. Nun komm schon!« erwiderte die Mutter ungeduldig. Der Fahrer blickte den beiden nach, als sie aus dem Bus stiegen. Das Gesicht der Frau war sehr blaß, auch sonst wirkte sie krank. Vielleicht will sie sich mit ihrer Tochter hier in der waldreichen Umgebung erholen, dachte er. Ein älteres Ehepaar stieg ein, er kassierte das Fahrgeld und fuhr weiter. Nicole sah sich um. »Ich sehe aber hier kein Kinderheim«, sagte sie. »Es liegt hinter Wildmoos«, erklärte Simone Brenner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Bestseller – 46 –Ich bin nicht Silke!
Wann komme ich wieder zu meiner richtigen Mami?
Anne Alexander
»Wildmoos!« verkündete der Busfahrer laut. Dann wandte er sich der hinter ihm sitzenden Frau zu und sagte: »Sie müssen hier aussteigen.«
Müde erhob sich die Angesprochene. »Danke«, erwiderte sie, stand auf und zog ein etwa sechsjähriges Mädchen, das neben ihr am Fenster gesessen hatte, mit sich.
»Sind wir endlich da?« fragte die Kleine.
»Ja, Nicole. Nun komm schon!« erwiderte die Mutter ungeduldig.
Der Fahrer blickte den beiden nach, als sie aus dem Bus stiegen. Das Gesicht der Frau war sehr blaß, auch sonst wirkte sie krank. Vielleicht will sie sich mit ihrer Tochter hier in der waldreichen Umgebung erholen, dachte er. Ein älteres Ehepaar stieg ein, er kassierte das Fahrgeld und fuhr weiter.
Nicole sah sich um. »Ich sehe aber hier kein Kinderheim«, sagte sie.
»Es liegt hinter Wildmoos«, erklärte Simone Brenner. »Wir sollen hier abgeholt werden.« Besorgt wanderte ihr Blick die Straße auf und ab. »Der Fahrer scheint sich verspätet zu haben«, bemerkte sie.
Obwohl die Sonne warm vom Himmel schien, war es ihr kalt. Sie stellte den Koffer neben sich hin und atmete schwer. Jede kleinste Anstrengung kostete sie Mühe. Sie wischte sich mit einem Taschentuch die feinen Schweißperlen ab, die sich auf ihrer Stirn gebildet hatten. Auch ihr Herz machte sich wieder bemerkbar. Es war ihr, als ob eine eiserne Faust es zusammenpressen würde. Mit diesem Anfall stieg die Angst in Simone hoch, zusammenzubrechen, bevor sie ihr Kind bei guten Leuten abliefern konnte.
Nicole öffnete den Mund, um die Mutter etwas zu fragen, doch ein Blick auf sie genügte, um zu erkennen, daß sie wieder mal nicht ansprechbar war. Die Kleine war mit dem Zustand der Mutter schon gut vertraut und wußte, wenn sie so schwer nach Atem rang, war es besser, nichts zu fragen, da sie kaum antworten konnte.
»Die Handtasche«, preßte Simone endlich hervor. »Tabletten.«
Das Mädchen begriff sofort. Es nahm der Mutter die Handtasche ab, zog ein Tablettenröhrchen heraus und entnahm diesem eine Tablette.
Hastig griff Simone danach und schluckte sie ohne Wasser hinunter. Aufatmend lehnte sie sich gegen den Bushaltepfosten.
»Geht’s wieder besser, Mama?« fragte Nicole und sah mit ängstlichen Augen die Mutter an.
»Soweit man von besser reden kann«, murmelte Simone. Dann seufzte sie und setzte lauter hinzu: »Es tut mir so leid, Mausi, daß ich dich immer erschrecken muß.«
»Kann ich nicht bei dir bleiben?« fragte das Kind. »Warum muß ich in ein Kinderheim? Ich kann dich doch pflegen, ich bin schon so groß.« Nicole stellte sich auf die Zehenspitzen, um so ihre Größe besser zu demonstrieren.
Simone lächelte wehmütig. »Zehn Jahre älter«, meinte sie, »und du könntest mir helfen.« Dann allerdings werde ich nicht mehr leben, dachte sie. »Mit sechs ist man selbst noch hilfsbedürftig«, fuhr sie fort. »In Sophienlust wirst du gut untergebracht sein und unter den vielen Kindern wieder fröhlich werden, was du doch längst nicht mehr bist.«
»Tante Steffi war oft bös’ zu mir«, sagte Nicole. »Warum kannst du nicht im Heim bei mir bleiben?«
»Weil ich ins Krankenhaus muß«, erwiderte Simone. Am liebsten hätte die junge Frau geweint. Das Schicksal hatte ihr schon viel genommen, und jetzt mußte sie sich für längere Zeit, sicherlich sogar für immer, von ihrer Tochter trennen, damit Nicole endlich ein geregeltes Leben führen konnte. Erleichtert bemerkte sie, daß kurz vor ihnen ein Auto hielt. »Ich glaube, wir werden abgeholt«, äußerte sie.
Der Fahrer stieg aus und kam auf die Wartenden zu. »Guten Tag!« grüßte er. »Sie sind doch sicher Frau Brenner?«
Simone nickte und erwiderte seinen Gruß.
»Ich bin der Chauffeur Hermann«, stellte er sich vor. »Sie müssen schon entschuldigen, daß ich mich verspätet habe, aber vor knapp einer Stunde hat sich ein Schoeneicher Gutsarbeiter das rechte Bein gebrochen. Ich mußte ihn erst nach Maibach ins Krankenhaus bringen.«
»Nicht so schlimm«, erwiderte Frau Brenner, »das heißt, für den Arbeiter schon.«
Während Hermann den Koffer im Gepäckraum verstaute, sagte Nicole: »Für Mama war es auch schlimm, sie hat wieder ’nen Anfall gehabt.«
Erstaunt sah der Chauffeur die junge Frau an.
»Nicole ist manchmal etwas vorlaut«, sagte diese entschuldigend. »Natürlich ist Ihre Verspätung nicht schuld daran. Ich bin herzkrank, da kommt so etwas eben vor.«
»Dann wird es höchste Zeit, daß wir nach Schoeneich kommen«, meinte der Fahrer. Er hielt Simone die Tür zum Fond auf. Während die junge Frau einstieg und sich ermattet in den Sitz fallen ließ, drehte er sich nach Nicole um und entdeckte, daß sich die Kleine schon auf dem Beifahrersitz niedergelassen hatte. »Nichts da, kleines Fräulein«, sagte er, »Kinder gehören nach hinten.« Er zog sie vom Sitz.
»Herr Hermann, kann ich nicht vorn sitzen?« fragte Nicole bittend. »Da sieht man viel mehr.«
»Nein, Nicole«, widersprach der Mann. Er strich dem Kind über das rötlichbraune Haar, dann schob er es auf den Rücksitz. Sein Blick fiel dabei wieder auf die junge Frau, die völlig apathisch dasaß. Sie gehört in ein Krankenhaus, dachte er mitleidig. Er ging um den Wagen herum, setzte sich hinter das Steuer und startete.
*
Denise von Schoenecker konnte nur schlecht ihren Schreck über das Aussehen der jungen Frau verbergen, als diese aus dem Wagen stieg. Sie nahm sich zusammen und begrüßte Simone Brenner mit aller Herzlichkeit. Dann wandte sie sich Nicole zu, die krampfhaft die Hand der Mutter umklammert hielt. Das Kind sah zwar gesund aus, wirkte aber bedrückt und unglücklich. Unwillkürlich zog sie die Kleine liebevoll an sich.
»Herzlich willkommen«, sagte sie. »Dir wird’s sicher hier bei uns gefallen.«
Mit großen, haselnußbraunen Augen sah Nicole staunend auf das große Gebäude, vor dem sie standen und an dessen dunklen Mauern sich wilder Wein hinaufrankte. »Das ist doch hier kein Kinderheim«, platzte sie heraus, »das ist ja ein Schloß.«
Denise lachte. »Du hast recht. Das Kinderheim Sophienlust ist es nicht. Es ist das Gutshaus von Schoeneich. Ich wohne hier mit meiner Familie.«
»Kein Schloß?« wunderte sich Nicole. »Es hat doch aber einen Turm.«
»Das schon«, erwiderte Denise. »Aber jetzt müssen wir ins Haus gehen. Deine Mutter will sich bestimmt etwas ausruhen.«
»Ich möchte Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen«, meinte Simone. »Ich wollte eigentlich sofort zurückfahren!«
Denise sah Frau Brenner an. Sie merkte, daß sich die junge Frau kaum mehr auf den Beinen halten konnte. »Nichts da«, entschied sie. »Sie sind heute mein Gast. Und morgen wird Sie unser Chauffeur Hermann direkt nach Karlsruhe zurückbringen. Dann kommen Sie um die für Sie so anstrengende Bahnfahrt herum.«
»Sehr gütig von Ihnen, Frau von Schoenecker«, entgegnete Simone verlegen, während sie die Halle betraten. »Sie wissen wohl schon genau Bescheid?«
»Frau von Berlitz hat mich ausführlich unterrichtet, als sie mich aufsuchte.« Sie unterbrach sich und sah sich nach Nicole um. Das Kind stand staunend vor dem Kamin. »Wir haben am Nachmittag noch Zeit genug, um ausführlich über Ihre Probleme zu sprechen«, wandte sie sich wieder an Simone.
Ein älteres Hausmädchen war in die Halle getreten.
»Bitte, Gusti, bringen Sie doch unsere Besucher in ein Gästezimmer«, sagte Denise zu ihr, »damit sie sich noch vor dem Essen frischmachen können.«
Nicole kam auf einen Wink ihrer Mutter herbei. »Hier würde es mir auch gefallen«, sagte sie. »So was habe ich noch nie gesehen.« Sie deutete auf den Kamin. »Kann ich nicht hierbleiben?«
»Sophienlust hat auch eine große Halle mit einem offenen Kamin«, erwiderte die Gutsbesitzerin. »Dort halten sich die Kinder gern auf, vor allem, wenn ihnen die Huber-Mutter schöne Geschichten erzählt.«
»Wer ist die Huber-Mutter?« fragte Nicole.
»Eine alte Frau, die von den Kindern heiß geliebt wird, weil sie so viele, schöne Geschichten kennt«, erwiderte Denise. »Sie wohnt im Nebentrakt des Kinderheims.« Dann wandte sie sich lachend an Nicoles Mutter: »Außerdem übt sie eine besondere Faszination auf die Kinder aus, weil man ihr nachsagt, sie würde über hellseherische Fähigkeiten verfügen.«
»Heißt das, sie steht in dem Ruf, die Zukunft deuten zu können?« Die Frau lachte bitter auf. »Gräßlich«, fuhr sie fort. »Was mir die Zukunft bringt, weiß ich auch so. Doch hätte ich es früher gewußt, hätte ich erst gar nicht geheiratet, dann wäre mir viel erspart geblieben. Komm, Nicole, wir wollen Frau von Schoenecker nicht länger aufhalten.« Sie faßte ihre Tochter bei der Hand und folgte Gusti, die ihnen den Weg wies.
Nach dem Mittagessen hatte Denise darauf bestanden, daß sich die kranke Frau etwas hinlegte, während sie selbst zum Turmzimmer hinaufstieg, um dort ihre Privatpost zu erledigen.
Denise von Schoenecker war eine schöne, jugendlich aussehende, moderne Frau mit schwarzem Haar und dunklen Augen. Sie liebte Kinder über alles. Als sie den Witwer Alexander von Schoenecker geheiratet hatte, war sie selbst auch Witwe gewesen und hatte zu den beiden Kindern Alexanders, Sascha und Andrea, ihren Sohn Dominik mit in die Ehe gebracht.
Vom Park her hörte sie die laute Stimme ihres gemeinsam, jetzt neunjährigen Sohnes Henrik. Sie stand vom Tisch auf und trat ans Fenster, von dem man zum Eingang des Gebäudes hinuntersehen konnte. Henrik stand unten mit der kleinen Nicole und verabschiedete sich laut von seinem Vater, der zu den Wirtschaftsgebäuden wollte. Dann verschwand der Junge Hand in Hand mit Nicole zwischen den alten Bäumen.
Denise trat an das andere Fenster. Von hier aus reichte der Blick weit bis nach Sophienlust hinüber. Tief atmete sie die frische Luft ein, die durch das geöffnete Fenster hereinströmte. Für sie gab es nichts Schöneres, als ihre Heimat und ihre Aufgabe in Sophinelust. Sie machte sich wieder an die Arbeit.
Nach etwa einer Stunde klopfte Gusti an die Tür und trat auf Denises »Herein« ins Zimmer. »Frau Brenner«, meldete sie.
Die Gutsbesitzerin stand auf. »Gusti, schicken Sie uns doch bitte den Kaffee herauf«, bat sie.
»Sofort, Frau von Schoenecker«, erwiderte das Hausmädchen. Es ließ Simone an sich vorbei und schloß hinter ihr die Tür.
Denise ging der Besucherin entgegen. »Sie sehen jetzt frischer aus«, stellte sie fest.
»Ich fühle mich auch etwas wohler«, erwiderte Simone.
»Das freut mich, Frau Brenner«, sagte Denise herzlich. Sie legte ihre Schreibsachen in eine Schublade, dann schob sie einen bequemen Sessel an den Tisch. »Bitte, setzen Sie sich, Frau Brenner. Wir werden jetzt gemütlich Kaffee trinken, wobei wir alles Wesentliche besprechen können.«
»Wo ist Nicole?« fragte Simone.
»Henrik und sie machen zur Zeit den Park unsicher«, erwiderte Denise lächelnd. »Ich schlage vor, daß wir nach unserer Aussprache Ihre Tochter gemeinsam nach Sophienlust bringen. Sie können sich dann selbst überzeugen, wie gut Ihre Kleine dort untergebracht sein wird.«
»Davon bin ich jetzt schon überzeugt, sonst hätte ich Nicole nicht hergebracht«, sagte die junge Mutter. »Sie hatten ja den kleinen Sohn von Frau von Berlitz hier, als sie mit ihrem Mann nach Kanada mußte. Frau von Berlitz war ganz begeistert von Ihrem Heim. Sie hat mir gesagt, daß man hier auch unbemittelte Kinder...«
Verlegen unterbrach sich die junge Frau.
»Darüber brauchen Sie sich tatsächlich keine Sorgen zu machen«, meinte Denise. »Wir haben dafür einen Fond.«
»Trotzdem hätte ich mich nicht getraut, mich direkt an Sie zu wenden, wenn mir Frau von Berlitz nicht zugeredet und es vermittelt hätte«, gestand Simone bedrückt.
Ehe Denise antworten konnte, klopfte es, und Gusti trat mit einem Tablett ein. Sie stellte es auf eine Anrichte und deckte den Tisch. In die Mitte stellte sie einen Teller mit Pflaumenkuchen.
Während Gusti den Kaffee einschenkte, sagte Denise: »Der Pflaumenkuchen ist eine Spezialität unserer Köchin Martha, die übrigens eine Schwester der Sophienluster Köchin Magda ist.«
»Haben Sie noch Wünsche?« fragte Gusti.
»Nein, danke.« Denise nickte dem Mädchen zu. Als sie wieder allein waren, sagte die Verwalterin zu ihrem Gast: »Bitte greifen Sie kräftig zu, sonst ist unsere gute Martha beleidigt.«
»Ich habe eigentlich keinen großen Hunger.«
»Sie müssen aber etwas essen, damit Sie bei Kräften bleiben.« Resolut legte Denise ihrem Gast ein großes Stück Pflaumenkuchen auf den Teller und gab auf ein kurzes Nicken auch noch eine Portion Sahne darauf. »Über Ihre Probleme reden wir erst, wenn wir uns gestärkt haben.«
Die nächste halbe Stunde unterhielten sich die beiden Frauen nur über Nebensächliches. Erst als Simone ein zweites Stück Kuchen ablehnte und demonstrativ ihren Teller zurückschob, kam sie auf deren Sorgen zu sprechen.
»Haben Sie sich das wirklich reiflich überlegt, daß wir für Nicole eine gute Pflegestelle suchen sollen?« fragte sie. »Sehen Sie, Ihre Tochter ist schon sechs, sie wird die Trennung von Ihnen nicht so leicht verkraften, und vor allem nicht verstehen.«
»Denken Sie nicht, Frau von Schoenecker, mir wäre der Entschluß leichtgefallen. Aber Nicole würde mehr darunter leiden, wenn Sie mich langsam sterben sehen müßte. Wenn sich eine gute Pflegefamilie finden sollte, ist diese dann vielleicht auch bereit, meine Tochter nach meinem Tod zu adoptieren.«
»Ich weiß von Frau von Berlitz, daß Sie schwer krank sind«, meinte Denise, »aber wenn Sie nun ins Krankenhaus gehen, meinen Sie nicht, daß Sie dann wieder gesund werden können?«
»Für mich gibt es keine Rettung«, behauptete Simone. »Ich weiß das ganz genau, denn ich habe bei einer Untersuchung zufällig gehört, wie sich zwei Schwestern darüber unterhielten. Sie meinten, mein Fall sei hoffnungslos und ich hätte nicht mehr lange zu leben.«
»Auf so etwas sollten Sie nichts geben«, erwiderte Denise. »Was wissen schon die Schwestern? Was hat denn Ihr Arzt gesagt?«
»Es ist nicht allein meine Krankheit, ich bin auch nervlich am Ende. Ich fühle mich nicht mehr in der Lage, das Kind zu erziehen, obwohl ich es liebe. Was hat denn Nicole noch von mir? Meine depressive Stimmung greift auf das Kind über, wenn es mit ansehen muß, wie ich leide, wie ich oft um jeden Atemzug ringe. Anstatt, daß ich für die Kleine sorge, muß sie oft mich betreuen, dabei ist sie doch erst sechs! Nicole war früher ein fröhliches Kind, aber in letzter Zeit ist sie immer stiller und trauriger geworden.«
Simone starrte zum Fenster hinaus, ohne etwas zu sehen, dann fuhr sie fort: »Das Schlimmste aber ist, daß ich sie nicht einmal mehr richtig ernähren kann. Ich weiß nicht, Frau von Schoenecker, ob Sie darüber informiert sind. Mein Mann ist vor zwei Jahren nach einer Unterschlagung mit dem Geld nach Amerika geflüchtet, wurde dort jedoch ausgeplündert und ermordet. Das gestohlene Geld hat ihm also kein Glück, aber mein Kind und mich um unsere Existenz gebracht.«
Ihre Stimme klang hart und haßerfüllt. Sie merkte selbst, daß diese Erregung nicht gut für sie war, denn sie spürte, wie sich ihr Herz wieder zusammenkrampfte und ihr die Luft knapp wurde.
Auch Denise bemerkte es. »Sie dürfen sich nicht so aufregen«, mahnte sie. »Erzählen Sie lieber später weiter.«
»Dann würde ich mich auch wieder aufregen«, erwiderte Simone. »Bringen wir es lieber hinter uns. Ich möchte nicht, daß Nicole ihre ganze Kindheit in einem Heim verbringt, auch wenn es noch so vorbildlich ist. Ich selbst bin in einem Heim großgeworden, weil mein Vater nach dem Tod meiner Mutter keine Zeit für mich gehabt hatte. Ich habe nichts anderes gelernt, als einen Haushalt zu versorgen. Als mein Mann uns mittellos zurückließ, blieb mir nichts anderes übrig, als als Putzfrau zu arbeiten. Da ich kein Geld für ein Kinderheim besaß, mußte ich Nicole viel zu oft meiner Nachbarin Stefanie Carstens überlassen, die nicht sonderlich geschickt im Umgang mit Kindern ist. Erst als mich Frau von Berlitz als Putzfrau anstellte, wurde es besser, denn sie erlaubte mir, Nicole mitzubringen. Doch mit meiner Krankheit wurde es immer schlimmer. Auch wenn Frau von Berlitz mir gegenüber viel Verständnis zeigte, litt mein Selbstbewußtsein darunter, daß ich von ihr Geld annehmen mußte, obwohl meine Arbeitskraft immer mehr nachließ. Eines Tages erzählte sie mir von Ihrem Heim und mein Entschluß war gefaßt.«
»Bei uns bekommen die Kinder eine Ausbildung, die ihrer Intelligenz entspricht«, erwiderte Denise, »also auch eine höhere Schulbildung. In diesem Punkt können Sie ganz beruhigt sein, Frau Brenner. Aber es braucht doch nicht für immer zu sein, sondern nur solange Sie im Krankenhaus sind, und bis Sie sich danach einigermaßen erholt haben.«
»In punkto meiner Krankheit sind Sie sehr optimistisch, Frau von Schoenecker. Doch ich mache mir da nichts vor«, äußerte Simone. »Ich habe noch einen anderen Grund, Nicole aus Karlsruhe wegzubringen. In Ihrem Heim wird sie nicht erfahren, daß ihr Vater ein Verbrecher war. Ich möchte nicht, daß sie darunter so zu leiden hat wie ich. Vor zwei Jahren war es ein regelrechtes Spießrutenlaufen für mich. In der Vorstadtsiedlung, in der ich lebe, kennt jeder jeden. Und nach einem halben Jahr ging in den Zeitungen der Rummel noch einmal los, als in allen Variationen darüber berichtet wurde, wie mein Mann gestorben sein soll. Zum Glück war Nicole damals erst vier und hat von alledem nichts begriffen. Doch nun wächst die Gefahr, daß sie es erfährt, zumal sie nächstes Jahr eingeschult wird. Sicherlich wird es dann Eltern geben, die ihren Kindern den Umgang mit einem Verbrecherkind verbieten.«
»Sehen Sie nicht etwas zu schwarz?« fragte Denise.
»Nein«, erwiderte Simone hart. »Nicht nach den Erfahrungen, die ich habe machen müssen.« Wieder rang sie nach Luft.
»Machen wir Schluß«, schlug Denise vor. »Es strengt Sie zu sehr an.«
»Ich hab’s gleich hinter mir«, erwiderte die junge Frau. »Er hat mir kein Geld hinterlassen, nicht einmal einen Abschiedsbrief«, setzte sie ihren Bericht fort, »dafür aber den Keim zu meiner Krankheit. Als mein Mann nach Geschäftsschluß nicht nach Hause kam, was bei ihm noch nie vorgekommen war, habe ich die ganze Nacht nach ihm gesucht. Es war kalt und es regnete. Am nächsten Tag hatte ich eine schwere Angina. Die Polizei kam ins Haus, das Oberste wurde von ihr zuunterst gekehrt. Durch diese Aufregung und den Kummer habe ich meine Erkältung nicht beachtet und keinen Arzt aufgesucht. Dann fing es mit dem Herzen an. Endlich ging ich zum Arzt. Er stellte eine Herzinnenhautentzündung fest, aus der eine bakterielle wurde. Die Ärzte rieten mir zur Schonung, aber ich mußte doch Geld verdienen. Nun habe ich eine Herzklappenentzündung.«
»Soviel ich weiß, kann man diese Erkrankung heute heilen«, sagte Denise.
»Ja, wenn noch keine Narben entstanden wären«, erwiderte Simone bitter.
»Und eine Operation?«
»Wozu? Um auf dem Operationstisch zu enden oder nachher als Hilflose weiterzuleben? In beiden Fällen würde Nicole die Leidtragende sein. Deshalb möchte ich sie schon jetzt gut versorgt wissen, ehe sie noch mehr von meiner Krankheit mitbekommt. Ich möchte, daß mein Kind wieder so unbeschwert wird, wie es früher einmal gewesen ist. Vielleicht finden Sie für Nicole eine Familie, die sie in liebevolle Pflegschaft nimmt, mit der Möglichkeit einer Adoption, wenn ich nicht mehr bin.«
»Gut, ich verspreche Ihnen, mich darum zu bemühen, wenn ich auch noch immer glaube, daß Sie zu schwarz sehen«, sagte die Verwalterin. »Ich bin sicher, daß Sie Ihr Töchterchen eines Tages wieder in die Arme schließen können. Sie müssen sich allerdings endlich dazu entschließen, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Versprechen Sie mir das?«