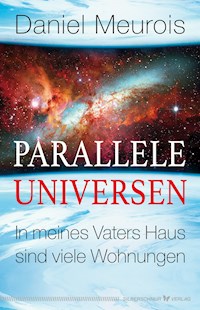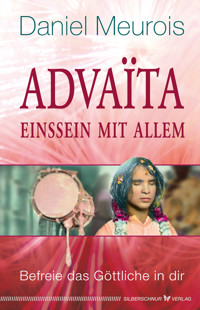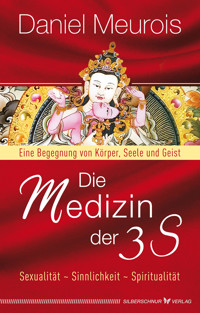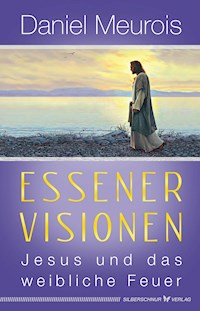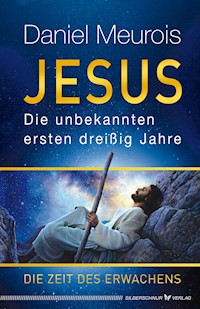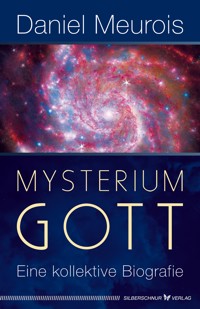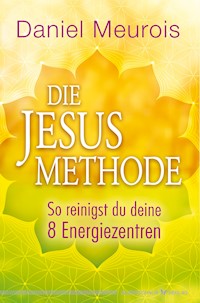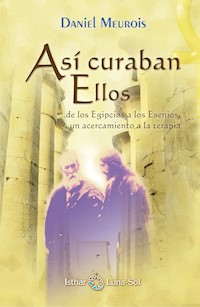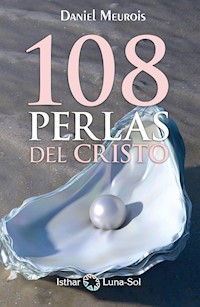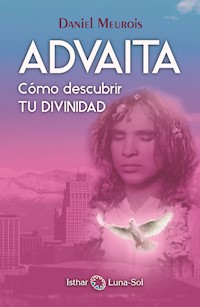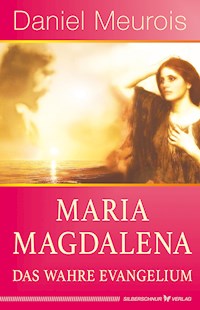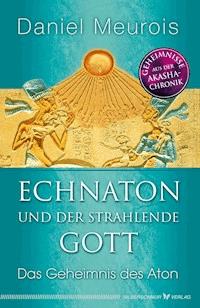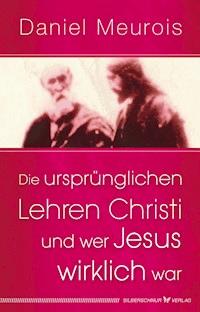29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag "Die Silberschnur"
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was die Bibel nicht erzählt Das Wirken Jesu und sein Leben nach der Kreuzigung ... bis zu seinem Tod im hohen Alter In seinem fesselnden Werk enthüllt Daniel Meurois die verborgenen Kapitel im Leben von Jesus Christus, die in der Bibel unerwähnt bleiben. Nachdem er uns bereits die Kindheit und Jugend Jeshuas (Jesu) nahegebracht hat, gewährt er uns nun Einblicke in dessen Erwachsenenjahre und die Zeit nach der Kreuzigung bis zu seinem Tod im hohen Alter. Neben den Wundern, die Jesus vollbrachte, war sein ganzes Leben geprägt von Geheimnissen und Mysterien. So enthüllt der Autor die wahre Rolle von Judas sowie bislang unbekannte Lebensstationen von Jesus, wobei deutlich wird, dass er während seines Erdenlebens eine bedeutende Aufgabe zu erfüllen hatte und mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert war. Die Taufe am Jordan markierte den Anfang seiner irdischen Mission, doch sein Wirken ging weit darüber hinaus. Mit diesem außergewöhnlichen Werk ermöglicht es uns Daniel Meurois, dank seiner Einsicht in die Akasha-Chroniken, Jesus Christus noch näher zu kommen und seine wahre Natur besser zu verstehen – auch indem wir von Lehren erfahren, die bislang im Verborgenen blieben. Ein imposantes Werk, das Geschichte schreiben wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1014
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Daniel Meurois
JESUS
Die wahrhaftige Aufgabe und seine Jahre nach der Kreuzigung
DIE ZEIT DER VOLLENDUNG
Aus dem Französischen von Dr. Gerhild Schulz
Alle Rechte vorbehalten.
Außer zum Zwecke kurzer Zitate für Buchrezensionen darf kein Teil dieses Buches ohne schriftliche Genehmigung durch den Verlag nachproduziert, als Daten gespeichert oder in irgendeiner Form oder durch irgendein anderes Medium verwendet bzw. in einer anderen Form der Bindung oder mit einem anderen Titelblatt als dem der Erstveröffentlichung in Umlauf gebracht werden. Auch Wiederverkäufern darf es nicht zu anderen Bedingungen als diesen weitergegeben werden.
Copyright der Originalausgabe © by Daniel Meurois, 2018. Titel der Originalausgabe: »Le Livre secret de Jeshua. La vie cachée de Jésus… selon la Mémoire du Temps. Tome II. Les saisons de l’Accomplissement«. Veröffentlicht in Partnerschaft mit Maurice Baldensperger und Francis Hoffmann GbR »Publish Vision« · info@publishvision.de · www.publishvision.de
Copyright der deutschen Ausgabe © 2023 Verlag »Die Silberschnur« GmbH
ISBN: 978-3-96933-053-1eISBN 978-3-96933-930-5
1. Auflage 2023
Übersetzung: Dr. Gerhild Schulz
Satz: Beeg|graphics, Kirchheimbolanden
Umschlaggestaltung: XPresentation, Güllesheim; unter Verwendung eines Motivs von © Greg Olsen. Nach Absprache mit Greg Olsen Art, Inc.
Weitere Informationen zu den Kunstwerken von Greg Olsen auf www.gregolsen.com
Abbildung Seite 369: © antiqueimgnet; istockphoto.com
Verlag »Die Silberschnur« GmbH · Steinstr. 1 · 56593 Güllesheim
www.silberschnur.de · E-Mail: info@silberschnur.de
Meiner lieben Marie Johanne,die schon so lange und tief die Dringlichkeit spürt, diese Worte und Seelenbilder aufzuschreiben.
Für alle, die ihr Lebender Suche nach der universellen Sonne widmen, ganz gleich aus welchem Kulturkreis sie kommen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel:»Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich nennen soll …«
2. Kapitel:Hinter den Mauern von Sokuk
3. Kapitel:Das Jordan-Mysterium
4. Kapitel:Meine ersten Schritte mit der Sonne
5. Kapitel:»Also, willst du mich?«
6. Kapitel:Nach dem Erdbeben
7. Kapitel:Das Lächeln einer Wolke
8. Kapitel:Von Yo Hanan zu Miriam
9. Kapitel:Erblühende Seelen
10. Kapitel:Im Lande der Gadarener
11. Kapitel:Die Wolke
12. Kapitel:In der Wahrheit von Kana
13. Kapitel:Der Plan des Tempels
14. Kapitel:Eliazars Verpuppung
15. Kapitel:Von Shlomit zu Procula
16. Kapitel:Das Wunder der Fische
17. Kapitel:Östlich von Bethsaida
18. Kapitel:Machtspiele
19. Kapitel:Öl und Wasser
20. Kapitel:Überall zugleich …
21. Kapitel:Die Versuchungen des Widersachers
22. Kapitel:Ein Tag in Jericho
23. Kapitel:Bar Abba, der Sohn des Vaters
24. Kapitel:Sanftmut und Strenge
25. Kapitel:Eine Epoche geht zu Ende
26. Kapitel:Kurz vor dem Laubhüttenfest
27. Kapitel:Ein Sturm im Tempel
28. Kapitel:Eines Nachts erschien der große Hirsch …
29. Kapitel:Gethsemane
30. Kapitel:Vom Sanhedrin in die Festung
31. Kapitel:Die Flagrum-Säule
32. Kapitel:Das Mysterium von Golgatha
33. Kapitel:Die Regeneration
34. Kapitel:In Schäferhütten verborgen
35. Kapitel:Das Dankesgebet
36. Kapitel:Sauls Erschütterung
37. Kapitel:Meryems tiefere Wahrheit
38. Kapitel:Unterwegs ins Land der großen Seelen …
39. Kapitel:Eines Abends in Bal Baktr
40. Kapitel:Die Höhen Meruvardhanas
41. Kapitel:Die insgeheime Freude
42. Kapitel:»Gebt gut aufeinander acht …«
Wie dieses Buch entstand ist
Anmerkung von Daniel Meurois
Glossar
Über den Autor
Vorwort
Seit der Veröffentlichung des ersten Bandes sind nun schon zwei Jahre vergangen. Es waren ohne Zweifel meine intensivsten und anspruchsvollsten Jahre, nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als ›Schüler des Lebens‹, also sehr bewegende Jahre.
Die Lebensbahn Jesu Christi im Detail nachzuzeichnen – vom Beginn seiner öffentlichen Mission bis hin zu seinem Ende im Himalaya, Jahrzehnte später – war wirklich ›eine große Baustelle‹ für mein Bewusstsein. Auch meine Leser wird es stark verändern und ihr Inneres völlig umkrempeln, davon bin ich überzeugt.
Welche Verantwortung ich damit auf mich lade, war mir durchgängig bewusst. Es erforderte viel Demut. Schließlich musste ich Tag für Tag über mich hinauswachsen. Nun, da das Buch fertig ist, muss ich sagen, dass ich beim Schreiben regelrecht von Christus durchflutet war – und es noch immer bin.
Damit meine ich freilich nicht ›den Christus der Kirchen‹. Sie zwängen ihn meines Erachtens in Dogmen und reduzieren so seine Tragweite. Das verursacht nur Leid. Ich meine vielmehr den universellen Christus, der als transzendente Energie im ewigen Kosmos stetig frei zirkuliert.
Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Christus bei der Lektüre zu entdecken. Vermutlich wird das Buch vor allem Menschen ansprechen, die zu einer ›Herzenslektüre‹ fähig sind, Menschen, denen bewusst ist, dass sich letztlich alles mitten in unserer Brust abspielt.
Ich wurde eingeladen, bis in intimste Winkel von Meister Jeshuas Leben vorzudringen. Nach der Jordantaufe war es völlig verwandelt. Und so gab ich mir alle Mühe, dieses innige Wissen in jedes Wort und jeden Satz einfließen zu lassen. Ich schrieb mit einer Feder auf Papier. Jede Seite sollte davon durchdrungen sein. Das war für mich ganz entscheidend. Schließlich wollte ich niemanden in eine rein intellektuelle ›esoterische Gesinnung‹ hineinziehen, die zu echter Bewusstseinserweiterung nicht taugt.
Besonders war mir daran gelegen, den persönlichen Entwicklungsweg und die psychologische Verfassung des Avatars während seines ständigen inneren Wachstums aufzuzeigen – bis hin zum Höhepunkt der Inkarnation der Göttlichkeit.
Nun könnte man sich überlegen, ob auch Historiker und Theologen von diesem Buch profitieren werden. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage gar nicht gestellt. Bei allem Respekt vor ihren wissenschaftlichen Methoden – die beiden vorliegenden Bände über Jeshuas Leben werden sich aus rein intellektueller Perspektive nicht erschließen. Um sie zu verstehen, bedarf es einer gewissen Offenheit und Spontaneität. Man muss bereit sein, alte Gedankengebäude, die einst Sicherheit boten, hinter sich zu lassen und einen Schritt ins Leere zu machen, um einen neuen Kontinent zu entdecken.
Für ›Gefühlsduseleien‹ ist auf den folgenden Seiten kein Raum. Es wurde nichts geschönt oder romantisiert. Daher sollen auch keineswegs nur diffuse Affekte angesprochen werden. Es handelt sich vielmehr um einen äußerst präzisen Bericht dessen, was ich aus Jeshuas Perspektive erleben durfte. Alles ist mit seinen Augen gesehen und aus seiner Erinnerung geschöpft.
Die hier angesprochenen Informationen und Überlegungen, aber auch mystischen und metaphysischen Gegebenheiten, stehen oft in enger Verbindung mit ganz aktuellen Zeitfragen. Das wird der Leser bald merken.
Im Übrigen war es mir ein großes Anliegen, bei der Niederschrift den Meister nicht in ein abgehobenes, sakrales Bild zu pressen. Jeshua hat stets die Nähe zu jedem Einzelnen gesucht. Er wollte nicht angebetet werden wie ein Gott, der außerhalb der Menschheit steht. Ganz im Gegenteil: Er lehrte uns ja gerade, wie wir Zugang zu unserer eigenen, wachsenden Göttlichkeit finden können. Zu dieser Einsicht führten mich meine Erlebnisse.
Jede einzelne Seite des Buches weist in diese Richtung, getragen von der Hoffnung, am Heraufziehen einer neuen Spiritualität teilzuhaben, die wir so dringend brauchen. Ich nenne sie Christismus – ganz unabhängig von jeder Religiosität. Jesus – Die wahrhaftige Aufgabe und seine Jahre nach der Kreuzigung ist strikt irreligiös, also auch völlig undogmatisch. Es wurde in aller Freiheit mit Liebe, Geduld und Willenskraft verfasst. Entsprechend hoffe ich, damit freie, aufgeschlossene Geister miteinander in Kontakt zu bringen. Es richtet sich an Menschen, die einer befreiten Zukunft entgegenblicken, jenseits der verknöcherten Einschränkungen der Vergangenheit.
Hiermit übergebe ich euch das Buch … Möge es aus jedem das Beste herausholen. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass ich auf die Welt gekommen bin, um dieses Werk zu verfassen und Zeugnis abzulegen.
1. Kapitel
»Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich nennen soll …«
An jenem Tag war das Licht im Garten vor Yussafs Haus bernsteinfarben. Gemessenen Schrittes trat ich ein, im vollen Bewusstsein, dass eine weitere, unauslöschliche Epoche meines Lebens begonnen hatte. In welcher Hinsicht vermochte ich noch nicht zu sagen, erahnte aber die Tragweite meines Handelns.
Die junge Frau, die mich empfangen hatte, bedeckte ihr Haar mit einem erdfarbenen Schleier und verschwand sogleich wieder.
Nun war ich mit meinem Onkel allein. Er konnte es noch immer nicht fassen.
»Jeshua … bist du es wirklich?«
Yussaf1 war ein alter Mann geworden. Doch an seiner kräftigen, nicht enden wollenden Umarmung spürte ich, wie viel Präsenz und Frische er sich bewahrt hatte. Es tat gut, ihn wiederzusehen. Es war wie ein Meilenstein, der meine Heimkehr markierte.
War ich hier wirklich ›zu Hause‹? Seit meiner letzten Fußreise von Joppe durch die Hügel wusste ich nicht einmal mehr, ob das wahr war – so viele Straßen war ich entlanggezogen, so viele Landstriche hatte ich durchquert. Sie hatten mich geprägt, geformt und eine Saat in mich gelegt.
Yussaf bedrängte mich mit Fragen. Ihm fiel es schwer, die Tränen zurückzuhalten, ich aber konnte mich nicht öffnen. Genau genommen schwirrten so viele Worte in mir herum, dass es keinem gelang, als Erstes über meine Lippen zu kommen.
Doch seltsamerweise hatte ich keine ›Gefühle‹, zumindest nicht im üblichen Sinne … Es war etwas Anderes, Unbestimmbares und ich empfand es zum allerersten Mal – vermutlich die Frucht meiner Metamorphose in der Pyramide. Es war so etwas wie ›Freude im Urzustand‹, ein reines, intensives Gefühl – aber ganz frei von Anhänglichkeit.
Schließlich bat mich mein Onkel, in einer Gartenecke im Herzen seines luxuriösen Anwesens auf einer Steinbank Platz zu nehmen. Eigenhändig brachte er mir etwas Wein, in der schönsten Schale, die ich je sah.
Ob wir uns unter diesen Umständen wirklich austauschen konnten? Siebzehn Jahre waren vergangen, seit er mich Yosh Heram und der Wüste anvertraut hatte. Damals war ich noch ganz jung gewesen. Seine Fragen glitten an mir ab …
Doch plötzlich verspürte ich das Bedürfnis, ihn mit anderen Augen anzusehen, tief in die Pupillen einzudringen, um seiner Seelenwahrheit auf den Grund zu gehen. Es musste einfach sein.
»Yussaf«, sagte ich noch einmal, »erkennst du mich wirklich?«
»Nein …«, gab er nach kurzem Zögern zurück. »Nein … aber ich weiß, dass nur du es sein kannst. Du … und … noch Etwas mehr, das mich erschauern lässt.«
»Ein Geisteshauch?«
»Ja, genau …«
»Um Seinetwillen bin ich losgezogen … Und darum komme ich auch zurück …«
Da verließ der Alte seinen Platz neben mir auf der Bank. Er glitt langsam abwärts, legte seine Stirn auf den Boden und nahm meine Knöchel in die Hände.
Ich ließ ihn gewähren …
Durch dies von ihm erahnte Etwas, sah ich weniger meinen Onkel in ihm, als einen nach Sonne dürstenden Menschen. Er war der Erste, dessen Durst ich löschen musste. Wie von selbst legte sich meine rechte Hand auf seinen schon ziemlich kahlen Kopf. Diese Geste erfolgte völlig frei von jeder Selbstgefälligkeit. Sie war Ausdruck Dessen, was nun in mir lebte – und das durfte ich auf keinen Fall zügeln.
So war der alte Yussaf von Ramathaijm, der meine lange Reise ermöglicht hatte, mein erster echter Schüler auf Erden.
Lange blieb meine Hand auf seinem Haupt liegen. Nun, zweitausend Jahre später, scheint mir, dass unsere Seelen sich in diesem Moment der Stille alles sagten. Freilich wussten wir beide nicht, was dieses ›Alles‹ genau umfasste. Jedenfalls brachte es ein schönes, tiefes, uraltes Einvernehmen an die Oberfläche unseres gegenwärtigen Lebens.
»Steh’ bitte auf«, sagte ich endlich. »Wir unterhalten uns heute Abend … wenn sich der vom Erinnerungswirbel entfachte Staub gelegt hat.«
Genau in diesem Moment erschien wieder die junge Frau, die mir die Türe geöffnet hatte.
Sie trug eine Schüssel und einen Wasserkrug. Der Brauch gebot, mir die Füße zu waschen, bevor ich das Haus betreten konnte.
»Das ist Marta, eine meiner Nichten«, erklärte Yussaf. »Sie ist also deine Cousine. Sie besucht mich oft … und wie du siehst, trägt sie ihren Namen zurecht.2
»Oh, … sie ist Eliazars Schwester, nicht wahr?«
»Woher weißt du das?«
»Ich wusste es nicht, sondern bemerke es gerade erst. Sie ist davon umflort …«
Einen Augenblick sah ich, wie Marta mit einer gewissen Würde das Kinn hob. Dann kniete sie zu meinen Füßen nieder, wich meinem Blick aber aus. Nun wusch sie mir mithilfe ihres Kruges und der Schüssel die Füße, wie man es mit jedem Gast tut, dem man Ehre erweisen will.
»Warum machst du das?«, fragte ich. »Du kennst mich doch gar nicht …«
»Ich habe gesehen, was mein Onkel tut, das genügt.« In Martas Tonfall schwang ein gewisser Überdruss mit. Sie sah mich noch immer nicht an.
»Meine Nichte hatte kein leichtes Leben«, erklärte Yussaf sogleich. »Sie ist zu oft allein …«
»Mit den Schafen in ihrem Haus in Bethanien?«
Diese Worte hatte ich ganz unüberlegt hingeworfen, als sei es selbstverständlich – als sei auch das einfach in ihr Seelenlicht eingeschrieben. Yussaf hatte sich gerade hinter sie gestellt, während sie meine Füße mit weißem Linnen abtrocknete. Mit offenem Mund stand er da und hielt die Luft an.
»Ja, so ist es … in Bethanien.«
Bethanien – dort war ich natürlich noch nie gewesen. Ich hatte sogar vergessen, dass es überhaupt existierte. Es fiel mir eben erst wieder ein. Doch der Klang des Namens verriet mir, dass es ein guter Ort sein musste, mit all den Dattelpalmen, die ich mir dazu vorstellte.
»Und was macht Miriam?«
Diesmal konnte Marta sich nicht beherrschen, meinen Blick flüchtig zu streifen.
»Es gibt viele Miriams …«
Mit diesen Worten stand die junge Frau auf und ging mit schnellen Schritten ins Haus.
Yussaf war das offensichtlich peinlich …
»Sie spricht nicht viel, weißt du … Sie hat oft Angst gehabt. Vor allem vor den Römern … Die Soldaten ziehen regelmäßig durch Bethanien. Sie sind ein bisschen hinter ihr her … Vielleicht erzählt sie es dir eines Tages …«
»Hast du dein Mosaik noch?«
Da brach Yussaf fast in Lachen aus. Es freute ihn offensichtlich, dass ich das Thema wechselte und mich nicht weiter für Dinge interessierte, die mich im Grunde nichts angingen.
Das war der Auslöser. Nun bat er mich in sein geräumiges Haus. Drinnen war es kühl und schattig. Wir stiegen ein paar Stufen empor und betraten eine kleine Vorhalle mit blauem Keramikbecken. Dann kamen Zimmer, viele Zimmer. Sie waren schlicht, aber sehr geschmackvoll eingerichtet … An all das konnte ich mich nicht mehr erinnern. Nur das Mosaik hatte sich meinem Gedächtnis eingeprägt. Es war noch da, am Ende eines Flurs, überflutet von Licht, das durch eine wohlplatzierte Luke eindrang.
Drei Tauben vor einem Hintergrund aus Palmen waren in feiner Eleganz darauf abgebildet.
Anders als ich es mir jahrelang vorgestellt hatte, rief die Szene jedoch keine besonderen Gefühle bei mir hervor. Zweifellos war ich sehr glücklich hier zu sein und diesen schönen Augenblick zu genießen. Umwerfend war es aber nicht. Ich war einfach nicht mehr derselbe …
Zwar war ich in meinem Körper völlig präsent, sah aber alles aus einem anderen Blickwinkel, der mir bisher unbekannt war. Es war eine Art lichtes Bewusstsein, das über allem stand …
Während ich mir das Bild der Tauben ansah, drang plötzlich Yussafs Stimme an mein Ohr. Sie klang beunruhigt.
»Verzeih mir, sag mal, … ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich nennen soll.«
»Aber … bin ich denn nicht Jeshua?«
»Nein … eigentlich nicht, so kann ich dich nicht mehr nennen. Das geht nicht mehr …«
»Wenn ich dich nun aber darum bitte?«
Darauf bekam ich keine Antwort. Löste ich wirklich so viel Angst aus? Verschärfte es also nur die Unterschiede, ›in Sonne gehüllt‹ zu sein? Führte es lediglich dazu, dass die Schutzwälle immer dicker wurden? Ach, … wie gerne hätte ich mich in diesem Moment einfach zum Beten zurückgezogen.
Während ich hinter Yussaf herging, der mir die letzten Zimmer seines Hauses zeigte, dachte ich bei mir, dass ich doch Mensch bleiben wollte – ungeachtet dessen, was geschehen war und wo es hinführen würde. Jedenfalls wollte ich dennoch Jeshua heißen … War es dieser Gedanke, dieser Wunsch oder auch Anflug von Schlichtheit, der in mir eine intensive Welle von Zärtlichkeit aufsteigen ließ? Vermutlich, denn als wir oben an der Steintreppe anlangten, die zur Dachterrasse führte, drängte es mich, Yussaf ganz fest in meine Arme zu schließen.
»Also … willst du mich auch weiterhin Jeshua nennen?«, sagte ich zu ihm.
»Wenn dir daran gelegen ist, aber …«
Nun, ich muss sagen, dieses kleine ›aber‹ stand hinfort zwischen uns – als Stigma einer Einsamkeit, die ich bis zum Ende durchleben musste.
Der Rest des Tages und Abends verlief jedoch in friedvoller Eintracht. Es war das reinste Glück. Wir tauschten uns intensiv aus. Yussaf bestätigte mir das Ableben meines Vaters und die würdevolle, starke Haltung meiner Mutter. Begeistert wurde erzählt, eins reihte sich ans nächste. Selbst Marta, die wir dazu gebeten hatten, vergaß, während sie Früchte aß, mit ihrem Lächeln zu sparen.
Es war schon spät, als sie sich, wie die anderen drei Hausangestellten, zum Schlafen zurückzog. Auf diesen Moment hatte Yussaf wohl gewartet. Aus alter Gewohnheit legte er eine Handvoll getrockneter Kräuter in die Glut …
»Bleibst du ein paar Wochen bei uns? Du bist doch so viel gereist … Hier bist du zu Hause.« Ich nahm seine Hand und legte meine geöffnete Handfläche hinein.
»Sieh mal … Seit meinen ersten Lebenstagen weißt du besser als viele andere, was hier zwischen den Linien geschrieben steht … Was soll ich deiner Meinung nach tun? Ich gebe mir drei Tage, Yussaf … drei Tage, um meinen Leib wieder auf den Gesang dieser Gegend einzustimmen. Länger nicht, denn dann …«
»Dann?«
»Was dann ist, wird Awoun mir sagen …«
Am nächsten Tag begann ich durch die Stadt zu streifen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Jerusalem war nicht mehr so wie in meinen Jugenderinnerungen. Vielleicht war es nie so gewesen …
Die Schönheit, die ich als Dreizehnjähriger im Gassengewirr, auf den kleinen Plätzen und sogar dem Tempelvorplatz wahrnehmen konnte, hatte sich gewandelt, gleichsam einen anderen Namen angenommen. Sie war zu einer Verführung geworden. Sogar eine gewisse Härte war fühlbar.
Ob es an der massiveren Präsenz der römischen Streitkräfte lag? Nein, … ich spürte sehr wohl, dass es immer so ist, wenn die Seelenpforten der Völker sich verengen. Und warum werden sie enger? Das wissen die Seelen selbst nicht. Im Grunde rufen sie in regelmäßigen Abständen nach Veränderung, lehnen deren Wirkung jedoch ab. Sie haben einfach Angst.
An jenen Nachmittag erinnere ich mich noch genau. Lange blieb ich unauffällig dem großen Tempel gegenüber sitzen und sah zu, wie die Leute vorbeizogen. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, ging es allein um die Abwicklung aller nur denkbaren menschlichen Geschäfte.
Eine Mutation? – fragte ich mich … Ja, sie war dringend nötig. Aber eine Mutation ist etwas ganz anderes als eine bloße Wandlung. Mit oberflächlichen Dingen gibt das Bewusstsein sich nicht zufrieden. Es braucht alles zugleich … die Pflugschar des Pfluges, den Geisteshauch des Sämanns, die Saat …Wasser und Feuer.
Dies waren keine glühenden Momente, im Gegenteil, ich war vollkommen ruhig. Dabei stand mir ganz klar vor Augen, dass ich all das zugleich sein musste. Es war meine Aufgabe, der einzig wahre Grund meiner Rückkehr – und zugleich meine Lebensaufgabe. Daran durfte ich auf keinen Fall zweifeln.
Als die Abenddämmerung vorbei war, fasste mich Yussaf nach der gemeinsamen Mahlzeit ungeschickt am Arm.
»Weißt du, … ich habe jetzt eine Tochter. Ich adoptierte sie kurz nach deiner Abreise. Es gab Unruhen, bei denen ihr Vater – mit dem ich befreundet war – und seine Frau umkamen. Und dann, nun ja …
Du hast ihren Namen ständig im Kopf, nicht wahr? Es ist Miriam …«
Der Name Miriam drängte sich mir auf, genau wie am Vorabend, ohne bestimmten Grund.
»Sie ist momentan in Migdel?«
Wie von selbst legten sich die Worte in meinen Mund. Sie schienen auf einen Blick oder ein Wissen zurückzugehen, die ich noch nicht beherrschte.
»Hat man dir von ihr erzählt?«
»Nein, Yussaf …«
Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Es war offensichtlich ein heikles, vielleicht sogar schmerzliches Thema. Im Grunde war mir völlig klar, wie es um diese Miriam stand, die mein Onkel adoptiert hatte … Sie hatte einen gewalttätigen Trunkenbold geheiratet und einen Sohn mit ihm … Als dieser noch ganz klein war, hatte sie ihren Mann schließlich verlassen. Welchen Ruf ihr das eingebracht hatte, konnte ich mir gut vorstellen – und auch, wie Yussaf darunter litt.
»Alles hat seinen Grund«, sagte ich, um das Thema zu beenden. »Und so gibt es auch für jeden eine bestimmte Zeit, um von der Nacht zum Tage überzugehen …«
Wie ich es mir vorgenommen hatte, blieb ich noch volle zwei Tage in Jerusalem. Ich verbrachte sie mit Nachdenken und Beobachten. Es war mir daran gelegen zu verstehen, was all diese Seelen umtrieb – und was sie brauchten.
Sie lebten letztlich im selben ›Gefängnis‹, das mir andernorts aufgefallen war – auch wenn es hier einen etwas anderen Anstrich hatte. Im Wesentlichen bestand es aus Stolz und Egoismus. Trotz aller Gebete, Tempelgaben und Geschäfte, lebte in der Masse doch jeder allein. All das war überzogen vom Spiel der Unterwerfungen, von Zugeständnissen, kleinen Aufständen und Gier. Es war die Welt des Schlafs – weder ganz böse noch wirklich gut …
Ich hätte all dem den Rücken kehren können. Doch es war so viel Feuer in mir, dass ich den betroffenen Seelen sogar dankte. Ihrem blinden Leiden und Irren hatte ich es zu verdanken, dass ich unbedingt wachsen wollte, mich erinnern – und meinen Vater einladen, in meinen Adern zu fließen …
Mit diesen Gedanken brach ich eines Morgens Richtung Bethanien auf. Marta begleitete mich, da sie ohnehin zurück nach Hause wollte. Sie ritt auf einem Maultier. Mir hatte Yussaf neue Sandalen und ein wenig Geld geschenkt, um mir die Rückkehr zu erleichtern. Einer weisen Regel folgend, die besagt, dass man nicht übers Wasser gehen muss, wenn es eine Brücke gibt, hatte ich es gerne angenommen.
»Was willst du jetzt machen? Gehst du zurück in dein Dorf?«, fragte mich Marta, als ich sie an der Haustüre absetzte.
»Zuerst möchte ich meinen Cousin Yo Hanan aufsuchen. Yussaf hat mir gesagt, dass er wie ein Verrückter in der Wüste den Allmächtigen predigt. Er soll viele Schüler haben. Und da ich Verrückte nun einmal mag …«
»Zurzeit soll er sich oft in der Gegend um Sokuk3 aufhalten … aber auch an der Flussmündung zum Salzmeer.«
Nach diesen wenigen Worten ließ ich Marta zurück. Sie hatte ohnehin ihren Platz auf meinem Lebensweg, dessen war ich gewiss. Wir würden uns wiedersehen. Es war von jeher so bestimmt.
Ja, natürlich würde ich ins Dorf zurückkehren. Ich wollte meiner Mutter und Judas wieder in die Augen blicken, aber auch der ›kleinen‹ Sarah … und all den anderen. Und doch war mein Leben längst von einem Willen geleitet, der weit darüber hinausging. Er brachte mich dazu, bestimmte Dinge zuerst zu erledigen, weil sie dringlicher waren …
Yo Hanan … Eine innere Stimme drängte mich, ihn unverzüglich aufzusuchen.
Daher löschte ich nur rasch am alten Brunnen von Bethanien meinen Durst und machte mich entschlossenen Schrittes auf den Weg. Durch Wüstenhügel wollte ich ans Ufer des Salzmeers gelangen.
Es war eben wieder eine einsame Reise durch Schotter und Sand. Auch eine weitere Nacht verbrachte ich so, eingehüllt in meinen groben Wollmantel, so lange ich nur konnte versunken in die Betrachtung der Millionen von Diamanten am Himmelszelt.
Am nächsten Tag erreichte ich staubbedeckt einen Felsvorsprung, von wo aus man einen Großteil der glitzernden Meeresfläche überblicken konnte.
Ganz in der Nähe hatte ein Beduine mit Familie sein Zelt aufgeschlagen. Ich ging hin. In der Wüste begrüßt man jede Seele, der man begegnet – und sei es nur ein kleiner Fuchs oder Falke. Mit einem Stock in der Hand kam der Beduine etwas misstrauisch ein paar Schritte auf mich zu.
»Der Ewige sei mit dir … Willst du Wasser?«
»Man ist stets auf der Suche nach Wasser in dieser Welt … Ich aber möchte vor allem den kürzesten Weg nach Sokuk wissen …«
Der Mann zögerte einen Moment.
»Sokuk? Es heißt, sie lassen zurzeit niemanden herein … Das liegt bestimmt an dem Mann, der so viele Menschen anzieht. Sie wollen nichts von ihm hören, denn sie trauen der Sache nicht … Geh’ also lieber anderswohin – außer du willst zu ihm …«
Mehr musste er nicht sagen. Ich dankte ihm und schlug den Weg ein, den er mir wies. Wasser hatte ich noch …
Unter sengender Sonne gelangte ich alsbald an den Strand des Salzmeers. Ich ließ meine Füße durch das zähe Wasser gleiten und genoss einfach dieses Spiel … Dann ging ich weiter Richtung Süden, bis ich auf ein Bauwerk stieß, das etwas zurückgesetzt lag … Erdfarbene Mauern, armselige Bäume … Sokuk!
Sogleich stieg die Erinnerung an Yosh Heram in mir auf.4
Schließlich war ich mit ihm zum ersten Mal hier im Kloster gewesen. Eine berührende Erinnerung, aber auch etwas schmerzhaft. Wobei, … genau betrachtet war sie das nicht mehr. Im Grunde begriff ich in diesem Moment, dass eine alte, spontane Regung versuchte in mich einzudringen, wie ein sinnentleertes Wort. Sie stammte aus der Zeit vor meiner Metamorphose – eine letzte Schaumflocke der Vergangenheit.
Genau genommen rang mir der Anblick des ockerfarbenen Gemäuers von Sokuk eher ein Lächeln ab.
Ob Yo Hanan hier irgendwo war? Nein – das sagte mir ein tiefes Gefühl, ungeachtet der Auskunft Martas und des Beduinen. Dennoch musste ich hin, einfach weil es stimmig war …
1Vgl. 1. Band, Kap. 1: Joseph von Arimathia
2Auf Aramäisch bedeutet das Wort ›Marta‹ ›Dame des Hauses‹.
3Sokuk: Das heutige Kloster Qumran. (Vgl. Band 1, Kap. 12.)
4Vgl. Band 1, Kap. 12.
2. Kapitel
Hinter den Mauern von Sokuk
Ein leichter, warmer Wind strich mir durchs Haar, als ich unten am letzten Abhang vor dem Kloster ankam. Es war schön, die Kiesel unter meinen Schritten knirschen zu hören. Daraus sprach die Liebe, welche ich für dieses Land empfand. Judäa mit seiner Wüste, das reglose Meer … So rau die Gegend auch war – sie rief doch eine Kraft in mir hervor, die zwar noch recht verhalten war, doch von Minute zu Minute anschwoll.
Im Weitergehen drangen allmählich Stimmen an mein Ohr. Ein heftiges Gespräch war im Gange … Nach ein paar Schritten sah ich am Wegesrand menschliche Gestalten hocken. Es waren drei junge Männer in braunen Gewändern, die Köpfe locker mit Tüchern bedeckt. Als sie mich kommen sahen, standen sie auf – gleichzeitig und leicht verstört, als hätten sie etwas falsch gemacht …
»Der Friede sei mit euch«, sagte ich sanft und legte die Hand aufs Herz, wie es sich gehörte. Im Grunde amüsierte es mich fast, sie überrascht zu haben, wie Jugendliche, die etwas aushecken …
»Der Friede sei auch mit dir, Rabbi …«
Der wohl Älteste der drei hatte das Wort ergriffen. Als er sich erhob, hatte er seinen Schleier auf die Schultern gleiten lassen, sodass ich seine Gesichtszüge genau erkennen konnte, zumal er fast bartlos war. Sie waren erstaunlich regelmäßig, von halblangem, sehr gepflegtem Haar gerahmt.
»Ich bin kein Rabbi …«, gab ich zurück, wobei diese Bemerkung mich noch mehr amüsierte.
»Man könnte es jedenfalls denken … Wer, außer einem Rabbi – oder einem von ihnen – würde hier sonst so selbstsicher eindringen?« Ich lächelte. Dann sah ich mir sein Gesicht noch etwas genauer an. Er hatte eine Arglosigkeit an sich, die mir vertraut war. Ja, ich war sogar sicher, sie zu kennen.
»Kommt ihr denn nicht gerade aus diesem Gemäuer?«
Darauf antwortete der Kleinste der drei jungen Männer sogleich. Sein heftiger Tonfall zeugte von unterdrückter Wut und unendlichem Leid.
»Wenn du kein Rabbi bist und zu ihnen gehörst, hilft es auch nichts, mit dir zu reden …«
»Ich ›gehöre‹ zu nichts und niemandem, wenn du das wissen willst. Nur zu mir selbst … Geht es dir nicht genau so?«
Meine Antwort verwirrte ihn offensichtlich. Er kratzte sich am Hals, als wolle er ein Insekt vertreiben, das gar nicht da war.
»Du heißt Samuel, nicht wahr?«, fuhr ich fort, ohne groß nachzudenken. »Mir scheint, dass du verbunden bist … Ja …«
Da ergriff wieder der Erste das Wort und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Nun … dort unten, nicht weit von hier, gibt es einen Mann. Er predigt und taucht uns ins Wasser des Flusses. Er sagt, dass wir alle mit dem Ewigen verbunden sind. Ja, insofern sind wir wirklich verbunden … und ich bin es auch.«
»Wie kann man mit Dem verbunden sein, was in uns Ist? Kannst du mit dir selbst verbunden sein? Ist das nicht komisch? Eine Verbindung besteht doch an sich zwischen Dingen, die getrennt sind …«
Mit diesen Worten stiftete ich Verwirrung in den Seelen der drei Männer, das wusste ich. Wahrscheinlich waren sie sogar schockiert … Aber es musste sein. Jenseits der Worte, die mir einfielen, sagte mir das Licht, mit dem ich eins war, dass ›morgen‹ schon angebrochen war. Es begann, sich einzuschreiben, ja sich geradezu einzugravieren.
Nun ergriff wieder der Junge das Wort, den ich Samuel genannt hatte. Seine Stimme klang unsicher. Da ihm das Gespräch zu entgleiten drohte, wollte er ihm wohl eine andere Richtung geben.
»Wir waren gerade dort, um den Mönchen von dem Mann zu erzählen, der nun schon über ein Jahr in der Wüste und am Ufer unser Lehrer ist. Wir taten das ganz von uns aus … Wir finden es unerträglich, dass sie ihn verachten, denn das Wort des Ewigen ist in ihm. Aber sie haben uns weggejagt …«
Ich hatte den Zusammenhang bereits erraten. Yo Hanans Feuereifer hatte sich gewiss nicht gelegt. Nur zu gut erinnerte ich mich daran. Insofern war es kaum verwunderlich, dass er den Zorn der Bewohner Sokuks auf sich gezogen hatte. Ich nickte, um volles Verständnis zu zeigen. Noch immer zog vor allem der Älteste meine Blicke auf sich. Er hatte die Arme weiterhin auf der Brust verschränkt. Plötzlich öffnete sich eine Art Brunnen in meiner Erinnerung … Ja, ich kannte diesen Mann. Er war noch sehr jung. Sein Gesicht hatte sich mir in wiederkehrenden Träumen und Visionen eingeprägt. Doch sein Name fiel mir nicht ein, obgleich ich danach suchte – vermutlich gerade deswegen.
»Gut«, sagte ich, »dann kehrt zurück zu eurem Lehrer … Ich aber werde bis ans Ende dieses Weges gehen und wahrscheinlich sogar ein paar Tage hierbleiben. Einen Suchenden werden sie wohl kaum abweisen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen …«
»Sie werden dich nicht hereinlassen. Sie glauben, schon alles gefunden zu haben!«, murmelte Samuel schulterzuckend.
Ohne etwas zu erwidern, verabschiedete ich mich von den dreien und schlug unverzüglich den Pfad zur kleinen Klostersiedlung ein.
Es schien sich nichts verändert zu haben, seit ich zuletzt mit Yosh Heram hier gewesen war. Erde, Steine, Mauerwerk … und Staub, der die kümmerliche Vegetation erdrückte, welche sich hier zu wachsen mühte … Nein, nichts hatte sich verändert. Nur wurde die marode Einfassung auch noch von einem Holzportal bewehrt.
Ohne zu zögern drückte ich es auf und ließ meine Blicke über die erstarrte Szenerie schweifen. Der Eindruck war noch derselbe: ein vor bernsteinfarbene Berge hingestreutes Dorf. Allein das Blöken von Schafen irgendwo in der Ferne wies auf Leben hin.
Was suchte ich hier nur?
Was noch von Jeshua in mir übrig war, sagte sich, dass er hier Halt machen musste, um die alten Texte aus seiner Jugend noch einmal anzusehen …
Vielleicht nicht die aus dem Karmel – sie waren einzigartig. Dafür solche, die mit dem Glauben der Menschen zu tun hatten, bei denen er in diesem Leben das Licht der Welt erblickt hatte.
Ich hatte diese Schriften nun schon seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr in Händen gehabt. Und mehr als zehn Jahre lang hatte ich sie nicht einmal mehr rezitiert, weil ich mich in die Texte anderer Völker vertiefte. Hatte der kleine Rest, der von Jeshua noch in mir übrig war, sie womöglich vergessen?
Ganz gleich … jedenfalls musste ich sie wiedersehen, wenn ich sie zum Leben erwecken wollte. Um sie von dem Sand zu befreien, der sie zweifellos bedeckte, verlangten meine Augen, ein letztes Mal über sie hinwegzugleiten. Dann würde ich sie für alle nachzeichnen, die bereit waren, mir ihr Herz zu öffnen.
»Was willst du, Bruder?«
Es berührte mich, dass ich als Bruder bezeichnet wurde. Von allem, was ich erwarten konnte, traf es das am ehesten.
»Ein paar Tage mit euch beten.«
»Woher kommst du?«
»Von sehr weit her …«
»Tritt ein …«
Nach wenigen Schritten befand ich mich wieder in dem großen Raum, an den ich mich noch gut erinnerte. Genau wie früher waren ein paar Greise in die Lektüre oder Abschrift alter Texte vertieft, während sich überall vergilbte Schriftrollen und Palmblätter stapelten. Kaum jemand hob den Kopf, als ich vorbeiging. Sie interessierten sich ausschließlich für ihre Studien. Das überraschte mich nicht. Auch ich wollte mich ja nur in die Schriften meiner Jugend versenken und beten. Bevor ich tief Luft holte für den nächsten, großen Schritt, zu dem ich mich berufen fühlte, musste ich noch einmal seelisch Bilanz ziehen.
»Deinem Gewand und Haar nach zu schließen … bist du einer von uns. Allerdings bist du hier nie gesehen worden.«
»Nun, es ist eben sehr lange her …«
Der Mönch, der mir die Tür geöffnet hatte, führte mich von Zimmer zu Zimmer. Er hinkte und tastete sich an den Unebenheiten der Mauern entlang wie ein Sehbehinderter. Schließlich gelangten wir in einen winzigen Innenhof, dessen Boden mit Matten bedeckt war.
»Unsere Zellen sind alle belegt … aber du kannst hier schlafen. Mehr können wir dir nicht bieten. Du kommst also von weither?
»Vom anderen Ende der Welt – oder doch fast …«
»Warum hast du diese Reise überhaupt unternommen?«
»Natürlich, um dem Ewigen näherzukommen …«
»Bist du verrückt, Bruder? Schau … Er ist hier … Sein Wort steht überall geschrieben … Die Mauern sind damit durchtränkt.«
»Du hast ganz recht, Sein Wort steht überall geschrieben … Darum wollte ich überall hin.«
»Oh …«, seufzte der Mönch und hob die Augenbrauen. »Ich sehe schon … ein wenig die Neugier befriedigen … und den Stolz, alles sehen und verstehen zu wollen. Nun, du hast gut daran getan, herzukommen! Zwischen diesen Mauern ist alles, was ein Mensch sich erhoffen kann zu lernen.«
Im ersten Moment wollte ich etwas erwidern, besann mich dann aber eines Besseren. Es würde nichts bringen. Ich war nur hier, um zu beten und zu lesen. Dies war die letzte Station, bevor Awouns Geisteshauch mich endgültig erfasste.
»Gut, mein Bruder«, sagte ich. »Mir ist bereits damit gedient, meine Tasche und den Mantel in dieser Ecke abzulegen. Noch glücklicher würde es mich machen, auch ein paar Texte entrollen zu dürfen.« Die Antwort war ein herablassendes Lächeln. Aber das war nicht schlimm …
So ließ ich mich also für ein paar Tage in Sokuk nieder. Wie viele – darauf wollte ich mich nicht festlegen. Ich spürte, dass ich die Anlage zu gegebener Zeit verlassen würde.
Zwei Mal am Tag würde ich Suppe und etwas sonnengebackenes Brot bekommen. Diese Mahlzeit sollte ich in aller Ruhe alleine einnehmen, wie die anderen Mönche auch. Das war mir sehr angenehm.
Am Abend desselben Tages stieg ein Gebet in mir auf, ein ganz einfaches, spontanes Herzensgebet …
»Ewiger Herr, mein Vater. Ich spreche von Dir, als seist Du außerhalb von mir – und doch bist Du der einzige Bewohner meiner Seele. All meine Bewegungen gehen allein auf Dich zurück und meine Tage sind völlig von Dir erfüllt … Bewahre die Kraft in mir, eins zu sein mit Dir – und auch in der Vielfalt nur Dich zu sehen. Sei meine Erde, mein Mond, meine Sonne … Sei mein Alles.«
Schlaf fand ich kaum, das weiß ich noch. Zu sehr spürte ich, dass der Vater, den ich wie ein Verrückter zu mir rief, mich bereits mit seiner Gegenwart erfüllte – und auf Seine absolute Stunde in mir wartete.
Während ich in jener Nacht unter dem Sternenlauf lag, hatte ich mehrmals das Gefühl, gleichsam von Ihm zu explodieren.
Ich achtete auf alles – war ganz offen für Seine höchste Manifestation bis in die Tiefen meines Leibes hinein.
Sobald das erste rosige Morgenrot dämmerte, begann ich mit der Lektüre der Texte, von denen meine Kindheit erfüllt gewesen war. Es waren die grundlegenden Schriften des Volkes Mose – die Miqra, mit ihren Gesetzen, Vorschriften, Wahrheiten und Verboten. Sie klangen wie ein Peitschenknall.
Von Zeit zu Zeit verschaffte mir das Geräusch nackter Füße, die über den Boden huschten, ein Räuspern oder Geraschel von Gewändern etwas Zerstreuung.
Dann blickte ich auf – und begegnete einem oder zwei Blicken, die meist sofort auswichen.
Die Mönche erwachten. Solange es noch halbwegs kühl war, gingen sie den ersten Beschäftigungen des Tages nach. Für sie war ich ebenso wenig vorhanden wie am Vorabend, lediglich ein Durchreisender, ein etwas merkwürdiger Bruder.
Auf einmal unterbrach ich meine Lektüre und legte die Palmrolle, die ich in der Hand hielt, beiseite … Was war los? Mir wurde plötzlich klar, dass ich die Zeilen, die ich gerade las, noch alle auswendig konnte – und zwar genauso klar und präzise wie früher. Ich hatte überhaupt nichts vergessen.
Auch mit geschlossenen Augen, zogen die Sätze, Wörter und Zeichen ganz von selbst an mir vorbei. Ich verstand sogar ihre zwei oder drei verschiedenen Bedeutungsebenen.
Was machte ich also überhaupt hier? Wenn alles noch völlig intakt war und im Vergleich zu meiner Jugend sogar eher an Bedeutungstiefe gewonnen hatte – was musste ich dann daraus schließen? Schob ich den Moment, in dem ich mich ›erheben‹ musste, nicht unbewusst hinaus?
Das fragte ich mich, denn es sollte nicht der kleinste, unerleuchtete Teil noch an meinem Inneren nagen. Hatte ich etwa Angst, ohne es mir einzugestehen?
Würde ich den Menschen enthüllen können, dass ich ein Av-Shtara war? Konnte ich das tragen? Mit all den Erschütterungen, die es mit sich bringt – für mich und die anderen? …
All die unabsehbaren Folgen der Revolution gegen diesen Schlafzustand, den ich in Flammen aufgehen lassen wollte?
Ich glaube, an jenem Morgen stand mir meine Mission zum ersten Mal restlos vor Augen – in ihrem ganzen Glanz, mit allem Wunderbaren, aber auch Schrecklichen.
Angst? Ich unterzog mich einer schonungslosen inneren Prüfung. Nein, ganz bestimmt nicht. Angst hatte ich überhaupt keine. Es ging eher um meine hohen Ansprüche. Schon die Vorstellung, auch nur den kleinsten Fehler zu machen oder das geringste Zögern an den Tag zu legen … kam für mich überhaupt nicht infrage. Darin lag die Herausforderung. Denn trotz des Geisteshauchs, der sich nun voll und ganz in meiner Seele zu entfalten begann, wollte ich mir auch die Zartheit und Schönheit des Menschlichen erhalten.
Es galt, Kraft und Zärtlichkeit zu verbinden – Feuer und Wasser. Ich wollte die Verletzung und der Heilbalsam zugleich sein … die Explosion und der Friede!
Von da an las ich nicht mehr … Ich schob meine Palmrolle weit weg und prüfte dafür mein Inneres. In tiefste Tiefen drang ich ein, schwang mich aber auch zu den höchsten Höhen empor. Ja, Awouns Geisteshauch war da – wie ein Pferd, das mit den Hufen scharrt, bereit loszurennen … aber auch wie jenes Pferd, das den Schatz5 trägt und von jeher die Mission hatte, Zeiten zu überspringen.
Ich wusch mein Gesicht und meine Haare mit etwas Wasser. Unterwegs grüßte ich drei oder vier Mönche, die sich am Brunnen leise miteinander unterhielten. Sie kamen mir so traurig vor … Das erinnerte mich an die Bemerkung des Karawanenmannes6, die ich siebzehn Jahre zuvor unweit von hier zu hören bekommen hatte – nämlich in Jericho: »Ist man immer so … traurig, wenn man ein solches Gelübde ablegt?«
Diesem Karawanenmann war vermutlich gar nicht bewusst, wie recht er hatte. Er wollte wohl nur eine kleine Spitze setzen. Ich lächelte, wohingegen die Männer mich mit verspanntem Kinn ansahen. Dann ging ich ein Stück weiter. Im Schatten neben einem kleinen Verschlag stand ein Esel. Dort wollte ich meditieren und die Bilder betrachten, welche die Sonne in mir aufsteigen ließ.
Und es kamen Bilder! Unzählige Bilder … doch nicht aus der Vergangenheit oder einer anderen Welt jenseits des Lichts. Sie stiegen aus einer Region auf, in der es darum ging, was ich selbst einzubringen hatte – eine Art Gerüst dessen, was ich mir im Herzen vorgenommen hatte und nun in die Welt bringen musste. Aber ein Raster ist eben noch nicht alles. Gerade in diesen Stunden, da ich die gespannten Fäden spürte, begriff ich auch, dass ich die Zwischenräume noch ausfüllen und gleichsam alles neu erfinden musste.
So sah ich mich mit Männern und Frauen auf Wegen wandeln und über Hügel ziehen, wo Mandel- und Olivenbäume wuchsen, sah mich in der Schotterwüste mit Menschen sprechen … oder am Ufer eines Sees liebevoll zur Menge sprechen. Es war wohl der See Kinnereth. Ich erkannte sein klares Wasser und das Ufer.
Von unbezähmbarem Feuer erfasst, sah ich mich auf einem kleinen Dorfplatz stehen, einer faszinierten Menge gegenüber. Dann sah ich, wie ich vor einer Synagoge ausgebuht wurde, erahnte Gestalten von Priestern und Soldaten … Und dann – nichts mehr.
Nichts – nur noch die fast grausame Kraft des Wirbels, um dessentwillen ich gekommen war. Ihm hatte ich nichts entgegenzusetzen – und wollte doch Alles.
In diesem winzigen Unterschlupf, zwei Schritte entfernt von einem Esel, mit dem ich zuweilen sprach, machte ich also die entscheidende Erfahrung von Sokuk. Hier fühlte ich mich wohler als in den Gebäuden oder im Hof, den man mir angewiesen hatte. Gelegentlich kam der eine oder andere Mönch vorbei, um sicherzugehen, dass ich ›noch bei Sinnen‹ war. Ich versuchte dann immer mit ihm zu scherzen und erzählte vom Glück, dem Ewigen im Bewusstsein so nahe zu sein. Jedes Mal erntete ich ein schiefes Lächeln oder einen verstörten Blick.
»Bist du hier nicht glücklich, mein Bruder?«, fragte ich einen von ihnen am Morgen des zweiten Tages.
Er wirkte dermaßen überrascht!
»Glücklich? Ich bin doch nicht hier, um glücklich zu sein … Ich habe dieses Gewand angelegt, um meinen Körper und meine Seele zu reinigen. Um Frieden zu haben und den Höchsten um Vergebung zu bitten, bin ich hier.«
»Wie kannst du auf Frieden hoffen, wenn der Friede, den du erwartest, nichts mit Glück zu tun hat? Führt nicht dieselbe Pforte zu beidem?«
Meine Antwort brachte den Mönch völlig aus der Fassung, so einfach sie auch war.
Es hätte ihm wohl gefallen, wenn ich irgendeine Strophe aus unseren Schriften zitiert hätte, wie es an solchen Rückzugsorten üblich war.
»Was sagst du da?«, meinte er. »Kein Mensch kann in dieser Welt glücklich sein – und auch in keiner anderen – so lange er unrein ist.«
»Bist du also schmutzig?«
»Bist du es denn nicht?«
»Wieso sollte ich es sein, da der Ewige doch in mir wohnt? Und du … spürst du Ihn etwa nicht in deiner Brust?«
Der Mönch war höchst irritiert von meinen Worten, daran erinnere ich mich genau. Da ich auf dem Boden saß, hatte er sich kurz zu mir herabgebeugt. Nun schnellte er hoch. Aus seiner Sicht hatte ich schändliche Worte geäußert. Wer konnte sich anmaßen, die Gegenwart des Ewigen in sich zu empfangen, anstatt in jedem Lebensmoment sein Bewusstsein zu peitschen?
Er warf mir einen verachtungsvollen Blick zu und drehte sich wortlos auf dem Absatz um. Damit zeigte er mir bereits, wie breit die Brücke sein musste, die ich zwischen meinem Vater und den Menschen bauen musste, … zwischen dem Licht – und der Angst vor dem Licht.
Am Abend erschien eine Gruppe von Mönchen in dem kleinen Hof, wo ich die Nacht verbracht hatte. Der Grund war leicht zu erraten.
Meine Behauptung, dem Allerhöchsten nahezustehen, hatte sie schockiert – allein schon die Vorstellung, Er könne in jedem Menschen leben und Glück prinzipiell erreichbar sein!
Wortlos setzten sie sich mir gegenüber und stellten eine schwere, irdene Öllampe zwischen uns auf den Boden. Sie schimmerte karminrot.
»So, der Ewige ist also in dir …«, meinte der Mönch, der mich empfangen hatte, mit gedämpfter Stimme. Ein sorgfältig auf dem Kopf drapiertes Leinentuch verdeckte zur Hälfte sein Gesicht und verhinderte die Begegnung unserer Blicke.
»Wie auch in dir, mein Bruder … und in uns allen …«
Da schlug er einen härteren Tonfall an.
»Steht das irgendwo?«
»Noch nicht direkt … Vielleicht irgendwo zwischen den Zeilen … Doch schon bald wird es für alle hörbar sein, die es hören wollen.«
»Mit welcher Rede spielst du da? Die Schrift fixiert … das gesagte Wort verfliegt.«
»Die Schrift verrät auch … das empfangene Wort aber lehrt …«
Darauf folgte ein langes Schweigen.
»Warum bist du hergekommen?«, fragte der Mönch schließlich und hob den Kopf.
Sein Blick war nun sichtbar, wich mir aber aus. Es sprach zugleich Verzweiflung und Aufregung aus ihm.
»Das habe ich dir schon gesagt … Ich komme von weither und bin hier, um zu beten. Außerdem will ich zum ersten Mal seit langer Zeit spüren, wie die Herzen der Meinen schlagen.«
»Du gehörst nicht zu uns … Du bist ein Gotteslästerer …«
Eine polemische Debatte lag mir völlig fern. Das wäre eine Grenzüberschreitung gewesen. Aber man setzt sich nicht über Grenzen hinweg, wo keine sind – wo es in Wahrheit nur Leben gibt – und Lebende, die noch nicht verstehen.
Ich sah mir diese Männer an, einen nach dem anderen. Sie waren hinter unsichtbaren Gitterstäben gefangen – obgleich sie den Weg des Göttlichen gewählt hatten.
Ich lächelte sie an und sagte dann: »Macht euch keine Sorgen, meine Brüder. Morgen werde ich in aller Frühe diese Mauern verlassen. Dann habt ihr wieder euren Frieden.«
Darauf folgte Gemurmel. Offensichtlich waren alle heilfroh über diese Ankündigung.
Damit hätte die Begegnung zu Ende sein können, gleichsam mit Auslassungspunkten …
Doch während einige bereits aufstanden, erhob sich aus der hintersten Reihe der kleinen Versammlung eine Stimme. Sie klang jung und unsicher. Ich blickte in das Gesicht eines Jugendlichen mit Hakennase. Es wandte sich mir zu.
»Bruder … darf ich dich etwas fragen … Was ist in dem kleinen Täschchen, das an deinem Hals baumelt?«
Ersticktes Gelächter erklang, aber einer hakte nach: »Ja, genau … was ist eigentlich da drin? Vielleicht irgendein Götzenbild aus einem fernen Land? So etwas braucht hier kein Mensch!«
Da öffnete ich meine kleine Tasche und entnahm ihr, ohne zu zögern, den Kristall aus meiner Kindheit. Auch das erstaunliche Medaillon Salomons, das die Seele meines Vaters Yussaf mir gegeben hatte, nahm ich heraus.7 Wie zu erwarten war, zog Letzteres die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Es wurde herumgereicht, wanderte von einer Hand zur nächsten.
»Wo hast du das her?«
»Ich habe es geschenkt bekommen …«
»Das ist unmöglich … du lügst!«
»Ich habe euch ja gesagt, dass ich von weither komme …«
»Wir hatten genau dasselbe – und es ist verschwunden. Wie kommt es an deinen Hals?«
Plötzlich merkte ich, dass mir gerade eine Hand gereicht wurde … Ich hätte es für eine hinterhältige Falle halten können, doch nein – es war wirklich eine Hand. Es war eine ausdrückliche Einladung der göttlichen Weisheit, den letzten noch greifbaren Rest meines alten Lebens hinter mir zu lassen.
»Wie gesagt … ich habe dieses Medaillon geschenkt bekommen. Wenn euch aber eines fehlt, das sich einst in diesem Gemäuer befand, so nehmt es … Ich brauche es nicht, um zu leben … Und nehmt gerne auch diesen kleinen Kristall. Er ist bestimmt nicht sehr wertvoll, aber er ist schön – und Schönheit ist ein Wert an sich.«
Noch knapp zehn Mönche waren anwesend. Sie brachen in ein Gemurmel aus, das für diesen Ort gewiss ungewöhnlich war. Es war eine Mischung aus Wut und Zustimmung. Allmählich wurde mir klar, dass die meisten der Meinung waren, nun sei alles gut. Schließlich hatte ich das Medaillon ja ›zurückgegeben‹.
Kurz darauf war ich mit dem jungen Mönch mit der Hakennase allein.
»Bruder«, flüsterte er, um sicher zu sein, dass die anderen ihn nicht hörten. »Ich würde den Kristall gerne haben. Er ist schön …«
»Wie heißt du?«
»Jonas …«
»Gut, Jonas, der Stein gehört dir. Bewahre dieses Erbe gut auf – es ist kostbarer, als du denkst …«
Meine Hand legte sich wie von selbst auf Jonas Stirn. Er war unfähig, noch etwas zu sagen … Dann holte ich meine Tasche aus der Ecke des Hofes und verließ ihn durch die erstbeste Türe.
Draußen war Nacht, doch der Mond rund und bleich. Die Einfriedung des Klosters mit dem aberwitzigen Portal lag etwa fünfzig Schritte vor mir. Ich durchschritt es, ohne mich auch nur umzusehen. Alsbald befand ich mich auf einem Schotterweg, der sich zum Meeresufer schlängelte.
In Ufernähe stieß ich bald auf eine Gruppe großer Steine, an die ich mich lehnen konnte. Sie schienen mich fast zu erwarten … Hier beschloss ich, die Nacht zu verbringen. Die Luft war mild und schwer vom Salz, das einen inkarnieren lässt.
Seltsam … ohne Salomons Medaillon und meinen kleinen Kristall fühlte ich mich noch leichter – freier denn je.
Als mir die Augen zufielen, dachte ich mit einem Lächeln an die Geschichte dieses Medaillons und wie ich es bekommen hatte. Nun hatte ich die Antwort auf eine Frage, die ich mir Jahre zuvor, während meines langen Rückzugs ins Land des Schnees, gestellt hatte.8
Mein Vater Yussaf hatte es also nicht ›materialisiert‹, als er mich aus dem Unsichtbaren heraus segnete. Er hatte es vielmehr aus Sokuk zu mir ›übertragen‹. Warum? Eigentlich kamen nur zwei Gründe infrage: Entweder, um etwas von Salomon in mir zu verankern, zu einem Zeitpunkt, als ich es gerade brauchte … oder, um mich noch radikalerer Kargheit auszusetzen … obwohl ich bereits glaubte, nichts weiter zu besitzen als mein Gewand und meine Tasche.
Jedenfalls war ich in dieser Nacht glücklich, das leere Täschchen an meinem Hals zu spüren …
Awoun? Elohim? Würden sie nie aufhören, mich zu prüfen, mich noch entblößter und stärker haben zu wollen? Es war so schön, was ihr Komplize – das Leben – aus mir herausholte, bevor ich begann, im Boden Galiläas meine Spuren zu hinterlassen!
Als ich in aller Frühe erwachte, war meine Gesichtshaut ganz ausgetrocknet vom Salz … Obwohl ich mich zerschlagen fühlte, von klebriger Feuchte durchtränkt, stand ich gleich auf und betrachtete lange die weißsilberne Wasserfläche des Meeres. Es schien auf ewig erstarrt zu sein.
Natürlich habe ich gebetet – ganz frei betete ich zu meinem Vater in mir. Dann brach ich auf Richtung Norden. Ich wusste ja, dass mir nur ein kurzer Weg bevorstand.
Ein paar Meilen weiter, oberhalb der Stelle, wo der Yarad9 ins Salzmeer mündete, würde ich gewiss auf Yo Hanan treffen – und auf die Menschen, die nun seine Schüler hießen. Sie dürsteten nach Licht, genau wie er.
Ich weiß noch, wie ich mich freute, als ein grüner Fleck am Horizont erschien – eine kraftstrotzende Oase am Saum der weißglühenden Schotterwüste.
Ich verlangsamte meine Schritte, um den Augenblick zu genießen. Das vergisst man allzu oft, wenn das Leben um einen herum geradezu explodiert. Man will es dann verschlingen. Dabei möchte es in kleinen Schlucken genossen werden …
Allmählich nahm der grüne Fleck Gestalt an … wandelte sich zu Tamarisken und Dattelpalmen. Bald waren auch Wasserhyazinthen und Schilf zu sehen. Friedlich schlängelte sich der Jordan durch das Pflanzengewirr. Ein Beduinenzelt erschien, dann ein zweites und schließlich noch eines. Am Ufer waren Männer und Frauen auszumachen. Einige standen andächtig schweigend bis zu den Waden im Wasser. »Oh, Vater«, sagte ich spontan zu mir … »Ja, ich erkenne den Ort … Hier bin ich mit Dir verabredet …«
5Dies ist eine Anspielung auf das geheime Wissen der Kabbala. Zugleich ist das Pferd der buddhistischen Shambhalla-Tradition aufgerufen. Es trägt den Stein von Shintamani, eine Art heiligen Graal der Menschheit.
6Vgl. Band 1, Kap. 12.
7Vgl. Kap. 2 und 26 des 1. Bandes dieses Werks.
8Vgl. Band 1, Kap. 26: Der Segen.
9Der Yarad – auf Altaramäisch Yerd ausgesprochen – entspricht dem Jordan.
3. Kapitel
Das Jordan-Mysterium
He, wohin gehst du?« Die Stimme kam von hinten. Sie war schrill und fiel damit aus der vorherrschenden Harmonie heraus.
Ich drehte mich um … Hinter mir befand sich eine kleine Einheit römischer Soldaten, etwa fünfzehn Mann, mit Lanzen in den Händen. Sie waren eben aus dem spärlichen Schatten eines Tamariskenwäldchens hervorgetreten und litten offensichtlich unter der Hitze. Ich hatte sie gar nicht bemerkt, als ich mich dem Fluss näherte …
»Ich?«, frage ich einfach, so friedvoll wie möglich.
»Ja, du … Findest du nicht, dass hier schon genug los ist? Willst du etwa auch zu dem Verrückten?«
»Zu dem Verrückten?«
»Dort drüben … Mach dich nicht über uns lustig. Was solltest du sonst in diesem verlorenen Winkel zu suchen haben?«
Mit ausgestrecktem Arm zeigte der Soldat, der mich angesprochen hatte, zum anderen Flussufer. Es war wohl der Truppenführer. Dort lauschten drei oder vier Menschen jemandem, der sehr lange, aschebedeckte Haare hatte.
»Ich bin auf der Durchreise … Was ist schon dabei?«
»Halte dich hier nicht länger auf, das ist alles. Anordnung des Prokurators … Er wünscht es nicht und Herodes auch nicht!«
Etwas in mir drängte mich, dem Römer tief in die Augen zu schauen. Es war nicht als Herausforderung gemeint. Das hätte mir nicht die geringste Befriedigung verschafft. Eine solche Haltung war mir völlig fremd. Nein, ich wollte bloß seine Seele spüren und sehen, was in ihrem Inneren vorging. Es ging mir darum, hinter dem Panzer des Soldaten den Menschen wahrzunehmen.
Die Antwort kam rasch. Der Mann senkte den Blick, entwaffnet von der schlichten, doch gerade darum so allmächtigen Wahrheit, die mich durchströmte. Ohne ein weiteres Wort, gab er seiner Truppe mit niedergeschlagenen Augen das Zeichen, ihm zu folgen und sich zurückzuziehen.
Zum allerersten Mal kam ich persönlich mit den Römern in Konflikt. Im Grunde hatte ich keine besonderen Empfindungen dabei, im Gegensatz zu allem, was ich bisher gehört hatte. Es hieß, solche Situationen würden einen unweigerlich in Angst und Schrecken versetzen. Immerhin beherrschten die Römer das Land nun schon seit über achtzig Jahren.
»Eigentlich sind es doch stets nur Menschen, wie überall anders auch«, dachte ich bei mir, »mit ihren Stärken und Schwächen. Sie streben nach Macht und sind innerlich doch ein wenig verloren …«
Das war erledigt. Nun machte ich ein paar Schritte aufs Wasser zu. Es gab dort eine Furt aus Sand, durch die man leicht ans andere Ufer gelangen konnte. In der Nähe nahmen gerade etwa dreißig Männer und einige wenige Frauen gemeinsam eine kleine Mahlzeit ein. Ehrlich gesagt sahen sie recht armselig aus, als hätten sie Wochen in der Wüste zugebracht. Doch nicht zu ihnen wollte ich, zumindest noch nicht … sondern zu dem Mann am anderen Ufer des Jordan. Er stach heraus, wohl durch sein üppiges, aschebedecktes Haar und seinen kräftigen Bartwuchs. Außerdem verströmte er eine ungeheure Klarheit. Man musste schon seelenblind sein, um sie nicht wahrzunehmen. Es war natürlich Yo Hanan, das war mir sofort klar, als ich ankam. Mit den Füßen im Wasser stehend, betrachtete ich lange seine Gestalt. Er kam mir genauso zart und schmal vor wie früher. Genau wie vor ein paar Tagen bei Onkel Yussaf, hatte ich keine Gefühle im Sinne typisch menschlicher Emotionen.
Aber ich war berührt, in jeder Hinsicht, erfüllt von tiefster Dankbarkeit … und Respekt vor einer uralten Verbundenheit mit diesem Mutterboden und den Männern und Frauen, denen ich begegnen durfte. Intuitiv wusste ich, dass mein Cousin während meiner langen Abwesenheit den ganzen Landstrich geistig genährt hatte.
Endlich stieg ich bis zur Brust in den Fluss … und am anderen Ufer durchs Schilf wieder an Land. Dieser kurze Augenblick ist unvergesslich. Lässt man solche Momente später an sich vorüberziehen, weiß man, dass man seit Ewigkeiten beschlossen hat, sie zu erleben.
Dann setzte ich meinen gemächlichen Gang zu Yo Hanan mit seinem aschebedeckten Haar fort. Die Sonne stand genau im Zenit. Mein tropfnasses Gewand klebte an meinem Körper. Er war noch immer ins Gespräch vertieft, das er seit meiner Ankunft führte, kehrte mir also den Rücken. Als ich etwa zehn Schritte von ihm entfernt war, drehte er sich plötzlich um, als habe er hinter sich seinen Namen rufen hören. Unsere Augen begegneten sich sofort und unsere Blicke umarmten sich.
Es war ein unendlicher Augenblick, das weiß ich bis heute, einer jener seltenen, kostbaren Momente, in denen man denkt: »Jetzt … endlich!«
Doch wieder war kein menschliches Gefühl in mir. Auch keine Worte kamen spontan über meine Lippen … Ich spürte nur eine Träne meine Wange hinabrollen, wie eine einsame Perle … Sie schien direkt aus meinem Herzen zu kommen.
»Jeshua, bist du es etwa?«
Yo Hanan blieb wie angewurzelt stehen, unfähig, etwas zu sagen oder auf mich zuzugehen.
Auch ich hatte noch keine Worte, spürte nur eine Kraft in Brust und Beinen. Es war eine Kraft, die langsam geschmiedet worden war. Sie trug mich bis zu meinem Cousin. Mit diesem freudigen Geisteshauch schloss ich ihn in meine Arme. Er aber warf sich mir sogleich zu Füßen, brach geradezu zusammen und weinte mit seinem ganzen Körper.
Allmählich waren wir von Gemurmel umgeben, das bald zu lautem Stimmengewirr anschwoll. Fassungslos schauten sich die Anwesenden an, völlig verwirrt, dass sich ihr Leiter und Lehrer so einfach in Tränen aufgelöst hatte. Nichts half ihnen, das zu verstehen …
Natürlich wollte ich Yo Hanan sofort aufheben, doch er klammerte sich an meine Knöchel und blieb am Boden. Da kniete auch ich lachend nieder und blieb so, bis unsere Blicke sich wieder begegneten und seine Tränen versiegten. Mehr war nicht nötig …
Die Menschen, die sich scheu um uns versammelt hatten, brachen in schallendes Gelächter aus. Sie begriffen zwar noch immer nicht, was los war, doch was sie sahen, stimmte sie froh.
Endlich stand Yo Hanan auf. Nun fiel es ihm schwer, seine unbändige, fast schon animalische Freude zu bezähmen. Und doch war sie ganz leicht, denn sie kam von der anderen Seite der weit geöffneten Seelenpforten.
»Dein Bart ist ja ganz schön gewachsen, lieber Cousin. Und die Haare scheinst du dir auch nicht oft zu waschen! Komm’, lass uns hier entlanggehen …«
Ich musste Yo Hanan beim Arm nehmen, um ihn vom Fluss zu einem Felsenhügel zu führen, der mir schon bei meiner Ankunft aufgefallen war. Er war sprachlos … Einige seiner Schüler wollten uns folgen, doch ich bat sie, uns allein zu lassen. Der Hügel würde uns den nötigen Schutz bieten. Wir mussten uns sofort alles erzählen, uns gleichsam ›ausschütten‹, denn wir hatten das brennende Gefühl, dass die Zeit drängte und uns in einen unausweichlichen Raum führen würde.
»Jeshua …«
Mehr brachte Yo Hanan nicht heraus, als wir uns hinter die Felsen in eine Senke gesetzt hatten, wo viele Lorbeerbüsche wuchsen. Also sagte ich einfach: »Ja, Yo …«
Dann wartete ich, bis die Worte von selbst kamen, bis der tosende Wildbach zum bloßen Fluss wurde – und dann zum breiten Strom. Es musste alles in Ruhe fließen, musste in Langsamkeit gesagt werden.
Wie es in einer alten Weissagung heißt: »Wenn das Feuer des Löwen zu Wasser wird und dieses Wasser es recht zu empfangen weiß, so steigt der Geisteshauch herab. Dann kann die Erde schwanger werden …«
Nun rollte ich mein Leben auf – und jener Mensch, der es besser verstand als jeder andere, bis in seine geheimsten Winkel hinein, schenkte mir Gehör.
Ob wir Hunger hatten oder Durst, darauf kam es jetzt nicht an – und auch nicht, wie viel Zeit verstrich.
Als das Wesentliche gesagt war, rötete sich bereits der Himmel. Auch Yo Hanan hatte mir sein Herz geöffnet, ohne etwas zu verbergen, ganz seinem eigenen Rhythmus folgend.
Inhaltlich hatte er von seinen siebzehn Lebensjahren nicht viel zu erzählen. Mit Worten gab es wenig mitzuteilen. Er hatte ›seinen Wüstenwinkel‹ ja nie verlassen. So nannte er die Gegend um Jericho, sowie die Schotterebenen und Gebirgszüge am Roten Meer.
Hier hatte er seine Seele ›kalziniert‹, wie er immer wieder sagte. Hier hatte er ›gebrüllt‹, um die Herzen zu bewegen.
Nach langem Zögern nahm er schließlich meine Hand …
»Ich bin fertig, Jeshua … Meine Zeit ist vorbei. Heute ist der Meister zu mir gekommen. Ich habe ihn erkannt. Der Ewige ist in dir. Mich nimmt er wieder an sich. Ich wusste es gleich. Noch ein paar Wochen, vielleicht noch ein paar Monate, das war’s. Jetzt bricht deine Zeit an – und Awouns Zeit durch dich.«
Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Was Yo Hanan sagte, stimmte, das wusste ich. Allmählich umgab die Wahrheit der geistigen Gegenwart in meinem Herzen spürbar meine Menschenform. Noch der kleinste meiner Schritte würde alles aufrühren, sogar die Menschen, die ich liebte und die mich liebten.
»Ilya …«, sagte ich mit leiser Stimme. »Ilya, erinnerst du dich?«
Nicht einmal innerlich konnte ich die Frage formulieren … Ich blickte Yo Hanan tief in die Augen und schon stiegen Erinnerungsbilder auf, begleitet von Worten und Düften, eingetaucht in eine ganz bestimmte Atmosphäre …
Ich saß auf dem Boden einer Felsenhöhle. Es roch nach Öl, das in einer tönernen Lampe brannte. Auch das Meer war nicht weit. Yo Hanan saß mir gegenüber, hatte jedoch ein anderes Gesicht, das an zerfurchte Erde gemahnte. Er hatte dünnes, langes, weißes Haar und trug einen schweren Fellmantel. Damals war er mein Lehrer und hieß Ilya10
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: