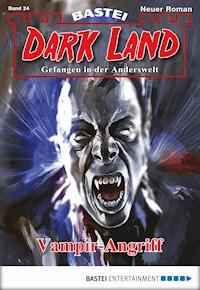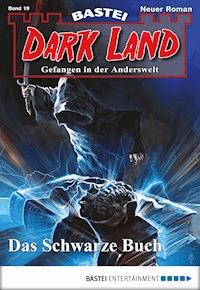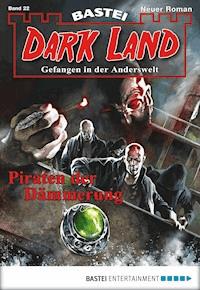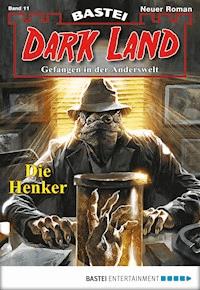1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
"Du willst schon gehen, Jimmy?"
Jim Conway lächelte den bärtigen Mann hinter dem Tresen an. "Nicht ich, Clint. Wir." Er deutete auf die blonde Frau neben sich.
Lara, die Angesprochene, lächelte ebenfalls und winkte dem Barkeeper etwas verlegen zu.
"Ich verstehe", erwiderte Clint und nickte.
Jim Conway griff nach seiner Brieftasche, doch der Barkeeper hob die Hand. "Vergiss es, das geht auf mich. Der alten Zeiten willen. Ich bin froh, dass du den Tod deines Vaters langsam überwunden hast. Vielleicht kannst du deinen Dreißigsten ja endlich nachfeiern. Mach dir noch eine schöne Nacht."
"Danke", sagte Jim nur und nickte Clint zu.
Der grauhaarige Barkeeper war der beste Freund seines Vaters gewesen, der nach einem schweren Autounfall vor zwei Wochen nur noch einmal kurz aufgewacht war, bevor er für immer die Augen geschlossen hatte. Das Gespräch, das Jim damals mit ihm geführt hatte, ging ihm bis heute nicht aus dem Kopf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Am Tor zur Hölle
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: shutterstock/Netfalls – Remy Musser
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-3813-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Am Tor zur Hölle
von Rafael Marques
»Du willst schon gehen, Jimmy?«
Jim Conway lächelte den bärtigen Mann hinter dem Tresen an. »Nicht ich, Clint. Wir.« Er deutete auf die blonde Frau neben sich.
Lara, die Angesprochene, lächelte ebenfalls und winkte dem Barkeeper etwas verlegen zu.
»Ich verstehe«, erwiderte Clint und nickte.
Jim Conway griff nach seiner Brieftasche, doch der Barkeeper hob die Hand. »Vergiss es, das geht auf mich. Der alten Zeiten willen. Ich bin froh, dass du den Tod deines Vaters langsam überwunden hast. Vielleicht kannst du deinen Dreißigsten ja endlich nachfeiern. Mach dir noch eine schöne Nacht.«
»Danke«, sagte Jim nur und nickte Clint zu.
Der grauhaarige Barkeeper war der beste Freund seines Vaters gewesen, der nach einem schweren Autounfall vor zwei Wochen nur noch einmal kurz aufgewacht war, bevor er für immer die Augen geschlossen hatte. Das Gespräch, das Jim damals mit ihm geführt hatte, ging ihm bis heute nicht aus dem Kopf …
Jim verdrängte die Gedanken an seinen Vater. Im Moment schien das alles so weit weg. Er hatte Lara erst in dieser Nacht kennengelernt. Sie waren sich sofort sympathisch gewesen. Wahrscheinlich auch, weil sie ebenfalls eine schwere Last mit sich herumtrug. Was diese Last war, hatte sie jedoch nicht verraten.
Jim winkte dem Barkeeper noch einmal zum Abschied zu, dann machte er sich auf den Weg in Richtung Ausgang. Lara griff nach seinem Arm und lehnte sich an ihn.
Als Jim die Tür aufstieß und die lauten Gespräche innerhalb der Bar zurückließ, blickte seine Freundin auf. »Zu mir oder zu dir?«, fragte sie.
»Kommt darauf an, wie du dir den Rest der Nacht vorstellst. Ich meine, wir müssen nicht …«
Lara lächelte. »Okay«, antwortete sie leise. »Lass uns einfach noch etwas fernsehen. Und reden. Und dann sehen wir, was noch passiert. Ich wohne nur zwei Straßen weiter. Und du?«
»In Notting Hill.«
»Dann zu mir«, erwiderte sie und küsste ihn.
Als sich Lara wieder von ihm löste, blickte er sich um. Das Alamo lag in einer etwas düsteren Seitenstraße. Über hundert Jahre alte, mindestens fünf Stockwerke hohe Steinhäuser rahmten die Gasse ein. An den Wänden hatten sich einige Graffiti-Künstler verewigt, und aus einem halben Dutzend Mülltonnen quollen dünne Dunstschwaden.
Da es doch recht kalt war, schloss Jim den Reißverschluss seiner Lederjacke. Lara hingegen schien die Kälte recht locker hinzunehmen. Vielleicht lag es auch daran, dass sie deutlich mehr getrunken hatte als er.
Außer ihnen war niemand in der Straße unterwegs. Dennoch hatte Jim plötzlich das Gefühl, aus der Dunkelheit heraus beobachtet zu werden.
Neben dem Eingangsschriftzug des Alamo spendeten nur zwei weit auseinanderstehende Straßenlaternen etwas Licht. So konnte es natürlich sein, dass sich in den dunklen Ecken jemand verbarg, der nicht gesehen werden wollte.
Aber wieso überkam ihn überhaupt dieses ungute Gefühl? Er hätte fast gelacht, als ihm der Ursprung dafür klar wurde. Er befand sich an seinem Unterschenkel!
Dort steckte in einem Lederhalfter ein Dolch, den ihm sein Vater vererbt hatte. Auf dem Krankenbett hatte Gabriel Conway ihm eingeschärft, den Dolch sein Leben lang immer bei sich zu tragen. Warum, hatte sein Vater ihm nicht verraten. Jim hatte die Stichwaffe hin und wieder in seiner Antiquitätensammlung gesehen, ihr aber nie viel Beachtung geschenkt.
Und jetzt das! Von seinem Unterschenkel aus rann ein deutliches Kribbeln über seine Haut. Fast, als würde der Dolch ihm ein Zeichen schicken. Aber das war unmöglich!
»Was ist los?«, fragte Lara. Sie schien seine innere Unruhe bemerkt zu haben.
Jim schüttelte leicht den Kopf. »Ich weiß es nicht. Ich habe nur das Gefühl, beobachtet zu werden.«
Seine Begleiterin zuckte zusammen. »Denkst du an einen Überfall?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich …«
Jim Conway stockte. Etwa fünfzig Meter vor ihm schälte sich eine hochgewachsene Gestalt aus der Dunkelheit. Schon auf den ersten Blick sah er, dass es sich um einen Mann handelte, trotz der langen, weißen Haare. Von seinem Gesicht war nicht viel zu erkennen. Dafür sah Jim, dass er einen Anzug trug.
Der Mann sagte nichts. Er starrte Lara und ihn nur an und schien auf eine Reaktion zu warten. Jim wusste nicht, was er tun sollte. Und auch seine Begleiterin blieb wie angewurzelt stehen.
Etwas irritierte Jim. Es war ein Geräusch, das er zunächst nicht einordnen konnte. Als würde jemand mit einem Handtuch in die Luft schlagen.
Doch das Geräusch hatte einen völlig anderen Ursprung. Etwas bewegte sich über dem Mann durch die Luft. Zunächst dachte Jim an einen Vogel, doch die Kreatur, die sich mit zackigen Flügelschlägen dem Fremden näherte und sich schließlich auf seine rechte Schulter setzte, war alles, nur kein Tier. Man konnte das Wesen schon eher als Ausgeburt der Hölle bezeichnen. Als ein Monstrum, das es gar nicht geben durfte.
Doch es war vorhanden. Das Wesen maß nicht ganz einen Meter. Die beiden Lederschwingen ließen es jedoch um einiges größer erscheinen. Die Arme liefen in kurzen, aber dafür spitzen Krallen aus. Der Körper selbst war recht dünn, wobei der Kopf mit den beiden Hörnern schon übergroß wirkte.
Die Kreatur sank auf die Schulter des Mannes nieder. Nun zeigte auch der Fremde mit den weißen Haaren eine Reaktion. Er griff in sein Jackett und zog etwas hervor. Eine großkalibrige Pistole!
Jim begann zu zittern.
»Oh Gott«, flüsterte Lara und drückte sich noch enger an ihn.
Jim legte ihr einen Arm auf die Schulter, helfen konnte er ihr jedoch nicht. Er wusste einfach nicht, was er tun sollte. Fliehen? Aber wohin? Einem gezielten Schuss konnte er nicht entkommen, so schnell er auch rannte.
»Gib ihn mir!«, schallte es ihm plötzlich entgegen. Die Stimme des Mannes klang rau, gleichzeitig aber auch recht jung. Der Lauf seiner Waffe zielte direkt auf Jim Conway.
»Was?«, fragte der Angesprochene verdutzt.
»Gib ihn mir«, wiederholte der Weißhaarige. »Oder deine Freundin wird sterben.«
Jim hatte keine Ahnung, was der Fremde von ihm wollte. Geld war es jedenfalls nicht, auch keine Wertsachen. Ansonsten trug er nichts bei sich, außer – den Dolch! War es das? War der Fremde hinter der Klinge her, die ihm sein Vater vererbt hatte?
Plötzlich geriet Lara in Panik. Sie stieß einen spitzen Schrei aus, riss sich von Jim los und rannte davon. In diesem Moment peitschte ein einziger Schuss auf!
Lara schrie auf, als die Kugel in ihren Rücken fuhr. Jim sah noch, wie das Blut seiner Freundin hervorspritzte, dann brach sie zusammen. Reglos blieb sie auf den Pflastersteinen liegen.
»Du bist der Nächste«, erklärte der Fremde. »Gib ihn mir!«
Jims Hände krampften sich zusammen. Tränen flossen über seine Wangen. Er wollte nicht sagen, dass er Lara geliebt hatte, dafür hatten sie sich nicht lange genug gekannt. Aber er hatte viel für sie empfunden, und sie jetzt blutend vor sich liegend zu sehen, versetzte ihm einen heißen Stich ins Herz.
»Was wollen Sie, verdammt?«, schrie er, als er wieder herumfuhr.
»Den Dolch!«, schallte es ihm entgegen.
Wieder zuckte Jim zusammen. Jetzt hatte er die Bestätigung dafür erhalten, was er schon länger geahnt hatte. Alles hing mit dem Erbstück seines Vaters zusammen. Es hatte ihn vor dem Erscheinen des Mannes und der geflügelten Kreatur gewarnt.
Plötzlich wusste Jim, was er zu tun hatte. Er ging in die Knie und zog sein rechtes Hosenbein hoch. Mit zitternden Fingern nahm er den Dolch aus dem Halfter und richtete sich wieder auf.
Der Griff der Klinge war mit merkwürdigen Figuren und Mustern verziert, die er nicht identifizieren konnte. Sein Vater hätte das vielleicht gekonnt, aber er hatte Jim nie etwas über den Dolch erzählt. Bis kurz vor seinem Tod.
Hart presste Jim seine Lippen zusammen und starrte den Weißhaarigen an. Der Fremde hätte längst schießen können, doch er zögerte noch.
Plötzlich ließ er seine Waffe sinken. »Du hast keine Ahnung, was du da in der Hand hältst«, erklärte er.
Der Kopf des Fremden ruckte leicht herum. Diese Bewegung war so etwas wie ein Startsignal für die geflügelte Kreatur. Lautlos breitete sie ihre Schwingen aus und stieß sich von der Schulter des Mannes ab.
Jim wusste, dass er das Ziel des Wesens war. Endlich meldete sich sein Überlebenswille zurück. Im Stand wirbelte er herum und rannte los.
Als er erneut Lara vor sich liegen sah, wäre er fast zu Boden gestürzt. So schnell wie nie zuvor in seinem Leben hetzte er über das Kopfsteinpflaster. Das laute Schwappen der Lederschwingen kam jedoch immer näher.
Wuchtig stieß etwas gegen seinen Rücken! Jim brüllte auf, verlor die Übersicht und stolperte über einen der Pflastersteine. Er versuchte noch, sich mit einer Hand abzustützen, den harten Aufprall konnte er jedoch nicht mehr abfedern.
Mit der Stirn knallte er gegen einen Stein. Sofort spürte er, wie seine Haut aufriss. Stöhnend versuchte er, wieder auf die Beine zu kommen. Doch die Kreatur über ihm ließ das nicht zu. Die Krallen des Wesens schlugen in seinen Rücken und rissen ihn herum.
Plötzlich blickte er dem Höllenwesen direkt in die rot glühenden Augen. Im Maul des kleinen Monsters schimmerten gelbe, spitze Zähne. Aus den Tiefen seiner Kehle drang Jim ein Zischen entgegen.
Intuitiv schlug er zu. Er hatte fast das Gefühl, als würde der Arm mit dem Dolch von einer fremden Macht gelenkt werden. Doch es war einfach die nackte Angst um sein Leben, die ihn zu dieser Reaktion trieb.
Der Dolch glühte hell auf, als er in die Nähe der Kreatur geriet. Die breite Klinge drang sogar in die Haut des Wesens ein und zog einen gut zehn Zentimeter langen Riss über seine Brust.
Die Kreatur stieß einen schrillen Schrei aus und bewegte sich mit schnellen Flügelschlägen von ihm weg. Diese Chance nutzte Jim sofort aus, um sich wieder aufzurichten.
»Jimmy!«, klang eine ihm nur allzu bekannte Stimme auf. »Mein Gott, was ist passiert? Einige Gäste haben einen Schuss und Schreie gehört und …«
»Hau ab, Clint!«, schrie Jim so laut er konnte. »Verschwinde!«
Clint Desmond blickte ihn für einige Sekunden verständnislos an. Dann entdeckte er die geflügelte Kreatur. Die Augen des Barkeepers weiteten sich, als er das Monstrum direkt auf sich zufliegen sah.
Jim wollte etwas tun, doch er blieb wie angewurzelt stehen. Auch, als sich die Kreatur auf seinen väterlichen Freund stürzte. Er sah noch, wie sich die Krallen des Wesens in Clints Hals wühlten, dann wandte er sich entsetzt ab.
Noch einmal fiel sein Blick auf den Weißhaarigen am anderen Ende der Straße. Seine Pistole hatte er wieder angehoben.
Noch ehe der Fremde abdrücken konnte, wirbelte Jim herum und rannte erneut los. Wieder hörte er einen Schuss, getroffen wurde er jedoch nicht.
Jim Conway lief einfach weiter, über die Straße, durch den ganzen Häuserblock, bis er nicht mehr konnte. An einer verwaisten Bushaltestelle brach er schließlich zusammen. Hechelnd ließ er sich auf eine eiserne Bank fallen und lehnte sich gegen die Glasscheibe.
Er wusste selbst nicht, wie lange er so dahockte. Erst ein lautes Hupen riss ihn aus seiner Lethargie. Von ihm unbemerkt war ein Bus an die Haltestelle gefahren.
Stöhnend richtete er sich auf. Instinktiv ließ er den Dolch in seiner Jacke verschwinden und schleppte sich in den Bus. Er kramte einige Münzen aus seiner Tasche, gab sie dem Fahrer und ließ sich auf einen der Sitze fallen. Dann schloss er die Augen und wollte nur noch schlafen.
***
Dünner Nieselregen empfing Suko und mich, als wir aus dem Rover stiegen. Von den Wolken war aufgrund der noch immer vorherrschenden Dunkelheit nicht viel zu sehen. Nur wenn ein Blitz über den Himmel zuckte, wurden sie für einige Sekunden aus der Finsternis gerissen.
Der Tatort, zu dem wir gerufen worden waren, lag in Westminster. Der Trafalgar Square befand sich nur einige Blocks weit entfernt.
Es hatte zwei schreckliche Morde gegeben, die möglicherweise in unser Metier fielen. So ganz sicher waren wir uns da jedoch nicht. Ein Detective Inspector, der wusste, in welche Richtung wir ermittelten, hatte sich bei Sir James gemeldet und uns bei einem Mordfall um Hilfe gebeten.
»Eigentlich hatte ich Shao ja versprochen, mal die ganze Nacht mit ihr zu verbringen«, murmelte Suko, während er seine Jacke zuzog. »Aber daraus wurde natürlich nichts.«
»Tja, weißt du, wobei mich der Anruf gestört hat?«, entgegnete ich.
»Bei was?«
»Beim Nichteinschlafen.«
Suko grinste schief. »Du Ärmster.«
»Die Leiden des jungen Sinclair«, zitierte ich den Titel eines recht bekannten Buches.
»Jung?«, stieß Suko hervor. »Na ja …«
»Was soll das denn bitte heißen?«, fragte ich mit gespielter Entrüstung.
Bevor Suko etwas entgegnen konnte, kam uns eine Uniformierte entgegengelaufen. »Hier ist Endstation, Leute«, rief sie uns zu. »Das ist ein Tatort.«
»Deshalb sind wir hier«, antwortete ich und zog meinen Ausweis hervor.
»Scotland Yard?«, fragte die junge Polizistin verwundert. »Ich wusste gar nicht, dass man Sie angefordert hatte. Chiefinspektor Bradley hat nichts davon erwähnt.«
»Ich war das, Sheryl«, rief ihr ein dunkelhaariger Mann in einer dunklen Lederjacke zu. »Bradley weiß nichts davon. Du weißt doch, wie er immer ist.«
Die Polizistin blickte kurz zu Boden, bevor sie die Schultern hob. »Das ist eure Sache.«
Der etwa fünfunddreißig Jahre alte Mann kam uns mit langsamen Schritten entgegen. Sein Gesicht kam mir bekannt vor, allerdings konnte ich es noch nicht so recht zuordnen.
»Detective Inspector Clyde Bennett«, begrüßte er uns. »Sie werden sich vielleicht nicht mehr an mich erinnern, aber ich war früher in Tanners Team, bevor ich zu einer anderen Mordkommission gewechselt bin.«
»Natürlich«, entfuhr es mir, als ich ihn erkannte. Lächelnd gab ich ihm die Hand. »Schön, Sie wiederzusehen.«
Bennett gab auch Suko die Hand. »Schon, auch wenn es immer traurige Umstände sind, wenn wir uns einmal begegnen. Es hat zwei Tote gegeben. Eine junge Frau wurde erschossen. Ein anderer Mann – tja, das sollten Sie sich wohl besser selbst ansehen.«
»Was wird Chiefinspektor Bradley dazu sagen?«, fragte Suko.
Bennett verzog das Gesicht. »Das ist mir ziemlich egal. Dieser Kerl verbaut mir seit Jahren meine Karriere. Außerdem fällt dieser Mord garantiert in Ihr Metier. Bei Bradley würde der Fall bestimmt in eine Sackgasse führen und in den Archiven vermodern. Sie werden ihn bald selbst erleben.«
Bennett blieb stehen und hob das Absperrband hoch, sodass wir ohne Probleme unter ihm durchgehen konnten. Die schmale Straße wurde von zahlreichen Scheinwerfern der Polizei erleuchtet. Einige Mitarbeiter der Spurensicherung machten Fotos und suchten gleichzeitig nach verwertbaren Beweismitteln.
Die beiden Toten waren noch nicht abtransportiert worden. Ihre Körper waren lediglich mit weißen Laken verdeckt. Über einer unscheinbaren Tür prangte ein Schild mit der Aufschrift Alamo. Zwei Uniformierte hielten vor ihr Wache.
Bevor ich auch nur einen Blick auf die Toten werfen konnte, kam ein gut sechzig Jahre alter Mann mit aschgrauen Haaren energisch auf uns zugelaufen.
»Was wollen Sie denn hier?«, blaffte er Suko und mich an.
»Sie kennen mich?«, fragte ich mit gespielter Überraschung.
»Natürlich weiß ich, wer Sie sind, Oberinspektor Sinclair«, erwiderte der Mann, bei dem es sich wohl um Chiefinspektor Bradley handelte.
Mein Kollege von der Mordkommission war sicher mindestens fünfzehn Jahre älter als ich. An seinem faltigen Gesicht waren vor allem die dicken Tränensäcke auffällig.
»Wer kennt Sie nicht?«, fügte Bradley sarkastisch hinzu. »Ich weiß nur nicht, was ein Geisterjäger an meinem Tatort zu suchen hat. Aber ich schätze, das kann mir DI Bennett wohl eher beantworten.«
»Ich habe sie hinzugezogen, weil …«, begann Bennett, wurde jedoch jäh von seinem Vorgesetzten unterbrochen.
»… weil Sie denken, dass hier irgendwelche Dämonen ihre Finger im Spiel haben. Ist es nicht so? Aber in meiner Abteilung arbeiten wir mit weltlichen Methoden. Ich lasse mir nicht von Scotland Yard in meine Ermittlungen hereinreden. Das ist mein Fall.«
»Sie können gerne die Lorbeeren ernten, wenn Ihnen das so wichtig ist«, entgegnete ich ihm äußerlich ungerührt. »Aber wenn wegen Ihres absurden Kompetenzgerangels weitere Menschen sterben, dann sind allein Sie dafür verantwortlich. Mein Partner und ich wollen nur helfen, mehr nicht. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann telefonieren Sie doch mal mit meinem Vorgesetzten, Superintendent Powell.«
»Das mache ich auch«, blaffte mich Bradley an und ging kopfschüttelnd an mir vorbei.
Ich war froh, mich nicht mehr vor diesem Kerl rechtfertigen zu müssen. Manche Menschen waren und blieben eben stur, da konnte man nichts machen.
»Ich habe Sie gewarnt«, meldete sich Clyde Bennett wieder zu Wort. »Aber jetzt sind wir ihn wenigstens fürs Erste los.«
Der DI umrundete eines der ausgebreiteten Laken, ging neben der Leiche in die Hocke und hob das Tuch leicht an. Sofort sah ich, wie die Frau mit den blonden Haaren gestorben war. Jemand hatte ihr mit einer großkalibrigen Waffe in den Rücken geschossen.
»Die Tote war aber nicht der Grund, warum ich Ihren Chef angerufen habe«, gab Bennett zu. »Sie sollten sich noch die zweite Leiche ansehen.«
Suko und ich schritten an der toten Frau vorbei und näherten uns dem Eingang des Alamo, bei dem es sich allem Anschein nach um eine Bar handelte. Etwa fünf Meter von der Tür entfernt lag der zweite Tote.
Bennett presste die Lippen zusammen, bevor er nach dem Laken griff. »Das ist Clint Desmond, der Barkeeper und Geschäftsführer des Alamo. Ich sage Ihnen gleich, das ist kein schöner Anblick. Selbst Tanner hätte bei so einem Toten gezuckt.«
Als der Detective Inspector das Tuch anhob, wusste ich sofort, dass er nicht übertrieben hatte. Der Tote war wirklich schlimm zugerichtet. Sein Hals und das Gesicht waren förmlich zerfetzt worden. Jemand oder etwas hatte da mit unbeschreiblichem Hass gewütet. Ob ein Mensch zu so etwas in der Lage gewesen wäre? Ich hatte da so meine Zweifel.
»Der Leichenbeschauer hat gemeint, die Wunden könnten dem Toten von einer größeren Raubkatze beigebracht worden sein«, berichtete uns Bennett. »Aber mal ehrlich, wer glaubt schon daran, dass mitten durch London unbemerkt ein Tiger oder etwas Ähnliches schleicht? Da steckt doch mit Sicherheit mehr dahinter. Zumal wir auch eine Zeugenaussage zu dem Täter haben.«
»Und die wäre?«, fragte Suko.
»Ein etwa ein Meter großes, geflügeltes Wesen mit Hörnern, rot leuchtenden Augen und Krallenhänden«, antwortete Bennett.
Suko und ich sagten zunächst nichts. Für einen Moment blickten wir uns fragend an, bevor ich erneut das Wort ergriff. »Glauben Sie an diese Zeugenaussage?«
Bennett grinste schmal. »Wenn nicht, wären Sie nicht hier. Ich weiß, das klingt ziemlich abgehoben. Aber was ich bei Tanners Fällen so alles erlebt habe – das passt doch genau in dieses Schema.«
Ich nickte. »Und gibt es auch eine Aussage dazu, was mit dem Wesen nach dem Angriff passiert ist?«
»Es ist davongeflogen. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Aber vielleicht sollten wir mal einen Abstecher ins Alamo machen. Meine Kollegen befragen dort gerade die Gäste.«
Ich ließ Bennett passieren und blickte erneut zu Suko herüber. »Was denkst du?«
»Die Verletzungen würden passen«, antwortete mein Partner. »Aber ich bezweifle, dass so ein Wesen auch mit einer Pistole umgehen kann. Wenn, dann steckt noch jemand anderes dahinter, auf dessen Befehl vielleicht auch dieser Dämon gehandelt hat.«
»Das war auch mein Gedanke«, bestätigte ich ihn und folgte Bennett. Bevor ich die Bar betrat, warf ich noch einmal einen Blick zu Chiefinspektor Bradley herüber. Mir entging nicht der wütende Blick, den mir der Leiter der Mordkommission zuwarf, während er sein Handy vom Ohr sinken ließ. Wahrscheinlich war ihm gerade der Befehl erteilt worden, uns unsere Arbeit machen zu lassen.