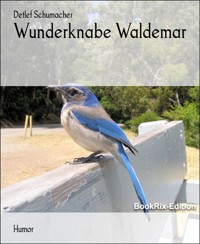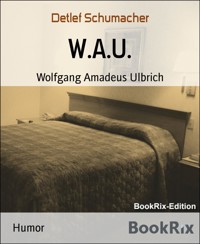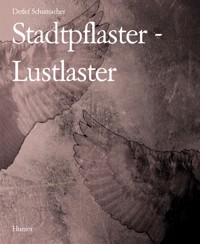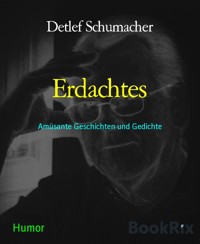0,00 €
Mehr erfahren.
Wenn Kriminalinspektor Rudolf Rasch seine Ermittlungen durchführt, dann gerät garantiert einiges daneben. So auch diesmal wieder. Allerdings trägt er die Schuld an Misserfolgen nicht allein, da er zwei Helfer an seiner Seite hat, die nicht weniger ungeschickt agieren.
Schwierig gestaltet sich das gemeinsame Vorgehen deshalb, weil die geglaubten Täter im mystischen Bereich vermutet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kopflos
Kriminalinspektor Rasch ermittelt wieder
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRasch braucht einen neuen Hund
Lustlos durchblätterte Kriminalinspektor Rudolf Rasch die Tageszeitung. Wichtig war ihm nur, was die Lokalseite hergab: Geburten, Todesfälle, eventuelle Vergehen, vor allem aber der Tiermarkt. Seit gut einem Jahr suchte er einen Ersatz für seinen dahingegangenen Hund Foxi.
Bislang war er nicht fündig geworden. Entweder waren ihm die Vierbeiner zu reinrassig, also zu pflegebedürftig und vornehm oder zu mickrig und faul. Alle Qualitäten, die einst Foxi besessen hatte, fanden sich bei keinem der gemusterten Artgenossen. Und einen Hund brauchte Rasch, weil er nun auf sich allein gestellt war. Sparmaßnahmen hatten das Morddezernat gelichtet, so dass er eigenständig einen Mord aufklären musste. Ein Doppelmord hätte ihn überfordert. Gott sei Dank war es bislang zu einem solchen noch nicht gekommen. Auch ein einfacher Mord war ausgeblieben. Die Bürger waren zu träge, jemandem das Leben zu nehmen. So war diese Stadt, sehr zum Ärger der Medien, monatelang mordlos geblieben. Selbst in der Kleingartenanlage ging es friedlich zu und keiner neidete dem anderen die größeren Kürbisse oder die längeren Gurken. Kein Nachbarschaftsstreit also, der wie anderswo zu einem Konflikt mit tödlichem Ausgang geführt hätte.
Rudolf Rasch sah sich zur Untätigkeit verdammt. Allerdings waren kleinere Vorfälle, die in die Rubrik ‚Mord‘ nicht einzuordnen waren, schon geschehen. Nur ungern befasste sich Rasch mit solchen Straftaten, die eigentlich keine waren.
Vor einigen Wochen waren an einer Hausecke in der Angela-Merkel-Straße zwei Privatdetektive mit dem Kopf zusammengestoßen, als der eine einem fremdgehenden Ehemann und der andere dessen fremdgehender Ehefrau nachspionierten. Der Zusammenprall war so heftig, dass beide Detektive ohnmächtig zu Boden sanken. Rasch ärgerte es, dass nicht wenigstens einer von ihnen zu Tode gekommen war. Den für Mordfälle zuständigen Lokalreporter der Lokalzeitung ärgerte das ebenfalls.
Das ständige Einerlei von Familienstreitigkeiten, Prügeleien in einer Kneipe und ähnlichen Verletzungen hing Rasch zum Halse heraus. Fast hätte er seinen Beruf aufgegeben und wäre zur Straßenreinigung gewechselt. Die brutale Kriminalität in dieser Stadt war zum Erliegen gekommen.
Auch folgender Zwischenfall belebte sie nicht. Im Gegenteil. Ein steckbrieflich gesuchter Handtaschendieb stellte sich völlig entnervt der Polizei, weil, wie er aussagte, das Ausrauben einer Bank einfacher sei als das Finden der Geldbörse in einer Damenhandtasche.
Der Lokalreporter der Bild-Zeitung, der ebenso wie Rudolf Rasch auf eine Bluttat erpicht war, teilte dem eines Tages mit, dass ein zünftiger Mord mit allem Drum und Dran zu erwarten sei. Ihn habe der Telefonanruf eines namenlosen Mannes erreicht, der das Rathaus in die Luft sprengen wolle. Den genauen Tag sowie die exakte Uhrzeit seines Anschlags habe er nicht mitgeteilt. Wohl aber, dass bei diesem Anschlag Menschen hopsgehen werden. Mindestens zwei, nämlich der Bürgermeister, diese geile Sau, und seine Sekretärin, diese lüsterne Nutte.
Rasch dankte dem Bild-Lokalreporter sehr herzlich. Endlich komme durch einen Mord wieder Leben in die Stadt, frohlockte er. Um den Verursacher des Attentats nach Verrichtung desselben allein zur Strecke zu bringen, ließ Rasch niemanden von dem geplanten Anschlag wissen. Nach einiger Überlegung kam er zu dem Entschluss, einen Helfershelfer, der der menschlichen Sprache nicht mächtig ist, an seiner Seite zu haben. Der sollte nur bellen können, Rasch dachte dabei an seinen verblichenen Hund Foxi, dem der neue Begleiter ähneln sollte. Als er den Polizeipräsidenten um finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung eines vierbeinigen Helfers bat, ließ er ungesagt, dass es ein Hund sein solle. Rasch wusste, dass ein Hund in Polizeidiensten einige Kosten verursachen würde.
Der Polizeipräsident besaß einen ausgesprochenen Sparsamkeitsfimmel, deshalb billigte er Rasch eine Katze zu. Es war seine eigene, die des Mäusefangens müde war, weil sie zu viel Fett angesetzt hatte. Das verschwieg er aber. Sie arbeite völlig lautlos, ließ er Rasch wissen.
„Haben Sie einen Vogel?“, erboste der sich respektlos.
„Selbstverständlich“, kam die erfreute Antwort. Der Polizeipräsident bot Rasch den Papagei seiner 90jährigen Großmutter an, die des Vogels Äußerungen nicht mehr richtig verstehe. Er sei sprachlich sehr geschickt. Er könne Laute nachahmen und die gebräuchlichsten Schimpfwörter und Drohungen von sich geben. Die Gro0mutter habe ihm eine Fülle auch anderer Wörter und Sätze beigebracht.
Zwei Einbrecher habe er mal mit dem Satz: „Flossen hoch, sonst knallt’s!“ in die Flucht geschlagen.
Pepi, so der Name des Papageis, sei ein furchtloser Vogel und für den Polizeidienst deshalb bestens geeignet.
Rasch bekam einen Wutanfall, hielt dem Polizeipräsidenten die geladene Dienstpistole an die Nasenspitze und brüllte: „Wenn ich nicht sofort einen Hund kriege, jage ich Ihnen einen Schuss in die Nasennebenhöhle!“
Den Polizeipräsidenten überraschte Raschs Reaktion. Zitternd versprach er, einen polizeifähigen Hund in Dienst zu stellen. Welcher Rasse, welcher Größe, welchen Alters und welcher Fellfärbung er sein solle, wollte er wissen. Rudolf nahm die Pistole von der Nasenspitze seines Gegenübers und sagte, dass er den Hund selbst finden wolle. Er müsse unbedingt eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem verschiedenen Foxi haben.
Man führte den Kriminalinspektor durchs Städtische Tierheim, in dem auch einige geflohene und ausgesetzte Hunde Asyl gefunden hatten. Sie sahen alle ein bisschen mitgenommen aus und hatten einen schwermütigen Blick. Bellen und mit dem Schwanz wedeln konnten sie alle, doch hatten sie sonst nichts Polizeifähiges an sich.
Rasch wollte wissen, ob einer der Hunde über einen besonderen Spürsinn verfüge. Er müsse nämlich Drogen und andere versteckte Dinge erschnüffeln können. Der Pfleger führte ihn zu einem Käfig, in dem eine Dogge ein Schläfchen hielt. Er erklärte, dass sie eine Deutsche Dogge sei. Das machte sie Rasch sympathisch, denn auch Foxi hatte arische Wurzeln. Der Pfleger weckte die Dogge. Als sie gähnend in voller Größe stand, reichte sie Rasch bis zur Kinnspitze.
„Ich will auf ihr nicht reiten“, erklärte er.
Sie verfüge über außergewöhnliche Kräfte, sagte der Pfleger und könne einen ausgewachsenen Menschen im Handumdrehen zu Fall bringen. Auch das gefiel Rasch, obwohl sie keinerlei Ähnlichkeit mit seinem Foxterrier Foxi aufwies. Den Pfleger freute Raschs Freude und er befahl dem Hund: „Pençe vermek!”
Rasch hatte verstanden: „Wirf ihn in den Dreck!“
„Ich darf doch sehr bitten“, erboste er sich, „mich soll er nicht in den Dreck werfen.“
„Das tut er nur, wenn Sie ihm das befehlen, Herr Inspektor.“
„Das haben Sie ihm eben befohlen“, meinte Rasch wirsch.
Der Pfleger verdutzt: „Dann haben Sie das falsch verstanden, Herr Inspektor. Ich sagte: Pençe vermek!”
„Was soll das heißen? Ist das Doggensprache?“
Der Pfleger lachte und erklärte, dass er dem Hund befohlen habe, Pfötchen zu geben.
„Er soll nicht Pfötchen geben, sondern aufspüren, zupacken und unter Umständen totbeißen.“
Rasch war verärgert, dass ihm der Pfleger einen zärtlichen Hund andrehen wollte. Der wehrte sich mit dem Hinweis, dass Pfötchen geben eine Grundregel für das höfliche Verhalten eines jeden Hundes sei. Türkisch laute diese Aufforderung: Pençe vermek!
„Türkisch?!“ Rasch glaubte, nicht richtig verstanden zu haben. „Weshalb Türkisch? Das ist doch eine Deutsche Dogge – oder?“
„Von der Rasse her ist sie deutsch, von der Herkunft her türkisch.“
„Wie soll ich denn das verstehen?“, schnaubte Rasch.
Der Pfleger brachte ihm schonend bei, dass die Deutsche Dogge eine türkische sei. Ein Türke habe sie ins Tierheim gebracht, weil seine Frau ein Kind geboren habe und fürchte, der deutsche Hund könne das Kind totbeißen. Man wisse ja, wie die Deutschen sind.
Rasch überging die politische Anspielung und fragte: „Das Kalb versteht demzufolge nur Türkisch?“
„Das ist kein Kalb, sondern eine türkische Deutsche Dogge, deren Muttersprache Türkisch ist. – Sie sprechen kein Türkisch, Herr Kriminalinspektor?“
„Bin ich Türke?“, schnauzte er, „ich will einen deutschsprachigen Hund.“
Pokémon GO
Enttäuscht begab er sich auf den Heimweg. Der führte ihn auch durch den Stadtpark. Auf einer Bank im Schatten einer großen Eiche ließ er sich nieder. Hier gab er sich verschiedenen Gedanken hin. Zwei waren hervorstechend, nämlich: a) Wie komme ich schnellstens zu einem Foxi-ähnlichen Hund? und b) Wann wird der Rathaus-Terrorist die Bombe zünden? Diese Frage fand er spannend, weshalb er vor sich hinsprach: „Endlich knallt’s wieder mal und es kommt Stimmung in die Bude. Hoffentlich gibt’s tatsächlich Tote.“
„Um Gottes Willen, Herr Inspektor, naht wieder ein Krieg?“
Eine korpulente Frau ließ sich neben Rasch auf die Bank plumpsen.
„Wer spricht von Krieg?“, stammelte er überrascht.
„Sie, Herr Inspektor.“
Rasch sah die Frau an und erkannte in ihr die Gattin des Bürgermeisters, die dafür bekannt war, mit der Zunge schneller zu sein als mit ihrem fülligen Körper. Ich verstehe nicht, dachte er sich, wie der Bürgermeister eine solche Matrone zur Ehefrau machen konnte. Kein Wunder, dass seine Zuneigung nun seiner Sekretärin gilt. Nun ja, brachte er seine Überlegung zu Ende, bald wird’s mit der Ehe vorbei sein. Der Tod macht vieles zunichte.
„Warum schweigen Sie, Herr Inspektor? Missfällt Ihnen meine Anwesenheit oder bedrückt Sie die Tatsache, dass nichts Mörderisches mehr passiert?“
„Es wird bald wieder etwas Mörderisches geschehen“, sagte er geheimnisvoll.
„Tatsächlich?“, zeigte sie sich neugierig und ängstlich zugleich. „Woher wissen Sie das?“
„Ein Kriminalinspektor ist auch vorausschauend.“
„Wen wird der Mord treffen?“ Ihre Stimme zitterte leicht, weil sie sich von einer Ermordung nicht ausschloss.
Rasch ahnte ihre Besorgnis und schürte sie noch etwas. „Sie werden ihm nur entgehen, wenn Sie sich zu Hause aufhalten.“
Damit hatte er sie gänzlich aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht.
„Sie ängstigen mich, Herr Inspektor. Erklären Sie sich genauer.“
„Aus ermittlungstaktischen Gründen darf ich diesem Mord nicht vorgreifen. Dienstgeheimnis! Doch freuen Sie sich mit mir, dass wieder etwas Furchtbares geschehen wird.“
„Darf ich hoffen, dass Sie mich unter ihren persönlichen Schutz nehmen, Herr Inspektor?“
Sie neigte ihren wuchtigen Oberkörper in seine Richtung.
„Ich schütze nicht vor einem Mord, ich kläre ihn auf. Das setzt voraus, dass ein solcher verübt worden ist.“
Er entzog seinen Oberkörper dem ihren.
„Das ist sehr klug gesagt, Herr Inspektor. Hoffen wir also auf einen baldigen Mord, der einen anderen ereilt und nicht mich. Es ist im Stadtgeschehen sehr eintönig geworden. Das Spannendste, das neulich im ‚Stadtanzeiger’zu lesen war, war die Mitteilung, dass der berüchtigte Küsser auf dem Joachim-Gauck-Platz wieder zwei Frauen unerlaubt geküsst hat. Der einen hatte er dabei sogar unsittlich ans Gesäß gefasst.“ Etwas enttäuscht fügte sie hinzu, dass er sich an ihr noch nicht vergriffen habe.
„Ich bin ja auch die Gattin des Bürgermeisters“, schloss sie überraschend schnell die Unterhaltung, verabschiedete sich von Rasch und watschelte davon.
Auch er erhob sich, um seinen Heimweg fortzusetzen. Kaum hatte er zwei Schritte getan, kam ein etwa zehnjähriger Knabe auf ihn zu und stieß mit ihm zusammen.
„Hoppla, junger Mann“, sagte Rasch, „Tomaten auf den Augen?“
„Nein, ein Smartphone in der Hand“, erwiderte der Knabe und hielt ein solches Rasch entgegen.
„Wenn du telefonieren willst, dann setze dich auf die Bank“, wies Rasch auf die, die er eben verlassen hatte, „und renne nicht blindlings Menschen über den Haufen.“
Er lächelte nachsichtig. Das tat er eigentlich selten.
„Ich will nicht telefonieren. Gehen Sie bitte mal zur Seite – Sie treten ja auf ihn“, beschwerte sich der Junge und stieß Rasch unfreundlich zur Seite.
„Na, na, na, was soll denn das?“, verging dem das Lächeln.
„Sie haben es vertrieben!“ Der Junge war dem Weinen nahe.
„Was habe ich vertrieben?“
„Das Pokémon.“
Rasch guckte verständnislos. Dann regte sich in ihm die kriminalistische Neugier und er wollte wissen, wer das Pokémon sei.
„Das Pokémon ist ein Pokémon, das ich fangen will. Ich jage ihm schon den ganzen Vormittag nach.“
„Versäumst du nicht die Schule?“
„Die Pokémon-Jagd ist wichtiger als die Scheiß-Schule“, meinte der Junge trotzig.
Donnerwetter, dachte sich Rasch, der ist aber ungezogen.
„Bist du ein Deutscher?“ erkundigte er sich, da für ihn nahe lag, dass der Lümmel als Asylanten-Kind nicht streng genug angehalten war, am Unterricht teilzunehmen. Vielleicht war er auch der deutschen Sprache nicht mächtig genug.
„Denken Sie, ich bin ein Chinese? Sehe ich so aus?“ Die Fragen klangen zornig.
„Dir fehlen die Schlitzaugen“, gestand Rasch. „Dennoch möchte ich wissen, wer dieses Pokémon ist.“
Der Junge guckte Rasch an, als zweifele er an dessen Allgemeinwissen und sagte: „Sie sind wohl ein Außerirdischer, alter Mann?“
Das waren gleich zwei Äußerungen, die Rasch missfielen. Ihm als Kriminalinspektor nachzusagen, er sei ein Außerirdischer und noch beizufügen, er sei ein alter Mann, überschritt seine Geduld.
„Sage mal, du Rotzlöffel“, revanchierte er sich, „weißt du nicht, wer ich wirklich bin?“
„Ich bin kein Rotzlöffel, sondern der Enkel des Fuhrunternehmers Franz Müller. Der ist mein Opa. Der besitzt zwei große Trucks. Ich fahre manchmal mit. Wenn ich groß bin, werde ich Trucker.“
Er maß Rasch von oben bis unten und sagte geringschätzend: „Jetzt erkenne ich Sie, Sie sind der Penner, der immer auf dem Markt in den Papierkörben nach leeren Flaschen wühlt.“
Rasch verging das Atmen. Soviel Schamlosigkeit hatte er durch einen Minderjährigen noch nie erfahren. Hier musste er pädagogisch streng reagieren. Er hob die Hand, um dem Bengel eine Ohrfeige zu geben, ließ sie aber sinken, da zwei ältere Damen in Begleitung eines Hündchens nahten. Mit roher Zärtlichkeit strich er über den Kopf des Knaben. Dabei dachte er grimmig: Dir klatsche ich eine, wenn die beiden Klatschtanten vorüber sind.
Der Knabe entzog seinen Kopf Raschs Hand, sah wieder aufs Smartphone und rief plötzlich überschwänglich: „Da ist es wieder!“ Eilig rannte er auf ein nahes Gebüsch zu und verschwand in diesem.
Rasch sah ihm verwundert nach. Dann verdrehte er die Augen, als er hörte: „Hallo, Inspektörchen, schön Sie zu sehen!“
Noch ein geplanter Anschlag
Ehe er sich versah, war er auf die Parkbank zurückgedrückt, genau in die Mitte der beiden Damen. Die waren ihm ein Graus. Nicht nur, weil sie unentwegt dummes Zeug redeten, sondern ihn auch oft genug mit falschen Aussagen auf eine falsche Spur gelenkt hatten. Selbst Foxi, Gott habe ihn selig, hatte sie zum Beißen gern. Am meisten deshalb, weil sie immer ein Hündchen bei sich hatten, dass unentwegt kläffte und so tat, als sei es der gefürchtetste Vierbeiner der Stadt.
Auch jetzt war der kleine Kläffer wieder dabei und kläffte nerventötend. Rasch bedauerte, dass Foxi im Himmel weilte und nicht hier. Er hätte dem kleinen Gernegroß entweder in den Schwanz gebissen oder ihm einige strenge Worte gebellt.
„Ihnen ist es wohl langweilig, Raschelchen“, zärtelte eine der beiden Damen, „dass sie so tatenlos hier sitzen? Ist auch verständlich, wenn kein Mord geschehen ist. Die Bürger sind zu friedlich geworden. Das muss Sie doch ärgern, Raschelchen.“
Mich ärgert, dass ihr nicht schnellstens verduftet, dachte er grimmig. Laut sagte er es nicht, denn mit den Beiden wollte er sich’s nicht verderben. Trotz mancher Fehlmeldungen war denen einige Male ein heißer Tipp gelungen.
„Ich bin überaus glücklich, Sie hier zu haben“, log er.
Der kleine Kläffer durchschaute Raschs falschen Sinn und bellte so laut, dass ihm die Luft auszugehen drohte. In einem unbeobachteten Moment trat Rasch ihm in den Hintern, so dass er einige Meter wegflog. Rasch war kein Tierquäler, aber diese Töle ging ihm auf den Geist.
Das Bellen des Hündchens verwandelte sich augenblicklich in Jaulen. Die beiden Damen wunderte das.
„Prinzesschen möchte wohl nach Hause?“, erkundigte sich das Frauchen, das das Hündchen an der Leine hielt.
Auch das noch, stöhnte Rasch verhalten, ein Prinzesschen. Sieht eher aus wie eine wildgewordene Klobürste.
Frauchen straffte die Leine und zog das Hündchen zu sich heran. Das sträubte sich so heftig, dass das Halsband es zu ersticken drohte. Ihm entfuhr nur noch ein Röcheln. Es fürchtete, von Rasch noch einmal getreten zu werden.
„Was soll das, Prinzesschen?“, meinte Frauchen ungehalten. „Schau, hier sitzt der gute Onkel Rasch, den der Verlust seines treuen Gefährten immer noch sehr betrübt. Du hattest doch auch ein gutes Verhältnis zu Foxi, nicht wahr Prinzesschen?“
Prinzesschen hatte kein gutes Verhältnis zu Foxi, und der Onkel Rasch war auch nicht gut, sondern böse. Trotz energischen Widerstands hatte Frauchen das fast leblose Prinzesschen endlich auf dem Schoß. Es erhielt nun unentwegt Streicheleinheiten, bis die Lebensgeister in diese Fußhupe zurückgekehrt waren. Deren Augen blieben starr und böse auf Rasch gerichtet. Der zeigte ihr den Stinkefinger. Das missfiel Prinzesschen, unterließ es aber, wieder zu kläffen.
„Prinzesschen ist doch ein liebes Hündchen, nicht wahr, Raschelchen?“
Rasch klappte den Stinkefinger zurück und wünschte sich, nicht ständig Raschelchen genannt zu werden. Das untergrub seine Autorität und verweichlichte sein Ansehen.
„Ein allerliebstes Hündchen, das ganz schnell nach Hause will“, wollte er die beiden Frauen veranlassen, schnell zu verschwinden.
Die aber dachten nicht daran und nahmen eine bequemere Sitzhaltung ein.
„Wissen Sie schon das Neueste, Inspektörchen?“, nahm die andere das Wort.
Rasch vergaß das Prinzesschen und war gespannt, was ihm als sicherlich erfundene Neuigkeit präsentiert werde.
„Auf das Altersheim in der Sigmar-Gabriel-Straße, die viel früher Adolf-Hitler-Straße hieß, ist ein Anschlag geplant.“
Rasch wurde hellhörig, doch beruhigte ihn, dass die beiden Spinatwachteln nichts vom Anschlag auf das Rathaus wussten. Das hätte schon heute die gesamte Stadt erfahren und seinen möglichen Einsatz vermasselt.
„Ach was?“, tat er überrascht. Prinzesschen sah ihn wieder böse, diesmal leise knurrend an. „Ein Anschlag auf das Altersheim? Der würde ja den Flug der Alten ins Jenseits beschleunigen.“
Diese Gehässigkeit war ihm gefühllos über die Lippen gekommen, weil seine Großeltern in diesem Heim nicht untergebracht waren, da sie sich bereits beim Herrgott aufhielten.
„Woher wissen Sie das?“, fügte er schnell hinzu, um seinen Zynismus zu mildern.
„Von dem Anschlag, der neben dem Eingang des Altersheims angeschlagen ist und auf den geplanten Anschlag hinweist.“
Das ist neu, dachte Rasch, dass ein Anschlag durch einen Anschlag angekündigt wird. Das macht ihn interessant.
„Was ist auf dem Anschlag zu lesen?“, fragte er.
Die linkssitzende Dame zog ein Handy aus der Handtasche und ließ Rasch auf dem Display lesen, was sie fotografiert hatte.
„‘Ir Schweine hapt meine Ohma auf den gewisen. Eure Erpsensupe hatt ir den Tot geprachd. Sie ist gebläht und auffgeblazt. Ich pringe euch ale umm.‘
Rasch las den Text noch einmal und wandte seine Augen dann leicht gähnend von ihm ab.
„Langweilt Sie der geplante Anschlag, Inspektörchen? Fällt Ihnen nichts auf?“, fragte die Handyhalterin.
„Natürlich fällt mir was auf. Der Verfasser des Anschlags war sicherlich ein notorischer Schulschwänzer. Seine Rechtschreibung ist ein schwerwiegendes Delikt an der deutschen Sprache.“
„Das ist alles, was Ihnen auffällt? Als Kriminalinspektor müssten Sie doch erkennen, dass der Täter
keinen Hinweis auf seine Person gibt, also wie er heißt, wann er geboren wurde, wie er gekleidet ist …“
„…welche Schuhgröße er hat, welche Zahnpaste er benutzt …“, setzte Rasch belustigt fort.
„Sie nehmen den Anschläger nicht ernst. Vielleicht fliegt bereits in diesem Augenblick das Altersheim in die Luft.“
Diese Bemerkung beseitigte Raschs ironisches Denken schlagartig. Die Alte hatte recht. Vor allem die Rechtschreibschwachen waren als Attentäter zu fürchten, weil die ihre Lese-Rechtschreib-Schwäche durch eine bestimmte Stärke zu vertuschen suchten. Wie von der Tarantel gestochen sprang Rasch auf, ließ die Damen und das erleichtert kläffende Prinzesschen zurück und eilte davon. Die riefen ihm nach, wohin er so eilig eile, doch konnten sie sich das natürlich denken.
„Hoffentlich erwischt er den Attentäter“, sagte die eine zur anderen. „Der muss ja ein rechter Dummkopf sein, wenn er Erbsensuppe falsch schreibt.“
„Komm, Prinzesschen“, sprach die andere, „auch wir begeben uns hinweg. Vielleicht erfahren wir in der Stadt brauchbare Neuigkeiten.“
Aufregung beim Altersheim
Nach etwa zehn Minuten hatte Rasch die Sigmar-Gabriel-Straße erreicht. Sie war nach diesem ehemaligen Bundesminister benannt, weil der hier mal, als er seine Tante in dieser Stadt besuchte, laut gerufen hatte: „Niemals mehr wird sie Adolf-Hitler-Straße heißen!“ Er wusste nämlich, dass sie früher diesen Namen getragen hatte und hoffte, dass sie noch zu seiner Lebenszeit nach ihm benannt werde. Adolf Hitler lebte ja auch noch, als man ihr dessen Namen gab. Wer konnte damals ahnen, dass sie irgendwann einmal nach einem Mann benannt wird, der mit dem Führer keinerlei Ähnlichkeit hat. Er hatte weder einen Schnurrbart, noch fielen ihm die Haarsträhnen in die Stirn. Er war auch zu dick.
Schwer atmend erreichte Rasch das Altersheim. Er spürte, dass er nicht mehr der Jüngste war.
Das Altersheim hatte noch die gleiche hellbraune Fassadenfarbe wie zu der Zeit, als es Sitz der NSDAP-Kreisleitung war. Bei der Beseitigung der faschistischen Spuren in dieser Stadt war das übersehen worden.
Rasch wandte sich dem Eingang zu, neben dem tatsächlich ein plakatgroßer Anschlag mit durchsichtigen Klebestreifen angebracht war. Nachdem er den bereits bekannten Text noch einmal verinnerlicht hatte, sah er vorsichtig nach allen Seiten. Vielleicht stand der Attentäter in Reichweite, um sein schändliches Werk zu verrichten. Wie wird er es verrichten?, fragte sich Rasch. In herkömmlicher Weise mit einer geballten Ladung Dynamit? – Ich werde mich hinter die Ecke des Nachbargebäudes stellen, entschied er, und ein waches Auge haben.
Als sei er ein ganz gewöhnlicher Spaziergänger schlenderte er dorthin. Noch ehe er die angepeilte Hausecke erreicht hatte, erreichte ihn von hinten die heisere Frage: „Hallo, du da, bist du der Satansbraten, der uns umbringen will?“
Rasch sah zurück und erblickte einen runzligen Menschenkopf, der aus einem der Altersheimfenster guckte. Weil es Rasch die Sprache verschlagen hatte, krächzte der Menschenkopf weiter: „Verschwinde oder ich mache dir Beine!“
Dann verschwand der Kopf und Rasch hörte aus der nun kopflosen Fensteröffnung: „Opa Heinrich, Sie haben ja schon wieder ohne Schal aus dem Fenster geguckt.“
Opa Heinrich: „Da unten steht der Mann, der uns zersprengen will!“
Aus dem Fenster sah nun ein blondgelockter Frauenkopf und stellte Rasch die Frage: „Suchen Sie jemanden?“
Er hätte antworten können, dass er den Anschlagschreiber suche, doch unterließ er das. Er gab sich allgemein und erwiderte unverfänglich: „Schönes Wetter heute, schöne Frau. Das macht Lust zum Bummeln.“
Neben dem Frauenkopf tauchte Opa Heinrichs Kopf wieder auf, der krächzte: „Der lügt! Den kenne ich! Der schleicht hier immer verdächtig rum. Der ist ein Terrorist.“
Der Frauenkopf böse: „Opa Heinrich, Sie sollen nicht ohne Schal aus dem Fenster gucken.“
Aus daneben befindlichen Fenstern guckten nun zwei Köpfe, grauhaarige Frauenköpfe und fragten, warum hier solcher Lärm gemacht werde. Sie könnten nicht ruhig ihren Mittagsschlaf halten.
Opa Heinrich: „Da unten steht der Mordbrenner, der uns in den Tod schicken will.“
Nun begann ein Zetern und Schreien, an dem sich weitere Personen beteiligten, die aus anderen Fenstern sahen.
Rasch, dessen Nervenkostüm nicht mehr das beste war - die anstrengenden Dienstjahre hatten ihre Spuren hinterlassen -, griff zum letzten Mittel seiner resoluten Konsequenz. Er zog die Pistole, hielt sie drohend in die Luft und rief: „Wenn nicht sofort Ruhe eintritt, drücke ich ab!“
Augenblicklich trat totale Stille ein. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Nur ein leises Klappern war plötzlich zu hören und dann das Nuscheln: „Mein Gebiss ist mir aus dem Mund gefallen. Ich habe große Angst.“
Rudolf Rasch wollte sich als friedfertiger Bürger zeigen. Deshalb steckte er die Pistole weg und hob die Zahnprothese auf.
„Soll ich sie hinaufwerfen oder hinaufbringen?“, fragte er.
Opa Heinrich erneut Stimmung machend: „Er hat eine Pistole bei sich. Lasst ihn keinen Schritt ins Haus! Der bringt eine Sprengladung an und uns um! Ruft die Polizei!“
Beinahe hätte Rasch gesagt, dass er die Polizei ist, doch dann hätte er den Attentäter, so er in der Nähe war, zur Vorsicht bewogen.
„Ich werde die Zahnprothese holen“, beruhigte der blondgelockte Frauenkopf die zahnlose Oma.
Wenig später stand eine hübsche junge Frau vor Rasch und erbat den Zahnersatz. Nachdem Rasch ihn ihr gereicht hatte, fragte er, weshalb der Anschlag neben der Eingangstür noch nicht beseitigt worden sei. Er würde doch weiterhin für Angst und Schrecken sorgen und den Attentäter ermutigen, seine Tat auszuführen. Es sei ein Glück, dass dies noch nicht geschehen sei.
Opa Heinrich rief: „Fräulein Hase, lasse dich von diesem Gangster nicht beschwatzen. Er lügt.“
Rasch war auf diesen krakeelenden Tattergreis nun wirklich böse.
„Mach den Mund zu, Opa, es zieht!“, rief er ihm zu.
„Wir haben diesen Aushang deshalb noch nicht entfernt, damit die Polizei sieht, wie bedroht wir sind“, erklärte Fräulein Hase. Und weiter: „Die Leitung des Hauses hat die Polizei natürlich telefonisch sofort verständigt. Der Polizeipräsident höchstpersönlich ließ wissen, dass der für solche Angelegenheiten zuständige Verantwortliche, ein Mann namens Rasch, im Moment nicht verfügbar sei. Er halte sich unter Hunden im Städtischen Tierheim auf. Sobald er wieder vorhanden sei, werde er der Sache nachgehen.“
Rasch wurde es ein bisschen mulmig. Mit kriminalistischem Geschick befreite er sich von diesem unangenehmen Gefühl und fragte Fräulein Hase, ob der Inhalt des Terrorplakats der Tatsache entspreche.
„Natürlich gibt es hin und wieder auch Erbsensuppe als Mittagsmahl, doch ist diese vorsichtig dosiert. Sie beinhaltet pro Teller nur so viele Erbsen, wie sie für die alten Menschen verträglich sind. Geplatzt ist nach Erbsensuppe noch niemand. Die Behauptung auf dem Anschlag, der rechtschreiblich übrigens sehr fehlerhaft ist, ist völlig aus der Luft gegriffen. Lediglich Opa Heinrich entlässt nach Erbsensuppe sehr gern und sehr laut seine Darmgase.“
Opa Heinrich, der trotz seines Alters noch ein feines Gehör besaß, hatte gehört, was Fräulein Hase geäußert hatte.
„Na und“, kreischte er, „ich furze nun mal gern. Wenn’s Arscherl brummt, ist‘s Herzel gesund!“
„Wie ertragen Sie diesen Schreihals, Fräulein Hase?“, wollte Rasch wissen.
„Mit Geduld und Spucke“, flüsterte sie lächelnd. „Vor langer Zeit, ich war noch nicht geboren, war er Polit-Offizier bei der NVA, der Armee der damaligen DDR. Sein Gehör sei damals für seine Aufgabe besonders geschult worden, sagte er mir mal. Staatsfeindliche und den Sozialismus schädigende Äußerungen von Soldaten habe er sofort weitergeleitet. Vor allem die Stasi habe sich für sie interessiert. Voller Stolz behauptete er, dass er während seiner Laufbahn hundertfünfzig Militärangehörige verpfiffen habe.“
„Was flüstert ihr da?“, krächzte Opa Heinrich und lehnte sich weit aus dem Fenster, um mitzuhören.
„Um Gottes Willen“, rief Fräulein Hase erschrocken, „ziehen Sie sich zurück, Opa Heinrich, sonst fallen sie raus!“
„Lassen Sie ihn ruhig fallen“, meinte Rasch herzlos.
Von einem anderen Fenster her nuschelte es: „Ich will mein Gebiss wiederhaben!“
„Ich muss jetzt gehen“, erklärte Fräulein Hase, „sonst fällt tatsächlich noch jemand aus dem Fenster.“
Sie eilte zum Haus, drehte sich jedoch noch einmal um und sagte in Richtung Rasch: „Danke für die nette Unterhaltung. Ich wünsche Ihnen einen weiteren schönen Stadtbummel.“
Dann verschwand sie im Haus.
„Von wegen schönen Stadtbummel“, grummelte Rasch, „ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Was soll ich tun, hierbleiben oder meine Dienststelle aufsuchen?“
„Was hast du Verbrecher vor dich hingesagt?“ Opa Heinrich war immer noch ganz Ohr.
„Verzieh dich, Opa, oder …“ Rasch zeigte seine Dienstwaffe.
„Hilfe, der will mich erlegen!“, schrie Heinrich und zog endgültig den Kopf zurück.
Ein Telefonanruf
Im Polizeipräsidium herrschte große Aufregung. Der Polizeipräsident informierte die Mitarbeiter der Polizeidienststelle über eine eben eingegangene schriftliche Drohung, die die Sprengung des Rathauses ankündete. Es solle dafür Sorge getragen werden, dass der Bürgermeister, diese geile Sau, und seine Sekretärin, diese sexlüsterne Nutte, während der Sprengung im Rathaus sind. Andernfalls werde zusätzlich das Polizeipräsidium platt gemacht. Rudolf Rasch war nun nicht mehr der Alleinwissende des geplanten Anschlags.
Die Polizisten erfasste ein heftiges Zittern, als der Polizeipräsident die Verlesung des Drohschreibens beendet hatte.
„Was sollen wir tun?“, fragte er mit flatternder Stimme. Weil keine Antwort kam, fuhr er fort: „Zur Klärung der Sachlage müsste jetzt Kollege Rudolf Rasch zugegen sein, er ist es aber nicht.“
„Wo ist er?“, fragte ein Polizist.
„Im Städtischen Tierheim, um dort einen Spürhund aufzuspüren.“
„Dann zitieren Sie ihn hierher, Herr Poprä“, meinte der gleiche Polizist.
Poprä war die Abkürzung für Polizeipräsident.
„Eine famose Idee, Kollege Schnürschuh“, lobte der Poprä. „Dann begib dich rasch zum Tierheim, um Rasch hierher zu bitten.“
„Warum begeben?“, maulte Schnürschuh, „telefonisch geht das schneller.“
„Telefonisch?“ Der Poprä sah Schnürschuh an, als hätte der einen Stein auf den Kopf bekommen.
„Unser Telefon wird vom Terroristen sicherlich abgehört. Der würde also flugs erfahren, wo sich Kriminalinspektor Rasch aufhält. Augenblicklich befände der sich in Lebensgefahr. Und wir natürlich auch.“
„Na gut, dann gehe ich halt“, maulte Schnürschuh. „Immer ich“, hängte er unzufrieden an und verließ ohne Hast und Eile den Dienstraum.
„Wenn Kollege Rasch das Tierheim bereits verlassen hat, dann wird ihn Schnürschuh nicht antreffen“, gab ein anderer Polizist zu bedenken.
„Eine gründliche Überlegung“, lobte der Poprä. „So begib auch du dich auf den Weg, Kollege After, um Rudolf Rasch außerhalb des Tierheims abzufangen.“
Ebenso unlustig wie Schnürschuh machte der sich davon.
„Gibt es noch einen nützlichen Gedanken?“, fragte der Poprä die Übriggebliebenen.
Zwei von denen sahen angestrengt auf den Boden und beobachteten eine Ameise, die eine tote Fliege durch den Raum schleppte. Zwei andere guckten in entgegengesetzte Richtung nach oben zur Raumdecke und verfolgten mit ihren Augen eine Spinne, die an der Deckenlampe ein Spinnennetz befestigte.
Des Popräs Blick konzentrierte sich auf die anderen Bullen, die weder nach oben noch nach unten guckten. Zwei von denen reinigten gewissenhaft ihre Fingernägel und die restlichen bewegten den Kopf von links nach rechts und wieder zurück, als wollten sie einer Genickstarre vorbeugen.
„Also sind wir gezwungen, auf das Eintreffen Rudolf Raschs zu warten“, meinte der Poprä wenig begeistert von der Wortenthaltung seiner Mitarbeiter.
Plötzlich schrillte das Telefon. Alle im Raum erstarrten. Die Ameise stellte den Transport der toten Fliege ein und die Spinne das Anbringen des Spinnennetzes.