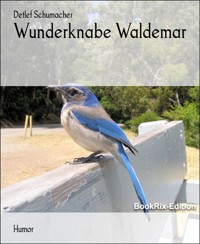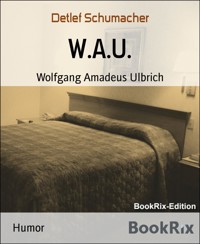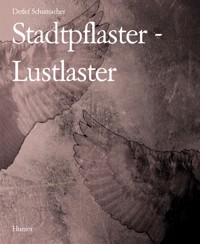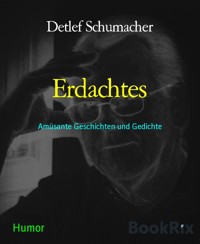0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Murks gelingt es, der Hölle zu entkommen und sich ins Diesseits zu flüchten. Hier hat er die Möglichkeit, zum zweiten Mal zu leben. Die ersten drei Tage seines irdischen Daseins, die in diesem Buch geschildert werden, stellen ihn vor einige Probleme. Die beseitigt er jedoch mit wirksamen Hilfsmitteln, die er in der Hölle gestohlen hat.
Ihm bietet sich auch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Er hofft, dass seine Nützlichkeit von Gottlieb Gott gesehen wird, zu dem er nach Ablauf dieses Lebens zurückkehren will.
Wilhelms Eindrücke und Erlebnisse könnten über viele Buchseiten hin fortgesetzt werden, doch soll es mit den vorliegenden genug sein. Sein zweites Leben hat ja eben erst begonnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Murks im Diesseits
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenWieder auf der Erde
Mir war gelungen, was bisher noch keinem geglückt war, nicht einmal Jesus. Nach Umwegen über Himmel und Hölle war ich im Diesseits gelandet, das ich infolge natürlichen Ablebens einst verlassen hatte. Wann das geschehen war, weiß ich nicht, weil ein Toter nicht erfährt, wann er aus dem Hienieden geschieden war. Bei sich bietender Gelegenheit würde ich den Friedhof aufsuchen, in dem meine sterblichen Überreste der Erde übergeben worden waren. Auf dem Grabstein könnte ich mein Sterbedatum erfahren.
Ich war also in der glücklichen Lage, die Welt nach meinem Tode zu erleben. Den Wiedereintritt ins irdische Dasein ermöglichten mir, wie auch am Ende meines Erlebnisberichts Murks in der Hölle zu lesen, die Zauberohrringe der Teufel-Großmutter, die ich ihr in einem passenden Moment entwendet hatte. Auch in den Besitz des göttlichen Fernglases war ich wieder gekommen, das Luzifer mir mit einem nichtigen Versprechen abgeluchst hatte. Sollte ich jemals wieder vor Gottlieb, den lieben Gott und meinen Gönner, hintreten, dann könnte ich ihm das Fernglas zeigen, das er mir in einer Anwandlung von Nächstenliebe geschenkt hatte.
Eigentlich wollte ich mit Marylin Monroe der Hölle entkommen, doch blieb sie zurück, weil mir ein Zauberfehler unterlaufen war. Sie würde nun den Zorn Luzifers und seiner Großmutter zu spüren bekommen, der eigentlich mir galt.
Ich nahm das Fernglas vor Augen und sah von der Stelle, an der ich mich befand, ins Erdinnere. Ich sah tatsächlich Luzi und dessen Oma wild gestikulieren. Bei ihnen befand sich Luzis Schwester Hexi, die Marylin an den schönen blonden Haaren gepackt hielt und sie ausreißen wollte. Was an bösen Worten ausgestoßen wurde, konnte ich nicht vernehmen, da das Fernglas ein Sehglas und kein Hörglas war. Dennoch konnte ich erahnen, welche üblen Beschimpfungen Marylin erdulden musste. Sie wehrte sich verzweifelt, jedoch vergeblich.
Mich packte Wut. Auch auf mich, weil ich die über alles geliebte Schöne schnöde im Stich gelassen hatte. Sollte ich sie aus den Klauen der Höllenbestien befreien? Mittels der Zauberohrringe? Doch kam mir in den Sinn, dass die ihre Wirkung in der Hölle verlören, geriete ich in den Bannkreis der Luzi-Großmutter. Dann wäre ich zwar bei Marylin, gleich ihr aber wieder ein Hölleninsasse. Luzifer würde auf meine Beratertätigkeit verzichten und mich zu einem einfachen wehr- und willenlosen Gefangenen seines Totenreichs machen. Mein Ansinnen, zu meinem Freund Gottlieb, den lieben Gott, ins Himmelreich zurückkehren zu können, bliebe dann für alle Zeiten ein unerfüllbarer Wunsch. Ich sollte die gewonnene Freiheit also nicht sinnlos vertun und sie nicht aus Liebe zu einer ehemaligen Hollywood-Schauspielerin leichtfertig aufs Spiel setzen. Sie würde diesen meinen Entschluss sicherlich gutheißen.
Mir war nun wichtig, so schnell wie möglich aus der Nähe des Vesuvs, der europäischen Ein- und Ausstiegsstelle der Hölle zu kommen. Es war nämlich nicht auszuschließen, dass Luzi mich verfolgen wird. Vielleicht in einer Gestalt, die seinem eigentlichen Aussehen überhaupt nicht ähnelte. Er hatte mich ja wissen lassen, dass er seine Erscheinung verändere, sobald er die Erdoberfläche besuchsweise betrete. Dafür benötigte er nicht die Ohrringe seiner grundhässlichen Oma. Ihm wohnten teuflische Kräfte inne, die seine Absichten sofort wahr machten. Ich musste also auf der Hut sein und in meinen Entschlüssen schneller sein als er.
Kaum war ich zu dieser Erkenntnis gelangt, vernahm ich in unmittelbarer Nähe das Muhen einer Kuh. Das erste irdische Lebewesen, das ich bei meinem Austritt aus dem Höllenschlund vor Augen bekam, war dieses grasende Rindvieh. Es muhte wiederholt, und zwar so eindringlich, als wollte es mir was sagen.
Kurzentschlossen sprach ich die Zauberformel, die die Teufelsgroßmutter ihrem Enkel anvertraut hatte, ohne zu merken, dass ich sie heimlich mithörte.
„Tut was ich will, und zwar schnell!“ sagte ich und fügte bei: „Ich will das Muh der Kuh verstehen!“
Die Zauberohrringe hatte ich Gott sei Dank – das durfte ich nun wieder sagen – noch an den Ohrläppchen hängen.
„Ciao gente“, hörte ich und schaute mich verdutzt um. Ich sah keinen Sprechenden.
„Sto parlando con te“, sagte die Kuh und stellte vorübergehend das Wiederkäuen ein.
„Kuhderwelsch“, ließ ich abfällig hören.
Die Kuh reagierte beleidigt. Sie vollführte mit ihrem Schwanz wischende Bewegungen an ihrem Hintern. Das sollte wohl heißen: „Leck mich am …!“
Ich wollte sie nicht weiter verärgern und erklärte, dass ich Deutscher sei und außer ein paar Brocken Russisch nur deutsch spreche und verstehe.
Sie stellte ihr obszönes Schwanzwischen ein und sprach gebrochen deutsch: „Ich sagte: Hallo Mensch, ich bin es, die mit dir spricht.“
„Du hast es in Kuhsprache gesagt“, entschuldigte ich mein Nichtverstehen.
„Ich habe es italienisch gesagt, denn ich bin eine italienische Kuh.“
„Oho“, staunte ich, „machst du hier Urlaub?“
Ihr Körper geriet in wackelnde Bewegung und ihr dickes Euter schwabbelte hin und her. Sie kommentierte diese Bewegungen als Lachen.
„Ich wohne in Italien. Ich gehöre einem italienischen Bauern, der in der Nähe sein Haus und meinen Stall stehen hat.“
„Sieh mal an!“, staunte ich. Mir Depp wurde bewusst, dass ich mich in Italien befand. Ich saß am Fuße des Vesuvs. Na klar, aus ihm war ich ja gekommen.
„Es ist erstaunlich, dass du als italienische Kuh deutsch sprechen kannst“, setzte ich das Gespräch fort.
Sie darauf: „Hier kommen viele ausländische Touristen vorüber, auch deutsche, die den Vesuv besteigen wollen. So lerne ich verschiedene Sprachen kennen.“
„Dann gehörst du nicht zu den dummen Kühen“, drückte ich meine Bewunderung über ihre Intelligenz aus.
„Das will ich wohl meinen“, gefiel ihr mein Lob. „Was machst du hier?“, wurde sie direkt. „Bist du auch ein Tourist, der in den Vesuv gekrochen ist?“
„Bin ich nicht. In den Vesuv kann man nicht kriechen, es sei denn, man will seinem Leben ein Ende bereiten.“ Ich war nicht gewillt, die Kuh wissen zu lassen, woher ich gekommen war. Sie würde das ohnehin nicht verstehen.
„Bist du eine Einzelkuh oder gehörst du zu einer Herde?“, gab ich der Unterhaltung eine andere Richtung.
„Ich bin eine …“
„Guten Tag, Kamerad“, wurde die Kuh von einer Männerstimme unterbrochen. Die Begrüßung galt mir. Welcher Mensch würde auch vermuten, dass ich mich mit einem Rind unterhalte.
„Guten Tag“, erwiderte ich überrascht. Im ersten Moment hatte ich geglaubt, Luzi hätte mich erwischt.
Wie war ich froh, einen Mann zu sehen, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Höllenfürsten hatte.
„Jetzt wirst du dich sicherlich mit diesem Menschen unterhalten?“, fragte mich die Kuh, „und ich bin nun Luft für dich.“
So unhöflich wollte ich nicht sein und bat das Tier, an der Unterhaltung teilzunehmen, sollte sich eine zwischen mir und dem Fremden entwickeln.
Der guckte mich zweifelnd an. „Habe ich eben richtig gehört? Hast du dem Rindvieh etwas gesagt?“
„Wenn der noch einmal Rindvieh sagt, haue ich ihm den Schwanz um die Ohren. Rindvieh klingt so abfällig“, meinte die Kuh empört.
„Gemach, gemach“, beruhigte ich sie, „er hat es nicht so gemeint.“
„Jetzt werde ich das Staunen nicht los. Bist du ein Kuhflüsterer?“, fragte er mich und fuhr fort: „Sicherlich der Hirt dieses Wiederkäuers.“
„Wie kommst du darauf?“
„Deine Kleidung ist so zerschlissen.“
Der Mann hatte Recht. Ich trug noch immer Hemd und Hose, die ich seit Eintritt ins Himmelreich am Körper hatte. Auch in der Hölle war mir ein Kleiderwechsel nicht möglich gewesen.
„Ich habe einen weiten Weg hinter mir“, log ich. Der Fremde sollte erkennen, dass ich deshalb einem Lumpen ähnlicher sah als einem ordentlich Gekleideten.
Auch ihn betrachtete ich nun genauer. Er hatte ein silberfarbenes T-Shirt und eine ebenso farbige Hose an. Auf dem Kopf trug er einen silberfarbenen Hut, auf dem eine kleine Solarzelle thronte.
„Deine Kleidung ähnelt der meinen in keiner Weise, versetzt mich aber dennoch in Erstaunen“, gestand ich beeindruckt. „Ist das der neue Männermodetrend?“
Er sah mich an, als wäre ich von Gestern. Dass ich das tatsächlich war, wurde mir durch seine folgenden Worte bewusst.
„Wenn du nicht wie ein normaler Mensch aussehen würdest, noch recht jung an Jahren übrigens, würde ich meinen, du bist ein Außerirdischer.“
„Wieso Außerirdischer?“
„Weil deine Modefrage naiv ist. Seit fünfzig Jahren kleiden sich Männlein, Weiblein und Kindlein so. Sag‘ bloß, das weißt du nicht.“
„Das weiß ich nicht“, versetzte ich ihn noch mehr in Staunen, fügte aber klug hinzu: „Einfarbige Einheitskleidung.“
„Sonnenschutzkleidung“, behob er mein Unwissen, allerdings nicht ganz, denn eine solche Kleiderordnung hatte ich zu meinen Lebzeiten nie gesehen. Fast war ich geneigt zu sagen, dass ich vor wenigen Augenblicken der Hölle entstiegen war, mich vorher im Himmel befunden hatte und nun zu neuem Leben erwacht die Erde wieder betreten hätte. Doch unterließ ich das, weil er mich für verrückt erklärt hätte. Mir entkam die Frage, welches Jahr der Kalender zeige. Ich hoffte, er würde eins Ende des 20. Jahrhunderts nennen. Wie erschrak ich, als er den heutigen Tag in einem Jahr datierte, das mich zum ältesten Menschen gemacht hätte, wäre ich 400 Jahre alt geworden.
„Du bist scheinbar doch nicht von dieser Welt“, stellte er fest. „Kommst sicherlich vom Planeten Sixtus, mit dessen Regierung vor einiger Zeit ein gegenseitiger Besucheraustausch vereinbart worden war. Ich habe meinen Besuchswunsch schon angemeldet und hoffe, dass ich in spätestens zwei Jahren den Planeten betreten darf. Du scheinst einer menschenähnlichen Sixtusrasse anzugehören. Die Sixtusianer, die bisher unsere Erde besucht haben, sehen allerdings ganz anders aus.“
„Wie?“, fragte ich interessiert. Auch die Kuh bekundete Interesse.
„Sie sind von gedrungener Gestalt, haben einen breiten Kopf mit flacher Stirn und schielen. Kopfhaare besitzen sie nicht. Vermutungen, sie seien dumm, bestätigten sich nicht; wie wären sie sonst in der Lage, Raumtransporter zu bauen, mit denen sie uns erreichen.“
Nach einer kleinen Pause, die er nutzte, mich noch einmal intensiv zu betrachten, fragte er: „Bist du ein Sixtusianer, ja oder nein? Deine komischen Ohrringe lassen es vermuten.“
Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Was sollte ich antworten? Verneinte ich, würde er weitere Vermutungen anstellen, die mich in Erklärungsnot brächten. Bejahte ich, wäre mein Hiersein erklärt und ich würde mehr über sein eigentümliches Aussehen und das vorangeschrittene Erdalter erfahren.
Mehr als dreihundert Jahre war ich also der Erde fern, als ich mich im Himmel und dann in der Hölle aufgehalten hatte. Noch vor Minuten hätte ich geglaubt, es wären nur wenige Tage gewesen.
„Du hast es erfasst. Ich bin ein Sixtusianer von der erdabgewandten Seite des Planeten. Deshalb
weiß ich nichts von euren Lebensgewohnheiten“, log ich so überzeugend, dass selbst mich es erstaunte. Auch die Kuh überraschte meine Herkunft.
„Zunächst sei gesagt, dass unsere Erde infolge des ständig zunehmenden Klimawandels so warm ist, dass wir Menschen uns zur Abwehr der Sonneneinstrahlung so kleiden, wie ich gekleidet bin“, erklärte er. „Hemd und Hose sind aus hauchdünnen Aluminiumfäden gewebt, die Solarzelle auf dem Kopf versorgt den Akku des Herzschrittmachers mit Strom, damit derselbe gleichmäßig arbeitet. Vor vielen Jahrzehnten besaßen Herzschrittmacher nur herzkranke Menschen. Nun hat ein jeder einen solchen in sich, auch die Jüngsten, weil das Herz ohne diesen Helfer bei den vorherrschenden Umgebungstemperaturen schlapp machen würde. Dass es so ist, daran tragen wir Menschen selbst die Schuld. Hauptauslöser dieses Missstands war die ständig zunehmende Anzahl der Autos. Bald aber löste sich das Problem des Benzinverbrauchs von selbst, als die Erdölvorkommen versiegten. Nun sahen sich alle Autohersteller genötigt, solargetriebene Fahrzeuge zu produzieren. Auch hierbei wurde Einheitlichkeit angestrebt. Unterschiedliche Autotypen wie vor 400 Jahren, auch ausgefallene Protztypen für die Reichen, gibt es nicht mehr. Man fährt mit einem Solaris, wie ich ihn besitze. Er steht dort am Rand der Kuhweide.“
Ich trat an das Fahrzeug heran. Es hatte die Form eines Käfers und bestand in der Außenhaut aus vielen kleinen Solarzellen. Weshalb, war mir nun ohne Erklärung des Fremden bewusst.
„Mit diesem Fahrzeug bringe ich es bis auf 60 km/h. Schneller fährt auch kein anderes Auto. Verkehrsunfälle, wie sie vor Jahrhunderten üblich waren, gehören der Geschichte an. Mit diesem Gefährt bin ich auch nach Italien gefahren, um hier den Vesuv zu besteigen. Meinen nächsten Urlaub verbringe ich jedoch wieder in der Heimat, und zwar am Strand des Alexanderplatzes in Berlin. Dorthin zu fahren bedarf es einer kürzeren Zeit, als es die Fahrt hierher verlangt.“
„Strand am Alexanderplatz in Berlin?“, fragte ich zweifelnd.
„Jawohl, lieber Sixtusianer. Die Klimaveränderung hat die Meeresspiegel ansteigen lassen. Es gibt keine Kältepole mehr. Das Eis des Nord- und des Südpols ist vollständig geschmolzen. Der einstige Ostseestrand hat sich deshalb bis zum Alex in Berlin ausgeweitet.“
„Die Menschen, die einstmals zwischen dem eigentlichen Ostseestrand und dem jetzigen lebten, sind also ertrunken“, stellte ich erschauernd fest.
Der Fremde lächelnd: „Nicht alle, nur die, die eines natürlichen Todes starben und die, deren Körper die Hitzeeinwirkung nicht vertragen hatte. Die übrigen haben eine neue Heimstatt weiter südlich gefunden. Viele sind auch schon in Afrika ansässig geworden. Afrika ist das Ballungsgebiet europäischer Einwanderer. Die Bevölkerungsdichte wird bald unerträglich sein, da auch weiterhin Kinder hergestellt werden, obwohl es bei Strafe verboten ist, mehr als ein Kind zu zeugen. Ein Glück für die Menschheit, dass der Planet Sixtus entdeckt wurde, der sechsmal größer ist als die Erde. Deshalb Sixtus. Er befindet sich auch in Erdnähe. Aber das weißt du ja.“
Der Fremde legte eine Pause ein und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er dann weiter: „Wenn es dir recht ist, Sixtusianer, komm mit mir. Ich zeige und erkläre dir, was dich ebenfalls erstaunen wird. Du könntest mir vom Leben auf deinem Planeten ebenfalls berichten.“
Ein verlockendes Angebot, mich aus Luzifers Nähe zu entfernen. Doch mit 60km/h in der Stunde und ohne Sonnenschutzkleidung? Mich schauderte, eine Welt zu erleben, wie ich sie in meinem vormaligen Leben in einem amerikanischen Science-Fiction-Film gesehen hatte. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, so sehr hatte mich das Gesehene bedrückt und verängstigt.
„Du musst nicht mit ihm gehen“, ließ sich die Kuh wieder einmal hören. „Ich spüre, dass du Angst vor deinem Landsmann hast. Dass du kein Sixtusianer bist, wird er irgendwann erfahren. Bleibe bei mir; vor mir musst du dich nicht fürchten.“
„Ich bliebe gern, liebe Kuh, doch will ich …“
„Was höre ich da?“, unterbrach mich der Fremde, „du sprichst schon wieder mit der dummen Kuh?“
Kaum gesagt, klatschte ihm der Kuhschwanz einige Male ins Gesicht.
„Das ist doch die Höhe“, empörte er sich, „ein italienisches Rindvieh schlägt einen Deutschen.“
Der Kuhschwanz setzte das Klatschen umso heftiger fort. Dem Fremden flog der Hut mit der Solarzelle vom Kopf. Er wehrte sich mit den hässlichsten, nationalistisch gefärbten Beleidigungen, die die Kuh auf ihre Weise beantwortete. Das Brüllen des Fremden wurde immer lauter.
„Wer macht hier solchen Lärm?!“, war plötzlich eine weithin schallende Stimme vom Vesuv her zu vernehmen.
Mich durchfuhr ein eisiger Schreck. Die Stimme kannte ich; es war die des Höllenfürsten Luzifer. Die Kuh stellte das Klatschen ein. Der Fremde erstarrte und fragte, ob ihm Vesuv jemand wohne.
Die Antwort versagte ich ihm. Blitzschnell reagierte ich mit dem Befehl an die Zauberohrringe: „Tut was ich will, und zwar schnell! Bringt mich ins ausgehende 20. Jahrhundert!“
Ein Brausen und Zischen hub an, mir wurde schwindlig und dann ward es dunkel.
Hübsche Hilfe
Als es wieder hell wurde, lag ich bäuchlings am Rand einer Straße. Auf ihr rasten Autos in beiden Richtungen dahin. Mir stieg der Geruch ihrer Abgase in die Nase. Ich erinnerte mich, vor wenigen Augenblicken noch auf einer Kuhweide in der Nähe des Vesuvs gelegen zu haben. Dort war es wesentlich ruhiger gewesen. Ich vermisste die italienische Kuh und den deutschen Fremden, mit denen ich mich angeregt unterhalten hatte. Warum hatte ich dieses beschauliche Plätzchen verlassen? Ach ja – die Höllenstimme Luzis hatte mich aufgeschreckt und zum Sprechen der Zauberformel veranlasst. Die Wirkungsweise der Zauberohrringe war phänomenal. Ich befand mich wunschgemäß tatsächlich im 20. Jahrhundert. In welchem Jahr genau müsste sich bald feststellen lassen. Jedenfalls war es ein Zeitraum, der meiner einstigen Lebenszeit nahe war oder sich in dieser bewegte.
Ich war heilfroh, nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Teufels zu sein. Der würde die Suche nach mir allerdings nicht aufgeben, wie weit ich von ihm auch entfernen würde. Vielleicht hatte er seine Schwester Hexi zur Seite, die mich ebenso verbissen verfolgte, weil sie mich zu ihrem Ehemann und Erzeuger vieler Teufelchen machen wollte. Luzis Großmutter nähme an meiner Verfolgung bestimmt nicht teil, da sie hierfür zu alt war.
Weshalb mich das Zauberergebnis an einen Straßenrand gebracht hatte, konnte ich mir nicht erklären.
Befand ich mich noch in Italien am Rande des Vesuvs? Ich hob meinen Kopf und ließ meinen Blick schweifen. Tatsächlich, der Vulkan hatte seinen Standort nicht verändert. Hier, wo Autos in hohem Tempo dahinsausten, würde in vierhundert Jahren eine Kuh grasen und ein Deutscher in Sonnenschutzkleidung die Folgen des Klimawandels erklären.
An dieser gefährlichen Stelle durfte ich natürlich nicht liegen bleiben. Der Schwenk eines Autos nach rechts und ich wäre meinen Kopf los. Würde ich dann erneut tot sein oder den tödlichen Unfall überleben? Auf einen Versuch wollte ich es nicht ankommen lassen. Ich fühlte mich quicklebendig und körperlich fit. Ich war ja erst 25 Jahre alt, durch Luzi verjüngt. Hätte ich einen Spiegel bei mir, könnte ich mich betrachten.
Mit scharfem Bremsgeräusch hielt vor meiner Nase ein PKW. Ich hob meinen Kopf und sah zwei wohlgeformte Frauenbeine, die dem PKW entstiegen, auf mich zukamen und vor mir in die Knie gingen. Die leicht gespreizten Knie ließen meinen Blick zwischen sie dringen und ich sah, was ich seit langem nicht mehr gesehen hatte: einen hauchdünnen, stoffarmen Slip.
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Mich machte das Klopfen froh, denn ich besaß wieder ein schlagendes Herz, das ich weder im Jenseits noch in der Hölle verspürt hatte.
„Hallo, junger Mann“, vernahm ich eine weibliche Stimme, „bist du noch am Leben?“
Eine Hand strich vorsichtig über meine Kopfhaare, die sich unter dieser Zärtlichkeit leicht hoben.
Was sollte ich antworten? Dieses Streichelgefühl wollte ich noch einen Augenblick genießen, weshalb ich antwortete: „Nein!“
„Wie ‚Nein‘“, fragte die Stimme, „lebst du noch oder nicht mehr?“
Ich hätte antworten können, dass ich schon mal tot war, doch unterließ ich das aus Pietätsgründen. Ich hob meinen Kopf höher, so hoch, dass ich die Person, zu der die Stimme gehörte, in Gänze sah. Mein Herzklopfen wurde heftiger, denn die Person war eine bildhübsche junge Frau. Ebenso blond wie Marylin Monroe und - wie ich im Augenblick empfand - ebenso hübsch. Zwei blaue Augen guckten mich teilnahmsvoll an. Die roten Lippen des Mundes öffneten sich zur nächsten Frage, ob ich Schmerzen verspüre.
„Ihre zarten Hände tilgen körperliche Schmerzen, bereiten aber seelische“, gab ich gequält von mir.
„Oh, ein Deutscher“, zeigte sie sich erfreut, „und ein Schwerenöter dazu.“
„Schwerenöter?“, fragte ich enttäuscht.
„Ja, denn mein Streicheln erhöht die Schwere der seelischen Not, in der du dich befindest.“
„Ach so“, meinte ich erleichtert.
„Wie bist du an den Rand einer italienischen Schnellstraße geraten? Haben dich Mafiosi ausgesetzt, nachdem sie dich deines Geldes oder einiger lebenswichtiger Organe beraubt haben? Erbärmlich gekleidet bist du ja.“
Einer raschen Eingebung folgend sagte ich, dass ich beraubt worden sei und die Mafiosi mich hier achtlos abgelegt hätten. Die Lüge würde meine dürftige Bekleidung - immer noch das
zerschlissene Hemd und die durchgewetzte Hose – glaubwürdig machen. Würde ich allerdings gestehen, dass ich so schäbig in den Sarg gelegt worden war, weil meine sparsamen Nächsten sich wohl gesagt hatten, dass die Würmer nicht nur mich, sondern auch die Kleidung zerfräßen, hätte ich die Schöne in die Flucht geschlagen. So aber rührte mein Aussehen ihr Herz und sie wollte wissen, ob mein Geld oder meine Nieren – Nieren seien im Moment sehr gefragt – von den Mafiosi genommen worden seien.
Ich umging die Nieren und erwiderte, dass man mir den Blinddarm genommen hatte. Was übrigens stimmte.
Sie winkte ab und erklärte, dass der nicht so wichtig sei. Sie wolle mich nicht hilflos liegen lassen und würde mich mit ihrem Auto zur nächsten Polizeistation bringen, in der ich Anzeige gegen die Mafiosi stellen könnte.
Sie fasste mich hilfsbereit unter und ich tat, als fiele mir das Aufstehen und der Gang zum Auto schwer. Ich spürte den sachten Druck ihrer Brust und wollte ihn noch lange spüren. Mein Gott, wie lange war es her, dass ich die Brust meiner Gattin in die Hände nehmen durfte. Mit den Brüsten dieser jungen Frau dürfte ich’s nicht wagen; Gott Gottlieb würde das ebenfalls nicht gutheißen. Ich hatte das Gefühl, dass er mich längst entdeckt hatte und mein weiteres Tun argwöhnisch beobachtete. Sicherlich fragte er sich, wie ich auf die Erde zurückgekommen war. Von meinem Zwischenaufenthalt ihn der Hölle wusste er bestimmt.
„So“, sagte die Hübsche erleichtert, „jetzt habe ich dich im Wagen.“
Noch bevor sie das Auto, dessen Verdeck aufgeklappt war, startete, guckte sie mich misstrauisch an und fragte, ob ich homosexuell sei.
„Was veranlasst Sie zu dieser Frage?“
„Die altertümlichen Ohrringe, die dir an den Ohren baumeln. Ohne die würdest du sympathischer aussehen.“
„Ich bin nicht schwul. Die Ohrringe sind ein Geschenk meiner Großmutter, die mich vor ihrem Ableben bat, sie stets zu tragen, weil sie mir Glück bringen würden.“ Dass ich des Teufels Großmutter beraubt hatte, ließ ich natürlich ungesagt.
„Und - haben sie dir Glück gebracht? Die Mafiosi haben sie nicht fern gehalten.“
„Ihre Wirkung beschränkt sich auf deutsche Lande“, log ich unverblümt weiter.
„Dann nimm sie in Italien ab. Die Carabinieri, du weißt, wen ich meine, würden dich als Schmuckräuber alter Frauen inhaftieren. Klauen ist zwar eine Lieblingsbeschäftigung der Italiener, doch würde dein Diebstahl den Polizisten nicht gefallen. Du hast hoffentlich Ausweispapiere bei dir, mit denen du deine Unschuld andeuten kannst.“
Die Hübsche hatte etwas berührt, was ich bisher nicht bedacht hatte. Guter Rat war nun teuer. Legte ich die Ohrringe ab, könnte ich nicht zaubern. Das sagte ich natürlich nicht.
Sie weiter: „Wenn nicht die Ohrringe, dann hast du das Fernglas gemopst, das dir am Hals hängt. Ein Bettler mit einem Fernglas wirkt höchst verdächtig.“
Mir trat Schweiß auf die Stirn. Ich transpirierte wie ein völlig intakter Mensch. Nicht intakt war mein Gewissen. Würde sie mir glauben, wenn ich sagte, dass es ebenfalls ein Geschenk ist. Vom lieben Gott geschenkt müsste ich verschweigen.
„Lass‘ mich mal durchsehen“, bat sie und nahm das Glas an sich.
Während sie in die Ferne guckte, besah ich mein Gesicht im Rückspiegel des Autos. Seit meiner letzten Betrachtung im Empfangsraum der Hölle hatte ich mich noch nicht wieder gesehen. Ich gefiel mir. Mein Gesicht glich dem, mit dem ich meine Gattin als meine Verlobte einst entzückt hatte. Allerdings war ich momentan sehr unrasiert und deshalb wenig Vertrauen erweckend. Auch meine Haare, sie bedeckten wieder gänzlich meinen Kopf, standen in allen Richtungen zu Berge.
„Ich glaub‘ es nicht!“, rief die Schöne plötzlich verwundert und erschrocken.
„Was entsetzt dich, du holde Schöne?“, fragte ich. Meine verbale Liebkosung überhörte sie, weil ihr das göttliche Fernglas etwas Unfassbares zeigte. Ihre schöne Brust hob und senkte sich rasch unter ihren erregten Atemzügen.
„Mein Freund treibt es mit einer anderen, wahrscheinlich einer Itakerin!“
„Was du nicht sagst“, wollte ich ihr nicht glauben. So eine gezielte Sichtweite traute ich dem Glas trotz seiner göttlichen Herkunft nicht zu.
„Sieh selbst!“, sagte sie erregt und drückte es mir in die Hand.
Ich hielt es an die Augen und blickte in die Richtung, in die auch sie geguckt hatte. Ich sah aber keinen Freund, von dem ich sowieso nicht wusste, wie er aussieht, sondern den Papst im Papstklo beim Stuhlgang. Er saß, den hinteren Teil seines langen Papstgewandes nach oben gerafft, auf einem Toilettenbecken und machte ein angestrengtes Gesicht. Hinter einer spanischen Wand stand ein Priester mit einer Pistole in der Hand. Zunächst dachte ich, er sei ein Attentäter und wolle den Papst erschießen, dann aber fiel mir ein, dass seine Heiligkeit auf Schritt und Tritt bewacht wird.
„Er pisst oder kackt“, kommentierte ich seine Haltung.
„Was quatscht du da?“ Die Erregung der Schönen ließ ihr hübsches Gesicht zornesrot werden. „Er knutscht und kackt nicht! Kannst du so etwas nicht unterscheiden?“
„Liebst du den Papst?“, versuchte ich, ihre Erregung zu dämpfen.
„Den alten Sack? Ich glaube, du spinnst!“
„Dann hast du deinen Freund mit dem Papst verwechselt.“
„Ich werde doch noch wissen, wie mein Freund aussieht!“ Sie riss das Fernglas wieder an sich und drückte es vor ihre himmelblauen Augen. Was sie nun sah, kommentierte sie mit den Worten: „Was für eine Sauerei! Die ganze Mühe umsonst!“
Ich glaubte, der Papst habe daneben gekackt, sie aber weiter: „Da hat die gute Frau die frisch gewaschene Wäsche zum Bleichen auf die Wiese gelegt und ist ins Haus zurückgekehrt, da kommen doch diese Italiener und scheißen auf die Wäschestücke.“
„Wo kommen plötzlich Italiener her?“, fragte ich verständnislos, obwohl wir in Italien waren. „Der Papst sitzt auf dem Klo und nicht auf Wäschestücken.“
Nun bekam ich zu spüren, wie unerfreulich es für mich wäre, wäre ich der Freund der Zornbebenden.
„Du kennst wohl nicht den Unterschied zwischen Italienern und dem Papst? Italiener gackern und der Papst predigt. Sie legen Eier und er nicht. “
Nun zweifelte ich an ihrem Verstand. Gackernde und Eier legende Italiener.
Weil sie merkte, dass mein Wissen lückenhaft ist, klärte sie mich über die Hühnerrasse ‚Italiener‘ auf.
Um nicht als völlig Unwissender zu gelten, fügte ich bei, dass es auch Putt-Hühner gebe.
„Wie bitte?“
„Das sind sprachlich intelligente deutsche Hühner, die sofort herzukommen, wenn man ‚Putt-Putt‘ ruft.“