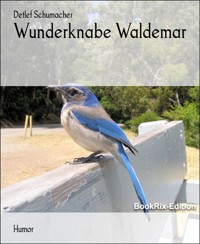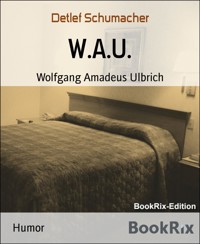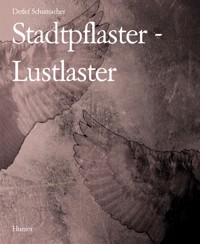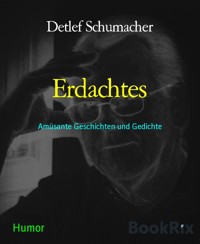0,00 €
Mehr erfahren.
Zugegeben, der Titel weckt keine ästhetischen Empfindungen, aber er macht neugierig. Hoffentlich! Wer erotische Literatur mag, vor allem solche mit einem Schuss Humor, der wird vom Inhalt dieses Buches nicht enttäuscht sein. Ein Mann in bestem Alter erzählt von seinen Liebesabenteuern, die ihm nicht nur Lust, sondern auch Frust am Sex bereitet haben. Das alles ist so fern der Glaubwürdigkeit, dass die eigene Moral keinen Schaden nehmen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der flotte Otto
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenFrau M.
Mit meiner Ehefrau Dagmar, die ich in zärtlichen Momenten auch Daggi nenne, führe ich ein überwiegend entspanntes Eheleben. Nur wenn sie wieder einmal die Lust packt, vollziehen sich kurzzeitige Veränderungen in meinem Tagesablauf. Dann muss ich ran wie Mops an die Möhren und meinen bequemen Schaukelstuhl verlassen, in dem ich ab und zu meine Seele wippen lasse. Habe ich meine Pflicht getan, sind meine Bewegungen etwas eingeschränkt, weil Daggi während unserer sexuellen Vereinigung lustvolle Sprünge vollführt hatte, die ich notgedrungen mitmachen musste. Neulich trug ich eine Kopfverletzung davon, weil unserem Springturnier die Schrankwand im Wege stand.
So ausgelassen kann meine Gattin nicht immer sein. Die eintretende Schonzeit nutze ich, um neue Energien zu sammeln. Ich tanke meinen Körper mit frischen Kräften auf, um recht schnell wieder der flotte Otto zu sein, als der ich bei dieser oder jener Dame in unserer Stadt beliebt bin. Viele Dinge des täglichen Begehrs weiß ich zu verrichten. So ist es mir bisher stets gelungen, die jeweilige Auftraggeberin zu befriedigen.
So auch eine gewisse Frau M., deren vollständigen Namen ich aus Diskretionsgründen nicht nenne. Neulich fragte sie telefonisch, ob ich ihren CD-Player wieder flott machen könne. Er hätte sich heiß gelaufen. Wenn mir das gelinge, würde sie mir, wie gehabt, einen Herzenswunsch erfüllen.
Da ich Frau M., den CD-Player und den Herzenswunsch bereits kannte, schaute ich kurz in mein Notizbüchlein, um zu ergründen, an welchem Tage meine Gattin wieder beim Friseur weilen würde. Als ich das ermittelt hatte, sagte ich Frau M. für besagtes Datum meine Hilfe zu.
Die wiederum überprüfte, ob sich ihr Gatte zu diesem Zeitpunkt auf Montage befinden werde. Da es terminlich passte, bereitete sie sich auf die Empfängnis vor.
Ausgerüstet mit meinem Reparaturköfferchen, einem Strauß Wicken für 1,50 € und einem Kondom, das ich vorbeugend dabei habe, erschien ich bei ihr am Vormittag des nächsten Tages. Wie vermutet, befand sich Frau M. noch im Negligé, dessen hauchdünnes Gewebe sehen ließ, was besser hätte verdeckt bleiben sollen. Bekannt für mein forsches Vorgehen drückte ich ihr die Wicken in die Hand und erkundigte mich nach dem überhitzten CD-Player. Sie deutete auf das mit allerhand nackten Porzellanfigürchen besetzte Vertiko, zwischen denen der Player qualmte. Ein kurzer Blick auf ihn veranlasste mich zur Feststellung, dass es wieder mal im Eimer sei.
Frau M. hatte mich missverstanden, weshalb sie eilte, einen bis zur Hälfte mit klarem Leitungswasser gefüllten Eimer zu bringen. Nachdem sie ihn vor mir abgestellt und das Blumensträußchen in ihm versenkt hatte, hauchte sie aus frisch lackiertem Munde, dass meine Wicken zum … - sie errötete gekonnt - einlüden.
Da ich befürchtete, die Reparatur des Players darüber zu vergessen, machte ich sie auf diesen Umstand aufmerksam. Sie stieß ein kurzes, verächtliches „Pah!“ aus, was mich annehmen ließ, dass sie an einem intakten Player im Moment nicht interessiert sei.
Weil ich meinen Ruf als flotter Otto nicht in Verruf bringen wollte, beschritt ich den umgekehrten Weg. Ich schnappte den CD-Player, der so heiß war, dass ich mir die Finger verbrannte. Aufgrund des Schmerzes fegte ich ungewollt einige Porzellanfigürchen zu Boden. Während sie zerschellten, ließ ich den Player in den Wassereimer fallen. Die in ihm befindlichen Wicken kräuselten sofort die Blüten. Das Eimerwasser begann zu dampfen und zu zischen und wurde augenblicklich zu Wickensuppe.
Frau M., die dieser Verlust nicht grämte, meinte leichthin, dass sich auch ohne Wicken gut Flirten lasse. Vielleicht sei ein Tässchen Kaffee anregend. Sie ging, denselben zu kochen.
Weil der CD-Player beim Eintauchen ins Wasser noch mit dem Stromnetz verbunden war, unterbrach die elektrische Hauptsicherung die weitere Stromzufuhr. Das hatte zur Folge, dass Frau M. vergeblich auf das Brodeln des Kaffeewassers wartete.
„Ottochen!“, rief sie mir zu, „ich glaube, es ist Stromsperre. Wie dumm aber auch, nun kann ich keinen Kaffee kochen.“
„Halb so schlimm“, rief ich beruhigend zurück, „kochendes Wasser habe ich hier.“
Sie tänzelte herzu, die zwei mit etwas Kaffeepulver gefüllten Tassen auf den Tisch stellend.
Ich zog den CD-Player aus dem Eimer und goss ein wenig des kochenden Wassers in die Tassen. Mit spitzem Mündchen prüfte Frau M. die Temperiertheit des Kaffees. Weil sie mit dieser zufrieden war, schlürfte sie den braunen Sud genüsslich in sich. Ihr Kommentar: „Köstlich, einfach köstlich dieser besondere Geschmack!“
Da es sie nach weiterem Kaffeegenuss verlangte, füllte sie die Tasse erneut mit Kaffeepulver und ich dieselbe mit Eimerwasser. Kaum hatte sie auch diese geleert, rülpste sie unanständig, verdrehte die Augen, nahm eine blasse Gesichtsfarbe an und streckte sich bewusstlos auf dem Teppich aus.
Mir war das peinlich, weil das nach oben gerutschte Negligé ihren nackten Unterkörper sehen ließ. Dergestalt erweckte sie den Eindruck, mit dem Ankleiden nicht fertig geworden zu sein.
Weil ich sie so nicht liegenlassen wollte, zupfte ich das verrutschte Negligé zurück, und zwar so weit, dass auch ihre Knie bedeckt waren. Das war des Guten jedoch zuviel, denn nun lagen ihre voluminösen Brüste frei. Deshalb zupfte ich den kurzen Fummel wieder nach oben. Weil die Bedeckung ihres ausgedehnten Brustbereichs mehr Negligé beanspruchte, als vorhanden war, entblößte sich ihr vaginaler Bereich erneut.
Ich war nun ratlos. Ich war gekommen, ihren CD-Player zu reparieren und nicht, ihr verrutschtes Negligé zurecht zu zupfen. Da an dem Player ohnehin nichts mehr zu retten war, nahm ich ihn vom Boden auf und warf ihn aus dem Fenster. Frau M. würde also gezwungen sein, sich einen neuen zu kaufen, und ich hätte einige Zeit Ruhe vor ihr.
Während ich das erleichtert feststellte, ertönte von draußen her lautes Wehgeschrei. Ich eilte ans Fenster und sah, dass ein Mann auf dem Bürgersteig lag und heftig mit den Gliedmaßen zappelte. Er schien Schmerzen zu haben. Rasch fanden sich Passenten ein, die ihn neugierig umstanden. Eine ältere Dame, mit einem altmodischen Hut auf dem Kopf, wies mit ihrem Krückstock in meine Richtung und krächzte: „Genau von dort her ist dem Herrn ein Gegenstand auf den Kopf geworfen worden!“
Die Blicke der Passanten wandten sich vom Zappelnden ab und dem Fenster zu, aus dem ich guckte.
Eine junge Frau, seit zwei Jahren verwitwet, erkannte mich und rief erfreut: „Hallo, Herr Sauseschritt, schön Sie zu sehen! Meine Waschmaschine ist wieder mal defekt. Würde es Ihnen etwas ausmachen, sie zu reparieren?“
Ich antwortete nicht, weil ich es pietätlos fand, in Gegenwart eines verletzten und vor Schmerzen wimmernden Mannes eine solche Frage zu stellen. Ich nahm meinen Kopf aus der Fensteröffnung und wandte ihn wieder Frau M. zu.
Sie lag noch immer so, wie ich sie vor wenigen Augenblicken verlassen hatte. An der geringfügigen Hebung und Senkung ihres strammen Busens erkannte ich, dass noch Leben in ihr war. Mich beschäftigte nun die Frage, wie ich ihr nach dem Erwachen klar machen sollte, dass ich den Kassettenrekorder entsorgt hatte.
Sinnend blickte ich auf ihren Körper und entdeckte, dass sie in Nähe des Bauchnabels einen hässlichen Leberfleck und am rechten Fuß zwei beachtliche Hühneraugen besaß. Den Leberfleck hätte ich nie und nimmer erblickt, wenn er vom Negligé bedeckt gewesen wäre. Bei den Hühneraugen wäre es etwas anderes gewesen. So lang war ihr Negligé nicht, dass es die Hühneraugen hätte verbergen können.
„Nun ja“, sagte ich mir, „warum soll Frau M. nicht mit vier Augen sehen können.“
Dann wandte ich mich der Überlegung zu, weshalb sie bewusstlos geworden war. Als ich da anlangte, dass vielleicht das ungewöhnliche Kaffeewasser der Urheber gewesen sein könnte, seufzte sie aus voller Brust, als wollte sie bejahen. Um sie vor weiterem Gebrauch dieses unreinen Wassers zu bewahren, schnappte ich den Eimer, ging erneut ans Fenster und entleerte ihn mit einem tüchtigen Schwung.
Das Wasser platschte nicht nur auf den Bürgersteig, sondern zum Teil auch auf die Mütze eines Polizisten, der sich zu den Neugierigen gesellt hatte, die den zappelnden Mann umstanden.
Der Bulle - wie ich stilistisch geschickt formulieren will, damit sich das abgedroschene Wort Polizist nicht wiederholt -, schaute ärgerlich zu mir empor.
Weil einige Leute über seine Anfeuchtung lachten, schnob er in meine Richtung: „Wir sprechen uns!“
Um ihm das Gespräch unter vier Augen zu erleichtern, denn Leute seines Schlages führen ihre Untersuchungen nicht gern in Anwesenheit anderer Personen durch, eilte ich ins Erdgeschoss und öffnete ihm die Tür. Ohne ein Wort des Dankes trat er ein. Ich hingegen begrüßte ihn höflich und bat ihn, Platz zu nehmen, obwohl kein Stuhl vorhanden war.
Diese gut gemeinte Geste verärgerte ihn noch mehr, weil er glaubte, ich wolle seinen Respekt untergraben.
„Zeigen Sie sofort Ihre Hände vor!“, forderte er barsch. Das klang jedenfalls angenehmer als: „Hände hoch!“
Dennoch wollte ich meine Hände nicht vorzeigen, da ich glaubte, er wolle die Sauberkeit meiner Fingernägel überprüfen. Man hört und liest in letzter Zeit so viel über Leute, die ihre schmutzigen Pfoten überall drin haben sollen. Zu denen gehöre ich nicht.
Weil ihm meine scheue Zurückhaltung zu lange dauerte, ergriff er meine Hände und verband sie mit verchromten Handschellen. Ich war verblüfft, denn zu DDR-Zeiten wurden Missetätern unansehnliche, meist schon vom Rost befallene gusseiserne Handschellen angelegt.
„Gestatten Sie eine Frage, Herr Gendarm“, bat ich um seine Aufmerksamkeit, „seit wann verfügen Sie über diese aparten und nicht billig aussehenden Schließeisen?“
In seiner Erregung hatte er wohl „Schieteisen“ verstanden, was ihn veranlasste, mich grob mit sich zu zerren.
„Wohin des Wegs, Genosse Ordnungshüter?“, fragte ich hinter seinem Rücken.
Irgendetwas schien ihm an meiner Fragestellung missfallen zu haben, denn er grunzte: „Da habe ich ja einen feinen Fang gemacht. Sozi, was?“
„Sozi nicht, aber Sozius, weil ich mit meiner Gattin hin und wieder durchs Schlafzimmer reiten muss.“
In diesem Augenblick ertönte von der oberen Etage her ein schriller Schrei, ausgestoßen von Frau M.
Der Pistolero stutzte und fragte mich, ob er aus dem Munde meiner Gattin gekommen sei.
Ich wollte verneinen, ließ mich dann aber von der fixen Überlegung leiten, dass es besser sei zu bejahen, weil …“ -
„Mitkommen!“ unterbrach er meine Denktätigkeit. Während er die Treppe hinan schritt und ich gezwungen war, ihm zu folgen, ertönte ein weiterer Schrei aus der oberen Etage.
Der Schutzmann zog mich, nachdem wir eiligen Schrittes die Stufen genommen hatten, ins Wohngemach der Frau M. Wie wunderte ich mich, sie nicht mehr auf dem Teppich liegen zu sehen.
„Huhu, Frau M., wo sind Sie?“, rief ich in alle Richtungen des möblierten Zimmers.
Der Polizist, der über einen erstaunlichen Intelligenzgrad zu verfügen schien, fragte mich: „Wer ist Frau M.?“
„Sie ist die Inhaberin dieser Wohnung.“
Sein Gehirn begann zu arbeiten.
„Weshalb reden Sie Ihre Frau mit Frau M. an?“
„Sie möchte das so“, reagierte ich rasch.
In diesem Moment ertönte erneut ein schriller Schrei aus dem Munde der Frau M.
Der Ordnungshüter nahm Witterung auf und hatte recht bald die Richtung ausgemacht, aus der der helle Ruf erklungen war. Er zerrte mich in ein Zimmer, das ich als das Badezimmer der Frau M. erkannte. In diesem hatte ich einige Male Reparaturen vornehmen müssen. Die letzte hatte ich an einer Rohrmuffe verrichtet, der dann ihre Muffe folgte, bis sie Muffensausen bekam, weil es an der Haustür geklingelt hatte. Sie glaubte, ihr Gatte sei überraschend heimgekehrt. Es war aber nur der Postbote.
Im Badezimmer bot sich dem Schutzmann und mir folgender Anblick: Frau M. kniete vor dem Toilettenbecken und hielt den Kopf in das Innere desselben.
„Sie wird etwas suchen“, flüsterte ich dem Bewaffneten ins Ohr, um Frau M. nicht zu erschrecken.
Weil aus dem Becken abgehackte Geräusche drangen, flüsterte er zurück: „Sie telefoniert mit Moskau.“
Ich nickte, denn die russische Sprache klingt bei weitem nicht so fließend wie die deutsche.
„Was sie wohl sagt?,“ flüsterte ich erneut, um das Allgemeinwissen des Uniformierten zu testen. Man hört ja so viel über die geistigen Fähigkeiten dieser Berufsgruppe.
Er musste sein Gehirn nicht weiter bemühen, denn Frau M. erhob sich. Gliederzitternd näherte sie sich dem Badspiegel, einem großen, ovalen, im Baumarkt erstandenen. In den guckte sie flackernden Blicks und war sogleich über ihr Aussehen entsetzt. Von ihrer rot lackierten Unterlippe troff Speichel.
Wie sie nun stand, weitere Auffälligkeiten an ihrer Visage zu entdecken, richtete sich das Augenmerk meines Begleiters auf ihr nacktes Gesäß. Der untere Teil ihres ohnehin sehr knapp bemessenen Negligés hatte sich in Hüfthöhe verschoben. Das war sicherlich passiert, als sie das Telefonat mit der russischen Hauptstadt geführt hatte.
Am Zittern der verchromten Handschellen spürte ich, dass den Schupo etwas erregte. Leise fragte ich ihn, ob er etwas entdeckt habe, was einer Indizaufnahme dienlich sei. Statt einer Antwort schob sich seine Zungenspitze zwischen den Lippen nach außen, und das sah so aus, als wollte er eine Briefmarke belecken. Weil mich das stärker werdende Zittern der Handschellen schmerzte, bat ich ihn, mich von diesen zu befreien. Geistesabwesend reichte er mir den Schlüssel. Ich löste unsere Verbindung. Auf leisen Sohlen verließ ich das Badezimmer, um die Untersuchungen des Staatsangestellten nicht zu behindern.
Ich betrat den Schlafraum, weil mir eingefallen war, dass ich beim letzten Besuch in diesem meine Sockenhalter zurückgelassen hatte. Während ich damit beschäftigt war, ihren Verbleib zu erkunden, drang ein Röhren an meine Ohren, wie ich es einmal bei einem brunftigen Hirsch vernommen hatte. Dieses für diese Umgebung ungewöhnliche Geräusch kam vom Badezimmer her. Ihm folgten Laute, wie sie Menschen ausstoßen, wenn ihnen ein Leids geschieht. In diese mischten sich erstaunlicherweise auch jauchzende Töne, die sogleich wieder von mehrfachem Stöhnen verdrängt wurden.
Sofort stellte ich die Sockenhaltersuche ein, um zu erfahren, welche Ursache diese Laute haben könnten. Mein Ansinnen geriet ins Stocken, als die Tür eines Kleiderschranks aufflog und aus diesem eine Gestalt heraus trat, die verblüffende Ähnlichkeit mit einer modisch gekleideten Vogelscheuche hatte. Sie gab unartikulierte Töne von sich. Dabei rüttelte und schüttelte sie sich, als wollte sie sich ihrer Verkleidung entledigen.
Ich half ihr dabei. Mit wenigen Handgriffen hatte ich sie entblößt. Wie staunte ich, in dem Nackten den Ehemann der Frau M. zu sehen. Weil ihm das peinlich war, bedeckte er die intime Stelle seines Körpers mit meinen Sockenhaltern, die ihm am rechten Handgelenk hingen.
„Wo haben Sie die gefunden?“, fragte ich erfreut.
Er antwortete, allerdings nur undeutlich, weil ihm ein Tanga-Slip seiner Frau im Mund steckte. Als er ihn ausgespuckt hatte, brach es aus ihm heraus: „Eine Sauwirtschaft in diesem Kleiderschrank. Typisch für diese Schlampe, die von früh bis spät nichts anderes im Kopf hat, als sich Musik vom CD-Player anzuhören. Wenn mich die Wut packt, werfe ich das Ding aus dem Fenster.“
Als ich ihn wissen lassen wollte, dass ich das bereits getan habe, erklang erneut das Brunftgestöhn vom Badezimmer her.
„Haben Sie das gehört?!“, fragte mich Herr M. noch wutentbrannter.
Ich hatte keinen Grund, das zu verneinen.
„Das Aas glaubt, ich sei auf Montage. Seit einigen Wochen verstecke ich mich immer dann im Kleiderschrank, wenn sich dieser perverse Installateur bei ihr angemeldet hat. Was der bei ihr installiert, weiß ich. Das habe ich inzwischen herausbekommen. Ha!!!“ stieß er triumphierend aus, „von heute an ist Schluss mit lustig. Jetzt überführe ich Beide auf frischer Tat. Dem Kerl trete ich so heftig vor die Hoden, dass ihm das Bumsen ein für allemal vergeht. Und meiner Frau trete ich so kräftig in den Hintern, dass sie einige Tage nicht sitzen kann.“
Die anhaltenden Brunftlaute steigerten seine Empörung. Weil er unbekleidet nicht vor seine Frau hintreten wollte, versuchte er, in ein Beinkleid zu steigen. Während er dies tat, fragte er mich beiläufig, wer ich sei und was ich hier zu suchen habe. Ich sagte, dass ich meine zurückgelassenen Sockenhalter hier zu finden hoffte.
„Und, haben Sie sie gefunden?“, fragte er immer noch beiläufig, weil er das rechte Hosenbein entknoten musste.
Ich bejahte und wies auf die an seinem rechten Handgelenk baumelnden Sockenhalter hin.
„Suchet und ihr werdet finden, sagt die Bibel“, meinte er.
Er reichte mir die Halter und stürmte dann grimmig gen Badezimmer.
Ich verließ erleichtert das Haus, denn endlich hatte ich meine Sockenhalter wieder. Sie waren ein Weihnachtsgeschenk meiner Frau.
Annabell
Unserer Ehe war bislang ein Mädchen entsprossen. Es zählte inzwischen 25 Jahre und hatte noch immer keinen festen Freund. Wir gaben ihr den Namen Annabell, weil bei ihrer Geburt Nachbars Hündin Anna bellte. Sie lebt so in den Tag hinein, statt uns einen passenden Schwiegersohn zu bescheren. Beim morgendlichen Blick in den Spiegel schreckt sie jedesmal vor ihrer geringen Schönheit zurück. Wenn sie doch nur ein bisschen von mir als ihrem Erzeuger mitbekommen hätte. Äußerlich wäre das auf jeden Fall von Vorteil gewesen. Innere Werte erwecken zwar auch Aufmerksamkeit, doch weiß kein Mensch, wo sie die ihren versteckt hält. Ich begreife meine Gene nicht. In wen sind sie nur gedrungen?
Vielleicht sollte ich das weitere Heranwachsen Ernst-Rudolfs abwarten, den ich versehentlich vor etwas mehr als einem Jahr mit Kunigunde Nimmersatt gezeugt hatte. Beim Versuch, eine defekte Sprungfeder ihres Kanapees auszuwechseln, war ich abgerutscht. Sie wollte mir helfen, hatte dabei aber eine falsche Stellung eingenommen.
Oder sollte ich das Wachstum der nun schon zehnjährigen Erika weiter verfolgen, die das Ergebnis eines tollkühnen Versuchs ist, den ich mit Frau Schnakenhasch aus Schleswig-Holstein vorgenommen hatte. Frau Schnakenhasch, damals bei ihrer hiesigen Cousine weilend, verstieg sich in die Behauptung, ich sei beschämend unsportlich, wenn ich den Sprung über das Bett, in dem sie nackt liege, nicht vollbringen würde. Unsportlichkeit wollte ich mir von einer Schleswig-Holsteinerin nicht nachsagen lassen und wagte deshalb den Sprung. Um weniger Gewicht und mehr Schwung in den Sprung zu bringen, hatte ich mich meiner gesamten Kleidung entledigt. Leider erreichte ich die andere Bettseite nicht, weil Frau Schnakenhasch meinen Sprung mit ihrem emporschnellenden rechten Fuß zu Fall brachte. So lag ich denn auf ihr und bezeigte mit mancherlei zeugenden Bewegungen, dass ein neudeutscher Bundesbürger kein unsportlicher Typ ist.
Mit der Übertragung der Gene ist das so eine Sache. Tochter Annabell ist so frigid, dass man ihr bedenkenlos einen nackten Mann auf den Bauch binden kann. Um ihre frauliche Begierde auf anschauliche Weise zu wecken, vollzogen Daggi und ich einen Geschlechtsakt vor ihren Augen. Mit dem bedauerlichen Ergebnis allerdings, dass sie meckerte: „Ihr seid Schweine! Wie soll ich den Teppich sauber kriegen, den Papa eben bekleckert hat?“
Als wohlmeinende Eltern hegen wir die Hoffnung, dass Annabell irgendwann einmal an den Mann kommt.
Jüngst glaubten wir, es sei soweit. Annabell, sonst damit beschäftigt, sich Micky-Maus-Hefte anzugucken, sah unentwegt aus dem Fenster auf den Bürgersteig, auf dem sich Passanten unterschiedlichen Geschlechts und Alters bewegten. Ihr Gesicht verriet nicht, auf wen oder was sie sich konzentrierte. Scheinbar gelangweilt sah sie nach draußen.
Daggi und ich, erwartungsvoll hinter ihr stehend, konnten ebenfalls nichts Aufregendes entdecken. Schon wollten wir uns enttäuscht abwenden, da straffte sich Annabells Oberkörper und lehnte sich samt Kopf weit aus dem Fenster, fast zu weit. Daggi unterdrückte einen Aufschrei. Auch ich befürchtete, Töchterchen wolle ihrem jungen Leben ein Ende setzen.
Spontan dachten wir: Warum ausgerechnet aus dem ersten Stock? Er ist nicht hoch genug. Dass sie uns um einen zeugungsfähigen Schwiegersohn und gezeugte Enkel bringen würde, daran dachten wir momentan nicht. Eine Schrecksekunde lässt offenbar nur Nebensächliches vermuten.
Vor dem vermeintlichen Sprung stieß Annabell plötzlich den weithin schallenden Ruf aus: „Da ist er wieder!“
Sofort schnellten unsere Blicke in Richtung Straßengeschehen, um den ausfindig zu machen, dem Annabells Aufmerksamkeit galt. Wie sehr wir unsere Augen auch bemühten, wir konnten ihn nicht sehen. Auch deshalb nicht, weil Annabell sich wieder in Schweigen hüllte und uns eine Personenbeschreibung vorenthielt. Dennoch waren wir froh, dass sie den Sprung aus dieser geringen Höhe nicht gewagt hatte.
Ihre Verschlossenheit währte nicht lange. Erneut schreckte sie uns mit dem Hinweis auf: „Da ist er wieder!“
Unsere Blicke erfassten erneut das Straßengeschehen. Enttäuscht stellten wir fest, dass da mehrere Passanten waren, denen Annabells Interesse gelten konnte. Daggi hielt es nicht länger zurück. Eilig verließ sie den Raum und befand sich wenig später inmitten des Bürgersteiggetümmels. Sie fasste eine männliche Person am Jackenärmel und rief zu uns herauf: „Ist es der?“
Annabell blieb stumm.
„Du musst deiner Mami antworten, wenn sie dich etwas gefragt hat“, erinnerte ich sie an die gute Erziehung, die sie durch uns erfahren hatte. Sie erinnerte sich nicht und blieb wortlos.
Daggi erfasste den nächsten Mann, versehentlich einen älteren. Als sie entschuldigend von ihm ließ, fragte der, ob sie mit auf seine Bude kommen wolle. Er sei allein, seine Frau befinde sich auf dem Friedhof. Daggi sprach ihm ihr Beileid aus. Der Alte erklärte, dass sie das Grab der Kinder pflege. Das tue sie täglich von Morgens bis Abends.
Daggi ließ ihn stehen und grabschte sich den nächsten Mann, einen weitaus jüngeren, ähnlich Annabells Alter. Der hatte eine schiefe Nase und wulstige Lippen. Auch fehlte es ihm an Pubertätspickeln und drei Zähnen nicht. Gerade deshalb glaubte Daggi, den Richtigen erwischt zu haben. Ihr Zuruf: „Ist es der?“ blieb ebenfalls unbeantwortet.
Meine Gattin hob und senkte ratlos die Schultern, nicht aber der Pickelige, der ihr lüstern ans Gesäß fasste und fragte, ob sie mit ihm bumsen wolle. Bums! hatte er einen Schlag ins Gesicht und eine breitere Zahnlücke.
„Doofe Ziege!“, maulte er und spuckte den gelösten Zahn aus.
Weil sich momentan keine weiteren Männer auf dem Gehsteig befanden, fasste Daggi den Entschluss, zu uns zurückzukehren. Kaum hatte sie einige Schritte getan, da gellte es aus Annabells Munde zum dritten Male: „Da ist er wieder!“
Daggi fuhr auf den Absätzen herum und stieß dabei eine ältere Frau um. Als die hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken lag und auch so zappelte, stimmte das Annabell heiter, und sie lachte aus vollem Halse. Darüber war ich recht froh und beteiligte mich am Lachen. Doch bald kehrte unser Töchterchen in ihre dumpfe Verschwiegenheit zurück. Das wunderte mich, denn die alte Frau lag noch immer zappelnd auf dem Rücken. Daggi hatte ihr bewusst nicht aufgeholfen, weil auch sie von Annabells Lachen angetan war.
Während die Alte jammerte und zeterte, sah sich meine Ehegefährtin nach anderen Männern um. Wie aus heiterem Himmel näherte sich ein Streifenpolizist. Entweder war er dienstlich unterwegs oder ging nur spazieren. Ich schärfte meinen Blick und erkannte in ihm denjenigen, der mir Handschellen angelegt und Frau M. vor den Schlägen ihres Ehemannes im Badezimmer beschützt hatte. Die Folgen dieses Kampfes hatten sein Gesicht gezeichnet. Meine Gattin wollte ihn auf Annabell aufmerksam machen, weil ein bewaffneter Staatsdiener als Schwiegersohn mehr hermachen würde als ein schnöder Zivilist. Der Uniformierte wandte sich jedoch der zappelnden Alten zu und fragte sie, weshalb sie auf dem Rücken liege.
„Weil’s mir Spaß macht!“, plärrte sie bösartig, stellte aber endlich ihr Zappeln ein.
Dem Schutzpolizisten war diese Antwort zu gering, weil sie kein ausreichendes Indiz für die unbequeme Lage der alten Dame darstellte.
„Stehen Sie bitte auf!“, verlangte er.
Die aber dachte gar nicht daran, das zu tun. Im Gegenteil, sie wurde richtiggehend frech und spreizte ihre dünnen Beine, so dass ein unachtsamer Fußgänger über sie hätte straucheln können. Das war für den Mann mit dem Colt der willkommene Anlass, den neugierig herzukommenden Passanten deutlich zu machen, dass er nicht zum Vergnügen hier war. Er zückte sein Notizbüchlein und einen angekauten Bleistiftstummel, um eine Eintragung vorzunehmen. Er kritzelte tatsächlich etwas. Anzunehmen war, dass er nur ungerade Striche zog, weil die Neugier der Umstehenden seinen Denkprozess ungünstig beeinflusste. So ließ er vom Stricheziehen ab und gab seinem Gesicht ein strengeres Aussehen, was ihm aufgrund der vorhandenen Blessuren Ähnlichkeit mit einem Rabauken verlieh.
„Schließen Sie sofort ihre Beine!“, befahl er der Seniorin. Die aber zeigte sich bockig. Eine typische Haltung für Kinder und Personen, die altersbedingt solche wieder werden.
Da er von der Schusswaffe nicht Gebrauch machen musste, die Alte wollte ja nicht flüchten, gab er eine Zusatzerklärung zum eben erteilten Befehl. „Mit ihrer Stellung behindern Sie den Verkehr der Passanten und tragen außerdem zur Erregung öffentlichen Ärgernisses bei.“
Das wollte das Mütterchen nicht einsehen und keifte deshalb trotzig: „Und du solltest mal zum Schönheitschirurgen gehen. Mit deinem Aussehen bist du ein öffentliches Ärgernis.“
Dem Polizisten missfiel, dass die Alte ihn geduzt hatte. Seine rechte Hand umschloss vielsagend den Griff seiner Pistole.
„Huch, jetzt will er mich umlegen“, höhnte die Betagte todesmutig. „Das wird dir nicht schwerfallen, denn ich liege ja schon.“
Nicht, dass es uninteressant wäre zu erfahren, wie sich das Geschehen weiter entwickelt haben könnte, wenn es sich so weiter entwickelt hätte, aber Annabell lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit erneut auf ihre Person, denn sie rief: „Da ist er wieder!“
Die Leute, inklusive Seniorin, Schutzmann und Daggi, schauten zu ihr, konnten aber nicht sehen, was Annabell wohl sah. Die tat nun etwas, was auf das völlige Unverständnis aller stieß. Sie kletterte aufs Fensterbrett und war geneigt, sich von diesem … -
Ich schloss die Augen, weil ich das nicht sehen wollte. Dann aber, im Bruchteil von Zehntelsekunden, regte sich mein Verantwortungsgefühl als Vater, und ich kletterte ihr nach. Auf dem Fensterbrett angekommen, stellte ich mich ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen und rief entschlossen: „Bis hierhin, lieb Töchterlein, und nicht weiter!“
Was dann geschehen war, erfuhr ich nach der standesamtlichen Trauung meiner Tochter Annabell mit dem Streifenpolizisten Ronald Hasenfuß. Der Bitte meiner Gattin entsprechend, hatte mich der behandelte Arzt notdürftig zusammengeflickt, so dass ich, im Rollstuhl sitzend und fast vollständig eingegipst, dieser Zeremonie beiwohnen konnte.
Der Schmetterling, den Annabell kurz nach meinem Absturz endlich eingefangen hatte, befindet sich, mit einer Stecknadel auf ein kleines Samtkissen gepiekst, im Schlafgemach der jungen Eheleute. Als ich ihn zum ersten Mal sehen durfte, sagte Annabell ganz glücklich: „Da ist er wieder!“
Während der ausgelassenen Hochzeitsfeierlichkeit schilderte mein frischgebackener Schwiegersohn den lachenden Gästen, wie ich aufs Pflaster vor unserem Haus geplumpst war. Da er als Diensthabender Streifenpolizist befürchtete, das reizende junge Mädchen – er meinte Annabell – wolle mir folgen, sei er schützend hinzugeeilt, hätte jedoch vergeblich auf ihren Sprung gewartet. Sein jetziger Schwiegervater, also ich, hätte vor Schmerzen zwar fürchterlich gebrüllt, doch sei er, seinem Pflichtbewusstsein folgend, hinauf zu Annabell geeilt, um sie vor dem Schlimmsten zu bewahren. Weil sie über den eingefangenen Schmetterling, einen Kohlweißling übrigens, sehr glücklich war, hätte sie dem Heiratsantrag des Herrn Hasenfuß zugestimmt. Der hatte nämlich erklärt, dass er bei ihrem Anblick Schmetterlinge in den Bauch bekäme. Annabell liebt Schmetterlinge über alles, vor allem die aufgepieksten.
Dagmar (Daggi)
Als Daggi und ich wieder einmal ein knappes Stündchen in Harmonie verbracht hatten und ich noch willfährig, ihr einen kleinen Wunsch zu erfüllen, bat sie mich, den weiteren Tagesverlauf mit einem Kinobesuch zu verschönen.
Warum nicht, dachte ich mir. Auf diese Weise kriege ich sie mal von den stinklangweiligen Fernsehprogrammen weg. Sie zappt so gern von einer Arztserie zur anderen. Ihr inzwischen umfangreiches Wissen vom einfachen Knöchelbruch bis hin zur gescheiterten Liebelei zwischen dem Oberarzt und der Assistenzschwester lässt sie zu einer gefragten Gesprächspartnerin im Hausflur, auf der Straße, im Supermarkt, beim Friseur und natürlich im Wartezimmer des Allgemeinmediziners, Dr. Nierenstein, werden. Auch ihm unterbreitete sie ihr diesbezügliches Wissen, wenn er mit der Untersuchung ihres Körpers beschäftigt war.
Nicht selten klagt Daggi über Unwohlsein, das vom übermäßigen Verzehr von Torten und ähnlichen Schleckereien herrührt. Weil sie von meiner Diagnose nichts hält und nur der Dr. Nierensteins vertraut, lässt sie sich von diesem Kurpfuscher gern befummeln. Vor allem am Fummeln ist ihr sehr gelegen. Nach einer besonders intensiven Fummelei war Dr. Nierenstein seine Nierensteine los, was den 70jährigen überschwänglich danken ließ.
Für meine Gattin war es nie ein Problem, eine ungewollte Schwangerschaft durch ihn beseitigen zu lassen. Nach der fünften Schwangerschaftsunterbrechung hatte sie die Nase jedoch voll und wandte sich einem jüngeren Arzt zu, dessen Kenntnisse auf dem neuesten Stand der Medizin basierten. Das Erfreuliche an seiner Untersuchungspraxis war - auch für mich -, dass Daggi nicht mehr schwanger wurde. Ein geschickter Arzt also.
Der Kinobesuch, den wir im einzigen Filmtheater unserer Stadt wahrnahmen, wurde zu einem Erlebnis für uns beide. Während sie damit beschäftigt war, zwei prall gefüllte Tüten Popcorn zu leeren, dabei die Zuschauer betrachtend, gab ich mich der Reparatur des linken Strumpfhalters meiner rechten Sitznachbarin hin. Sie kannte mich von früheren Reparaturen an gleicher Stelle und am gleichen Ort. Ihr Vertrauen in meine Fingerfertigkeit war groß, vor allem, weil ich trotz geringer Helligkeit im Kinoraum die schadhafte Stelle wieder einmal rasch gefunden hatte. Natürlich tastete ich auch den nächstliegenden Bereich ab, um einen möglichen anderen Schaden ausfindig zu machen. Als ich ihn ertastet hatte, ging ihr Atem hörbar schneller. Ein erfreuliches Zeichen, wie ich zufrieden feststellte.
Weil Daggi noch immer Popcorn in sich warf und meiner Tätigkeit keine Aufmerksamkeit schenkte, flüsterte ich meiner rechten Sitznachbarin zu, mich vorüber zu lassen, weil ich aufs Kinoklo müsse. Es wunderte mich nicht, dass siemirin die Männertoilette folgte, um mir das reparierte Strumpfband zu zeigen. Hier war es wesentlich heller. Sie bat mich, auch ihren rechten Strumpfhalter nach möglichen Mängeln zu untersuchen. Um eintretende Männer beim Wasserlassen nicht zu stören, schlossen wir uns in eine WC-Kabine ein. Als wir sie nach einiger Zeit verließen und in den Kinoraum zurückkehrten, stellten wir fest, dass niemand mehr in ihm saß. Der Film war schon zu Ende. Fräulein Steckenrein bedankte sich für meine Reparaturtätigkeit und verabschiedete sich mit dem Wunsch, bald wieder einmal einen interessanten Film gemeinsam anzusehen.
Nach Hause zurückgekehrt, empfing mich Daggi mit den üblichen Klagelauten, dass ihr wieder einmal sehr übel sei.
„Sicherlich ist mir die Filmhandlung auf den Magen geschlagen.“
Ich widersprach dieser Vermutung nicht.
Als sie mich fragte, wie ich mich während der Filmvorführung gefühlt habe, erwiderte ich, dass auch mir übel geworden sei, weshalb ich die Toilette aufgesucht hätte.
„Es werden in letzter Zeit so viele schlechte Filme gezeigt, dass einem tatsächlich übel werden kann“, meinte Daggi und dann: „Wie hieß der Film eigentlich?“
„Das lässt sich leicht ermitteln“, erwiderte ich. „An der Litfasssäule, Ecke Luisestraße, klebt das aktuelle Filmplakat.“
Weil ihr Unwohlsein nicht nachlasse, müsse sie sofort wieder den Arzt ihres Vertrauens, Herrn Dr. Bodo Busengrabsch, aufsuchen. Durch ihn erhoffe sie Linderung. Sie verabschiedete sich mit dem Hinweis, dass ich – sollte sie gegen Mitternacht noch nicht zu Hause sein, denn gründliche Untersuchungen dauern etwas länger -, unbesorgt zu Bett gehen könne.
Ich wünschte ihr von vorn herein alles Gute und ließ sie ziehen. Vom Fenster unseres Wohnzimmers aus schenkte ihr noch ein flüchtiges Nachwinken, dabei feststellend, dass es ein Glück für mich ist, mit einer von allen guten Geistern verlassenen Gattin verehelicht zu sein.
Oberschwester Beate
Das Krankenhaus, in das ich nach meinem Fenstersturz gebracht worden war, beherbergte weitere Leicht- und Schwerverletzte sowie mehr oder minder Erkrankte. Da sie allesamt nicht in ein Zimmer gepasst hätten, waren sie in unterschiedlich großen und kleinen Räumen untergebracht. Ich befand mich in einem großen. Mit mir lagerten fünf Personen. Sie litten an unterschiedlichen Gebrechen. Der eine lungerte bereits ein halbes Jahr hier und brachte den Stationsarzt an den Rand der Verzweiflung. Der Simulant hatte einfach nicht die Absicht, gesunden zu wollen. Kaum war eine Heilung gelungen, beklagte er ein nächstes Leiden. Eine gewisse Zeit glaubte jeder, er wolle sich vor der Arbeit drücken, weil es hier im Krankenhaus so schön warm war und immer gutes Essen gab. Auch die Krankenschwestern waren nicht ohne. Nur die Oberschwester, die über eine beträchtliche Oberweite und viele Leibespfunde sowie einen barschen Ton verfügte, blieb unbegehrt. Sie verfügte auch über einen festen Griff, den vor allem der Drückeberger zu spüren bekam. Als der eines Tages einer schnuckeligen Krankenschwester unsittlich ans Gesäß gefasst hatte, zerrte ihn die Oberschwester aus dem Bett und sperrte ihn drei Tage in ihr Amtszimmer ein. Weil sich Beate, so hieß die OS, in diesem auch an-, aus- und umzukleiden pflegte, war es für den Dauerkranken eine Erlösung, wieder in sein Bett verlegt zu werden. Als ihm Beate einen nächsten Aufenthalt in ihrer Garderobe ankündigte, wurde er schlagartig gesund und durfte das Krankenhaus verlassen.
Diese Therapie sprach sich natürlich herum, und so war jeder darauf bedacht, seinen Aufenthalt hier nicht über Gebühr auszudehnen. Da war aber einer, der als Neuzugang von dieser Marter nicht wusste und Beate fragte, ob er in das Zimmer verlegt werden könne, in dem die jungen und hübschen Patientinnen untergebracht seien. Schon bald war ihm dieser Wunsch vergangen, und er hatte nur noch den, recht schnell wieder zu Hause zu sein.
Die psychische Folter, OS Beate beim An-, Aus- und Umkleiden zusehen zu müssen, widerfuhr auch einem Mann, der mit schweren Verletzungen in unser Zimmer eingeliefert worden war. Rundum bandagiert war er einer Mumie ähnlicher als einem noch lebenden Menschen. Eine Unterhaltung mit ihm war nicht möglich, da seine Lippen und Nasenlöcher nur so weit freigelassen waren, dass er Luft holen konnte. Wir waren natürlich neugierig, was Schlimmes ihm widerfahren war. Einer tippte auf einen Verkehrsunfall, ein anderer auf einen Betriebsunfall, und ich sprach die Vermutung aus, er sei wie ich von einem Fenstersims gestürzt. Der Stationsarzt ließ uns wissen, dass die Verletzungen das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit der Ehefrau seien. Der Geschädigte habe den Leichtsinn begangen, sie beim Schäferstündchen mit ihrem Hausfreund zu überraschen. Der Hausfreund hätte das Weite gesucht und er die Konsequenzen zu spüren bekommen.
Als OS Beate vom Missgeschick dieses Mannes erfahren hatte, nahm sie sich seiner mit überraschender Wärme und Hingabe an. Sie witterte wohl die Möglichkeit, endlich einen Mann an ihre Seite zu bringen. Ihr Alleinsein wollte sie ein für allemal beenden. Mit diesem Leidgeprüften, der sicherlich nicht den Wunsch hegte, zur Gattin zurückzukehren, wäre das möglich. Um ihn auf seine künftige Aufgabe als ihr Lebenspartner vorzubereiten, bugsierte ihn Beate in ihre Umkleidekammer. Am nächsten Tag machte die traurige Kunde die Runde, die Mumie sei überraschend verstorben – erstickt. Wie es zu diesem Mangel an Atemluft gekommen war, konnte nicht ermittelt werden. Beate schwieg sich hierzu gründlich aus.
Mein Bettnachbar unterhielt uns mit außergewöhnlichen Erlebnissen, die ihm widerfahren waren. So mit dieser: