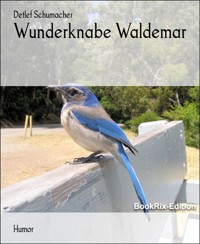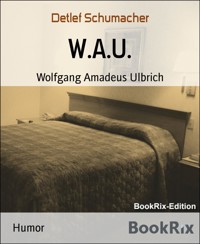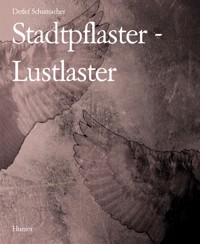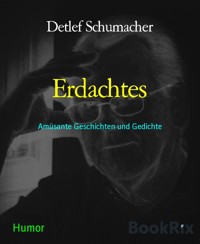0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Spannung und Humor in Einklang zu bringen, ist nicht leicht. Mit dieser Geschichte sollte es gelungen sein. Die Anspannung lässt nach, wenn sie in befreiendes Lachen übergeht.
Der Leser kann sich auf allerhand Überraschungen gefasst machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Sieben Verwegenen
Für alle meine LiebenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEin Vorsatz
Glaub nicht alles, was du lesen wirst.
Früchte des Zorns
Vor vielen Jahren geschah Folgendes: Mein Vater beobachtete mich beim Betrachten von Früchten. Ich sah der Nachbarin beim Pflücken von Erdbeeren zu. Mein Blick konzentrierte sich aber nicht auf diese wohlschmeckenden Beeren, sondern auf ihre Pflaume. So nannten freche Schulbuben die weibliche Vagina. Die war aber nur zu ahnen, weil die Pflückerin einen Schlüpfer trug. Der war nicht der modernste, ihrem Alter aber angepasst. Liesel Müller, so der Name der Nachbarin, zählte damals 50 Jahre. Sie war also wesentlich älter als ich. Ich zählte 15 Lenze. Pubertät und Stimmbruch hatte ich erfolgreich hinter mich gebracht.
Vater packte mich an einem Ohr und fragte streng, wohin ich sehe. Ich sehe in Nachbars Garten, antwortete ich schmerzhaft. Er glaubte mir nicht und erfasste auch mein zweites Ohr. Ich solle die Wahrheit sagen, schalt er und zog heftig an beiden Löffeln. Gequält äußerte ich, dass Nachbars Erdbeeren meinen Blick fesseln. Ich empfing darob eine Ohrfeige. Er ahnte wohl, dass mein Blick
einer anderen Frucht galt.
Seit frühester Kindheit, genauer gesagt seit meiner Geburt, wachte er streng darüber, dass ich sittlich, züchtig und moralisch unbefleckt aufwuchs. Diese Erziehung, die er gemeinsam mit meiner Mutter betrieb, erfasste nicht nur mein Denken und Handeln, sondern auch mein Äußerungen. Hätte er gewusst, dass ich das Geschlechtsteil der Nachbarin gedanklich als Pflaume erfasst hatte, hätte er mich mit vierzehntägigem Stubenarrest bestraft. Dass es ein Wort der Gossensprache war, hätte mir nicht zur Begnadigung gereicht. Meine Mutter hätte mir zusätzlich den Pudding entzogen, den sie nach jedem Mittagsmahl reichte. Pudding war meine Lieblingsspeise. Gab es Mohrrübensuppe und ähnliche ekelhafte Speisen, dann verzehrte ich diese mit innerlicher Verachtung, aber in freudvoller Erwartung des nachfolgenden Puddings. Puddingentzug war für mich schlimmer als Stubenarrest.
Meine Eltern erzogen mich deshalb so unnachgiebig, weil sie selbst keine humanere erfahren hatten. Ihr zutiefst christlicher Glaube verstärkte ihre Härte, die sie sich auch selbst auferlegten. Kein sonntäglicher Kirchgang wurde versäumt, kein Gebet vor und nach den Mahlzeiten und vor dem Zubettgehen unterlassen und kein mahnendes Wort an mich, dem Herrgott zu danken, dass ich auf Erden sei. Ein bisschen mütterliche Nachsicht ließ Mutter walten.
Als ich mal als junger Bub wagte zu sagen, dass nicht der Herrgott, sondern sie mich durch Ficken geschaffen hatten, brach die Hölle los. Wie dieses verderbliche und gotteslästerliche Wort in meinen Sprachschatz geraten sei, tobte mein Vater. Ich verwies auf den sprachlichen Umgang mit meinen Mitschülern und Altersgenossen. Die Eltern waren nahe daran, mir den weiteren Schulbesuch an dieser weltlichen und lasterhaften Schule zu untersagen und mich einer Klosterschule zuzuführen. Zum ersten Male begehrte ich auf und sagte, dass ich kein Mönch werden wolle. Sollten sie dennoch auf diesem Ansinnen beharren, nähme ich mir das Leben. Das brachte sie zur Besinnung. Sie beließen mich an der Dorfschule, in der ich zu diesem Zeitpunkt die fünfte Klasse besuchte. Weil mich meine Mitschüler anfänglich ob meines unfehlbaren Verhaltens hänselten, passte ich mich ihrem Tun und Lassen schnell an. Das machte, dass ich akzeptiert wurde und ihre Umgangsformen verinnerlichte. Deren ungebührliches Verhalten wurde zu meinem außerfamiliären Benehmen. Innerfamiliär zeigte ich mich gottgefällig. Hin und wieder entkamen mir jedoch Bemerkungen, die in den häuslichen Gebrauch nicht passten. Sie wurden mit Ohrfeigen oder anderen Strafmaßnahmen bedacht. Um mich wissen zu lassen, für welches Vergehen ich welche Strafe erhalten sollte, hatte Vater einen Verhaltenskodex aufgestellt, der meinen häuslichen Tagesablauf regelte.
So wunderte es mich also nicht, dass mich mein Erzeuger an den Ohren packte, als ich meinen Blick Frau Müllers Unterleib zuwandte. Mich wunderte allerdings, dass er ahnte, wohin ich sah. Erst als ich älter war, wurde mir bewusst, dass diese Blickrichtung Männer jedes Alters und Glaubens erfasst. Wäre Vater nicht zugegen gewesen, wäre ich an Frau Müller herangetreten und hätte ihr beim Erdbeerpflücken geholfen. Beseelt vom heimlichen Wunsch, ihre Pflaume kurz berühren zu dürfen. Ihrem Ehemann würde sie das nicht sagen, weil der an Alzheimer litt. Er sah zwar ständig durchs Fenster in den Garten, nahm aber nicht wahr, was in diesem geschah.
Weil ich Vaters Backenstreich mit einem lauten „Au!“ hinnahm, wurde Liesel Müller auf uns aufmerksam. Sie hielt erstaunt inne. Wir grüßten höflich. Sie grüßte zurück und pflückte weiter.
Ein verwegenes Ansinnen
Je älter ich wurde, desto mehr Fragen drängten sich mir auf. Solche, die mein vergangenes und kommendes Leben umfassten. So wagte ich eines Tages meinen Vater zu fragen, weshalb mir kein Schwesterchen zur Seite gestellt ist. Ich sei immer noch das alleinige Kind. Die Herstellung einer Schwester geschehe doch sicherlich auf gleiche Weise, wie ich produziert wurde. Meine Eltern sahen sich entsetzt an, weil sie mein Wissen erschreckte. Mein Vater richtete seinen strengen Blick auf mich und fragte, ob mich das Fehlen einer Schwester bedrücke. Es könnte auch ein Brüderchen sein, umging ich die direkte Antwort.
Vater richtete seinen rechten Zeigefinger zum Himmel und sagte streng, der Herrgott habe auch nur einen Sohn und keine Tochter. Sein Sohn sei als junger Mann ans Kreuz genagelt worden und dann zum Himmel aufgefahren. Die Römer nagelten zwar Frauen, aber nicht ans Kreuz.
Mutter begann zu weinen. Vater verlangte, sie solle sich beherrschen. Es sei Jesus gewesen, dem die gottlosen Römer Nägel durch Hände und Füße getrieben hatten. Weil sich Mutter vorstellte, mich hätten die Römer ans Kreuz geschlagen, begann sie wieder zu schluchzen. Sie besitzt ein sehr weiches Gemüt.
Vater beendete abrupt das Gespräch und erklärte resolut, dass es bei mir als einzigem Sohn der Familie bleibe. Damit begrub ich endgültig die Hoffnung auf eine Schwester.
Still dachte ich mir, dass Mutter und ich glücklicher leben würden, wenn es Vater nicht gebe. Als ich diesen Gedanken meinem einzigen Freund Jürgen Klops anvertraute, knurrte der, dass er unter der Knechtschaft seines Vaters täglich leide. Die Mutter sehe hilflos zu, wie er ihn prügele. Oftmals wegen Nichtigkeiten. Neulich habe ihn der Alte dabei erwischt, wie er eine seiner Zigaretten rauchte. Grün und blau habe ihn der Mistkerl geschlagen.
Jürgen zeigte mir die blauen Stellen. Als er seinen Vater mutig darauf hinwies, dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen, bekam der einen Tobsuchtsanfall und würgte ihn. Diese Marter kommentierte er mit dem Satz, dass Würgen nicht Schlagen sei. Mutter, die beistehen wollte, drosch er mit einem Fausthieb zu Boden. Schier leblos blieb sie liegen. Das kümmerte ihn nicht, und er setzte sein Würgen fort. In unbändiger Wut habe er, Jürgen, dem brutalen Vater mit dem rechten Knie vor die Eier getreten, und zwar so heftig, dass der wie ein Schlosshund heulend in die Knie ging.
Jürgen atmete schwer, als würde ihn der Vater wieder würgen. Plötzlich schoss es aus seinem Mund: „Den Schweinehund bringe ich um! Ich ermorde ihn!“
Mir blieb vor Schreck die Luft weg. Ich glaubte, Jürgen werde ein Blitzstrahl treffen, als Gottesstrafe für sein frevelhaftes Ansinnen. Ein Strahl fuhr aber nicht hernieder.
„Jürgen“, keuchte ich schier atemlos, „wie kannst du so etwas Schlimmes sagen!“
„Was ist daran schlimm“, antwortete er, „die Barbarei muss beendet werden.“
„Irgendwann stirbt auch er“, mäßigte ich seinen Zorn, „und dann kann er dich nicht mehr verhauen.“
„Er muss vor seinem Tod sterben“, entschied Jürgen.“
„Wie kannst du nur so hartherzig sein, er ist dein Vater“, versuchte ich seinen Zorn zu lindern.
„Er will 100 Jahre alt werden“, sagte er grimmig.
„Woher weißt du das? Dieses Alter erreichen nur wenige Menschen.“
„Mein Alter ist überzeugt, es zu erreichen. Auf seinem Nachtschrank liegt ein Buch mit dem Titel Wie werde ich 100. Außerdem betreibt er Kraftsport.“
„Das hat er als Dorfschmied doch gar nicht nötig“, sagte ich verständnislos.
„Ihm ist diese Tätigkeit zu wenig. Er will noch mehr Kraft gewinnen, weil er ahnt, dass ich mich als erwachsener Mann für seine Brutalitäten rächen werde. Stelle dir mal vor, er würde tatsächlich 100.“
„Dann besäße er nicht mehr die Kraft, Hand an dich zu legen“, sagte ich beruhigend.
Jürgen lachte kurz auf und sagte: „Dann hätte er überhaupt keine Kraft mehr. Ständig müsste ich seine Windeln wechseln und ihn mit Babynahrung füttern.“
„Für diese Hilfe wäre er dir sehr dankbar.“
„Sicher doch, weil ich dann 80 wäre und selbst schon Altenpflege in Anspruch nehmen müsste.“
„Vielleicht ereilt ihn Alzheimer. Dann weiß er nicht mehr, wer du bist und wärest vor seinen Schlägen sicher.“
Meine trostreichen Worte beruhigten Jürgen nicht.
„Wenn das Wörtchen vielleicht nicht wäre. Vielleicht kriegt er nicht Alzheimer und lässt seine Wut
weiterhin an mir und meiner Mutter aus. Deshalb muss ich ihm schnellstens das Leben nehmen.“
Ich gab nicht auf, Jürgen zu beruhigen. „Vielleicht holt ihn der Herrgott zu sich, weil er zu schnell gefahren ist und dabei einen Baum übersehen hat.“
Jürgen blieb wütend. „Der Herrgott holt ihn nicht. Er wäre ja blöd, täte er das. Im Himmel würde mein Alter seine Wutattacken fortsetzen und die kleinen Engel grundlos vermöbeln. Nein, nein, den holt der Teufel.“
Die läutende Schulglocke beendete unsere Pausenunterhaltung. Leider war es mir nur in den Schulpausen möglich, mit Jürgen Gespräche zu führen.
Gossensprache?
Obwohl ich 15 Jahre alt war, verwehrten es mir die Eltern weiterhin, meine Freizeit außer Haus im Dorf zu verbringen. Sie fürchteten, ich könnte verderblichen Einflüssen der Dorfjugend erliegen. Obgleich ich den Eltern immer wieder versicherte, mein Glaube an Gott sei stärker als das dümmliche Benehmen der Dorfjugend, beharrten sie auf ihrer Strenge. Weil sie dennoch glaubten, dass ich vor dem Fehlverhalten Gleichaltriger nicht gefeit sei, begleitete mich Mutter täglich zur Schule und holte mich von dort auch wieder ab. Meine Mitschüler hatten dafür nur ein verächtliches Lächeln übrig. Mein Freund Jürgen nicht. Er riet mir, mich meines Vaters auch zu entledigen. Ich erwiderte, dass das nicht vonnöten sei, denn er schlage mich nicht. Irgendwann werde das geschehen, gab sich Jürgen wissend, denn wenn Männer älter werden, werden sie brutaler. Die Beseitigung meines Vaters wäre also eine Vorsichtsmaßnahme. Ich hielt furchtsam entgegen, dass im Falle eines Vatermordes die Polizei sehr schnell mich als Täter ermitteln würde. Jahrelanger Kerker wäre die Strafe.
Lächelnd meinte Jürgen, dass es verschiedene Möglichkeiten des Ermordens gibt. Auch solche, in denen kein Blut fließt und die Polizei deshalb Schwierigkeiten hätte, den Täter zu finden. Im Fernsehen wären zahlreiche Filme zu sehen, die zeigen, wie getötet wird. Ob ich kein Fernsehen sehe, fragte er mich. Ich verneinte, weil in unserem Haus kein Fernsehgerät geduldet wurde. Für meinen Vater war das Fernsehen eine Erfindung des Teufels, der auf diese Weise in die Hirne und Herzen der Menschen eindringen wolle.
Jürgen schaute mich verwundert an und fragte, wie ich meine Freizeit verbringe. Sie müsste doch sterbenslangweilig sein. Ich verneinte und sagte, dass ich sehr viel lese. In unserem Hausgarten befinde sich eine Gartenlaube, in der ich stets beim Lesen zu finden sei. In der kalten Jahreszeit diene mir mein Kinderzimmer als Leseort. Ich besitze eine Vielzahl an unterhaltsamen und lehrreichen Büchern.“
„Auch Liebesromane?“
„Um Gottes Willen nein!“, erwiderte ich und schaute scheu zu Himmel.
„Ich würde dich gern einmal zu mir einladen“, sagte ich meinem Freund, „doch lässt mein Vater das nicht zu.“
„Du bist ein bedauernswertes Geschöpf“, meinte Jürgen. „So wirst du niemals ein Mädchen knutschen oder vögeln können.“
„Knutschen und Vögeln sind verderbliche Worte“, sagte ich angewidert, „sie haben in meinem Sprachschatz keinen Platz. Vor einigen Jahren äußerte ich einmal das Wort Ficken. Mein Vater hätte vor Entsetzen beinahe einen Schlaganfall erlitten. Unser familiärer Sprachschatz erlaubt nur Wörter der deutschen Hochsprache. Die Gossensprache ist verpönt.“
„Knutschen und Vögeln gehören zur deutschen Alltagssprache. Jeder vernünftige Deutsche versteht sie und handelt danach.“
„Hast du schon einmal geknutscht und gevögelt?“, stellte ich Jürgen die Gewissensfrage.
Seine Antwort ging im Läuten der Schulglocke unter. Er verwies auf die nächste Pause. In ihr werde er mir das Knutschen einmal vorführen.
„Vögeln auch?“
„Nicht auf dem Schulhof.“
Wir suchten unseren Klassenraum auf - er den der 10. Klasse und ich den der 9. Klasse.
Die nächste Hofpause konnte ich kaum erwarten. Erstmals würde ich in natura sehen, wie geknutscht wird. In meinen 15 Lebensjahren hatte ich noch nicht erlebt, dass Vater und Mutter sich knutschen. Vom Vögeln ganz zu schweigen. Von diesen Vorgängen hatte ich nur verschwommene, unwirkliche Vorstellungen. Ein Fernsehgerät besaßen wir nicht, auch kein Radio. Ganz zu schweigen von einem Handy. Wie sollte ich also eine genaue Vorstellung von der Wirkungsweise dieser Gossenbegriffe haben. Deshalb verlangte es mich auch nicht nach einer Freundin. Keine meiner Mitschülerinnen hatte bislang Anstalten gemacht, mich sympathisch zu finden. Für sie war ich ein Sonderling, dem man lieber aus dem Weg ging. Die Mädchen waren unterschiedlich hübsch. Eine hob sich allerdings durch eine gewisse Schönheit hervor. Die fasste ich verstohlen ins Auge, wann immer sich mir die Gelegenheit bot. Einmal sah sie, dass ich sie ansah. Grob fragte sie, weshalb ich sie so blöd anglotze. Diese Beleidigung traf mich zutiefst und ich schenkte ihr keinen Blick mehr. Sie war übrigens diejenige, die ihre Freunde wechselte wie andere das Hemd. Ich stellte mir vor, ich würde mit ihr bei meinen Eltern vorstellig werden und sie würden diese Vorstellung akzeptieren. Sie würden sich sogar freuen, dass ich ein so hübsches deutsches Mädel ins Haus bringe. Vor allem ein deutsches. Ihre Freude wäre spätestens nach einer Woche verflogen sein, weil Susi, so hieß dieses flatterhafte Ding, mit einem anderen entschwunden wäre. Vielleicht mit einem Asylanten.
„Hans!“, riss mich die Biologielehrerin aus meiner Verträumtheit, „fühlst du dich nicht wohl?“
„Doch, doch, natürlich“, stotterte ich und kehrte augenblicklich in die Realität zurück.
„Dann wende dein Interesse bitte wieder dem Unterricht zu!“
Die Lehrer der Schule kannten mich als einen vorbildlichen und lernwilligen Schüler. Nichts gab es an meinem Verhalten, an meinem Fleiß und meiner Ordnung zu beanstanden. Mein Zeugnis war stets das beste von allen. Das ließ mich in den Augen der anderen ein Streber sein, der ich aber nicht sein wollte. So oft ich mir vorgenommen hatte, nur einmal ein beschämendes Verhalten an den Tag zu legen, um den anderen zu gefallen, so oft kam es in den Ansätzen zum Erliegen. So hatte ich einmal laut geäußert, dass Schule zum Kotzen sei. Kaum war das meinem Munde entfahren, drang in meine Ohren der allgemeine Ruf: „Der Streber will sich bei uns beliebt machen!“ Diesem Satz folgten laute „Buh!“-Rufe. Sofort kehrte ich in meine übliche Vorbildhaltung zurück. Wie schlimm wäre es auch geworden, wäre mein Vater über mein Fehlverhalten in Kenntnis gesetzt worden. Ich hätte wochenlang auf den Nachtisch-Pudding verzichten müssen.
Reiß dich zusammen, sagte ich mir und hörte die Bio-Lehrerin sagen: „Vögeln wird nicht die Liebe geschenkt, die sie verdienen. Sie werden in enge Käfige gequetscht.“
„Vögeln ist ein unanständiges Wort!“, schoss es spontan aus meinem Munde, „und geknutscht ist auch verwerflich!“
Atemlose Stille im Raum. Lehrerin und Schüler sahen mich verblüfft an. Man war überrascht, dass ich sie unterbrochen hatte, und zwar in ungehöriger Weise mit ungehörigem Inhalt. So etwas hatte man bei mir noch nicht erlebt.
Die Lehrerin gefasst: „Hans, wie kannst du dich so gehen lassen?“
Rasch fasste ich mich und erwiderte: „Ihre verwerfliche Formulierung Vögeln hat mich zu meiner Aussage inspiriert.“
„Was ist an Vögeln verwerflich?“, fragte sie fassungslos.
Ich schwieg, weil ich eine Begriffsklärung nicht vornehmen kann. Die Mitschüler sahen das mit sichtlichem Vergnügen. Die Lehrerin mit anhaltendem Unverständnis.
Ein Schüler sprang vom Platz auf und rief: „Er meint Ficken!“
Hörbares Feixen aller. Nicht so die Lehrerin. Sie schaute mich an, als sehe sie mich zum ersten Mal.
„Bist du Hans Meier?“, fragte sie.
Verwundert antwortete ich: „Jawohl, Frau Ziesel, sie kennen mich doch.“
„Ich kenne einen anderen Hans Meier“, fuhr sie fort, „einen Jungen, der durch untadeliges Benehmen auffällt. Du kannst Hans Meier also nicht sein.“
„Wieso nicht, Frau Ziesel?“
„Weil du etwas Ungehöriges gesagt hast. Etwas, das dem Hans Meier nie aus dem Mund gekommen wäre.“ Ihr Gesicht verzog sich, als würde ich unangenehm riechen.
„Ich habe nicht Ficken gesagt“, reinigte ich mein Gewissen.
Alle lachten. Ich merkte, dass ich dieses verwerfliche Wort doch geäußert hatte.
„Ist es dein Ansinnen, den deutschen Wortschatz zu reinigen?“, fragte Frau Ziesel.
„Dazu wäre ich kaum imstande“, antwortete ich, „es findet sich zu viel Unflat in ihm. Das Wort Ficken würde ich durch Picken ersetzen. Das klingt nicht obszön.“
Frau Ziesel ironisch: „Also müsste ich sagen: ich picke, obwohl ich ficke.“
Ich hierauf: „Es steht mir nicht zu, ihren privaten Sprachgebrauch zu kritisieren, vernünftiger wäre es allerdings.“
„Weißt du was, Hans Meier“, sagte sie entschieden, „für mich gilt weiterhin das Urdeutsche: Ich ficke, denn ein Vogel bin ich nicht.“
„Bei Vögeln heißt es ja auch vögeln“, ergänzte Schüler Nico Schröder.
„Richtig“, meinte Frau Ziesel und kehrte zum eigentlichen Inhalt der Unterrichtsstunde zurück.
Eklat auf dem Schulhof
Nun soll der Leser erfahren, wie mein Freund Jürgen Klops in der folgenden Pause das Knutschen demonstrierte. Er war kein Tausendsassa und kein Schürzenjäger, der die Mädchen reihenweise im Sturm eroberte. Sie mieden ihn. Dennoch glaubte er sich begehrt. Sein Selbstbewusstsein war sehr ausgeprägt. Freunde hatte er nicht, wohl deshalb nicht, weil er in seinen körperlichen Bewegungen plump war. Die Elastizität und Schwungkraft seiner Altersgenossen fehlte ihm. Diese Trägheit machte auch, dass er nie eine Disco-Veranstaltung besuchte.
Dass ich ihm zum Freund wurde, machte ihn beweglicher. Auch geistig, denn in mir fand er keinen Dummkopf. Leider konnten wir uns, wie schon gesagt, nur in den Unterrichtspausen nahe sein. Doch gaben wir die Hoffnung nicht auf, dass sich dieses begrenzte Feld einmal weiten werde.
Als ich den Pausenhof betrat, war Jürgen schon dort und winkte mich zu sich.
„Pass gut auf, Hans, jetzt erlebst du, wie man knutscht.“
Er sah um sich und versuchte, aus dem Gewimmel der Schüler und Schülerinnen eine Knutschwillige zu finden. Schließlich war er fündig geworden. Er nahm mich an der Hand und ging mit mir wie Brüderchen und Schwesterchen zu einer Gruppe jüngerer Schülerinnen. 5. oder 6. Klasse konstatierte ich.
„Hallo, ihr Süßen“, machte er sie auf sich aufmerksam, „Habt ihr Mami oder Papi heute schon ein Morgenküsschen gegeben?“
Die Mädchen unterbrachen ihren Plausch und guckten Jürgen böse an.
„Was fällt dir ein, Dicker, unsere Unterhaltung zu stören!“
Mit dieser Abwehrreaktion hatte er nicht gerechnet. Jedenfalls nicht bei Mädchen dieses Alters.
„Weshalb so aufgebracht, meine Damen“, schlug er deshalb einen versöhnlichen Ton an, „ich wollte nur erfahren, ob ihr schon im kussfähigen Alter seid.“
„Sag mal, hast du sie noch alle?“, wurde ein Mädchen grob, dass sich in ihrer pummeligen Statur kaum von Jürgen unterschied. „Kussfähiges Alter! Das ich nicht lache. Das haben wir längst hinter uns. Wir befinden uns bereits im Knutschalter. Du weißt, was Knutschen ist?“
Jürgen reagierte geschickt. „Neeeein!“, dehnte er gespielt unwissend, „das will ich von euch erfahren. Deshalb bin ich hier. Mein Freund auch. Der will ebenfalls wissen, was Knutschen ist.“
Die Mädchen musterten uns von oben bis unten an und machten eine geringschätzende Miene.
Eine meinte dann: „Wenn man euch so sieht, kann man glauben, dass euch Mami heute Morgen ein Abschiedsküsschen gegeben hat.“
Die Mädchen kicherten. Ich wollte mich beschämt zurückziehen, doch Jürgen hielt mich fest.
„Von diesen dummen Gänsen lassen wir uns nicht verhöhnen“, raunte er.
„Hört mal ihr Gäns…, ihr gänzlich wissenden Schönheiten“, wandte er sich wieder an sie, „könntet ihr uns demonstrieren, wie Knutschen vor sich geht. Ich würde meinen Mund zur Verfügung stellen.“
Die Mädchen schienen Jürgen, den Sohn des Dorfschmieds, nicht zu kennen. Wohl deshalb nicht, weil sie in umliegenden Dörfern beheimatet waren. Unsere Schule war auch Einzugsschule für drei benachbarte Dörfer. Eine Zentralschule also.
Ein anderes Mädchen mit einem Herz-Tatoo auf einer Wange zynisch an Jürgen gewandt: „Das Kindergartenalter hast du schon verlassen, sonst wärest du nicht hier.“
Natürlich hatte er das. Jürgen überragte die jungen Dinger.
„Mich müsstest du eigentlich mit Sie ansprechen, du Rotznase“, revanchierte er sich an der Zynikerin.
Rotznase war starker Tobak. Mit lautem Wortschwall fielen die Mädchen über ihn her. Begriffe wie „Hosenscheißer“, „Fettarsch“, „Elefantenbaby“ usw. waren zu hören.
Ein körperlich größeres Mädchen verlangte plötzlich Ruhe. Wahrscheinlich ein zu rasch gewachsenes oder eine Sitzenbleiberin. Ihr Befehl wurde sofort befolgt. Sie deutete auf mich und sagte den Mädchen: „Dem können wir Knutschen beibringen. Der sieht vernünftig und nicht
aufdringlich aus. Wer will ihm zuerst an die Lippen?“
Die Mädchen schauten die Befehlshaberin verdutzt und mich dann prüfend an. Jürgen guckte verdattert.
Die Pummelige wollte es zuerst tun. Sie kam auf mich zu und wollte mich mit ihren wurstigen Armen umfassen. Vor Schreck war ich bewegungsunfähig. Die Dicke schob ihre Zunge zwischen den wulstigen Lippen hin und her, was mich glauben ließ, sie wolle mich auffressen. Als sie meinen Kopf fasste und ihn an ihren Mund ziehen wollte, rief Jürgen plötzlich: „Halt ein, Kugelfisch! Mein Freund ist ein anständiger Mensch, der sich nicht von einer Dahergelaufenen beschmatzen lässt. Er hat schon zahllose Mädchen zu Boden geknutscht und wird sich nicht an minderjährigen Gören vergehen.“
Die Dicke hielt verblüfft inne. Verblüffung auch bei der Befehlshaberin und den ihr hörigen Mädchen. Auch ich war des Staunens voll. Mich erstaunte, dass Jürgen so perfekt gelogen hatte. Ich war ihm deshalb nicht gram. Im Gegenteil, ich war ihm für seine Hilfeleistung dankbar.
Die Befehlshaberin fand zuerst wieder Worte und fragte Jürgen, weshalb seinem Freund, also mir, das Knutschen beigebracht werden solle, wenn der schon oftmals geknutscht habe. Sogar zu Boden, also im Dreck.
Jürgen stammelte Unverständliches, weil ihm eine akzeptable Antwort nicht einfiel. Weil er sich dennoch rechtfertigen wollte, verlegte er sich wieder aufs Beleidigen.
„Ihr doofen Ziegen solltet eure Barbiepuppe küssen, denn die wehrt sich nicht gegen euer Gesabbere.“
Ui!, das hätte er nicht sagen sollen. Jedes der Girls glaubte, schon hinreichend erfahren zu sein. Typisch für Pubertierende. Mit lautem Gezeter fielen sie erneut über Jürgen her. Mit Fäustchen schlugen sie auf ihn ein. Schützend hielt er die Arme über den Kopf. Sicherlich erwartete er von mir tätliche Unterstützung, doch solche Hilfestellung war mir fremd und widersprach meinem christlichen Glauben. Um nicht in den Verdacht zu geraten, ich gehöre zu diesem Haufen schrillen Geschreis, trat ich einige Meter zur Seite.
Es dauerte nur Augenblicke und der aufsichtführende Lehrer kam heran. Es war der Sportlehrer, bekannt auch als guter Torschütze beim Dorffußballverein. Bei den Jungfrauen des Dorfes als flotter Tänzer begehrt. Die Hoffnung einer jeden, mit ihm einmal im Stroh der Feldscheune kuscheln zu können, enttäuschte er nicht. Er war aber auch für seinen rüden Umgangston bekannt.
„Was ist das hier für ein Gebrülle?“, so fragte er, da war’n sie stille.
„Maul auf! Was ist der Grund?“
Die Pummelige meldete sich zu Wort und sagte: „Der da!“, sie wies auf Jürgen, „hat versucht, uns unsittlich zu berühren.“
„Jawohl“, so eine andere, „er wollte uns knutschen.“
Der Sportlehrer trat an Jürgen heran, packte ihn am Schlafittchen und knurrte: „Stimmt das, du Hurensohn?“
„Ich bin kein Hurensohn“, brachte der zitternd hervor.
„Ich will wissen, ob es stimmt, was die Schnecken behaupten?“
Eine andere Schnecke ergänzte: „Vielleicht wollte er uns öffentlich vergewaltigen.“
Der Sportlehrer ließ Jürgen los und wandte sich ihr zu.
„Weißt du Schnepfe eigentlich, was Vergewaltigen bedeutet?“
„Klar, weiß ich das. Ein fremder Mann raubt einer jungen Frau gewaltsam die Unschuld.“
„Dann ist er ein Räuber und kein Vergewaltiger. Hast du das verstanden, du blöde Kuh?“
Eingeschüchtert hauchte sie: „Ja!“
Streng fragte er dann die lange Befehlshaberin: „Bist du schon einmal vergewaltigt worden?“
„Bis jetzt noch nicht“, stotterte sie, „was nicht ist, kann aber noch werden.“
Der Sportlehrer grinsend: „Das möchtest du wohl gern?“
„Wenn es sich nicht verhindern lässt.“
„Verpisst euch, ihr Rasselbande!“, befahl er den Mädchen und an Jürgen gewandt: „Auch du mache dich schleunigst vom Acker, sonst trete ich dir kräftig in den Arsch.“
Der Pulk löste sich rasch auf.
Als der Sportlehrer mich entdeckte, der ich wie eine Salzsäule erstarrt stand, kam er auf mich zu und fragte: „Wolltest wohl zusehen, wie ein Halbstarker sich an Minderjährigen vergeht?“
Entsetzt hob ich die Hände. „Um Gottes Willen“, sagte ich abwehrend, „ich würde auf der Stelle erblinden, sähe ich so etwas.“
Der Sportlehrer sah mich mit zusammengekniffenen Augen prüfend an und fragte: „Du bist wohl katholisch?“
„Nein, evangelisch“, verteidigte ich meine Glaubensrichtung, „mit den katholischen Ferkeln habe ich nichts im Sinn.“
„Ich auch nicht“, sagte er.
Er ließ mich stehen und schlenderte über den Schulhof.
Jürgen trat zu mir und schnaufte empört: „Die jungen Weiber werden immer verlogener und schamloser. Du hättest mir ruhig beistehen können.“
Meine Antwort ging im Läuten der Pausenglocke unter.
Ein Plan
Wenn mich Mutter nach Unterrichtsschluss von der Schule abholte, fragte sie jedes Mal: „Wie war’s? Stand dein Benehmen im Gleichklang mit der Schulordnung? Gab es Zwischenfälle?“
Meine Antworten waren immer die gleichen. Zwischenfälle verschwieg ich. So auch den mit den pubertierenden Mädchen. Dass ich einen Schulfreund habe, erwähnte ich ebenfalls nicht. Was würde das für ein Tara geben, wenn ich ihr sagte, dass er mir riet, ihren Mann, also meinen Vater, abzumurksen. Er wolle das gleiche auch mit seinem Alten tun.
Nicht nur mein Vokabular würde sie erschrecken, sondern auch die Tatsache, dass ich mich an einem Mordkomplott beteilige.
Jürgen bezog wieder eine gehörige Tracht Prügel. Sein Vater hatte während des wöchentlichen Skatspiels in der Kneipe vom Sportlehrer erfahren, dass Sohnemann Jürgen Minderjährige vergewaltigen wollte. Der Sportlehrer ist Teilnehmer des wöchentlichen Skatens. Sportlich aktiv ist er also auch beim einarmigen Reißen – des Bierglases.
Diesmal war Jürgen vom Vater so arg gezüchtigt worden, dass er fast bewegungsunfähig war. Mit großer Mühe schleppte er sich zur Schule. Als ich ihn so auf dem Pausenhof erlebte, glaubte ich einen Schwerbehinderten zu sehen.
Voller Ingrimm keuchte er – zu normalem Sprechen war er auch nicht fähig -, dass er nun endgültig die Schnauze voll habe. Einen 16jährigen, der kurz vor der Volljährigkeit stehe, dermaßen zu verhauen, stehe in krassem Widerspruch zum Jugendschutz. Seine Mutter habe der Alte auch wieder geohrfeigt, und zwar so heftig, dass sie für die nächste Zeit taub sei.
Empört riet ich meinem Freund, die Polizei zu informieren.
„Glaubst du, unser Dorfsheriff unternimmt etwas in dieser Hinsicht? Der ist doch auch Stammgast in der Kneipe wie mein Oller. Die Säufer stecken unter einer Decke.“
„Dann nimm die Schmerzen ergeben hin, bis du die Volljährigkeit erreicht hast“, gab ich Jürgen in christlichem Sinne zu verstehen.
„Wenn der sich weiter so brutal verhält, erreiche ich die Volljährigkeit nicht. Der Kerl muss schnellstens beseitigt werden. In diesem Zusammenhang solltest du deinen Erzeuger auch aus dem Wege räumen. Das wäre ein Abwasch.“
Ich war geistig noch nicht so weit, diesen Schritt zu wagen. Mir sei diese Art von Vaterentsorgung zu inhuman. Für meinen Vater müsse es eine andere Möglichkeit seiner Außerkraftsetzung geben.
„Wie wäre es“, meinte Jürgen listig, „wenn wir beide uns auf und davon machen. Still und leise. Möglichst bei Nacht und Nebel. Für immer und ewig.“
„Du meinst“, fragte ich etwas ungläubig, „wir sollten dem Elternhaus entfliehen?“
„Na klar, Mensch!“, so Jürgen erfreut über seinen Einfall. „Wir packen das Notwendigste in einen Rucksack, kleiden uns warm genug, festes Schuhwerk nicht vergessen und verduften.“
„Auch die Zahnbürste“, bemerkte ich klug.
„Die muss unbedingt mit“, grinste Jürgen.
„Und wenn uns einige Tage später das Heimweh packt, dann können wir nicht zurückkehren, weil wir nicht mehr willkommen sind“, gab ich zu bedenken.
„Würdest du denn zurückkehren wollen?“, fragte Jürgen nicht sehr erbaut von meiner Unentschlossenheit.
„Es würde mich schon schmerzen, sähe ich mein geliebtes Mütterchen nicht mehr. Der Herrgott sähe mein Enteilen auch mit Unverständnis.“
„Dann nehmen wir deine Mutter mit. Meine kann sich uns auch anschließen. Die hat nämlich die Schnauze ebenfalls voll. Im wahrsten Sinne des Wortes.“
Diese Möglichkeit des Enteilens war mir genehmer. Bestärkt auch durch Jürgens folgende Worte:
„Die Weiber könnten für uns kochen, die Wäsche waschen und was sonst noch an Tätigkeiten in der Wildnis so anfällt. Beginnen wir also so, dass jeder seine Mutter ins Vertrauen zieht. Sollte deine Mutter Bedenken haben, weil sie eine zu starke Bindung an ihren Mann fühlt, dann nimm eine weinerliche Haltung ein und jammere, dass sie dich als ihren Sohn dann nimmer wiedersehen wird. Du seist dann der verlorene Sohn. Meiner Mutter muss ich nichts vorjammern, die ist auf Anhieb bereit, ihren brutalen Mann zu verlassen.“
„Diese Art deines Fluchtplans ist mir genehmer“, sagte ich schon entschlossener, was Jürgen gefiel.
„Dann wirst du endlich nach 15 sinnlos vertanen Lebensjahren die echte Freiheit des Lebens genießen. Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, tun und lassen zu können, was man will.“
Das hatte er so gesagt, als wäre er schon einmal in den Genuss solches Wohlbefindens gekommen.
Die Hofpause war zu Ende und wir kamen mit festem Händedruck überein, Mutter in kürzester Zeit vorsichtig in den Fluchtplan einzuweihen.
„Aber vergiss nicht“, so Jürgen, „Weiber können den Mund nicht halten. Wir müssen sie schonend zwingen, ihren Mann ahnungslos zu lassen.“
Dann entschwand er in seinen Klassenraum, ich in den meinen.
Unglaubliches geschieht
Mein ganzes Sinnen war nun darauf gerichtet, Mutter von der Notwendigkeit gemeinsamer Flucht zu überzeugen. Dass es nicht leicht sein würde, war mir bewusst. Sie würde sich von dem Mann trennen müssen, an den sie seit Anbeginn ihrer gemeinsamen Beziehung gekettet war. Jawohl gekettet, denn ihr Glaube verbot ihr, einen anderen zu begehren. Mit keinem anderen Mann war sie in nähere Berührung gekommen, außer beim sonntäglichen Kirchgang mit dem Pfarrer, dem sie zum Abschied die Hand reichte. Sie zeigte sich von oben bis unten verschlossen. Sie war Christin von Kopf bis Fuß, von innen und außen.
Nie gab sie etwas über ihr Privatleben preis, so dass ich nicht wusste, welche Vergangenheit sie hatte, welche seelischen Leiden sie bedrückten. Dass ihre Ehe nicht die glückliche war, wie mir vorgegaukelt wurde, hatte ich längst begriffen. Ich hatte mir auch die Frage gestellt, wie sie und ihr Mann es angestellt hatten, mich herzustellen. Nie hatte ich auch ein Foto von ihr oder von ihm zu sehen bekommen. Nicht einmal ich war abgelichtet, weder als Säugling noch als freudestrahlendes Kind inmitten meiner Eltern. Worüber hätte ich auch freudestrahlend sein können. Ich duldete, wie es von mir verlangt war. Auch Mutter duldete, ganz dem christlichen Ehegelöbnis folgend … und sei deinem Manne untertan. So hatte ihr Mann sie verpflichtet, nur Hausfrau und Mutter zu sein, keinen Beruf auszuüben, der sie mit anderen Menschen – vor allem ungläubigen – in Berührung gebracht hätte. Mein Vater versah eine Arbeit. Er war als Buchhalter im Finanzamt der Kreisstadt tätig. Eine Beamtentätigkeit, die er nicht mit Hingabe versah. Wenn er Abends nach Hause zurückgekehrt war, tat er Buße und bat Gott um Vergebung für die Finanztricks, derer er sich ungern bedient hatte.
Wie ich alles Revue passieren ließ, fiel mein Blick auf eines der zahlreichen Bücher, die die Wandregale in meinem Zimmer füllten. Der Titel lautete Wir sind Gottes Samen.
Ich hatte es noch nie gelesen, weil mir der Titel zu landwirtschaftlich klang. Es hätte auch lauten können Acker, Bauer, Drillmaschine. Nun aber, da ich in einem Alter war, in dem das Wort Samen für mich eine tiefere Bedeutung erlangt hatte, nahm ich das Buch aus dem Regal.
Als ich es zu lesen begann, betrat Mutter mein Zimmer und bat mich zur Einnahme des Abendbrotes ins Wohnzimmer.
„Lieb’ Mütterchen“, sprach ich in rascher Eingebung, „verweile doch, du bist so hold.“
Ich sah die günstige Gelegenheit, mit ihr ins vertraute Gespräch zu kommen.
„… du bist so schön“, korrigierte sie.
„Goethe wusste nichts von dir“, entschuldigte ich meinen Versprecher, der aber kein Versprecher war.
„Weshalb sagst du plötzlich lieb Mütterchen zu mir?“, fragte sie beeindruckt. „Solches kam noch nie über deine Lippen.“
Sie hatte Recht. Das hatte ich noch nie gesagt. Das klang fast wie eine Liebeserklärung.
Verträumt sah sie mich an. Vielleicht erinnerte sie sich eines Mannes, der sie in jungen Jahren so innig angesprochen hatte.
„Liebste Mama“, wechselte ich die Anrede, nun sachlicher werdend, „es hat einen Grund, dich so
anzusprechen, wie du es verdienst. Auch du erträgst die Schwere des Alltags mit Gottes Beistand.
Wie schön wäre es, könnte man diese Last abwerfen und sich der Lebensfreude unbeschwert hingeben.“
Ich war erstaunt, wie leicht mir diese Einleitung gelungen war. Mutter war nicht minder erstaunt, solches von mir zu hören. Das gefiel ihr, und es verlangte sie nach mehr solcher Worte. Das sah ich ihr an. Ihr Mann hatte solche Töne bestimmt noch nie angeschlagen.
„Sprich weiter, mein Sohn“, sagte sie mit einer Stimme, die Verzückung verriet.
„Es ist mir nicht leicht, immer nur in diesem Hause zu hausen, ohne auch einmal Gottes freie Natur in ihrer ganzen Pracht genießen zu können. Der Herrgott hat uns Menschen nicht als Stubenhocker geschaffen, sondern als Wesen, die sich dort bewegen, wo er Räume unter seinem Himmel für sie geschaffen hat.“
Ich pausierte, weil ich von meinen Worten beeindruckt war.
Mutter schlug überrascht die Hände zusammen und sagte perplex: „Du sprichst wie der Herr Pfarrer. Ich werde Papa bitten, dich Theologie studieren zu lassen.“
Diese ihre Reaktion war nicht in meinem Sinne. Doch durfte ich nicht schroff ablehnen, sondern musste weiterhin geschickt zu Werke gehen.
Deshalb sagte ich: „Mir wäre es genehmer, ich könnte Gottes Wort da predigen, wo es alle Geschöpfe seiner Welt vernehmen, also auch die Tiere.“
„Du kennst die Sprache der Tiere doch nicht“, schrumpfte sie mein Pathos.
„Ich könnte sie lernen, und zwar dort, wo sie zu hören ist.“
„Das hieße ja, du müsstest im Wald und auf der Wiese wohnen“, sagte sie nun weniger begeistert.
„Richtig“, versuchte ich, sie wieder zu entfachen, „und Gottes großer, freier Himmel wäre mein Dach.“
„Hans“, sagte sie besorgt, „auf einer Wiese könntest du dich in Kuhkacke legen und im Wald würde dich der böse Wolf zausen.“
„Gottes Geleit würde Arges verhindern.“
Sie überdachte diesen Satz und sprach: „Bei allem Trost Gottes, aber du würdest Hunger und Durst leiden.“
Endlich war der Punkt erreicht, von dem aus ich direkter werden konnte.
„Du hast Recht, Mamutschka.“
Sie zuckte zusammen und sagte erschrocken: „Willst du in Russland Wohnstatt nehmen?“
„Wieso Russland?“
„Mamutschka klingt russisch.“
„Aber nein, Mamutschka! Mamutschka ist international und wird auch in der Bibel auf Seite 345 erwähnt.“
„Auf Seite 345?“, fragte sie angestrengt nachdenkend. Doch wusste sie natürlich nicht, was auf dieser Seite geschrieben steht. Auch ich wusste es nicht. Damit sie das nicht nachprüfte, führte ich die Unterhaltung auf das Ursächliche zurück.
Kaum hatte ich gesagt: „Hunger und Durst erführen Stillung, wenn …“, da klang Vaters Stimme vom Wohnzimmer herüber: „Kommt sofort zu Tisch! Das Abendmahl ist bereitet!“
Enttäuscht sackte ich innerlich zusammen. Es hatte so günstig begonnen und nun schien alles verloren. Doch täuschte ich mich. Bevor wir zum Wohnzimmer schritten, sagte Mamutschka: „Wir müssen die Unterhaltung recht bald fortsetzen. Du brauchtest ja jemanden, der deinen Durst und Hunger unter Gottes freiem Himmel lindert.“
„Dieser Jemand könntest du sein, lieb Mütterchen“, sagte ich begeistert, umarmte sie kurz und eilte ihr voran an den Abendbrottisch.
Verdattert verharrte sie. Umarmt hatte ich sie noch nie. Eine solche körperliche Berührung verbot der von Vater erstellte Familienkodex.
Als ich am Tisch Platz genommen hatte, steif aufgerichtet und beide Hände exakt ausgerichtet auf der Tischplatte, erschien Mutter. Ein wenig verwirrt ließ sie sich nieder. Vater entging das nicht.
„Was ist dir?“, fragte er lieblos.
(„Geht es dir nicht gut, mein Liebling?“, hätte er als mitfühlender Gatte fragen können. Doch das hätte sie seelisch nicht verkraftet, von zwei Seiten so innig angesprochen zu sein.)
Gesetzt setzte sie sich, dann ebenso aufrecht sitzend wie ihr Gatte und ich.
„Nach dem Tischgebet und der Abendmahlzeit erklärst du mir, Elfriede, weshalb du so verstört wirkst“, verlangte er.
Sodann falteten wir die Hände, blickten stur auf die Tischplatte und murmelten stoisch das Gebet, das inhaltlich unverändert war. Nur einmal unterbrach Vater ärgerlich sein: „Vater segne Speis und Trank!“ mit „Hau ab, du Mistvieh!“ und klatschte mit der rechten Hand nach dem Störenfried. Das Mistvieh entkam, die Kartoffelsuppe schwappte ihm ins Gesicht, weil die Fliege auf dem Tellerrand gesessen hatte. Da er bei Tisch nicht fluchen wollte und durfte, eilte er nach draußen und entlud seinen Unmut in Begleitung unflätiger Worte. Also ist er sprachlich doch nicht so sauber, dachte ich und lachte leise. Auch Mutter konnte ein Schmunzeln nicht verbergen. Schließlich war es nicht alltäglich, dass sich das Familienoberhaupt bekleckerte.
Die Speiseeinnahme erfolgte geräuschlos. Schmatzen, wohliges Grunzen oder Schlürfen waren als tierische Fresslaute verpönt. Einmal nach einer Mahlzeit äußerte ich verwegen Luthers Tischspruch: Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket?
Vater kippte vom Stuhl und bat den Herrgott röchelnd um Verzeihung für den missratenen Sohn.
Das Abendessen war beendet. Mutter wollte den Tisch abräumen, wurde von ihm aber angehalten, das später zu tun. Sie müsse ihm erst einmal erklären, weshalb sie einen so ungewöhnlichen Eindruck gemacht habe. Ich musste den Raum verlassen, hielt mein Ohr aber ans Schlüsselloch.
Hoffentlich verrät sie nicht mein Ansinnen, bangte ich und hörte Folgendes.
„Elfriede“, so Gottfried, mein Vater. Eigentlich war ihm der Geburtsname Hubert gegeben worden. Unmittelbar nach Beginn seiner Volljährigkeit verlangte er die Änderung seines Vornamens. Der Name Hubert klinge zu sehr nach Humus, er wolle aber gottergeben heißen. So kam er zu seinem Vornamen Gottfried. Zur Auswahl standen noch Gotthelf, Gottestreu und Gottlieb, doch dieser Name war ihm zu anzüglich.