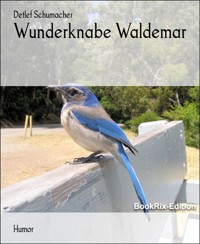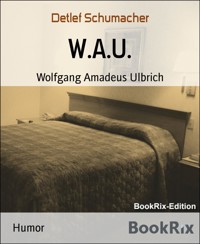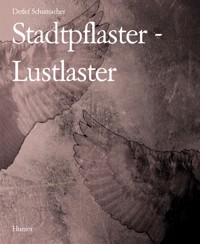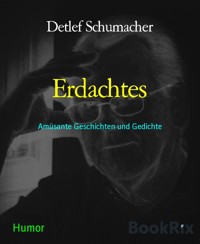0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Würda und Weckelnheim, einst hochgelobte und ausgezeichnete Vorzeigedörfer, hat Walter Ulbricht aus dem Staatsgefüge der DDR verstoßen. Die BRD nimmt sich der entrechteten Einwohner an und lässt sie als Neubundesbürger in den Genuss westlicher Demokratie kommen. Ulbricht, dem die kapitalistische Entwicklung in dieser Enklave missfällt, will seine Fehlentscheidung rückgängig machen. Mit einem absurden Einfall zwingt er die Bundesregierung, von diesem kleinsten Bundesland zu lassen. Als in der Nähe Weckelnheims ein Naturwunder entdeckt wird, bahnt sich eine überraschende Wende der Geschehnisse an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Würda - Wir werden wieder Wer
Meinem Bruder RainerBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenWürdig
Unser Sohn überraschte uns mit der Mitteilung, dass er Halbstarker werden wolle. Wir guckten verdutzt, weil wir nicht verstehen konnten, wie er auf diese absurde Idee gekommen war. Würdig nutzte die fassungslose Stille zur Auskostung des Triumphs. Seine schmächtige Brust wölbte sich, seine Augen bekamen Siegerglanz und seine Ohren wurden rot, wie sie es immer wurden, wenn ihm etwas geglückt war. Weil er glaubte, wir wüssten mit dem Begriff „Halbstarker“ nichts anzufangen, klärte er uns aus seiner Sicht auf. Halbstarker zu sein sei tausendmal angenehmer, als ein Ganzstarker zu sein. Man dürfe Zigaretten rauchen, Bier trinken, Mädchen knutschen, bis in die Nacht hinein laute Musik hören und sich von den Eltern nichts sagen lassen, weil ein richtiger Halbstarker sich nicht dreinreden lässt. Halbstarke folgen eigenen Gesetzen und sind eine verschworene Gemeinschaft, die dem ständigen Nörgeln und Meckern der Erwachsenen mutig ent gegentreten. Sie tun immer genau das, was sie nicht tun sollen. Würdig drückte sich natürlich kindlicher aus, weil sein Wortschatz als Schüler der 1. Klasse noch recht dürftig war. Dennoch hatten Inge und ich sofort erkannt, welche Gefahr seine Entwicklungsphase bedrohte.
Weil Inge in diesem Moment der Fassungslosigkeit nichts pädagogisch Nützliches einfiel, strafte sie mich mit einem tadelnden Blick. Ich wusste – aus Erfahrung bisheriger Ehejahre und der gemeinsamen Erziehung unseres Sohnes -, dass sie mir die Schuld für Würdigs unglaublichen Entschluss gab. Ich hielt es daher für angebracht, einen Vater-Sohn-Dialog zu entfachen, um der Mutter Gelegenheit zu geben, sich zu sammeln und zu erkennen, dass nicht ich der Verursacher der Halbstarkentheorie war.
Das Gespräch in allen Einzelheiten wiederzugeben, erspare ich mir. Wichtig ist zu erfahren, wer Würdig auf diesen abstrusen Gedanken gebracht hatte. Man höre und staune, Theodora Lieblich, Klassenlehrerin der 1. Klasse, hatte Würdig auf dem Gewissen. Natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es von ihm zu hören bekommen hatten. Die Schulanfänger waren von ihr lediglich gefragt worden, was sie später einmal werden wollen. Die Frage war zwar verfrüht gestellt, sollte den Schülern aber den Sinn fleißigen Lernens bewusst machen. Ungeachtet der Tatsache, dass im Verlaufe weiterer Schuljahre andere Einflüsse das Lernverhalten negativ beeinflussen können. Bei Würdig schien sich eine solche Beeinträchtigung schon in der 1. Klasse abzuzeichnen.
So glaubte ich zunächst. Im Verlaufe des weiteren Gesprächs mit ihm kam ich zu der Erkenntnis, dass er nachplapperte, was ältere Mitschüler auf dem Pausenhof zum Besten gegeben hatten.
Natürlich war auch Theodora baff, als sie aus dem Munde Würdigs – und gerade aus seinem – einen solchen Berufswunsch erfahren hatte. Sie blieb aber die geschickte Pädagogin und unterließ es, Hals über Kopf und voller Entsetzen einen Elternbesuch abzustatten.
Sie suchte mich nächsten tags im Gemeindeamt auf, um mit mir in aller Ruhe darüber zu sprechen, wie mit einem Schulanfänger umzugehen ist. Aus Erfahrung wusste sie, dass Eltern, deren erstes, bislang einziges und die erste Klasse besuchendes Kind, behutsame Anleitung brauchen.
Ich nahm ihre Erklärungen mit ständigem Kopfnicken entgegen, um zu bekunden, dass ihre Hinweise auf fruchtbaren Boden fallen. Auch deshalb nickte ich, weil mir einfiel, was mir meine Mutter einst über mein Verhalten als Erstklässler gesagt hatte. Es waren keine Lobeshymnen, die sie zwanzig Jahre später anstimmte. Demnach war ich wohl ein kleiner Tausendsassa, wie meine Lehrer gepetzt hatten. Vor allem die Mädchen hatten es mir angetan, denen ich aber noch nicht so begegnete wie Jahre später meiner Oberschulfreundin Rita.
Als Theodora sagte, dass Würdig seinen Mitschülerinnen gegenüber nicht immer nett sei, hatte ich das Gefühl, meine Gedanken würden offengelegt. Mir wurde siedendheiß. Ich fürchtete, meine einstigen Schandtaten hätten nun ihren originalen Nachahmer in meinem Sohn gefunden. Von vererbbaren Genen wusste ich nichts, und Theodora ließ dieses heikle Thema auch unberührt. Wohl aber kannte ich Weisheiten wie: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! oder Wie der Vater, so der Sohn!
Im Moment wünschte ich mir, Theodora möge Harndrang verspüren und das Büro eiligst verlassen. Wie ein Blutegel saugte sich in mir die Befürchtung fest, die schöne Lehrerin könnte nun beklagen, dass Würdig den Mädchen die Röcke hochzieht, wie ich es einst auf Verlangen der älteren Jungen getan hatte. Sinn und Zweck dieses unanständigen Benehmens blieben mir damals fremd, doch war ich mächtig stolz darauf, wenn mich die Großen lobten, auch deshalb, weil ich die Ohrfeigen der Mädchen klaglos erduldet hatte.
Das Telefon schrillte, und wieder einmal war mir dieser Ton das rettende Geräusch. Aus dem Hörer tönte die erregte Stimme der Schulsekretärin, die schier atemlos verlangte, dass Fräulein Lieblich schnellstens in die Schule kommen solle. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, atmete ich befreit auf und fühlte mich wie ein Knabe, dem eine Tracht Prügel erspart geblieben ist. Ich würde Inge natürlich nicht sagen, dass mich Frl. Lieblich im Gemeindeamt aufgesucht hatte. Aus zweierlei Gründen nicht: Zum einen, weil Inges Eifersucht noch unverbraucht war, und zum anderen, weil sie sich in Erziehungsfragen hintergangen fühlen könnte. Und gerade das durfte sie nicht spüren, denn als Leiterin des Kindergartens Würda – diese Verantwortlichkeit trug sie seit einiger Zeit – besaß sie eine gehörige Portion pädagogisch-psychologischer Erfahrung.
Mein diesbezügliches Wissen beschränkte sich auf praktische Erkenntnisse, die ich als Vater gesammelt hatte. Ungleich größer war mein Erfahrungsschatz in der Beurteilung erwachsener Personen. Ich stand der Gemeinde Würda jetzt als Bürgermeister vor.
Umbrüche
Der Umbruch, wie die radikale Verfügung Walter Ulbrichts seither genannt wurde, hatte in Würda und Weckelnheim einiges verändert. Die meisten Einwohner fühlten sich hinters Licht geführt, betrogen, weil ihnen ein zufriedenes kommunistisches Leben vorgegaukelt worden war. Ihr Glaube an den Wahrheitsgehalt staatlicher, aber auch lokaler Politik war erschüttert, zum Teil sogar restlos vernichtet. Die abrupte Rückkehr in den üblichen Alltagstrott verkrafteten nur die problemlos, die sich schon vor dem Umbruch gewünscht hatten, ihrer geregelten, nützlichen Arbeit wieder nachgehen zu dürfen. Die Bauern und Handwerker ergriff deshalb keine Enttäuschung, als alles wieder so wie früher zu werden schien.
Zu werden schien, betone ich, denn wie der weitere Verlauf der Ortsgeschichte zeigen wird, kam manches anders, als gemeinhin vermutet werden könnte. Die krassesten Veränderungen hatten sich am und im Menschen vollzogen.
Traugott Hampel stellte nach der für ihn unverständlichen Ulbricht-Entscheidung sein Amt zur Verfügung. Als sein fähiger Nachfolger kam ich in Betracht. Auf eine Neuwahl wurde verzichtet.
Traugott verklimperte seine Tage am Klavier. Wer die Disharmonien vernahm, wusste, dass er eine Oper komponierte, die den Arbeitstitel Das Scheusal in Berlin hatte. Die Findung desselben war Willi Stoffel zu verdanken, der die Texte für diese Grusel-Oper schrieb. Tage- manchmal Nächtelang saßen die Beiden in Traugotts Hauskeller – nur in diesem hatte Gattin Elsbeth das Geklimper gestattet –, um ihr gewaltiges Musik-Epos wider den spitzbärtigen Schuft in Berlin zu erstellen. Nach unermüdlichem Schaffen war das Werk aber immer noch nicht vollendet, weil den Künstlern stets neue Anklagen einfielen.
Natürlich war das staatsfeindliche kompositorische Schaffen über Würdas Grenzen hinaus bekannt geworden. Dass davon auch Walter Ulbricht erfuhr, war einem Brief geschuldet, den meine Schwiegermutter an ihre Vornamensschwester Lotte Ulbricht gechrieben hatte. Eigentlich wollte sie darum bitten, den Briefverkehr wieder aufleben zu lassen, da es sich so klug mit ihr unterhalten lasse. Außerdem sei es für die Berlin-Lotte sicherlich interessant zu erfahren, wie das Leben in dem einst so hoch gelobten Würda weiter verlaufe. Als Beispiel verriet Schwiegermama auch das Kellerwirken Hampels und Stoffels.
Um Frau Ulbricht vollends geneigt zu machen, endete Lotte Goldstein ihren Brief mit dem Hinweis, dass sie ein Rezept besitze, nach dem bisher nur ihre Großmutter den leckersten Apfelkuchen der Welt zu backen verstanden hatte. Sie werde dieses Rezept allerdings nur dann nach Berlin schicken, wenn sie Antwort erhalte. Mit einem herzlichen Gruß an den Herrn Ehegemahl, Genossen Parteifreund Walter Ulbricht, ließ Schwiegermutter den Brief ausklingen. Sie buhlte, das war offensichtlich.
Entschuldigend muss ich bemerken, dass sie sich seit ihrer Abschiebung in den Ruhestand tuttlig benahm. Weil ihr bisheriges Leben von Rastlosigkeit gezeichnet war, konnte sie auch jetzt nicht zur Ruhe kommen. Mit ihrer Freundin Emmi Pospischil fand sie ein neues Aufgabengebiet, das ihrem einstigen Beruf nahe war. Mehrmals wöchentlich saß sie mit Emmi beisammen, um Kinderpuppen zu reparieren. Sie teilten sich die Arbeit. Lotte renkte verrenkte Puppengliedmaßen wieder ein, klebte Löcher im Puppenleib mit Heftpflaster zu, nähte abgerissene Ohren oder Nasen an und füllte Köpfe mit frischem Heu. Das tat sie mit Akribie wie eine Chirurgin, einem Beruf, dem sie zeitlebens nachgeträumt hatte. Emmi agierte als OP-Schwester und musste mit notwendigen Operationswerkzeugen zur Hand gehen. Nicht selten geschah es, dass eine besonders arg zerschlissene Puppe vor der Operation eine Narkose erhielt. Lotte spritzte der Lädierten mit einer echten Spritze Wasser in den Stoffpopo.
Reichlich zu tun hatten beide, denn schnell hatte sich herumgesprochen, welche wichtige Dienstleistung das Haus Goldstein anbot. Nicht nur Würdaer Mädchen nahmen die medizinischen Dienste an ihren kleinen Lieblingen in Anspruch, sondern auch die aus Bimstedt und Weckelnheim.
Mit der Zeit wurde den beiden Medizinfrauen die Arbeit aber zu monoton. Emmi kam auf den Einfall, die Reparaturtätigkeit mit lustigen Sprüchen unterhaltsamer zu machen. So dichteten sie wacker drauflos und fanden großen Gefallen an ihren lyrischen Einfällen.
Schwiemu (Schwiegermutter), die sich früher schon im Dichten geübt hatte, fand stets den passenden Reim zur Anfangszeile, die von Emmi vorgegeben war. Einige Kostproben aus der Puppenklinik:
Geht’s dir dünne durch die Därme, brauchst du dringend etwas Wärme.
Windet’s über Stoppelfelder, wird es irgendwann mal kälter.
Jedes Jahr vorm Weihnachtsfest kriegt der Geldbeutel den Rest.
Raschelt’s unterm Haselstrauch, liegt sie drunter und er auch.
Emmi Pospischil notierte die Reime und Lotte Goldstein verschloss sie im Geheimfach des Schreibsekretärs. Diese Vorsichtsmaßnahme hatten sie beschlossen, um keinem Außenstehenden ein Plagiat zu ermöglichen. Vor allem Adolf Hiller wurde beargwöhnt.
Ein Lotte-Ulbricht-Brief
Walter Ulbricht erfuhr vom schändlichen Tun der einstmals führenden Genossen Würdas. Das sei ihm scheißegal, sagte er seiner Gattin. Sollten die Kuhbauern doch zusehen, wie sie mit sich und der Welt zurechtkommen. Wer die Idee des Kommunismus lächerlich gemacht habe, verdiene nichts anderes, als verachtet zu werden. Die Würdaer und Weckelnheimer könnten ihm heute und künftig den Buckel runterrutschen. Sie seien für ihn gestorben.
Lotte hatte Mühe, ihren aufgebrachten Gatten zu beruhigen. Sie spürte sehr wohl, dass ihn die Hampel-Stoffel-Oper nicht kalt ließ. Weil sie sich die Sympathie für die Bürger der einst Glücklichen Dörfer erhalten hatte, bemühte sie sich, Walter für sie wieder einzunehmen. Jeder Versuch in dieser Hinsicht schlug jedoch fehl. Auch die Verlockung mit Lotte Goldsteins Apfelkuchenrezept hatte keinen Erfolg.
Wörtlich sagte er: „Die soll sich mit ihrem Rezept den Hintern abwischen. Ich kann mich mit diesen kleinbürgerlichen Elementen, die jämmerlich versagt haben, nicht weiter befassen. Als Staatsratsvorsitzender muss ich wichtigere Dinge im Blick haben als solchen reaktionären Apfelkuchen. Was glaubst du wohl, Lottchen, wie die sowjetische Partei- und Staatsführung reagiert, wenn sie erfährt, dass ich wegen Apfelkuchens aus frühkapitalistischer Zeit in meinen Entscheidungen rückfällig geworden bin. Die Genossen im Kreml scheißen mich dermaßen zusammen, dass ich denke, der 17. Juni ist auferstanden!“
Lotte wurde endgültig klar, dass Walter nicht umzustimmen war. Dennoch hielt sie es für ihre Pflicht, Lotte Goldstein zu antworten.
Ihr Brief löste nicht nur bei Schwiemu Erstaunen aus, sondern auch bei Inge und mir, die wir diesen Brief anschließend lesen durften. Was die Frau des Staatsratsvorsitzenden in diesem zum Besten gab, grenzte an die völlige Missachtung menschlicher Empfindungen. Lotte Ulbricht tat kund – mit persönlichem Widerwillen -, welches vernichtende Urteil ihr Gatte über Würda und Weckelnheim gefällt hatte. Weil dieses Schreiben die weitere Entwicklung beider Dörfer vorausahnen lässt, gebe ich es wörtlich wieder.
Liebe Lotte Goldstein, es freut mich, von Dir wieder zu hören. Nach all dem, was euch durch Walters Entscheidung widerfahren ist, erstaunt mich die Standhaftigkeit Deiner Mitbürger. Es war und ist für euch sicherlich nicht einfach, den Wechsel von hohem Glücksgefühl zu schmerzlicher Enttäuschung mit Fassung zu ertragen. Das ehrt euch, und ich bewundere euch deshalb. Die Berliner Großklappen, auch die, die hier im Staatsratsgebäude Walters Unnachgiebigkeit preisen, wären an eurer Stelle zu winzigen Jämmerlingen geschrumpft. Ich sage das deshalb so offen, weil ihr mir leid tut und ich für euch immer noch die wärmsten Empfindungen hege.
Als ihr damals so überzeugt um den Titel 'Glückliches Dorf' gerungen hattet, blickte die Welt voller Bewunderung auf euch, die sozialistische wie auch die kapitalistische. Es war schon erstaunlich, welche positiven Veränderungen sich im Verhalten eurer Bürger vollzogen hatten. Nachahmenswert für alle, die davon erfuhren.
Ich gebe zu, dass ein Mensch so gänzlich ohne nützliche Arbeit nicht glücklich sein kann. Nicht arbeiten zu dürfen, war deshalb wohl eine der entscheidendsten Fehlentscheidungen meines Mannes. Ich glaube nicht, dass Lenin so verstanden sein wollte, als er über das Anfangsstadium kommunistischen Zusammenlebens schrieb. Allzu voreilig war auch Walters Festlegung, das Geld abzuschaffen. Leider ist man anschließend immer etwas klüger. Bedauerlich an der ganzen Sache ist, dass mein Mann sich so rasch von all dem abgewandt hat, was er einst für gut gehalten und selbst eingefädelt hatte. Er zeigt sich in der Hinsichtunerbittlich und duldet keinen Widerspruch. Selbst ich kann mit meinem Apfelkuchen keine Meinungsänderung herbeiführen. Insofern bleibt auch Dein Apfelkuchenbackrezept aus Großmutters Zeiten ohne Wirkung, liebe Lotte Goldstein. Dennoch Dank für Deine ehrliche Absicht!
Natürlich zeigt sich Walter, dem ich Deinen Brief vorlesen musste, sehr ungehalten über die beleidigende Freizeitbeschäftigung des Herrn Hampel und des Herrn Stoffel.
Weil beide aus der Partei ausgestoßen sind und das in den Tageszeitungen unserer Republik auch zu lesen war, sieht Walter die Verunglimpfung seiner Person als Machwerk zweier Schwachköpfe und politischer Querulanten.
Es wundert Dich sicherlich, dass er gegen die Beiden nicht vorgehen lässt. Aus folgendem Grund nicht: Nach wie vor beäugen die Medien des kapitalistischen Auslands sehr aufmerksam eure Weiterentwicklung und warten gierig darauf, dass sich Walter in seiner Partei- und Staatsführung noch mehr gehen lässt. Das darf nicht geschehen, und deshalb hat er einen für euch folgenschweren Entschluss gefasst.
Weil ihr eine Schande für den sozialistischen Aufbau seid – entschuldige bitte, dass ich das so sagen muss -, will er euch an den Rand der gesellschaftlichen Entwicklung stellen. Strafe muss sein, hatte er wörtlich gesagt, wenn ich persönlich auch meine, dass er eine Strafe verdient hätte. Aber er ist mein Gatte. Ich hoffe, Du verstehst mich.
Er ist so verbittert über seine Niederlage, dass es ihm völlig egal ist, ob der Kapitalismus nun seine Hände nach euch ausstreckt. Mir sagte er, dass ihm dies sogar lieb sei, weil sich dann beweisen werde, wie unfähig das kapitalistische System auch in der Führung der Menschen ist. An euch könne ohnehin nichts mehr verdorben werden. …
Als ich diese Stelle des Briefes las, überkamen mich Attentatsgedanken. Den Schluss des Schreibens las ich mit zorngeröteten Augen.
Um diese seine privaten Rachegedanken staatlich zu sanktionieren, will Walter sie in der nächsten Sitzung des Staatsrates und auch in der nächsten ZK-Tagung zum Beschluss erheben. Ich ahne schon, wie sich der Westen ins Fäustchen lacht, wenn Presse und Rundfunk unserer Republik diesen Unsinn verkünden.
Bleibt hart im Nehmen und mutig im Glauben! Vielleicht gelingt es euch, dem heraufbeschworenen Unheil – von welcher Seite es auch kommen mag – entschlossen zu widerstehen.
Ich wünsche euch das von ganzem Herzen!
Lotte Ulbricht
PS.: Walter weiß nichts von diesem Brief. Hänge ihn deshalb nicht an die große Glocke!
Von weiterem Briefverkehr mit Dir, liebe Lotte, muss ich leider absehen.
Schwiegermutter verschloss den Brief sehr sorgfältig im Geheimfach, damit niemand, außer Inge und mir, von seinem Inhalt erfährt. Auch Emmi Pospischil nicht. Mir schwante, dass sich für Würda in nächster Zeit ein Unheil großen Ausmaßes anbahnen wird. Als Bürgermeister konnte ich nichts dagegen tun, im Moment jedenfalls nicht, weil abgewartet werden musste, welche Verfügungen Ulbricht in Berlin treffen würde. Ich fühlte mich ziemlich hilflos, denn von einer funktionierenden Gemeindevertretung konnte seit Monaten nicht mehr die Rede sein. Auch Hampel und Stoffel wollten von Politik nichts mehr wissen. Der Einzige, der an die Kraft und Stärke der Partei noch glaubte, war Oskar Müller.
Oskar Müller - parteitreu, aber doof
Ich werde nicht zum Verräter, sagte er mir, und ich glaubte ihm das, weil es nichts mehr zu verraten gab. Dass seiner Parteitreue demnächst mit einer Auszeichnung gedankt werde, daran glaubte er felsenfest. Die aber schien nun aussichtsloser denn je, denn die SED-Bezirksleitung hatte ihm kurzerhand das Arbeitsverhältnis gekündigt.
Der Erste Sekretär der Bezirksleitung bedankte sich für Müllers Bemühungen mit einem Buch, das Oskar zur Bibel wurde. Der Titel auf dem braunen Einband lautete: Aus dem Leben unseres Führers. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend.
Der Bezirkssekretär hatte diesen Schmöker geschenkt bekommen, als er zum Fähnleinführer der Hitlerjugend ernannt worden war. Da sich das Buch in seinem Bücherregal neben den dicken Marx- und Engelsbänden wie ein verirrtes Schaf ausnahm, entsorgte es der SED-Gewaltige. Es der Altpapierannahmestelle zuzuführen, wagte er nicht, weil die erste Seite eine Widmung des Gauleiters enthielt. Wichtig war ihm deshalb, wissen zu lassen, dass sein Aufstieg zu den Höhen der Partei schon durch andere wichtige Aufgabenbereiche vorbereitet worden war. Oskar Müller las den Spruch allabendlich vor dem Zubettgehen in tiefer Ergriffenheit, weil der Hola-Chef unter diesen auch den eigenen an seinen ehemaligen Aschenbecher- und Toilettenreiniger gekritzelt hatte. Geschrieben stand: Dem völkischen Glauben und dem Führer des Deutschen Reichs treu ergebenen Ehrenfried Purzelbaum anlässlich seiner Erhebung zum Fähnleinführer gewidmet von der Gauleitung Hola.
Dieser Text sowie die Unterschrift des Gauleiters mit dem beigefügten Hakenkreuzstempel waren von Purzelbaum zwar durchgestrichen, aber noch lesbar. Nicht durchgestrichen, sondern mit roter Tinte darunter geschrieben stand: Dem kommunistischen Glauben und dem Führer der Deutschen Demokratischen Republik treu ergebenen Oskar Müller anlässlich seiner Enthebung als Putz- und Spülgenosse gewidmet von der SED-Bezirksleitung Hola.
Unterschrift: Ehrenfried Purzelbaum - Stempel: SED-Emblem
Belastungen
War ich früher gern ins Gemeindeamt geeilt, wurde mir dieser Weg nun zum Gang nach Canossa. Tagtäglich musste ich mir das Wehklagen oder Wettern Würdaer Bürger anhören. Wer nicht beklagte, dass es in Würda seit dem Umbruch immer mehr bergab gehe, der schimpfte darüber, dass die einstmals lobenswerten Umgangsformen der Menschen Opfer ungebührlichen Verhaltens geworden seien.
Ich unterließ es, die Empörten vom Gegenteil zu überzeugen, denn es gab nichts Gegenteiliges. Deshalb hielt ich es auch für ratsam zu schweigen, weil selbst unser Sohn Anlass zur Besorgnis gab. Ich verwünschte den Tag, an dem ich beglückt und stolz das Amt des Bürgermeisters übernommen hatte. Dass Traugott Hampel froh war, diesen Posten los zu sein, übersah ich im Überschwang meiner Gefühle. Ich nahm mir fest vor, Vieles anders und besser zu machen als er.
Erfahrung im Umgang mit den Bürgern hatte ich genug, und so wollte ich ein Bürgermeister sein, der niemandem Anlass zur Klage gab. Leider hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Zeitzeichen änderten sich rasant und mit ihnen die Menschen. Die Einwohner Würdas wussten, dass nicht ich der Urheber der verfahrenen Dorfpolitik war. Sie sagten mir das auch, blickten mich aber zweifelnd an, wenn ich vom Kommen besserer Zeiten sprach.
„Du redest wie der Pfarrer“, urteilte Yvonne Klein und wollte mir doch Mut machen. „Wenn dir niemand beistehen und helfen will, ich werde es tun!“
Sie war keine Frau von leeren Worten, das hatte sie in der Vergangenheit bewiesen. Nur wusste sie im Moment nicht, wie dem zunehmenden Verfall von Moral und Sitte zu wehren war. Doch versprach sie mir sofortige Unterstützung, sollte ich in einer schier ausweglosen Situation nicht weiter wissen.
Ich bedankte mich ehrlichen Herzens, denn ich wusste: Auf die Frau ist Verlass. Natürlich hätte ich mich auch an Dorothea Rülle, die Bürgermeisterin von Bimstedt, wenden können. Doch wollte ich sie nicht mit meinen Problemen belasten, weil ich mich dann in ihrer Schuld glaubte. Bislang war aus ihrer Richtung noch kein Angebot zur Unterstützung eingegangen. Vielleicht meinte sie, ich werde aus diesem Schlamassel allein herausfinden. So jedenfalls deutete es Theodora Lieblich, die – noch immer eng mit Dorothea Rülle befreundet – diese Vermutung aus einem Gespräch mit ihr gewonnen hatte.
Auch Theodora hätte mir gern geholfen, aber sie war in ihrer Funktion als neu ernannte Schulleiterin von Würda selbst sehr gefordert. Belastend war, dass sie ihre Aufgabe ebenso ernst nahm wie ich. Fehler wollten wir beide nicht begehen, und das war in dieser Zeit wahrlich ein Kunststück. Erschwerend kam hinzu, dass wir niemandem mehr rechenschaftspflichtig waren. Uns stand es also frei, tun und lassen zu dürfen, was und wie wir wollten.
Man mag nun meinen, dass eine solche vogelfreie Situation trefflich für unbeschwertes Handeln hätte sein können. War es aber nicht. In vielerlei Hinsicht nicht. Bislang waren wir immer nur Angestellte gewesen, die den Anweisungen einer höheren Instanz zu folgen hatten. Das war allemal leichter, als selbst entscheiden zu müssen. Wir wirkten nun im luftleeren Raum, d.h., wir konnten uns nur selbst Rechenschaft über unsere geleistete Arbeit geben. Es war niemand, der sagte, das habt ihr gut gemacht oder das könnte noch besser gehen. Uns fehlte das Erfolgserlebnis. Ich bekam es nicht durch die Einwohner Würdas und Theodora nicht durch die Eltern ihrer Schüler. Obwohl ihre Beliebtheit ungebrochen war, hielten sich Mütter und Väter auf Distanz, weil sie nicht mitverantwortlich sein wollten für Misserfolge in der Erziehung ihrer Kinder. Was sie pädagogisch selbst vermasselten und nicht in den Griff bekamen, schoben sie bedenkenlos auf die Lehrer ab.
Auch meine Ehefrau Inge als Leiterin des Kindergartens hatte mit erheblichen Problemen zu ringen. Beim Abendbrot kam es nicht selten zu Zerwürfnissen. Anlass waren oftmals nichtige Dinge aus dem eigenen Arbeitsbereich. So klagte Inge einmal über einen Fünfjährigen, der ihr gesagt hatte, er würde sie niemals zur Frau nehmen, weil sie nicht hübsch genug sei. Was Schlimmeres konnte Inge nicht widerfahren. Dass Urteil dieses Vorschulknaben kränkte sie, denn in ihrer vieljährigen Kindergartentätigkeit hatte sie die Erfahrung gewonnen, dass Kinder die Wahrheit rücksichtloser gebrauchen als Erwachsene. Hätte Franz-Otto, so hieß das Bübchen, geäußert, seine Mutter sei hässlich, dann hätte Inge aus pädagogischer Notwendigkeit heraus zwar warnend den Finger gehoben, widersprochen hätte sie jedoch nicht.
Ich hielt mich im Wehklagen zurück, weil Sohn Würdig, der mit am Tisch saß, Schwächen in meiner Führungstätigkeit als Bürgermeister entdeckt hätte. Ich wollte ihm weiterhin das gute Vorbild sein.
Schwiemu Lotte hatte es aufgrund der Streitlust ihrer Tochter vorgezogen, dem Abendbrot fern zu bleiben, wie sie überhaupt die Abende oft bei Emmi Pospischil verbrachte. Lotte Goldsteins Kampfgeist war erlahmt, was ich als angenehm empfand.
Ein anderer und sehr wesentlicher Grund, weshalb Inge und ich uns in die Haare bekamen, war, dass wir für unsere Tätigkeit keine Bezüge mehr erhielten, also nicht mehr entlohnt wurden. Und das nun schon seit Wochen. Auch Theodora Lieblich erhielt kein Gehalt mehr. Sie empfand das weniger bedrückend, weil sie eine beträchtliche Summe gespart hatte. Für sie als ledige Person, die weniger Ansprüche gestellt und weniger Ausgaben getätigt hatte, konnte die fehlende Gehaltsfortzahlung noch nicht bedrohlich sein. Sie gehörte auch zu denjenigen, die damals, als das Geld als Zahlungsmittel für ungültig erklärt worden war, ihre Finanzen sicher verwahrt hatte. Inge und ich hatten nicht so klug gehandelt. Doch will ich darüber nicht schreiben, weil es peinlich ist. Es heißt doch: Über Geld spricht man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht.
Auf jeden Fall machte die fehlende finanzielle Vergütung bewusst, dass verantwortliche Dienststellen von uns keine Notiz mehr nahmen. Mich wunderte, dass wir auf der Kreislandkarte noch als Ort verzeichnet waren.
Schabunke auf schiefer Bahn
Das gesellschaftliche Zusammenleben der Würdaer geriet aus den Fugen. Personen, die unter einer Charakterschwäche litten, machten jetzt auf Anarchie. Einige Einwohner beschwerten sich über dreiste Einbrüche. Am schlimmsten zürnte Fleischermeister Schmer, dem ein ganzes Schwein vom Haken geklaut worden war. Sauf-Anton hatte einem Dieb die fast volle Schnapsflasche auf die Rübe geknallt, wie er sagte. Er verlangte von mir als Bürgermeister, dass ich ihm die Flasche ersetze, weil er im Dienste der Sicherheit gehandelt habe. Dass der Verletzte tagelang nicht aus dem Krankenbett kam, interessierte Anton nicht. Lapidar meinte er, dass den Verbrecher eine Gottesstrafe ereilt habe.
Die Würdaer taten mehr und mehr in Selbstschutz und beinahe wäre der Hüter von Ordnung und Sicherheit, Dorfpolizist Schabunke, das Opfer von Lynchjustiz geworden. Der war, ebenso wie Hampel und Stoffel, längst nicht mehr in Amt und Würden.
Das Volkspolizeikreisamt hatte ihn seines Postens enthoben, mit einer fadenscheinigen Begründung allerdings, die er nicht einsehen wollte. Als er in Hola aufgefordert wurde, seine Pistole abzugeben, legte er sie nicht auf den Schreibtisch des VP-Oberst, sondern hielt sie ihm vor die Nase. Dann sprach er: „Bevor ich meine Kanone aus der Hand gebe, lege ich euch alle um! Treu und brav habe ich in Würda für Zucht und Ordnung gesorgt und nun willst du uniformierter Sesselfurzer mir das Schießeisen abnehmen?“
Sprach’s und verschwand – mit der Dienstwaffe.
Der VP-Oberst bekam vor Wut einen Erstickungsanfall und musste ins VP-Hospital eingeliefert werden. Nach seiner Entlassung litt er an Verfolgungswahn.
Zwei Volkspolizisten mussten ihn rund um die Uhr beschützen, weil er fürchtete, Schabunke könnte ihn auf offener Straße kaltblütig umlegen. Ihn dingfest zu machen, war nicht mehr möglich, da Würda nun außerhalb seines Zugriffsbereichs lag. Diese Tatsache brachte ihn fast um den Verstand. Selbst in seinen eigenen vier Wänden bangte der Polizeigewaltige um sein Leben, weil er Schabunke für einen rücksichtslosen Mörder hielt. Diese seine Befürchtung war durch einen amerikanischen Dokumentarfilm genährt worden, den sich alle verantwortlichen VP-Dienststellenleiter ansehen mussten. In schonungsloser Offenheit zeigte er das Verhalten eines US-Sheriffs, der wegen sexueller Nötigung im Dienst vom Dienst suspendiert worden war. Der schnappte sich daraufhin die Ehefrau des Marshalls und missbrauchte sie vor dessen Augen. Der Marshall konnte nichts dagegen tun, denn während des Geschlechtsakts hielt ihn der Suspendierte, der unter der Frau lag, mit dem Colt in Schach.
Als der Film abgelaufen war, äußerten die Genossen den Wunsch, ihn noch einmal sehen zu wollen, um den Ekel vor diesem Gewaltakt besser verinnerlichen zu können. Es bedurfte noch einer dritten Verinnerlichung, ehe der Film des Klassenfeindes endgültig im Geheimarchiv verschwand.
Der VP-Oberst, der das Ansehen dieses Schulungsfilms veranlasst hatte, informierte Tags darauf die geschulten Genossen, dass er für einige Zeit auf Dienstreise sei und er seine Frau deshalb allein zu Hause lassen müsse. Es wäre ihm lieb, wenn sich die Genossen – abwechselnd versteht sich – um seine Gemahlin kümmern würden.
Als er von der Dienstreise zurückgekehrt war, stellte er mit Enttäuschung fest, dass sich nicht ein Genosse seiner Gemahlin angenommen hatte. Als er einen zur Rede stellte, meinte der, dass es anstrengend sei, unter der Genossin Ehefrau zu liegen. Ihr Gewicht würde es unmöglich machen, die Pistole gegen einen Eindringling zu erheben.
Ernst-Günther Schabunke, bekannt für seine Angst vor Spinnen, geriet in eine noch größere Bedrängnis. Weil auch ihm die Bezüge gestrichen waren und er fürchtete, bald hungern zu müssen, suchte er mehrfach im Schutze der Dunkelheit die Hühnerställe des Dorfes heim. Hühnerfleisch sei gesund und halte schlank; auch Hühnereier seien nahrhaft. Das wusste Schabunke vom Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Würda, mit dem er einige Zeit befreundet war. Diese Freundschaft ging nur deshalb in die Brüche, weil Ernst-Günther Hühnereier als Zielscheibe für seine Schießübungen benutzte.
Dieser Missbrauch erregte die Gemüter der Geflügelzüchter und sie forderten die Einstellung der sinnlosen Zerstörung eines wertvollen Grundnahrungsmittels und Fortpflanzungsprodukts.
Schabunke störten die Proteste nicht und er ballerte fröhlich weiter. Sein schädigendes Verhalten begründete er damit, dass er schießtechnisch auf dem Laufenden bleiben müsse.
Warum er auf Eier und nicht auf etwas anderes schieße, fragte ihn der Vereinsvorsitzende.
Diese Zielobjekte kämen dem realistischen Einsatz seiner Pistole sehr nahe, erwiderte Schabunke, denn er habe den Befehl erhalten, Flüchtenden genau in den Schritt zu schießen.
Nun war er selbst auf die schiefe Bahn geraten. Das wurde ihm endgültig bewusst, als er beim letzten Einbruch gestellt worden war.
„Ich könnte mich in den Hintern beißen!“ fluchte er, und verspürte sofort wieder Schmerzen an diesem. Beim letzten Raubzug durch einen Hühnerstall war er von der Bäuerin Klara Klawitter auf frischer Tat gestellt worden.
„Wer da!“ rief diese, als Ernst-Günther im Begriff war, die aufgescheuchten und laut gackernden Hühner zu beruhigen. Sie sollten sich leiser verhalten, er wolle nur ihre Eier ablesen.
„Dir werde ich auch die Eier ablesen!“ dröhnte die Bäuerin und stach dem Dieb, den sie wegen der Dunkelheit nicht erkennen konnte, mit der Mistgabel ins Gesäß. Schabunke heulte auf und war trotz des Schmerzes froh, nicht anders herum gestanden zu haben.
Klara Klawitter, bekannt für ihr erbarmungsloses Vorgehen gegen Diebsgesindel – sie war des Öfteren schon bestohlen worden – stach erneut zu, traf aber nur eins der wild durcheinander flatternden Hühner. Der Lärm im Stall war ohrenbetäubend. Ernst-Günther jaulte, weil er große Schmerzen spürte. Ein Huhn hatte sich in panischer Angst auf seinem Kopf festgekrallt und beschmutzte diesen mit Kot. Noch ehe der Dieb den rettenden Stallausgang ertappen konnte, hatte Klara Klawitter diesen bereits von außen verriegelt.
Schabunke musste den Rest der Nacht in der unangenehm riechenden Hühnerbehausung zubringen. Er litt körperliche und seelische Schmerzen. Schlimm empfand er, dass er am kommenden Morgen entdeckt und als gewöhnlicher Einbrecher der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden würde.
Wie befürchtet, geschah es dann auch.
Donna Klara, wie die Klawitter von der Dorfbevölkerung spöttisch genannt wurde, öffnete unter Anwesenheit einiger Zeugen die Stalltür. Nichts war zunächst zu sehen. Die Leute fühlten sich veralbert. Sie waren der Klawitter nur deshalb gefolgt, weil die behauptet hatte, den seit Wochen gesuchten Eierdieb dingfest gemacht zu haben.
„Zicke-Zacke, Hühnerkacke, hoi, hoi, hoi!“ rief ein junger Mann und verlieh damit seiner Enttäuschung spöttischen Nachdruck.
„Ich bin doch nicht blöd!“ schimpfte Klara, „den Kerl habe ich mit der Mistgabel aufgespießt. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.“
„Da ist er ja!“ rief eine Frau und zeigte auf eine Gestalt, die ängstlich in der hintersten Ecke des Stalles kauerte.
Mit gesenkter Mistgabel ging Klara auf das Häufchen Elend zu.
„Mach ihn fertig!“ brüllten einige blutrünstig.
Die Klawitter war noch keine drei Schritte gegangen, da sprang das Häufchen Elend mit einem entsetzlichen Schrei empor. Die Leute durchfuhr ein eisiger Schreck. Klara ließ verdutzt die Mistgabel fallen.
Schabunke setzte auf diese Schrecksekunde und wollte dem Stall unerkannt entweichen. Damit ihm das gelinge, hielt er beide Hände vors Gesicht. Aber auch ohne diese Gesichtsverdeckung wäre er zunächst unerkannt geblieben. Über und über mit beschmutztem Stroh bedeckt, flößte er den Leuten noch mehr Furcht ein. Den rettenden Stallausgang erreichte er dennoch nicht, weil er über die von Klara fallen gelassene Mistgabel stolperte und nun den Stallboden küsste. Angewidert spuckte er aus. Weil er seiner fatalen Lage noch ein bisschen Hoffnung geben wollte, erhob er sich und stellte sich breitbeinig vor die fassungslosen Leute hin. Diese Haltung nahm er stets ein, wenn er sich wichtig machen wollte. Glaubhaft fauchte er: „Beinahe hätte ich ihn erwischt, diesen Lump! Leider bekam ich ihn in der Dunkelheit nicht mehr zu fassen. Aber verlasst euch drauf, in allernächster Zeit packe ich den Eierdieb.“
Klara und ihren Zeugen verschlug es die Sprache. Die Klawitter dachte, was die anderen nicht dachten, nämlich: Dieser dreckige und übel riechender Bursche will mich für dumm verkaufen. Wollte klauen, wurde erwischt, von mir gepiekst und dann eingesperrt. Bodenlose Frechheit von diesem Aas!!
Die Leute dachten anders, nämlich: Die Klawitter will uns für dumm verkaufen. Der Geschundene wollte den Dieb fassen, erwischte ihn aber nicht und wurde undankbarerweise eingesperrt. Freche Lügnerin, die Klawitter!
Trotz kotverklebter Augen erkannte Schabunke, dass die Anwesenden in Zweifel geraten waren. Diesen Vorteil muss ich schnellstens nutzen, beschloss er.
Auch Donna Klara merkte, dass man nicht ihr, sondern dem Schmutzfink glauben wollte. Von tiefer innerer Empörung gepackt ergriff sie die auf dem Boden liegende Mistgabel und richtete sie gegen Schabunke.
Die vorhin blutrünstig gerufen hatten: „Mach ihn fertig!“, riefen jetzt: „Tu dem Braven kein Leids!“
Ernst-Günther, der die rücksichtslose Brutalität der Klawitter kannte, sank auf die Knie, hob die gefalteten Hände und bat inständig, ihn nicht noch einmal in den Popo zu stechen.
Das war Klara nicht genug. Mit lauter Stimme rief sie: „Gestehe, du Schwein!“
„Ja, ja, ja, ich wollte Eier mopsen, aber nur drei bis vier Stück! Du weißt doch, dass ich am Hungertuch nage.“
Eine Zeugin schluchzte teilnahmsvoll. Klara blieb unbeeindruckt und forderte den Knienden auf, sich erkennen zu geben, denn noch hatte niemand sein wahres Gesicht erkannt.
„Ich bin’s, Klärchen“, wimmerte Ernst-Günther, denn die Mistgabel senkte sich bedrohlich in Richtung seines Hinterteils.
„Sprich deutlicher und mache mich nicht mit meinem Kosenamen an, den nur einer nennen darf!“
„Wer ist der eine?“ fragte die schluchzende Frau.
Klara Klawitter, die sich inzwischen auf dem Tiefpunkt ihres Gemütszustandes befand, antwortete wirsch: „Der eine ist Schabunke, unser ABV. Dem erlaubte ich, mich Klärchen zu nennen, nachdem er mein Schwein aus dem Dorfteich gerettet hatte. Und jetzt erlaubt sich dieses Dreckschwein, mich Klärchen zu nennen!“
Ernst-Günther Schabunke merkte, dass er sich verraten hatte. Da er keinen Ausweg aus der bedrohlichen Situation sah, gab er seiner Stimme einen süßen Unterton und flötete: „Klärchen, holdes Klärchen, erkennst du mich nicht? Ich bin’s, Günthi, der Schweineretter!“
Klara stand wie vom Donner gerührt. Das war doch nicht zu fassen! Dieses Stück Dreck sollte der Dorfpolizist sein? Nicht zu glauben.
„Reinige deine Fresse!“ schnauzte Klara, und Ernst-Günther tat wie ihm geheißen. Dabei dachte er verbittert, dass ihn nur Spinnen und willensstarke Frauen das Fürchten lehren. Sein strammes polizeigeprägtes Selbstbewusstsein brach in Klärchens Hühnerstall vollends zusammen.
Sauber bekam Schabunke sein Gesicht nicht, im Gegenteil, er verschmierte es noch mehr.
Klara befahl einem Zeugen, einen Eimer Wasser von der Pumpe zu holen. Während er das tat, sprach sie mit unheilschwangerer Stimme: „Und wehe dir, wenn du mich belogen hast! Dann jage ich dir die Mistgabel noch einmal hinten rein!“
Der Mann mit dem Wassereimer kam.
„Schütte ihm die Brühe über den Kopf!“ befahl sie.
Nachdem das geschehen war, sah Günthi wie eine an Land gezogene Wasserleiche aus. Dieser Anblick entsetzte die Leute noch mehr, nur Klara Klawitter nicht. Sie rang zwar einige Augenblicke mit der Atemluft, denn sie hatte Ernst-Günthers Visage vage erkannt, fand aber schnell wieder zurück auf den Boden der Realität.
Der Kniende jammerte zum Herzerweichen, aber Klaras Herz erweichte er nicht. Verächtlich dachte sie, dass dieses feige Benehmen eines Dorfpolizisten unwürdig ist.
Der wiederum dachte flüchtig, weil er nicht mehr flüchten konnte, dass die Pistole ihm jetzt gute Dienste leisten würde, wenn er sie bei sich hätte.
Klara schnauzte: „Steh auf und verschwinde!“
Schabunke tat das schleunigst. Als er an Klara vorbeihuschte, hauchte er „Danke Klärchen!“
Sie schleuderte ihm drohend nach: „Lass’ dich bei mir nie wieder blicken!“
Als E.-G. den Blicken entschwunden war, sagte die Frau mit den Schluchzern: „Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Dieb große Ähnlichkeit mit unserem Polizisten.“
„Er hat sie nicht nur, er ist es auch“, bemerkte Klara verächtlich.
Die Leute guckten verwundert.
„Und warum hast du ihn einfach laufen lassen?“ fragte die Frau.
„Weil es für ihn die größte Strafe sein wird, mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen. Als Polizist hat er sich jedenfalls unmöglich gemacht. Oder glaubst du, dass vor ihm noch jemand Respekt haben wird oder Räuber vor ihm ausreißen?“
Die Frau schüttelte den Kopf.
Der Mann, der Schabunke das Wasser über den Kopf gegossen hatte, meinte, dass es besser wäre, den Dieb nicht als ABV zu entlarven. Immerhin hätte er ein Schwein vor dem Ertrinken gerettet.
„Das sagst du nur, weil du Freiwilliger Helfer der Volkspolizei bist. Stelle dir mal vor, ich hätte Schabunke nicht enttarnt und er würde weiterhin unerkannt Hühnerställe ausrauben. Niemand käme dahinter, dass die Polizei persönlich am Werk ist. Wir alle, auch du als Freiwilliger Helfer der VP, würden jahrelang einem Gangster nachjagen, den es gar nicht gibt.“
Die Leute erkannten, dass Klara richtig gesprochen hatte.
„Und wer soll nun für Recht und Ordnung sorgen?“ fragte jemand.
Klara, die Schultern hebend: „Das weiß ich doch nicht. Seit Monaten geht es in Würda ohnehin drunter und drüber.“
„Leider ist es so“, schluchzte die Frau wieder, „aus unseren Kindern werden bestimmt einmal richtige Verbrecher.“
„Quatsch nicht so blöd!“ fuhr Klara sie an. „Was aus euren Kindern wird, liegt an euch selbst. Ihr müsst sie nur richtig erziehen.“
„Du hast gut reden“, bemerkte der Wassereimer-Mann, „hast selbst keine Kinder. Auch meine Nachkommen werden erfahren, dass der Polizist geklaut hat. Sie werden den Respekt auch vor mir verlieren, weil ich Schabunke immer treu und brav zur Seite gestanden habe.“
Klara zweideutig: „Auch beim Klauen?“
Die Leute lachten.
Nur einer sagte sehr ernst: „Um unser Dorf ist es schlimm bestellt. Nun ist auch das letzte Fünkchen Glaube an Gerechtigkeit dahin. Ich finde das nicht lustig.“
Schnell wurden die anderen wieder ernst.
Der eine weiter: „Damit der Zustand in unserem Dorf nicht noch mehr verlottert, brauchen wir jemanden, der die Bürger zu richtigem Verhalten zwingt. Schabunke können wir nun vergessen.“
Die Leute nickten und blickten zu Boden, als könnte aus dem Hühnermist ein unbescholtener Ordnungswächter erstehen. Gleich Phönix, der sich aus der Asche erhoben hatte.
Der Mann sah das mit Missvergnügen. Er fuhr die zu Boden Sehenden an: „Ihr seid Feiglinge!“
„Und wie ist das mit dir?“ schnauzte Klara Klawitter. „Du machst auch nicht den Eindruck, als wolltest du die Leute zur Räson bringen.“
Der Angesprochene wehrte sich mit dem Hinweis, dass es ohne Pistole unmöglich sei, den Würdaern Vernunft beizubringen. Die Schluchz-Frau meinte, dass die Ungehorsamen auch vor einer Mistgabel Schiss bekämen.
So kam es, dass Klara Klawitter von einem Häufchen Bürger zum neuen Dorf-Sheriff gewählt wurde. Sie nahm die Wahl ohne Zögern an, denn ihr Wunsch war es schon immer, unbequemen oder widersetzlichen Personen die Leviten zu lesen.
Emanzipationsgebaren
Stunden später wurde ich über die Ernennung eines neuen Dorfpolizisten informiert und erfuhr auch den Grund hierzu. Begeistert war ich nicht. ABV Schabunke war mir irgendwie vertrauter als der weibliche Haudegen Klara Klawitter. Doch zweifelte ich keinen Augenblick daran, dass Donner-Klara, wie man sie nun wohl nennen würde, mit eisernem Besen kehren werde. Sicherlich bediente sie sich dabei nicht nur der Mistgabel, denn in ihrem Besitz fanden sich noch andere Hieb- und Stichwaffen.
Als ich Inge über diese Mist-Wahl informierte, Klara war ja auf mistbedecktem Boden gekürt worden, zeigte sie sich sehr erfreut. Sie jauchzte und triumphierte: „Endlich mal eine Polizistin im Ort, die dem Mannsvolk den Marsch blasen wird. Hoffentlich erwischt sie dich auch mal beim Eier klauen!“
Ich spürte, mit wie viel Liebe sie das gesagt hatte und wandte mich kusslos zum Gehen. Noch ehe ich die Stubentür aufgeklinkt hatte, holte mich ihr Befehlssatz zurück: „Und lasse dir ja nicht einfallen, Klara minderwertiger als Schabunke einzustufen. Als Bürgermeister hast du die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ihr den Rücken zu stärken. Du weißt doch hoffentlich, was Gleichberechtigung bedeutet?“
„Natürlich, weiß ich das, mein Liebling. Gleichberechtigung heißt, dass ich als Familienvater auch einmal zu Wort kommen darf.“ Das Wörtchen darf betonte ich. Inge war’s zufrieden.
Als ich mich erneut zum Gehen wandte, fiel ihr der Hinweis ein, mich schnellstens um eine weibliche stellvertretende Bürgermeisterin zu bemühen. Theodora Lieblich dürfte es aber nicht sein. Inge grenzte den Emanzipationsbereich ein.
Ich äußerte, dass mir bereits eine Stellvertreterin zur Seite sei: eine reizende, manchmal auch aufreizende, aber sehr charmante junge Frau. Ihrem Einfluss könne ich mich kaum entziehen.
Da hatte ich mir wieder was erlaubt. Inge kletterte auf besagte Palme. „Du hast doch nicht etwa Tamara Orlowski in dein Büro geholt? Das fehlte gerade noch, dass du wieder mit deinen Weibergeschichten beginnst.“
Ich war beleidigt. „Was heißt hier Weibergeschichten? Ich hatte und habe nur immer Geschichten mit dir.“
Inge höhnisch: „Na klar, wie könnte es Tamara auch einfallen, mit dir ein Techtelmechtel zu haben!“
Sie lachte spöttisch, und ich war nun vollends die gekränkte Leberwurst. Sofort besann sie sich wieder auf ihre Eifersucht und wollte nun definitiv wissen, wer diese reizende, manchmal auch aufreizende, aber sehr charmante junge Frau sei. Sie hatte sich diese Formulierung gut gemerkt.
Meine beginnende Antwort schnitt sie mit einer barschen Handbewegung ab. „Damit du es weißt, eine solche Beschreibung trifft einzig und allein auf mich zu!“
„Natürlich, mein Schmuckstück, dich habe ich ja auch gemeint.“
Inge perplex: „Was soll der Unsinn? Ich bin doch nicht deine Stellvertreterin!“
„Natürlich nicht“, erwiderte ich belustigt, „du bist weitaus mehr!“
Sie: „Das will ich dir auch geraten haben.“
Nach einer kurzen Pause des Überdenkens sie dann weiter: „Wie hast du das eigentlich gemeint: manchmal charmant! Bin ich nicht immer charmant?“
„Ja, mein Häschen, du bist nicht immer charmant!“
„Na also, was du nur immer für Unsinn redest. Aber bilde dir ja nicht ein, dass ich mich als Kindergartenleiterin auch noch in dein Büro hocke, um deine Stellvertreterin zu sein. Dafür musst du dir eine andere Dumme suchen.“
„Welche empfiehlst du?“ fragte ich.
Sie überlegte nicht lange: „Frieda Kolle würde in dein Büro passen.“
„Vortrefflich deine Wahl“, empörte ich mich leicht, „du willst mir mein Amt wohl vollends vergällen!“
„Aber nicht doch, Didilein“, spöttelte sie, „jeder weiß doch, wie unnachsichtig Frieda mit denen umspringt, die ihr zuwider sind.“
„Frieda kann kaum ein Wort richtig schreiben“, ließ ich mich auf das Hohngeplänkel ein, „außerdem würde niemand mehr zu mir kommen wollen, weil er das Gemeindeamt und keine Hexenküche aufsuchen will.“
„Na höre sich einer diesen überheblichen Pinkel an! Wo gibt’s denn so was, dass ein Bürgermeister so abfällig über Frauen spricht und ihnen die Übernahme von Verwaltungsaufgaben verwehrt!“
Ich ärgerte mich über ihre Boshaftigkeit, mir ein weibliches Schreckgespenst unterjubeln zu wollen. Sicher, Frieda war nicht Schuld an ihrer Missgestalt, doch als Stellvertreterin war sie nun wirklich die ungeeignetste Person.
„Weißt du was“, brachte ich das Gespräch zu Ende, „wir sollten die Sache mit der Stellvertreterin sein lassen. An meiner Seite würde ich nur eine Frau dulden, die genau die Eigenschaften besitzt, die du hast. Nun nenne mir bitte die Person, auf die das zutrifft!“
Wortlos fiel mir Inge um den Hals. Nachdem wir einige Küsschen ausgetauscht hatten, sagte sie: „Nun geh, mein liebes Didilein, und mache deine Sache weiterhin gut. Ich weiß, du hast auf deinem Posten keinen leichten Stand, aber ich werde ihn dir als Nichtstellvertreterin hier zu Hause als Vorsitzende erträglicher machen.“
Donna Klaras erster Einsatz
Während des Sonntagsgottesdienstes, den trotz nachlassenden Interesses noch einige tapfere Christen besuchten, versuchte ein junger Mann, die Kollekte samt spärlichen Inhalts zu stehlen. Als er flüchtete, stellte ihm Kurt, der Kirchendiener, ein Bein, so dass er mit ererheblicher Wucht zu Boden und dann gegen den steinernen Sockel des Taufbeckens sauste. Ihm schwanden sofort die Sinne. Die erzürnten Gottesdienstbesucher zerrten ihn in die Abstellkammer. Kurt verschloss schnell die Tür.
Pastor Frommel ließ sogleich die Polizistin Klawitter holen, auf dass sie den frechen Dieb in sicheren Gewahrsam nehme. So geschah es dann auch. Bevor sie ihn abführte, zwang sie ihn, sich vor dem Altar zu verneigen und den lieben Gott um Vergebung zu bitten.
Weil der Delinquent sich weigerte, trat ihm Klara kräftig in den Hintern, woraufhin er in die Knie ging. Statt der verlangten Entschuldigung stieß er böse Worte aus. Er beleidigte die Klawitter und bezichtigte sie, ihn brutal misshandelt zu haben. Er werde sich bei höherer Instanz über sie beschweren.
Eine höhere Instanz gebe es für Würda nicht mehr, donnerte Donna Klara entschieden. Einzig und allein der liebe Gott sei für die Würdaer noch zuständig.
Von dieser Äußerung war Pastor Frommel so angetan, dass er Klara eine Armbrust schenkte, die er auf seinem Hausboden versteckt gehalten hatte. Sie sei ein Geschenk des Würdaer Schützenvereins, der vor dem Kriege existiert hatte, sagte der Pfarrer. Seinem Vater, auch einem Pfarrer Frommel, sei sie in Dankbarkeit überreicht worden, weil er die Schützen und deren Waffen gesegnet hatte.
Klara Klawitter war entzückt und versprach dem Pastor, noch mehr Kollektediebe zur Strecke zu bringen.
Ob sie wisse, wie mit einer Armbrust umzugehen sei, wollte der Gottesdiener wissen.
„Selbstverständlich“, erwiderte Klara im Brustton der Überzeugung, „wer wie ich genug Brust hat, der kann das.“
Sie wölbte den Brustbereich und äußerte die Absicht, die Bluse zu öffnen, damit ihren Worten Glauben geschenkt werden könne.
Der Kirchendiener und die drei männlichen Christen unterstützten Klaras Ansinnen, nur Pastor Frommel sowie die sechs Christinnen – inklusive Gundula Geier - erhoben Einspruch.
„Na gut, dann zeige ich meine Möpse nicht“, zeigte sich Klara ein wenig beleidigt und nahm die Armbrust nebst dreier Bolzen mit festem Griff entgegen. Als sie das Gotteshaus verließ, folgte ihr Kurt und äußerte Zweifel an der Größe ihrer Möpse. Er würde sich gern vom Gegenteil überzeugen.
Der Kirchendiener, ein spindeldürrer älterer Junggeselle, war bisher immer nur mit dem Bildnis der Mutter Maria in Berührung gekommen. Allabendlich vor dem Zubettgehen streichelte er lüstern deren Brustbereich. Das regte seine erotischen Phantasien dermaßen an, dass er bei Gottesdiensten von der Empore herab den betenden Weibern in den prall gefüllten Ausschnitt sah.
Donna Klara wusste um die Einsamkeit des Junggesellenlebens, war sie doch selbst ohne Anhang geblieben. Männer fanden an ihr nur den enormen Vorbau sehenswert. Diese Übermaße neidete ihr nur Elsbeth Hampel, die mit solchen nicht konkurrieren konnte.
Kurt kam auf seine Kosten. Als er hinter einem Gebüsch Klaras füllige Oberweite betrachten durfte, wurde ihm ganz schwindlig. Als er sie gar betasten durfte, drohten ihm die Beine wegzuknicken. Wie im Trance taumelte er in die Kirche zurück und verkündete mit bebenden Lippen, dass Klara solche Möpse habe. Dabei formten seine kreisenden Armbewegungen die Größe von Wagenrädern.
Die sechs Christinnen kreischten entsetzt, und die drei männlichen Christen rannten nach draußen, um sich zu überzeugen. Klara Klawitter war aber längst auf dem Heimweg.
Dieser scheinbar nebensächliche Vorfall hatte sich in Würda schnell herumgesprochen und unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Frauen verabscheuten Klaras Entblößung und das sündhafte Verhalten des Kirchendieners. Die Männer hingegen hießen gut, dass die Ordnungshüterin Einsicht in ihre inneren Angelegenheiten gegeben hatte.
Pastor Frommel kam dieser Dorftratsch schnell zu Ohren und er hielt es für angebracht, beim nächsten Sonntagsgottesdienst diese Angelegenheit von der Kanzel herab zu klären. Dabei hatte er die grandiose Idee, das Gotteshaus wieder einmal bis auf den letzten Platz zu füllen. Er ließ verkünden, dass Klara Klawitter, als treue Christin übrigens, die Armbrust, die ihr der Herrgott zur Beseitigung sündiger Verbrecher gesandt habe, in der Kirche vorführen werde. Sie werde auch noch mehr zeigen. Bei dieser Ergänzung dachte Frommel natürlich an ihre Fertigkeit im Umgang mit Kollektedieben.
Das hervorgerufene Missverständnis führte dazu, dass die Kirche am folgenden Sonntag rammelvoll war. Mit Donna Klara hatte sich Frommel vorher abgesprochen. Der war es nur recht, allen zeigen zu können, wie sie mit Tage- und Kollektedieben abrechnen wird.
Vor Beginn des Gottesdienstes äußerte Kirchendiener Kurt den Wunsch, noch einmal an ihre Brüste tippen zu dürfen. Der Wunsch wurde ihm erfüllt. Frohgemut eilte er dann hinauf zur Empore.
Als die Dorfpolizistin mit geschulterter Armbrust durch den Mittelgang des Kirchenraumes schritt, schauten ihr die Männer mit Begierde und die Frauen mit Abscheu nach. Sie durfte sich auf einen der Ehrenplätze niederlassen, die vor Zeiten nur den Großbauern und ihren Gattinnen vorbehalten waren.
Der Gottesdienst begann. Pfarrer Frommel war mit der Vielzahl der Erschienenen sehr zufrieden. Dass auch Sauf-Anton unter den Anwesenden weilte, war ihm nur recht, denn in seiner Kanzelrede würde er weniger über den lieben Gott, als vielmehr über die Verrohung der Sitten in Würda sprechen. Damit allen der Schreck in die Glieder fahre, sollte Klara Klawitter vorführen, wie erbarmungslos sie Strafgericht halten werde.
Als Pastor Frommel mit der Abkanzlung fertig war, erteilte er Donna Klara das Wort. Dieser Vorgang, ungewöhnlich wie einmalig bisher, aber notwendig, weil dem lieben Gott vorgeführt werden sollte, wie in seinem Namen mit Missetätern abgerechnet wird.
Donna Klara erhob sich von ihrem Ehrensitz und verkündete laut, dass sie nicht viel Worte und mit Verbrechern und Ehebrechern nicht viel Federlesens machen will. Sie erinnerte an das Bestrafungsregister, das allen Würdaern bekannt war. Jeden im Kirchenraum schauderte es. Als Klara erwähnte, dass Frauen und Mädchen, die in fremden Betten ertappt würden, mit dem Verlust ihrer Haare rechnen müssten, kam so manches Weibsbild trotz der Kühle im Kirchenraum tüchtig ins Schwitzen. Die eine und andere fuhr sich deshalb mit dem Taschentuch trocknend in den Ausschnitt der Bluse. Das freute Kurt auf der Empore, und er beugte sich so weit über die Brüstung, dass er beinahe nach unten gefallen wäre. Nach unten musste er dennoch, weil ihn die Klawitter zu sich rief. Während er hinab eilte, in der Hoffnung, wieder antippen zu dürfen, herrschte im Kirchenraum atemlose Stille.
Die durchbrach Klaras mächtige Stimme: „Seht genau her, was ich euch zeigen werde!“
Die Männer sprangen von ihren Sitzen auf, die Frauen zerrten sie zurück. Donna Klara packte den klapperdürren Kirchendiener am Schlafittchen und zog ihn dicht an sich. Der spürte die Wärme ihres bebenden Busens und roch dessen Ausdünstung. Sie hauchte ihm ins Ohr: „Wenn du jetzt machst, was ich von dir verlange, darfst du nachher wieder anfassen!“
Ohne sein Einverständnis abzuwarten, schüttelte sie ihn so heftig, dass sein Kopf vor- und zurückschlug. Alle sahen, dass Kurt etwas bejahte, doch was, wusste man nicht.
„Ich beweise euch nun, dass ich auf Name, Alter, Geschlecht, Funktion und Auszeichnungen keine Rücksicht nehmen werde. Wie diesen elenden Wurm werde ich jeden zerquetschen, der mit mir und den Gesetzen in Berührung kommt.“
Röchelnd protestierte Kurt: „Ich bin doch kein elender Wurm!“
„Das habe ich doch nur als Beispiel genannt“, flüsterte Klara. Und weiter: „Willst du nachher anfassen oder nicht?“
Wieder schüttelte sie ihn und wieder wackelte willenlos sein totenkopfähnlicher Schädel. Einige Frauen klatschten Beifall, weil sie dem sündigen Kirchendiener diese Behandlung gönnten und ihren eigenen Gatten in die derben Hände der Klawitter wünschten.
Mit strenger Stimme sprach die zu Kurt: „Du stellst dich unter die Kanzel und hältst dieses Gesangbuch mit der rechten Hand empor.“
Sie reichte es ihm.
Kurt überkam mächtiges Zittern. Die Ehefrauen sahen ihre Männer triumphierend an.
„Ich werde nun mit einem einzigen Schuss meiner Armbrust das Gesangbuch aus deiner Hand ballern“, sprach Klara und schob den Angstbebenden in Richtung Kanzel.
„Wenn du nun daneben triffst?“ fragte das Männlein in höchster Pein.
Statt einer Antwort deutete Klara mit dem linken Zeigefinger auf ihren Brustbereich.
„Schwester Klara“, rief Pastor Frommel von der Kanzel herab, „du kannst doch ein Kirchenbuch nicht zur Zielscheibe deiner Schießerei machen!“
„Was ist Ihnen denn lieber, Herr Pfarrer, ein durchschossenes Gesangbuch oder eine zerfetzte Kollekte?“
Frommel schlug schnell ein Kreuz und betete im Eiltempo für seinen Kirchendiener. Klara spannte die Armbrust, legte einen Bolzen ein und zielte in Richtung Bibel. Die Männer staunten, weil sie wussten, dass sie diese Armbrust nicht so leicht hätten spannen können. Die Klawitter war ja auch ein Mannweib mit außergewöhnlichen Kräften.
Klara setzte die Waffe ab und forderte Kurt auf, das Buch ruhig zu halten. Wenn er weiter so zittere, könne sie womöglich seinen Kopf treffen. Der war nahe daran, ohnmächtig zu werden, doch folgte er Klaras Anweisung, weil er sich vor einem Kopfschuss fürchtete.
Wieder atemlose Stille im Kirchenschiff.
Klaras Zeigefinger krümmte sich am Abzug, und alle waren nun sicher, dass des Kirchendieners letzte Sekunde geschlagen hat. Eine junge Frau, die diese Spannung nicht mehr ertragen konnte, schrie laut auf.
Erschrocken verriss Klara die Armbrust und schoss den Bolzen in Richtung Kanzel. Der traf nicht Pastor Frommel, sondern fetzte einem Stuckengel, der schon seit zweihundert Jahren vergeblich versuchte, von der Kanzel zu flattern, den linken Flügel vom Schulterblatt.
Die Gottesdienstbesucher schrien ebenfalls, weil sie glaubten, Klara hätte auch Pastor Frommel getroffen, denn der war nicht mehr zu sehen. Lang ausgestreckt lag er hinter der Kanzelbrüstung in Deckung, so wie er es als Soldat an der Ostfront im Schützengraben auch oft getan hatte.
Kurt hatte sich endgültig auf seine Ohnmacht besonnen und fiel in diese. Die Unruhe im Kirchenraum legte sich erst, als erkannt wurde, dass Pastor Frommel noch unter den Lebenden weilte. Die Leute verließen die Kirche in der festen Überzeugung, dass mit Klara künftig nicht gut Kirschen essen sein wird.
Brigitte Nimrods Notlüge
Besonders hart betroffen vom Fehlen polizeilichen Schutzes waren die Einkaufsgeschäfte Konsum und der Tante-Emma-Laden von Brigitte Nimrod. Der Warenbestand verringerte sich auch deshalb zusehends, weil die Leute mitgehen ließen, was sie nicht bezahlt hatten.
Sonja Krause, die Leiterin des Konsums, beklagte, dass ihr Warenvorrat in den nächsten Tagen erschöpft sein werde. Nichts sei dann mehr vorhanden, nicht einmal mehr Toilettenpapier.
Auf das könne man notfalls verzichten, äußerte jemand. Nach dem Krieg hätte man sich ja auch mit Zeitungspapier den Arsch abgewischt. Dieses Argument sei nicht stichhaltig genug, jammerte Sonja, denn Zeitungspapier werde ebenfalls knapp, weil der Zeitungsvertrieb die Lieferung von Tageszeitungen eingestellt habe. Begründet wurde dieser Schritt mit dem Hinweis, dass Würda für die Welt uninteressant geworden sei. Wer nicht mehr im Mittelpunkt des Interesses stehe, brauche auch keine Zeitung mehr lesen. Diese fadenscheinige Erklärung war ein weiteres Anzeichen dafür, dass niemand mehr mit uns etwas zu tun haben wollte.
Der Konsum schloss zuerst die Pforte. Brigitte Nimrod wollte die Schließung ihres Ladens eleganter verkünden und heftete deshalb an die Tür ein Pappschild mit der Aufschrift Wegen Warenannahme geschlossen!
Das hätte sie nicht tun sollen, denn nun hatte sie auch diejenigen am Hals, die vormals nur im Konsum gekauft hatten. Die Leute standen stundenlang vor ihrem Geschäft und warteten geduldig darauf, dass sie das Schild entfernt und den Laden wieder öffnet.
Nichts dergleichen geschah. Nachdem die Leute vergeblich gewartet hatten, riss ihnen der Geduldsfaden. Lauthals riefen sie nach Brigitte: „Wenn du jetzt nicht aufmachst, treten wir die Tür ein!“
Dieses Gewaltgetöse vernahm Klara Klawitter. Der lag es jedoch fern, gegen die Massenunruhe vorzugehen, weil sie seit langem persönliche Differenzen mit Brigitte Nimrod hatte. Der Anlass dieser Zwietracht war von Brigitte ausgegangen, die Klara Rasierklingen zum Kauf angeboten hatte. Die Kunden im Laden feixten, weil sie wussten, dass Klara zwar keinen Mann, aber männlichen Haarwuchs im Gesicht hatte.
Klara verbat sich Brigittes Frechheit und die – welch grober Fehler – ergänzte, dass die Klingen auch bestens geeignet seien, Haare an Armen, Füßen und anderen Körperteilen zu entfernen.
Nun lachten die Leute aus vollem Halse.
Klara schwur Brigitte grimmige Rache. Die in die Tat umzusetzen, war bisher keine Gelegenheit gewesen. Jetzt wäre der Zeitpunkt günstig, doch als Ortspolizistin fühlte sie sich zur Wahrung ihrer Würde verpflichtet. Dennoch gesellte sie sich zum Massenauflauf. Da sie nicht eingriff, fühlten sich die Bürger ermutigt, die Drohung in die Tat umzusetzen. Innerlich wünschte sich Klara, dass mehr als nur die Ladentür zu Bruch gehen möge.
Bevor die Menschen ihr Vernichtungswerk beginnen konnten, ereilte sie die Nachricht, dass Brigitte Nimrod nicht zu Hause sei, sondern bei ihrer Schwester in Schöndorf weile. Sie gedenke, dort bis auf weiteres zu wohnen, weil die Lebensumstände in Würda unerträglich geworden seien. Sie grüße ihre Kundschaft herzlich und hoffe auf eine baldige Besserung der Zustände.
Die Leute waren natürlich von den Socken, als ihnen dieser Telegrammtext vom Postboten vorgelesen worden war.
„Himmelkruzitürken!“, rief jemand in der Menge, „hier wird es ja immer schöner! Jetzt gehen schon die Geschäftsleute stiften! Wohin soll das bloß noch führen?“
Darauf wusste niemand eine Antwort, wie überhaupt niemand wusste, wie es weitergehen sollte.
Ein Flugblatt und ein Gespräch mit Lotte Ulbricht
Die endgültige Ausklammerung Würdas (auch Weckelnheims) aus dem gesellschaftlichen Leben der DDR wurde uns durch Flugblätter bekannt gemacht, die eines Morgens vom Himmel fielen. Als ich den Text vor Augen bekam, wurde mir klar, dass sich Partei- und Staatsapparat der DDR scheuten, uns von Angesicht zu Angesicht ihr Urteil zu verkünden. Wir, die einstmals Hochgelobten, Vielverehrten und Mustergültigen wurden nun mit einem Schriebs abgefertigt, der uns zu Minderwertigen und Unfähigen degradierte. So war zu lesen: Ihr da in Würda und Weckelnheim, hiermit wird euch kundgetan, dass ihr ab sofort nicht mehr Bürger der Deutschen Demokratischen Republik seid. Diese folgenschwere Entscheidung habt ihr euch selbst zuzuschreiben, da ihr die Sache des Sozialismus/Kommunismus verraten habt. Das große Vertrauen, das die fortschrittliche Menschheit in euch gesetzt hat, ist von euch schmählich missbraucht worden. Das Rad der Weltgeschichte wird sich auch ohne euch unaufhörlich in Richtung Weltkommunismus drehen. Betrachtet euch als menschliche Versager und geistige Nieten, die in unserer Gemeinschaft nichts mehr zu suchen haben. Diesen unwiderruflichen Beschluss haben wir gefasst, damit weiteres Unheil durch euch verhindert werden kann. Seht nun zu, wie ihr mit eurem Unvermögen und eurer Unfähigkeit weiter kommt; auf unsere Hilfe, Unterstützung und unseren Großmut müsst ihr fortan verzichten. Gezeichnet: Politbüro des ZK der SED und Volkskammer der DDR, Berlin
Nachdem ich mich ein wenig beruhigt hatte und wieder klar denken konnte, fasste ich den Entschluss, mich telefonisch in Berlin zu melden. Mein Telefon war noch intakt und mit ihm die Verbindung zur Außenwelt. Nach einigen vergeblichen Wählversuchen war die Verbindung nach Berlin hergestellt, jedoch erst, nachdem ich mich entschlossen hatte, mich nicht als Bürgermeister von Würda zu melden, sondern als Otto Schnulpentulprich aus Klein-Kleckersdorf. Ich sei ein ehemaliger Rot-Front-Kämpfer und habe den Wunsch, mit meinem ehemaligen Kampfgefährten Walter Ulbricht ein Wörtchen zu reden.
Klack ging es in der Leitung, und ich war mit Ulbrichts privat verbunden. Diese Rufnummer war Traugott Hampel einst von Walter persönlich mitgeteilt worden. Er sollte sie immer dann wählen, wenn er irgendwelche ernsthaften Probleme bei der Schaffung eines Glücklichen Dorfes hätte. Nun wählte ich sie als Bürgermeister eines unglücklichen Dorfes.
Mir war von vornherein klar, dass ein vernünftiges Gespräch mit einem vernünftigen Ergebnis nicht zustande kommen würde, doch wollte ich in dieser Hinsicht nichts unversucht lassen. Walter Ulbricht lag mir zwar schwer im Magen, doch sollten meine Nachfahren nicht sagen müssen, ich hätte als Bürgermeister versagt, weil ich untätig geblieben war. So viel Schuld wollte ich nicht auf mich laden und meldete mich deshalb entschlossen mit meinem richtigen Namen, als am anderen Ende der Leitung abgehoben wurde. Sogleich fiel mir ein Stein vom Herzen, denn ich vernahm die freundliche Stimme Lotte Ulbrichts. Zunächst war sie etwas verwundert, dass nicht Otto Schnulpentulprich, sondern Dieter Schuster am Apparat war. Ein Allerweltsname, den sie zunächst nicht zuordnen konnte. Ich ließ das Stichwort „Würda“ fallen, und schon hatten wir einen gemeinsamen Draht.
„Mein lieber Dieter“, sagte sie sichtlich erfreut und unterließ es, mich korrekt mit „Herr Schuster“ anzusprechen. „Es tut gut, wieder mal von euch zu hören. Was rede ich da“, lachte sie verhalten, „ich habe ja noch gar nichts über euch gehört.“
Ich ließ sie reden, weil es mir so leichter wurde, Zugang zu ihrem Herzen zu finden.
„Wie geht es euch denn?“ Sie wies sich selbst zurecht und fuhr entschuldigend fort: „Dumme Frage! Natürlich weiß ich, wie es um euch bestellt ist, d.h., ich kann es mir denken.“
Schweigen am anderen Ende der Leitung. Ich erkannte, dass ich mich nun mitteilen müsse.
„Liebe Frau Ulbricht“, sprach ich äußerst liebenswürdig, „es fällt mir nicht leicht, Ihnen am Telefon unsere Sorgen und Nöten zu nennen.“
„Du musst dich nicht genieren“, unterbrach sie mich, „und Befürchtungen musst du auch nicht haben. Ich bin allein zu Haus. Mein Mann weilt seit einigen Tagen in Moskau. Er ist dorthin befohlen worden, weil er …“, ihre Stimme bekam einen bedauernden Unterton, „…über euer weiteres Wohl und Wehe, eigentlich nur Wehe, Anweisungen bekommt oder schon bekommen hat.“
Ich merkte, dass Frau Ulbricht noch nichts von den Flugblättern wusste. Ich unterließ es, sie zu erwähnen, obwohl die der eigentliche Grund meines Anrufs waren. Ich wollte Frau Ulbrichts Mitgefühl für uns nicht verletzen, denn offensichtlich war es ihr ehrlich damit, mehr über unseren trostlosen Zustand zu erfahren. Nur einen Lichtblick in dieses Dunkel der Hoffnungslosigkeit sollte Lotte Ulbricht senden. Mehr war durch sie ohnehin nicht zu erwarten. Wie auch. Ohne Umschweife kam ich deshalb auf ihren letzten Brief an Schwiegermutter zu sprechen. Ich deutete an, dass er stilistisch ein Meisterstück sei und das tiefe Mitgefühl für uns Würdaer in warmen Worten zum Ausdruck bringe.
Kaum hatte ich mich soweit geäußert, wollte Frau Ulbricht wissen, wieso ich Kenntnis von diesem Schreiben habe. Der Brief sei doch als persönlicher Brief an Lotte Goldstein gerichtet gewesen.
Ich hätte mich ohrfeigen können, so peinlich war mir meine Offenheit. Um nicht gänzlich zu versagen, gab ich Frau Ulbricht zu verstehen, dass Schwiegermutter ihn nur mir und ihrer Tochter gezeigt habe, einzig und allein vom mütterlichen Gefühl getrieben, uns wissen zu lassen, dass es in Berlin noch einen guten Menschen gibt, der für uns empfindet.
Lotte Ulbricht war’s zufrieden und ließ sich von mir nun in aller Kürze berichten, wie belämmert es um uns steht. Ich endete mit dem Hinweis, dass auch der Omnibusverkehr zwischen Würda und Hola eingestellt worden sei. Wenn das so weitergehe, wüssten wir nicht mehr aus noch ein. Als Bürgermeister sähe ich keinen Ausweg aus diesen chaotischen Zuständen. Urplötzlich kam es über mich und ich begann zu schluchzen. Ich entschuldigte mich für meine unmännliche Schwäche.
Lotte versuchte zu besänftigen, doch fiel ihr das nicht leicht, weil sie – wie ich hörte – selbst den Tränen nahe war.