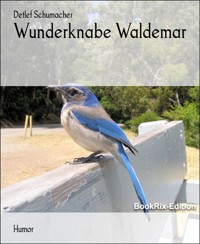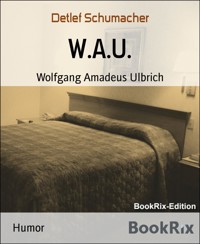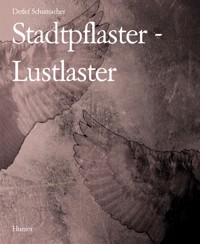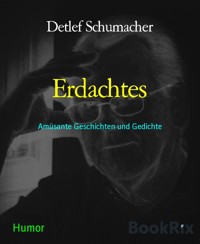0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Es wird die Geschichte eines Dorfes dargestellt, die so nicht geschehen ist. - Würda befindet sich auf dem Territorium der DDR. Hier vollzieht sich die ideologische Ausrichtung wie überall in diesem noch jungen Staat. Die Befolgung gerät in diesem Ort jedoch zur Parodie. Allen voran ist es der Parteisekretär der SED, der wider jede Vernunft überzeugen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Würda - ein Dorf macht Geschichte(n)
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenGenossen und Nichtgenossen
Der Bürgermeister hatte zu einer Öffentlichen Einwohnerversammlung eingeladen. Sie sei sehr wichtig, war angekündigt worden. Deshalb fanden sich Männer und Frauen sehr zahlreich im Großen Saal hinter der Dorfkneipe ein. Die Versammlung begann pünktlich 20 Uhr. Ein wichtiges Anliegen liege an, ein höherer Beschluss von oben, erklärte der Bürgermeister und blickte hinauf zur Saaldecke, an der noch der Papiermond vom letzten Faschingsball hing. Es sei an der Zeit, die neue Zeit auch in Würda einzuläuten.
Pastor Frommel verstand das als Wink. Am kommenden Sonntag würde er die Glocken zweimal läuten lassen, einmal für die gute alte Zeit und einmal für die neue, von der er nicht wusste, ob auch sie gut werde. Der Herrgott hatte sich diesbezüglich noch nicht geäußert. So musste sich Frommel vorläufig auf das verlassen, was Traugott Hampel, der Bürgermeister, sagte.
„Überall in Stadt und Land sind die Weichen gestellt“, verkündete der. „Wir sitzen alle in einem Zug, der uns in eine lichte, frohe Zukunft fährt. – Auch dich, Franz“, wurde Traugott laut, als er sah, dass der Angesprochene einschlafen wollte.
„Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren“, rief Minna Mampel und klatschte freudig erregt in die Hände.
Einige lachten. Andere, die den Ernst der Stunde begriffen, blickten so wichtig drein, als hätten sie die Fahrkarte schon in der Tasche. Am Jackettrevers dieser Personen steckte das Parteiabzeichen der SED.
Von seinem Platz hinter dem Präsidiumstisch erhob sich ein Mann, schaute streng auf die vor ihm sitzende Masse und donnerte los: „Genossen, es ist unsere heilige Pflicht…“
Er wurde vom nebensitzenden Bürgermeister angestoßen, der ihm etwas ins Ohr flüsterte.
Dann dröhnte er wieder: „Genossen und Nichtgenossen, es ist unsere Pflicht, …“ –
Pastor Frommel entfaltete enttäuscht die gefalteten die Hände.
„... auch unser Dorf in den Blickpunkt der Weltgeschichte zu rücken. Das sind wir uns und unseren Nachkommen schuldig. Deshalb hat mich die Kreisleitung der SED beauftragt“, der Brustkorb des Redners wölbte sich, „euch mitzuteilen, dass schnellstens eine Chronik über unseren Ort zu verfassen ist. Ich als Sekretär der Ortsparteigruppe meine, dass dieses Dorfgeschichtsbuch nicht mit der Stunde Null oder der Geburt Jesus Christus beginnen sollte, sondern mit dem Jahre 1945, als der Große Vaterländische Krieg siegreich beendet war.“
Der Redner verstummte und erwartete Beifall. Der erfolgte nicht, dafür aber die naive Frage eines Einwohners, ob es nicht so gewesen sei, dass die Russen den Krieg gewonnen hätten. Unser Vaterland hätte ihn doch verloren.
Willi Stoffel, der Ortsparteisekretär, schaute den Fragesteller tadelnd an. Es sei wohl noch nicht in sein schwaches Hirn gedrungen, dass nicht von den Russen, sondern von den Sowjets die Rede sein müsse und auch davon, dass die siegreiche Rote Armee dem Faschismus vernichtend aufs Haupt geschlagen hatte.
Die Wortwucht ließ den Belehrten auf dem Stuhl schrumpfen.
Fünfzehn Jahre nach Kriegsende müsste doch auch der größte Schafskopp begriffen haben, was sich bisher so alles entwickelt hat. Damit das auch künftig jeder schnallt, müssten die örtlichen Erfolge schriftlich festgehalten werden.
Eine schrille Stimme durchschnitt die Stille im Raum. Eine ältere Dame plärrte, dass es unerhört sei, erst mit dem Jahre 45 beginnen zu wollen. Davor hätte es das Dorf Würda auch schon gegeben, und in diesem hätten nicht nur Schafsköppe gelebt.
Die Köppe der Anwesenden drehten sich in Richtung der Erzürnten. Aha, dachte jeder, wieder die alte Meckerziege Freifrau von Hummelshausen. Aus der Sicht vieler Würdaer hätte die Betagte zu viele Hummeln im Kopf.
Als halbwüchsiges Mädchen war die Dame, damals noch Freifräulein und Tochter des Rittergutsbesitzers Wotan von Hummelshausen, beim Ausritt vom Pferd gefallen. Dieser Zwischenfall veranlasste den mächtigen Agrarier, Töchterchen Agnes von der Höheren Töchterschule zu nehmen. Gewisse geistige Überlastungen würden ihr Kopfschmerzen bereiten. Einige ganz gemeine Einwohner höhnten nach dem Krieg, Agnes sei so verblödet, dass sie den Anschluss an ihresgleichen verpasst hätte. Während einige Junker in den Westen geflohen seien, wäre sie hier geblieben. Agnes behauptete, sie könne Grund und Scholle nicht verlassen, auf der sie groß geworden sei und sie das Andenken an ihre verstorbenen Eltern binde. Sie wolle die Familientradition wahren und mit ihrem Hiersein bezeigen, dass sich bedeutende Geschlechter auch nicht von schlimmsten Stürmen hinwegfegen lassen. Ein mächtiger Stammbaum mit breiter Verästelung hätte bisher jedem Winde getrotzt. So fänden sich in ihrer Ahnenreihe auch Kommerzienräte.
Als sie dies an anderer Stelle schon einmal geäußert hatte, vor den Ohren Willi Stoffels nämlich, schmetterte der zurück: „Haha, Kommerzienräte! Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will!“ Dabei schaute er kraft seines proletarischen Bewusstseins zu den an der Wand hängenden Porträts von Marx, Engels, Lenin und Stalin, als müssten die jetzt aus dem Rahmen und ihm um den Hals fallen. Mit Unmut nahm er dabei wahr, dass an Lenins Nase ein dunkler Fleck haftete. Genauere Untersuchung ergab, dass es eingetrockneter Popel war, der schwerlich von Wladimir Iljitsch selbst stammen konnte. Irgendein klassenfeindliches Subjekt hatte ihn irgendwann in diese Richtung geschnippt.
Freifrau Agnes hatte für den gottlosen Ausspruch des Parteisekretärs nur ein verächtliches Schnaufen übrig. Nun aber, in der Einwohnerversammlung, war es an Stoffel zu schnaufen, weil er mit dem Einwurf dieses kapitalistischen Überbleibsels fertig werden musste.
„Fräulein Agnes“, rief er und riss beim A den Mund so weit auf, als wollte er die Dame verspeisen, „es ist erwiesen, dass die Weltgeschichte bis 1945 eine einzige Ansammlung von Unterdrückung der werktätigen Bevölkerung war.“
Der führende Genosse erhielt wieder einen Stoß in die Seite, worauf hin er berichtigte: „Ein Volk war stark genug, die Ausbeuterbrut hinwegzufegen. Die Große Sozialistische Oktoberrevolution von 1917 machte in der Sowjetunion Schluss mit den Herrschenden.“
Die Augen der sieben aufrechten Genossen mit dem Parteiabzeichen am Revers leuchteten. Bürgermeister Hampel setzte zum pflichtgemäßen Beifall an, der aber durch eine weitere dämliche Zwischenfrage gebremst wurde. Die Aussage des Genossen Parteisekretärs könne wohl nicht ganz stimmen, weil Stalin der Herrschende in der ruhmreichen Sowjetunion war.
Stoffel wirkte etwas verwirrt. Einerseits tat es ihm wohl, von ruhmreicher Sowjetunion aus dem Munde eines parteilosen Bürgers zu hören, andererseits missfiel ihm die Bloßstellung der einstigen Führungsrolle im Moskauer Kreml. „Du stellst historische Tatsachen auf den Kopf“, agitierte er ungehalten, „der Genosse Stalin war kein Herrschender, weil das Volk herrschte. Der von allen geliebte Josef Wissarionowitsch war nur der Führer, der Führer des mächtigsten Landes auf Erden, der unbezwingbaren Sowjetunion. – Merke dir das!“
Damit war der Ausrufer um einiges klüger und kehrte in seine dumpfe Versammlungsandächtigkeit zurück.
Adolf Hiller
„Nun aber endlich zur Sache!“ riss der Bürgermeister die Führungsrolle wieder an sich. Er befürchtete, dass sich um den Begriff des Führers ein weiteres ideologisches Wortgeplänkel entfachen könnte. Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, weil Adolf Hiller sein quadratisches Bärtchen unter der Nase mit Zeige- und Mittelfinger glatt strich. Ein Zeichen dafür, dass auch er das Wort ergreifen wolle. Nur das nicht, grauste es den Bürgermeister, der wusste, wie schwer diesem politischen Querulanten beizukommen war. Ideologisch war dieser Mensch unerträglich, weil er nur Blödsinn redete.
Während des Tausendjährigen Reiches war Hiller bei der Ortsgruppenleitung der NSDAP mit der Bitte vorstellig geworden, man möge seinen Familiennamen etwas ändern. Er wolle nun Hitler heißen, ebenso wie der Führer des Großdeutschen Reiches. Den passenden Vornamen besäße er ja bereits. Es müsse nur noch eine geringfügige Konsonantenänderung im Nachnamen vorgenommen werden. Was machte es schon aus, ein l durch ein t zu ersetzen. Nachdem sich Hiller einen Vortrag über sein schwachsinniges Anliegen und dessen mögliche Folgen hatte anhören müssen – gepaart mit der Bemerkung, dass da jeder Idiot kommen könne und Hitler heißen wolle -, wurde der falsche Adolf der Gestapo in Hola, der Kreisstadt, übergeben. Die nahm ihn freudig in Empfang und dann gehörig in die Mangel. Tags darauf war Hillers Aussehen sichtbar verändert. Der Anführer der Nazischläger höhnte, dass er nun nicht mehr den Wunsch hege, Hitler heißen zu wollen. Von dem arischen Aussehen des Führers sei bei ihm ohnehin nichts zu erkennen. Man hielt ihm einen Spiegel vors Gesicht, und Hiller erkannte die Richtigkeit der Aussage. Seine Augen waren jetzt zwar blau, aber die deformierte Nase verriet nichts von germanischer Herkunft. Weil unter der groben Behandlung auch sein Verstand gelitten hatte, wurde er einer Anstalt zugeführt, in der sich noch mehr Personen befanden, die behaupteten, Adolf Hitler zu sein.
Wie Hiller später erklärte, hätten sich unter seiner Führung wahre Patrioten zusammengefunden. Einer sei dabei gewesen, der hätte dauernd „Heil Moskau!“ gerufen und ein anderer „Nieder mit dem Wodka!“ Nur einen hätten sie wegen völliger Verblödung aus dem Kreis Gleichgesinnter ausgeschlossen, weil der immerzu geschrien hätte: „Ihr könnt mich und den Papst am Arsch lecken!“
Anfang April 1945 wurde Hiller samt Gesinnungsgenossen von der siegreich vorrückenden
Roten Armee befreit. Irgendeinem Towarisch in Offiziersuniform erklärte Hiller, wie grausam er von den Faschisten gefoltert worden war. Nachdem er von den erlittenen Qualen berichtet hatte, fiel er dem sowjetischen Unterbefehlshaber tränenüberströmt um den Hals. Weil der Geherzte ein Kulturoffizier war, dessen Herz mehr für den Dichter Goethe als für den Generalissimus Stalin schlug, empfahl er Hiller allsogleich an die Sowjetische Militäradministration weiter. Die stempelte das Empfehlungsschreiben mit Hammer und Sichel ab, und Adolf Hiller war von Stund an ein Verfolgter des Naziregimes. Mit dieser Legimitation mogelte er sich durch die Nachkriegszeit, die ihm täglich mehr Brot und Pflaumenmus gab als anderen Darbenden. Die Nazis hatten ihm zwar das t nicht gegönnt, in der Bezeichnung „Verfolgter“ war es ihm nun nützlicher.
Weil er sich als VdN-Mann (Verfolgter des Naziregimes) auch vor wissbegierigen Pionieren und FDJlern darzulegen hatte, begann er seine Ausführungen immer mit einem Zitat persönlicher Herkunft. Das war ihm während eines Trinkgelages in der Würdaer Kneipe eingefallen. Das sagte er den jungen Leuten jedoch nicht, und so wurde dieser alkoholgetränkte Satz zum vorwärtsweisenden Leitspruch für die, die ihn empfangen durften.
Er lautete: Die Nazis haben mir zwar die Fresse poliert, es siegt aber immer der, der nicht verliert!
Die jungen Menschen klopften nun selbst Sprüche, deren Gehalt aber noch haarsträubender war als der ihres lyrischen Vorbilds. Selbst Pastor Frommel wurde von dieser Sprüchemacherei inspiriert und dichtete für alle Feinde der neuen Ordnung den aufmunternden Satz: Als alle frommen Christen die Fahne Jesus Christus` hissten, da gab es keine Kommunisten!
August Trautloff
Bürgermeister Hampel, der spürte, dass ihm die Zügel aus der Hand zu gleiten drohten, griff fester zu und ergriff die kleine Handglocke, die vor ihm auf dem Tisch stand. Deren Geläut hatte ihn in Kindheitstagen zum Schweigen gebracht, wenn der Weihnachtsmann seine Ankunft einläutete. Warum sollte der schrille Glockenklang nicht auch das Volksgemurmel im Saal zum Verstummen bringen. Hampels heftiges Glockenschwingen zeigte nur mäßigen Erfolg. Minna Mampel und einige andere Weiber führten ihre Unterhaltung unbeirrt weiter. Hampel deshalb: „Wenn nicht sofort Ruhe eintritt, lasse ich den Saal räumen!“ In dieser Formulierung war er sehr geübt, denn bis kurz vor Kriegsende war er Laufbursche und Gerichtsdiener beim Gerichtspräsidenten Arnulf von Habestreit in Hola gewesen.
Hampels Androhung hatte Erfolg. Nach und nach verfiel man in Schweigen. So die Masse wieder im Griff, tadelte Traugott dieselbe: „Es geht hier um eine Sache von höchster Wichtigkeit. Hier wird nicht um des Kaisers Bart gestritten!“
Kaum war das gesagt, schraubte sich ein runzliger Alter von seinem Sitz empor und plärrte mit altersschwachem Stimmchen: „Hoch lebe der Kaiser! Kaiser Wilhelm, er lebe hoch!“
Ein nachsichtiges Grinsen huschte über die Gesichter der Anwesenden. Der Schreihals mit dem hochgezwirbelten Bart war für seine senilen Kaiserrufe bekannt. August Trautloff, einer der Ältesten im Ort, war in besten Jugendjahren in den I. Weltkrieg gezogen, mit dem festen Vorsatz, dem Kaiser Paris zu erobern, damit der sich im „Moulin Rouge“ von den Kriegsanstrengungen ein wenig erhole. Wer einen Krieg gewinnen will, muss sich auch entspannen können. Das gehe am besten beim Genuss von Sinnesfreuden. Dieser seiner Strategie folgte August in den ersten Kriegsmonaten selbst sehr eifrig. Während seine Kameraden bemüht waren, dem Erbfeind jenseits des Schützengrabens das Lebenslicht auszublasen, trachtete der Meldegänger Trautloff danach, etwas Nützliches für die Völkerverständigung zu leisten. Dabei näherte er sich – so oft es möglich war – den Frauen Frankreichs. Die meisten von ihnen hatten allerdings wenig Verständnis für das Ansinnen des Deutschen mit dem Kaiser-Wilhelm-Bart. August suchte die Verständigung zu weit unten und bekam sie deshalb weiter oben schmerzhaft quittiert. Wenn er mit verschiedenfarbiger Gesichtsblessur zu seiner Truppe zurückgekehrt war, wusste er mit kläglicher Miene zu jammern, wie er bei heftigstem Beschuss von einem Granattrichter in den anderen geschleudert worden wäre.
Die Soldaten äußerten kein Bedauern, dafür waren andere zuständig; sie hatten mit sich selbst zu tun. Das ärgerte August, weil er seine Kampfeinsätze auch gewürdigt wissen wollte. Wie er um Anerkennung und Beachtung auch buhlte, stellten seine Kameraden unzufrieden fest, dass manche Franzosen schlechte Schützen seien.
Da ergab sich eines schönen kugeldurchzirpten Maientages doch eine günstige Gelegenheit für August, seine Stärke zu beweisen. Vom Hauptmann der Kompanie war er wieder einmal in Richtung eines anderen Kampfabschnitts geschickt worden, mit dem Hinweis versehen, ja nicht vom Wege abzukommen. Traugott kicherte in sich hinein: Der Spieß glaubt wohl wirklich noch an den bösen Wolf!
Wie er sich als Meldegänger also in die Spur machte, den feindlichen Geschossen geschickt ausweichend, erblickte er plötzlich einige kleine Bauernhäuser, die sich dem Krieg bisher unbeschadet widersetzt hatten. Vorsichtig pirschte August näher und hörte aus einem nahe gelegenen Stall munteres Hühnergackern. Jede Vorsicht außer acht lassend – das Federvieh war ja unbewaffnet -, betrat er die Tierbehausung. Kaum drinnen, vergaß er vollends, dass draußen der Krieg tobte. Ein Strohnest war mit herrlich weißen Eiern gefüllt. Sofort durchschoss Traugott der Gedanke, dass mit diesen die Gunst seiner Kameraden leicht zu erringen sei. Ein kleiner Weidenkorb stand in der Nähe, und so requirierte der deutsche Soldat August Trautloff französische Eier. Wenig später ergriff die französische Bäuerin Madeleine Tussout eine Heugabel und schlug mit dieser auf den deutschen Eierkopp. Die Frau prügelte so heftig drein, dass August sich bald nicht mehr rührte. Verächtlich murmelte sie, natürlich französisch: „Seine Schuld, wenn er keinen Stahlhelm trägt.“
Als die deutschen Truppen nach glorreichem Vormarsch auch dieses Dörfchen erobert hatten, fanden sie den Meldegänger Trautloff in einer Stallecke sitzen und greinen, dass seine Eier kaputt seien. Der Sanitäter befand aber, dass Augusts Geschlechtsteil in Ordnung sei. Der wimmerte jedoch in einem fort seine Schadensmeldung.
Im Lazarett stellte man schließlich fest, dass August keinen Eierschaden, sondern einen gehörigen Dachschaden hatte. Man hängte ihm das Eiserne Kreuz II. Klasse um und schickte ihn zurück in die Heimat.
Bis zum heutigen Tage begriff der Dekorierte nicht, dass Kaiser Wilhelm den Krieg verloren hatte und sich bereits im Jenseits befand – oder in der Hölle, ganz nach Wertung seiner irdischen Leistungen.
Theodora Lieblich
Bürgermeister Hampel hatte den Glauben verloren, die Versammelten auf den einzigen Tagesordnungspunkt zu konzentrieren. Selbst Partei-Stoffel sah sich dazu außerstande. Wie ein rettender Engel, der durch das Deckenlüftungsgitter hereingeschwebt sein könnte, stand Theodora Lieblich auf einem Stuhl und breitete prophetisch ihre Arme aus. Die Männer wurden augenblicklich still, nur die Frauen nahmen sich etwas Zeit dazu. Herrmann Ackermann, der neben Theodora saß, stierte lüstern auf ihre wohlgeformte Beine. Gern hätte er mehr sehen wollen, doch seine nach oben wandernden Blicke wurden durch einen Klaps seiner Ehefrau wieder gesenkt.
Theodora ließ die Arme sinken und erhob ihre Stimme. „Liebe Freunde! Liebe Mitbürger! Aus welchem Grund haben wir uns hier und heute zusammengefunden? Um zu lärmen? Um unaufmerksam zu sein? – Nein! Wir sind hier versammelt, um darüber zu befinden, wie unseren Nachfahren bewusst gemacht werden kann, was gestern und heute, aber auch morgen in unserem Dorf an wichtigen Ereignissen geschah. Das wird zwar in keinem Geschichtsbuch stehen, so bedeutend sind wir nicht. Es muss aber in einer Dorfchronik stehen, damit von unseren kleinen Taten die lesen können, die uns nicht vergessen sollen. Wenn wir hier aber weiter wild durcheinanderschwätzen, dann wird unseren Nachkommen nicht die angenehmste Erinnerung an uns überliefert.“
Die Rednerin ließ sich wieder auf ihrem Stuhl nieder. Sie wusste, dass die allgemeine Aufmerksamkeit nicht nur der Kraft ihrer Worte, sondern vor allem auch der Kraft ihrer Persönlichkeit zu verdanken war. Als Lehrerin und Leiterin der Gemeindebibliothek genoss sie das Ansehen aller im Dorf. Vor allem respektierte man ihr hohes Wissen, das ihr den Beinamen „die Gebildete“ eingebracht hatte. Schön von Angesicht und in den besten Lebensjahren war sie die heimlich Verehrte vieler Männer Würdas.
Sie war keine hier Geborene. Während der letzten Kriegswochen flüchtete sie von Ostpreußen nach Original-Preußen. Als aber auch dort die Endsiegkanonen die Luft zerrissen, wandte sie sich nach Süden und landete schließlich in dem weniger kriegsgeschüttelten Dorf Würda. Weil nach Kriegsende eine Rückkehr in die Heimat nicht möglich war, blieb sie hier und wollte es dauerhaft auch sein. Einen Mann, den sie mit ins Leben hätte nehmen können, hatte sie noch nicht gefunden. Sie suchte nach einem solchen auch nicht. Ihre einzige große Liebe galt den Büchern und Schülern. Die Mädchen bewunderten sie, weil sie sich immer chic machte und sich in ihren selbstgeschneiderten Kleidern von der Mode der Dorffrauen abhob. Die Jungen hegten ein ähnliches Gefühl wie die Männer des Ortes.
Theodora wusste um die heimliche Zuneigung „ihrer“ Jungen und nutzte diese geschickt als Motivationstrieb für bessere Lernleistungen. Selbst die Ehefrauen Würdas, die beim Blick auf ihre Ehemänner hätten argwöhnen müssen, sahen dazu keine Veranlassung. Fräulein Lieblich hatte sich nämlich in ihrer Kulturbesessenheit zur Urheberin einer Kulturgruppe gemacht, deren wichtigster Bestandteil ein Chor war, dem neben einigen Männer viele Frauen angehörten. Was gab es Schöneres für Würdas Chor, als Mittwoch Abends zu üben und sich an bestimmten Wochenenden am Beifall der Zuhörer zu erfreuen.
Theodora Lieblich, deren Eltern bald nach Kriegsende verstorben waren, hatte nun eine neue Familie gefunden, eine weitaus größere. Das machte, dass sie Würda nicht mehr verlassen wollte und sich ein Leben andernorts nicht vorstellen konnte. Verständlich also, weshalb die im Saal Versammelten den Worten der schönen Lehrerin andächtig lauschten. Aber nicht stummes Schweigen wollte sie erreichen, sondern eine Mitteilungsbereitschaft, die nützlich für das neue Buch der Gemeinde Würda sein könnte.
Der Bürgermeister warf ihr dankbare Blicke zu; für den Moment schien die Situation gerettet. Und in der Tat, ein lebhafter Gedankenaustausch entfachte sich. Als gäbe es das Präsidium da vorn und seine Besatzung dahinter nicht, so dirigierte die Lieblich den Kommunikationsaustausch. Schließlich war das Wichtigste dann festgehalten, nämlich, wer die Chronik schreiben sollte. Einzig und allein war Theodora dafür benannt, die aber entschieden ablehnte. Als es deshalb im Saal zu grummeln begann, stellte sie sich erneut auf den Stuhl und fragte die Menge, ob sich im Falle ihres Einverständnisses jemand finden würde, die Kulturgruppe zu leiten. Es sei nämlich gar nicht einfach, auf zwei Hochzeiten zu tanzen.
Franz Apel, der wohl ausgeschlafen hatte, fragte seinen Nebenmann verdutzt: „Die will wohl endlich heiraten?“
Weil sie halbe Sachen nicht liebe, sondern etwas richtig oder gar nicht mache, müsse das zu einer einzigen Entscheidung für sie führen: Entweder Chronik oder Chor!
„Chor! Chor!“ riefen die Frauen.
„Chor! Chor!“ riefen die Männer, durch Rippenstöße ihrer Frauen dazu ermuntert.
So rief man also in einem gewaltigen Chor: „Chor! Chor!“
Als der Lärm verebbt war, herrschte wieder Ratlosigkeit. Wer sollte das Dorf-Buch denn nun schreiben? Jeder schaute zu Boden, als müsse er angestrengt darüber nachdenken. Tatsächlich glaubte man, durch diese Haltung unentdeckt zu bleiben. Schon ein Blick zum Nachbarn hätte den veranlassen können zu rufen: „Hier, der Paul!“ oder „Klare Sache, die Klara!“
Mit dem Schreiben hatten sie es alle nicht sonderlich. Na ja, hin und wieder mal eine Geburtstagskarte oder die Unterschrift hinter die geleistete Spende für die Volkssolidarität, das war schon drin. Aber so in richtigen Sätzen mit richtiger Rechtschreibung und in richtig sauberer Schrift – nee, das war tausendmal schwerer als die schwerste Arbeit auf dem Feld oder im Stall. Also brav den Kopf nach unten halten und nicht aufsehen.
`Da habe ich ja was angerichtet`, murmelte Theodora. Sie gehörte zu denen, die den Kopf erhoben hielt, gleich dem Bürgermeister und dem Pfarrer. Achselzuckend blickte sie zu Traugott Hampel, der das Achselzucken höflich erwiderte. Willi Stoffel blätterte angestrengt in der broschürten Ausgabe des 'Kommunistischen Manifests', um anzudeuten, dass er auf politischer Ebene wichtigere Dinge zu bewältigen habe. Es schien, als wäre man da angelangt, wo man begonnen hatte. Kreisverkehr in Würda.
Rita und ich
Hätte sich der Bürgermeister gründlicher umgesehen, wäre ihm aufgefallen, dass auch ich erhobenen Hauptes saß – nicht inmitten der Menge, auch nicht im Präsidium, sondern vier Meter ab von diesem an einem kleinen, wackeligen Tischchen. Diesen Platz hatte ich während öffentlicher Einwohnerversammlungen immer einzunehmen, weil ich hier die Versammlungsabläufe oder andere Vorgänge zu protokollieren hatte. Mir war diese entlegene Arbeitsstelle zugewiesen, damit ich nicht in Versuchung käme, an eine höhere Bestimmung meiner Person zu glauben. Ich war schließlich und endlich nichts weiter als der Gemeindesekretär, verantwortlich für allen Krimskrams, mit dem Traugott Hampel sich nicht befassen wollte. So nebensächlich der Schriftkram für ihn, so nebensächlich war auch ich.
Wer war ich denn schon? Sekretär des Bürgermeisters. Ein Amt, das einem Fräulein besser zu Gesicht und Figur gestanden hätte. Mir konnte man nicht unter den Rock greifen, geschweige denn an eine wohlgeformte Brust. Ich war also keine attraktive Vorzimmerdame, sondern ein Schreiberling des Bürgermeisters. Dass der sich nicht nach einem schöneren Geschlecht umgesehen hatte, war dem drohenden Einfluss seiner Gattin geschuldet. Selbige duldete keine Zweite neben sich. Außerdem war es ihr wichtig, mit Frau Bürgermeister angesprochen zu werden. Beim Einsteigen in den Linienbus hatte man ihr devot den Vortritt zu lassen. Beim Aussteigen ebenso, was ihr einmal einen Knöchelbruch einbrachte, weil jemand von hinten nachgeholfen hatte.
Stellt sich die Frage, warum ich keinen ordentlichen Beruf erlernt hatte. Auf dem besten Wege dahin war ich bereits, denn ich besuchte die Höhere Bildungsanstalt, die EOS (Erweiterte Oberschule), dem Niveau eines Gymnasiums entsprechend. Meine Eltern wollten aus mir einen Studierten machen. Als ich schließlich nach großen Mühen die 11. Klasse erreicht hatte, waren meine letzten Kraftreserven verbraucht. Ich stellte fest, dass mein Kopf zu klein war, in ihm das gebotene Wissen unterzubringen. Als ich mehr und mehr an Gehirnverengung litt, sah ich mich nach einer gesünderen Betätigung an der Schule um. Dabei fiel mir auf, dass der Umgang mit den Mädchen dieser Bildungseinrichtung erquicklicher war.
Weil ich mich seit meiner Kindheit auch mit dem Dichten von Gedichten befasste, wuchs in mir urplötzlich der Wunsch, eine Liebeslyrik zu verfassen. Dieser Drang, zunehmend zur Seelenqual werdend, war durch ein Mädchen von besonderer Schönheit verursacht worden. Sie hatte in mir eine Glut wilder Leidenschaften entfacht. In Liebe zu ihr verzehrte ich mich fast. Um dieses kannibalische Gefühl etwas zu lindern, ließ ich sie nicht aus den Augen, so oft ich sie sehen konnte. Dass ich ihr mein Herz zu Füßen warf, sah sie anfänglich nicht. Sie hätte es sicherlich auch verächtlich zur Seite gestoßen. Sie war schön wie Greta Garbo, hatte den Wohlklang der Stimme Zarah Leanders und den stolzen Gang von Marlene Dietrich. Diese Eigenschaften machten sie unnahbar. Das bewirkte, dass sie nicht wahrnahm, wie ich mich in Liebespein krümmte. Ich folgte ihr auf Schritt und Tritt, nicht aber in die Mädchentoilette. Einige Male setzte ich zum Überholen an, um mich dann mit empfangsbereiten Armen vor sie hinzustellen und zu hauchen: „Ich liebe dich!“ Im letzten Moment gebrach es mir aber an Mut, und so wandelte ich nur wieder in ihrem Schatten.
In meinen nächtlichen Träumen wuchs ich über mich selbst hinaus. Ich wurde zum verwegenen Ritter, der Rita, so hieß sie, aus der bestialischen Umklammerung eines bösen Drachen zu befreien. Der Drachen sah so aus wie Helmut Hagedorn, ein Mitschüler, der ihr mit Erfolg den Hof auf dem Schulhof machte. Ich begriff das nicht. Hatte meine Angebetete denn Tomaten auf den Augen, dass sie nicht wahrnahm, wie Helmut öfter popelte? Auch furzte er ungeniert und rauchte auf dem Klo. Mich belastete der Gedanke, dass Schön-Rita von diesen Unmanieren vielleicht nicht wusste. Wie gern hätte ich diesem Unhold auf die Finger geklopft und Rita dabei zugerufen: „Nimm mich! Ich pople, furze und rauche nicht! Ich bin rein von diesen Lastern!“
Doch ach, Träume sind Schäume! Und weil ich es nicht länger aushielt, schrieb ich das bereits erwähnte Liebesgedicht, dessen Wortlaut ich hier wiedergebe, damit verstanden wird, warum ich dem Pegasus so ungestüm in die Weichen trat.
Kussrezept
Man nehme ein Mädchen in den Arm,
man halte es sicher, man halte es warm.
Dann streiche man übers Köpfchen von ihr,
man tue es sanft und nicht wie ein Stier.
Ist sie nun geschmeidig wie Kuchenteig,
dann gehe man ran und sei nicht zu feig.
Drückt sie die Augenlider verzückt nach unten,
dann hat man das rechte Maß gefunden.
Man gehe beim ersten Mal nicht zu weit,
das hat schon so manches Pärchen entzweit.
Geht das Gefühl noch Monate mit,
freut man sich dann – und ist zu dritt.
Diesen lyrischen Erguss steckte ich ihr heimlich in die Brotbüchse, die auf einer Schulhofbank lag. Natürlich hatte ich es vermieden, meinen Namen unter die Verse zu setzen. Ich wollte zunächst die Wirkung abwarten. Und die war verblüffend. Als Rita die Büchse öffnete und ihr eine Stulle entnahm, fiel ihr auch das Zettelchen in die Hände. Sie las, und ihr blieb der Bissen im Halse stecken. Ihr Gesicht verfärbte sich, und ich fürchtete, sie würde ersticken. Hilfreich wollte ich zu ihr eilen, aber da stand schon Helmut Hagedorn an ihrer Seite. Als der ihr besorgt auf den Rücken klatschte, klatschte sie ihm ins Gesicht. Dann folgte ein wahres Trommelfeuer an Faustschlägen und hysterischen Wortausbrüchen. Von diesen verstand ich immer nur Bruchstücke wie „Du elender Mistkerl! – Du Hurenbock! – Willst mir ein Kind andrehen!“
Frohen Sinnes sah ich, wie Helmut geprügelt, beschimpft und gedemütigt von dannen zog – nicht wissend, warum ihm so geschehen war. Mein Herz wollte vor Freude aus der Brust hüpfen, denn nun konnte ich die frei gewordene Stelle an Ritas Seite besetzen Der günstige Augenblick gab mir nun auch den Mut, mich ihr ohne Umschweife zu nähern. Ich sei zufälliger Beobachter dieser Auseinandersetzung gewesen und wolle nur wissen, ob ich dem Hagedorn auch eins aufs Maul geben solle, weil der ein ganz fieser Lüstling sei.
Diese entschlossene Mannhaftigkeit rührte die Schöne zutiefst, und sie fiel mir innig um den Hals, als wären wir schon verlobt. Während sie ohn Unterlass schluchzte, jubelte ich innerlich.
Nachdem meine linke Schulter durchnässt war, senkte Rita ihr Köpfchen auf die rechte Schulter. Schließlich hatte sie die Tränendrüsen leergeheult und gab mir zu verstehen, dass ich sie nach Hause begleiten solle. Sie fürchte sich vor dem Ungeheuer Hagedorn, der mit einem schaurigen Gedicht ihre reine Mädchenseele verunreinigen wollte. Ich dachte an den Traumdrachen und auch daran, dass Träume manchmal doch in Erfüllung gehen.
Alles Folgende kann ich kurz fassen. Aus dieser angebahnten Freundschaft wurde Liebe. Wir liebten uns nicht nur vom Gefühl her, sondern auch in ihrem Bett. Der Umgang mit Rita nahm mich so in Anspruch, dass ich zu geistiger Tätigkeit nicht mehr imstande war. Als mein Abschlusszeugnis der 11. Klasse weit hinter meinen Erwartungen lag , zogen mich meine Eltern vom weiteren Bildungsgang zurück. Ich war sehr erleichtert – meine Lehrer auch.
Mit diesem schmählichen Abgang von der EOS entfernte sich auch Rita von mir, denn sie meinte, dass sie mit einem Schwachkopf keinen gemeinsamen Lebensweg beschreiten könne. Schließlich käme es auch dazu, dass die gemeinsam gezeugten Kinder bekloppt seien.
Meine Abschiedshaltung glich der des Helmut Hagedorn. Nur hatte ich meinen Kopf noch tiefer zwischen die Schultern gezogen.
Ortsparteisekretär Willi Stoffel vis-à-vis
Die im Saal Versammelten erweckten den Eindruck, als schliefen sie bereits. Weil es deshalb nichts zu protokollieren gab, kehrte ich zu meinen Erinnerungen zurück.
Die Trennung von der Schule bedrückte mich nicht so sehr wie die von Rita. Ich wurde das Gefühl nicht los, ein Versager auf allen Gebieten zu sein. Deshalb war ich nicht zu bewegen, einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Ich fürchtete weitere Blamagen. Weil meine besorgten Eltern mich nicht aufrichten konnten, wandten sie sich hilfesuchend an Bürgermeister Traugott Hampel. Der wollte edel, hilfreich und gut sein und bot an, mich als persönlichen Sekretär in seine Dienste zu nehmen. Er vermute bei mir eine geringe Restintelligenz, die ausreichend sei, Gemeindeschriftkram zu erledigen. In einer höheren Entwicklungsstufe könnte ich dann zum Gemeindeboten aufsteigen, der wichtige Mitteilungen des Bürgermeisters im Dorf ausruft. Das würde mein Selbstbewusstsein stärken und mich nach und nach vergessen zu lassen, dass ich eigentlich eine verkrachte Existenz sei.
So geriet ich in die Hände des Bürgermeisters. Der ließ mich alle Arbeiten tätigen, die ihm zuwider waren. Vorrangig waren es solche, die sich mit Schriftverkehr befassten und den dazugehörigen umständlichen Amtsdeutsch-Formulierungen. Gewürzt wurde diese Amtsschimmelprosa durch überflüssige Floskeln zur Weitsicht der Partei, zur unverbrüchlichen Freundschaft mit dem Sowjetvolk oder zur Sieghaftigkeit des Sozialismus.
Auch im Gemeindeamt hatte ich meinen gesonderten Platz – ich saß im Vorzimmer des Chefs. Das war gleichzeitig der Durchgangsraum für diejenigen, die bei ihm vorsprechen wollten. Ich besaß somit auch die Funktion einer Einlassdame, denn nicht wenige, die an mir vorbeistrebten, hielten vorher inne, um sich nach dem Gemütszustand Hampels zu erkundigen. Es geschah auch des öfteren, dass Einwohner bereits bei mir wichtige Auskünfte einholten. Wenn sie mit diesen mehr als zufrieden waren, dann setzten sie sich zu mir, um zwanglos zu plaudern. So wurde ich zu einer Art Vertrauensperson, der man sich auch in privatesten Angelegenheiten anvertraute. Bald war ich über alles informiert, was sich unter Würdas Dächern zwischen Bett- und Tischkante abspielte.
An meinem kleinen bescheidenen Schreibtisch, der links neben der Eingangstür des Vorzimmers stand, erhöhte sich mein Bildungsstand gewaltig. Bald wähnte ich mich klüger als ein EOS-Abiturient. Helmut Hagedorn, der mich in meinem Wirkungsbereich einmal aufsuchte, äußerte abfällig, dass ich doch nur ein Schreibstubenhengst sei. Daraufhin wieherte ich laut, und er flüchtete, sich den rechten Zeigefinger an die Stirn haltend.
Das Vorzimmer besetzte noch eine Person. Schräg gegenüber von meinem Platz hatte Willi Stoffel seinen Schreibtisch stehen, ein pompöses antiquares Stück, aus dem Gutshause derer von Hummelshausen stammend. Hinter diesem verschnörkelten Junkermöbel bereitete der Parteisekretär die ideologische Beeinflussung der Ortsbevölkerung vor. Manchmal war er jedoch nicht zugegen. Dann trieb er sich wieder auf irgendeiner Parteikonferenz herum. Auch in diesen Zeiten seiner Abwesenheit war er mir allgegenwärtig, denn an der Wand hinter seinem Schreibtisch prangten zwei aufdringliche Losungen. Die erste: Überholen ohne einzuholen! Gleich daneben grinste der gerahmte Ulbricht aus seinem Spitzbart. Die zweite: Der Kapitalismus steht kurz vor dem Abgrund – wir sind einen Schritt weiter! Auch neben dieser Schlagzeile hing ein Bild. Es zeigte irgendein Gebirgsmassiv der Alpen mit der Unterschrift Alpenglühen.
Als ein Ortsgenosse es einmal wagte, Zweifel am Platz dieses Ölgemäldes zu äußern, fuhr Stoffel ihn an, dass es veranschauliche, wie tief das zum Absterben verurteilte kapitalistische System fallen werde.
Weil es ihm an weiteren Losungen fehlte, hatte er die Bildergalerie vervollständigt. Direkt über der Eingangstür hingen vier gerahmte Köpfe mit unterschiedlich langen Bärten. Jeder kannte sie: Marx, Egels, Lenin, Stalin. Ende der 50er Jahre holte Stoffel den vierten von der Wand. Als ich das zum ersten Mal wahrnahm, sang ich vor mich hin: „Zehn kleine Negerlein …“
Stoffel zürnte, ich solle meine defätistischen Anspielungen unterlassen. Zu Adolfs Zeiten wäre ich dafür vor den Volksgerichtshof gekommen. Er räusperte sich: Nur zum Vergleich, damit ich spüre, wie human jetzt mit Menschen umgegangen werde, die eine Lippe riskieren. Weil ich Stoffels Laune wieder in Ordnung bringen wollte, sagte ich ihm, dass ich größte Bewunderung für seine politisch-ideologische Wortführung empfinde.
So zufrieden mit mir war Genosse Stoffel aber nicht immer. Es wurmte ihn, dass er mich noch nicht von der Notwendigkeit der SED-Mitgliedschaft überzeugt hatte. Seit Wochen und Monaten bastelte er an meiner Bewusstseinsänderung ohne jeden Erfolg. Der Grund hierfür lag weniger in meiner eigenen Meinungsbildung als vielmehr in der sturen Absicht meiner jüngst erworbenen Schwiegermutter. Gemeinsam mit ihrer Tochter drang sie in mich, diesem Kommunistenverein die kalte Schulter zu zeigen. Die bessere Lösung wäre, wenn ich der NDPD (National Demokratischen Partei Deutschlands) beiträte. Diese Partei würde mir nicht nur wohltuenden Gesinnungsfrieden geben, sondern auch – dabei funkelte sie mich unmissverständlich an – hinreichend häuslichen Frieden.
Was sollte ich tun? Ich liebte meine Frau und sie mich. Schwiegermutter liebte ich nicht und sie mich ebenso wenig. Um des erwähnten lieben Friedens willens ließ ich beide Frauen im Glauben, ich sei dem Gedankengut der NDPD sehr zugetan, doch müsse in mir der endgültige Entschluss noch reifen. So reifte ich also spärlich und wurde deshalb zum Spielball ideologischer Gewalten. Spielball ist weniger treffend, mehr schon Magdeburger Halbkugeln.
Willi Stoffel brachte als ideologisches Argument vor, dass die NDPD die verkrüppelte Version der NSDAP sei. Als ich das Schwiegermutter hinterbrachte, hätte sie mich beinahe in die Abgründe des Junggesellendaseins zurückgejagt. Mich rettete nur die eiligste Willensbekundung, nun doch der NDPD beizutreten. Wie freuten sich die Parteifreunde über den jugendlichen Zuwachs.
Überhaupt nicht erfreut war Willi Stoffel, der beklagte, dass ich schutzloses Opfer der braunen Horde geworden sei. Irgendwann würde ich es bitter bereuen, der einzig wahren Partei die kalte Schulter gezeigt zu haben. Wenn es nach ihm ginge, würde er alle Splitterparteien der DDR zum Teufel jagen und nur der SED die einzige Machtfülle gestatten. Plötzlich frohlockte er, mich schadenfroh ansehend, dass die Splittergruppen ohnehin nichts zu sagen hätten.
Weil ich ihm nicht in die Fänge geraten war, fiel Willi nun über all die anderen Leute her, die durchs Vorzimmer gingen. Ich gewann den Eindruck, dass dieser Raum zum Politbüro mutierte. Zwei Beispiele hierfür:
Als eines glatten Wintertages Emma Zunke vor dem Gemeindeamt ausgerutscht war und sich vergeblich bemühte, ihren umfangreichen Körper in die Senkrechte zu bekommen, half ihr dabei der zufällig herbeigekommene Willi Stoffel. Nach ihrer geglückten Auferstehung schleppte er Emma ins Vorzimmer und ließ sie dort auf einen Stuhl plumpsen. Statt sich um ihr weiteres Wohlbefinden zu bemühen, fragte er, ob sie aus Dankbarkeit bereit wäre, Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu werden. Emma, für ihre derbe Wortwahl bekannt, raunzte: „Ich bin doch uffen Arsch jefalln und nich uffen Kopp!“
Willi merkte, dass mit bloßer Fragestellung der parteilosen Masse nicht beizukommen war. Er sann auf eine andere List. Eines schönen Frühlingstages lagen auf seinem Schreibtisch viele rote Luftballons in schlaffem Zustand. Wer vorbei ging, durfte sich bedienen, ohne von Stoffel belästigt zu werden. Als noch am gleichen Tage der Vorrat aufgebraucht war, zog Stoffel, begleitet von einem hinterhältigen Grinsen, einen letzten Ballon aus der Schublade. Als er diesen aufgeblasen hatte, prangte auf der Gummihaut in großen weißen Lettern: Juchhe, Juchhe, ich geh in die SED!
Stoffel musste in den nächsten Tagen erstaunt feststellen, dass sich in seine Werbeliste niemand einschrieb. Als er am nächstfolgenden Wochenende im Konsum nach Schnitzelfleisch anstand, entnahm er der Unterhaltung zweier Frauen, dass es in seiner Parteizentrale etwas sehr Nützliches umsonst gegeben habe: Rote Kondome mit weißer Aufschrift.
Schwiegermutter, Ehefrau und ich
Ich schaute zum Präsidiumstisch und sah, dass Stoffel immer noch im Kommunistischen Manifest blätterte. Auch die Menge verharrte noch in Schweigen. Entschlossen riss ich meinen rechten Arm empor und schnippte mit Daumen und Zeigefinger. Ich wollte auf mich aufmerksam machen und den alle befreienden Satz rufen: „Ich will die Ortschronik schreiben!“
Traugott Hampel nahm mit Missfallen wahr, wie ich mich in eine Diskussion einmischen wollte, die gar keine war. Mit barscher Handbewegung brachte er mich zum Schweigen, noch ehe ich ein Wort gesagt hatte. Eingeschüchtert ließ ich meinen Arm sinken. Mir wurde die Verhaltensregel bewusst, die er mir am ersten Tage meines Bürodienstes eingebläut hatte. Ein Sekretär ist nicht nur zu größter Verschwiegenheit im Amt verpflichtet, sondern hat auch den Mund zu halten, wenn die Bevölkerung das Wort hat. Ich sei eine neutrale Person und müsse mich deshalb aus allen öffentlichen Angelegenheiten heraushalten.
Mich überkam wieder die Erkenntnis, dass ich aus Hampels Sicht kein Lebewesen bin, sondern nur ein Werkzeug in seiner Gewalt. Vielleicht spielte beim ihm auch die Überheblichkeit gegenüber Flüchtlingen und Umsiedlern eine Rolle, die er immer wieder dann an den Tag legte, wenn er sich in die Gunst der alteingesessenen Würdaer bringen wollte. Im Verlauf weiterer Nachkriegsjahre verpufften seine diesbezüglichen Anstrengungen, denn auch in dieses Dorf war anderes Blut eingeflossen bzw. hatte sich mit dem vorhandenen vermischt. Solcher Mix vollzog sich auch zwischen mir und meiner Frau.
Ich war mit meinen Eltern von weit her gekommen – aus dem Riesengebirge. Bestimmt wären wir dort geblieben, wenn es nicht zur dritten Völkerwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen wäre. Nun waren wir hier und froh, ein neues Zuhause gefunden zu haben. Wir jammerten nicht, wir bettelten nicht, wir schämten uns auch nicht, an den Arsch der Welt geraten zu sein. Wir beeilten uns, schnell gute Freunde und verständnisvolle Menschen zu finden. Das gelang uns recht mühelos.
Mir war Würda in den zurückliegenden Jahren so sehr ans Herz gewachsen, dass es mich drängte, über dieses Dorf und seine unverwechselbaren Menschen ein Buch zu schreiben. Ich wusste nur nicht, welchen Anfang es nehmen sollte. Aller Anfang ist schwer. Auch in der Schriftstellerei.
Mitten hinein in diese umherirrenden Überlegungen platzte die öffentliche Einwohnerversammlung, die meinem Ansinnen eine gerade Richtung hätte geben können. Da aber war Bürgermeister Traugott Hampel, der alles, was ich in meiner Vorstellung aufgebaut hatte, mit einer einzigen Handbewegung zum Einsturz brachte. Mich überkam die gleiche Niedergeschlagenheit, die ich nach der Trennung von Rita empfunden hatte. Weil ich diesen Gemütszustand nur schlecht vor meiner Frau verbergen konnte, musste ich mich ihr schließlich anvertrauen. Sie meinte kurz und bündig: „Kümmere dich lieber um mich und meine Mutter!“
Damit war mir wieder ins Bewusstsein gerückt, dass sie ein Kind und ihre Mutter einen Enkelsohn wünschten. Mit einer Enkeltochter hätte sie sich auch zufrieden gegeben, aber ja nicht beide auf einmal, drohte sie. Weil ich fürchtete, Schwiegermutter würde uns in den nächsten Nächten belauschen, hielt ich mich von geschlechtlicher Vereinigung fern. Meine Gattin führte diese Enthaltsamkeit auf meinen depressiven Gemütszustand zurück. Sie konnte nicht begreifen, warum ich ein Buch schreiben wolle. Dieses Vorhaben sei ein Hirngespinst und letztlich eine brotlose Kunst. Nützlicher wäre, wenn ich nach Feierabend Geschirr abwasche, Staub wische oder im Garten umgrabe. Solche Tätigkeiten zeichneten einen treusorgenden Ehemann aus. Um ihre Vorstellungen noch eindringlicher zu machen, übergab sie für weitere Worte an ihre Mutter. Die zog vielleicht vom Leder. Mich überkam das Gefühl, vor kurzem aus einer Besserungsanstalt entlassen zu sein und nun die Grundbegriffe zivilisierten Zusammenlebens erlernen zu müssen. Als sie sich jedoch der Aussagegrenze näherte, ich sei doch nur ein Zugelaufener und hätte hier gnädigst Unterkunft gefunden, da platzte mir der Kragen. Ich brüllte, dass ich dann ja die Freiheit besäße, dieses Haus sofort zu verlassen.
Meine Lautstärke veranlasste zunächst die Katze, dem Haus zu entfliehen. Die war kaum draußen, da sanken Schwiegermutter und Ehefrau ängstlich auf die Küchenbank. Furchtsam saßen sie aneinandergepresst. Sicherheitshalber schob meine Gattin das lange Brotmesser vom Küchentisch.
Ich war nun voll im Eifer und spürte, wie all die seelischen Belastungen der letzten Tage von mir fielen wie welkes Herbstlaub von den Bäumen. Weil ich mich so siegverheißend im Vormarsch befand, feuerte ich noch ein letztes Geschoss ab. Wenn niemandem mehr an meiner Person gelegen sei, dann könnte ich mich auch aus der NDPD verabschieden. Das war zuviel! Schwiegermutter erstarrte zur Salzsäule, und meine Gattin schaute verwirrt.
In dieser Haltung ließ ich beide Frauen zurück und folgte der Katze. Kaum hatte ich die Hoftür erreicht, da wurde ich von hinten umklammert. Schwiegermutter und Gattin zerrten an mir, als müssten sie mich vor weiteren verderblichen Schritten bewahren. Als ich mich im Wohnzimmer wiederfand, umfächelten mich freundliche Töne. Binnen weniger Minuten war meine Ehe wieder gekittet. Schwiegermutter gab sich lammfromm und bewirtete mich mit Kaffee und Kuchen, der eigentlich für andere Zwecke bestimmt war. Auch meine Frau zeigte sich in ausgesuchter Liebenswürdigkeit und träufelte mir Milch und Zucker in den Kaffee. Die Katze, die an diesem Friedensschluss teilhaben wollte, zwängte sich durch den Türspalt ins Zimmer und strich schmusend um meine Füße.
Für mich wurde in dieser gezähmten Situation das Goethewort dominierend: …Amboss oder Hammer sein. Ein Hammer wollte ich fortan sein. Das hier am Kaffeetisch zu sagen, vermied ich jedoch, weil Schwiegermutter mich sonst gebeten hätte, das Handwerkszeug aus dem Geräteschuppen zu holen. Im Haus gab es immer etwas zu reparieren.
Als ich den letzten Kuchenkrümel vom Teller gestippt hatte, gab ich zu verstehen, dass es meine unumstößliche Absicht sei (das Wort Wunsch tilgte ich), ein Buch über Würda zu schreiben. Nichts könne mich mehr davon abhalten. Und wenn mir alles gut gelinge, dann würde man von guten und weniger guten Menschen lesen können. Als Gemeindesekretär hätte ich so Manches erfahren.
Schwiegermutters Haltung veränderte sich ein weiters Mal. Wie beiläufig wischte sie mir ein Stäubchen vom Ärmel und säuselte, dass ich sicherlich auch das Wetzen böser Zungen vernommen hätte. Diesem Geräusch dürfte ich keinesfalls trauen. Es sei für mich auch gar nicht einfach, tatsächliche Hintergründe zu entdecken, weil ich doch erst einige Jährchen nach dem Krieg hier sesshaft geworden sei.
`Nachtigall, ick hör dir trapsen`! dachte ich sofort. Ich wollte die Gunst der Stunde zwar nicht ausnutzen, aber nutzen und sagte deshalb: „Die Spreu vom Weizen wird sich schon trennen lassen.“
Weil ich nun als Geheimnisträger galt, wurde ich während der nächsten Tage beargwöhnt, jedoch mit einer Liebenswürdigkeit, die einen Labilen leichtsinnig und schwach gemacht hätte. Mich beugt ihr nicht, war mein Entschluss. Goethes Hammer hielt ich fest umfasst, auch des Nachts, wenn meine Frau mit all ihrem Charme versuchte, mich wehrlos zu machen.
Die scheinbare Zwangssituation schien für beide Frauen immer fataler zu werden, denn sie machten alle möglichen verbalen Verrenkungen, um mich zu einer Äußerung zu bewegen. Schwiegermutter gab sich dabei am eifrigsten und zirpte: „Wäre es nicht möglich …“ oder „Es könnte doch sein …“ -
Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als am Schwarzen Brett - der öffentlichen Mitteilungsfläche für Gemeindenachrichten - zu lesen war, dass nach der ergebnislosen Einwohnerversammlung auch eine geschlossene Sitzung der Gemeindevertretung keine Einigung darüber erzielt hätte, wer die Ortschronik schreiben soll. Das sei jammerschade, weil unser Dorf nun dazu verdammt sei, irgendwann einmal in Vergessenheit zu geraten.
Als Schwiegermutter diesen Text gelesen hatte, meinte sie, dass das gar nicht tragisch sei, weil unser Ort ohnehin nicht sehr bedeutungsvoll sei. Dabei blickte sie mich fragend an, und ich antwortete entschlossen: „Nun denn, ans Werk! Dem Dorf muss Bedeutung gegeben werden!“
Im Grunde genommen war mir klar, dass ich eine gründliche Chronik nicht schreiben könnte, weil mir lokalhistorische Fakten nicht zur Verfügung standen. Die Schreibtischgespräche an meinem Arbeitsplatz konnten kaum dazu beitragen, ein gewichtiges Geschichtswerk über Würda zu erstellen. So bemächtigte sich meiner der Entschluss, die Finger vom Schreiben einer Ortschronik zu lassen. Was soll`s, sagte ich mir, Chroniken sind ohnehin nur fades, trockenes Geschreibsel. Von solchem hatte ich im Amt täglich zur Genüge. Ich wollte endlich einmal Freude am Formulieren haben, mein Geist sollte fröhlich von Einfall zu Einfall hüpfen und Würda in einem Buch verewigen, das auch solche Leser in heitere Stimmung versetzt, die selbst an Sonnentagen ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen. Dass Dichtung und Wahrheit um gegenseitige Vorherrschaft ringen müssten, war mein Entschluss schon vor dem ersten Federstrich. Die innere Einstellung hatte ich also gefunden und guckte deshalb entschlossen drein.
Schwiegermutter fiel mir um den Hals und herzte mich, wie seit der Eheschließung ihrer Tochter nicht mehr. Mir war nun klar, dass sie etwas zu verbergen hatte. Sie fürchtete mit größter Wahrscheinlichkeit, dass ich davon bereits wüsste. Ich wusste natürlich nichts.
Als ich mich aus ihrer liebevollen Umklammerung löste, standen ihr Tränen in den Augen. Dass sie echt waren, erkannte ich auch am leichten Zittern ihres Körpers. Meine Gattin eilte besorgt zu ihr und setzte sie in einen Sessel. Weil sich Schwiegermutter nicht mehr in der Gewalt hatte und zu stottern begann: „Er wird es schreiben! Er wird es schreiben!“, warf sich meine Ehehälfte vor ihr auf die Knie und flehte inständig: „So sage ihm doch, dass alles in guter Absicht geschah!“
Nach beiderseitigem Tränenfluss, der die schlimmsten Befürchtungen wohl weggeschwemmt hatte, bat mich Schwiegermutter an ihre Seite. Sie offenbarte mir nun etwas, was ich zwar nicht für möglich gehalten hätte, aber doch nicht so dramatisch empfand, als dass ich davon nicht hätte wissen dürfen.
Nachdem meine liebe Schwiegermama, denn augenblicklich hatten wir uns lieb gewonnen,
geendet hatte, fiel ich ihr mit Dankesworten um den Hals. Das verstand sie nun wieder nicht. Ich beteuerte nochmals, dass das, was sie mir eben mitgeteilt hatte, einem wertvollen Geschenk gleichkäme. Ich hätte von all dem nichts gewusst, nun sei es aber heraus, und sie müsste mir mehr dazu sagen. Für mein Buch, dessen Titel ich noch nicht gefunden hatte, sei das von allergrößtem Nutzen. Vertrauliche Angelegenheiten würde ich natürlich vertraulich behandeln.
Dieser Satz wirkte wie eine Erlösung. Schwiegermutter erhob sich aus dem Sessel und ging zum Schreibsekretär, an dem sie nun geheimnisvoll herumfummelte. Dass dieses alte Möbelstück ein Geheimfach besaß, wusste ich, nicht aber, wie es zu öffnen war. Nach wenigen Handgriffen entnahm sie diesem Sesam-öffne-dich ein … - Das verrate ich an späterer Stelle, weil meine Darlegungen auch spannungsgeladen sein sollen.
Vom schwierigen Anfang
Froh beschwingt und voller Elan zog ich mich in mein kleines Arbeitszimmer zurück, das eigentlich eine Bodenkammer war. Ich hatte sie mir etwas hergerichtet. Umgeben von allerlei nicht mehr gebrauchten Gerätschaften saß ich nun an einem von Holzwürmern bewohnten Tischchen direkt vor dem einzigen Fensterchen. Die frühe Abendsonne, die schon nahe dem Horizont stand, schickte einige Sonnenstrahlen los, die nachsehen sollten, was ich unter dem Dach juchhe wieder treibe. Sie hatten es nicht leicht, sich durch das dichte Laubwerk der alten Kastanie zu zwängen, die direkt vor dieser Fensterseite stand. Für mich war dieser Platz hier oben von auserlesener Romantik, vor allem dann, wenn ich mit mir allein war.
Das war ich in diesem Moment jedoch nicht lange, denn kaum hatte ich die Bleistiftspitze auf das erste Blatt Papier gesetzt, da schwebte meine Gemahlin herein und stellte eine Vase mit blühendem Klatschmohn und wunderbar blauen Kornblumen auf das Tischchen. Sie wusste, was ich liebe und mich inspiriert. Wie, um meinen Gedankenfluss zu beschleunigen, drückte sie mir ein zartes Küsschen auf die rechte Wange. Und wieder einmal entdeckte ich, dass ich mit einer wunderschönen Frau verheiratet bin. Weil sie meine Empfindungen wohl erraten hatte, schmatzte sie noch meine linke Wange. Nun war alles geschehen, was ich brauchte, um mich emphatisch an meine Dichtung zu wagen.
Dieser Schwung wurde jedoch durch das Vorhandensein meiner Gattin gedrosselt. Sie setzte sich auf eine alte Holzkiste gegenüber und schaute mir in die Augen, so wie sie es immer tat, wenn sie mich ins Gebet nehmen wollte.
„Es ist sehr erfreulich, dass du ein Buch schreiben willst. Vielleicht gelingt dir das auch. Aber denke schon bei den ersten Zeilen daran, dass du dich kurz fassen musst. Dein Schreibstil ist oftmals sehr weitschweifend und deshalb schwer verständlich. Deine früheren Liebesbriefe beweisen das. Oftmals habe ich sie nur bis zur Hälfte gelesen, weil ich dann eingeschlafen bin.“
Mich ärgerten ihre Worte. Noch hatte ich keine einzige Zeile geschrieben und schon wurde ich kritisiert. Wie ich ihrer Meinung nach denn beginnen solle, fragte ich.
„Kurz und knapp. Du könntest mit einem weisen Spruch beginnen, der dann ein bisschen verdeckt, was dir an dummen Sätzen einfällt. Etwa so: Dreht euch nicht um, der Plumpsack geht um, er geht um den Kreis, dass niemand was weiß.“ Und weiter: „So wäre es sinnvoll, wenn du vom Plumpsack sofort auf einen anderen Sack überleitest, nämlich auf Torsten Sack. Er ist eine geachtete Person in unserem Ort, weil er mit seiner Spritze schon viel Zufriedenheit gebracht hat. Mit ihm bist du also ohne alle Umschweife mitten im Anfang. Zitiere doch einfach aus dem Weckelnheimer Rundblick, Ausgabe Nr. 15.“
Weil ich mich als einsichtiger Schriftsteller zeigen wollte, tat ich nach ihrem Geheiß und schrieb aus dem Amtsblatt für umliegende Gemeinden folgendes ab: Wieder einmal ist von einer aufopferungsvollen und mutigen Tat zu berichten. Torsten Sack, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Würda, hat an der Spitze seiner Kameraden ein wahres Beispiel von Entschlossenheit gezeigt. Die Bäuerin Dora Klee hatte kürzlich einen Brand; er tat aber nichts, die alte Ziege konnte gerettet werden. Und nicht nur dieses Haustier verdankt seine Rettung vor dem Flammenmeer Torsten Sack, sondern auch anderes Getier, das in letzter Zeit durch seinen selbstlosen Einsatz bis zur Schlachtung am Leben bleiben konnte. Auch das ist ein lobenswerter Beitrag zur Aufrechterhaltung der Volksernährung.
Weil mir das stupide Abschreiben von Dorfkorrespondenzen zu dumm war, blieb ich bei der Findung eigener Worte. Hilfreich wurde mir dabei ein Ereignis, das die Würdaer in Aufregung versetzt hatte. Der Enkelsohn der längst verblichenen Freiherrschaft von Hummelshausen erschien im Dorf, um Kenntnis zu nehmen vom Zustand seines Erbteils. Er fuhr in einem schwarzen Mercedes vor und hatte in diesem seine gesamte Familie sitzen, nämlich seine Gemahlin, die er in Hamburg St. Pauli kennen gelernt hatte. Während die mit den pomadebeladenen Wimpern klimperte, hob Enkel-Freiherr von Hummelshausen die Nase, als wollte er mit dieser das Autoschiebedach öffnen. Dann aber hätte es ihm in die Nasenlöcher geregnet, denn ein unfreundliches Tief bewegte sich über Würda hinweg. Weil er sich die Salamander-Schuhe im Straßenmodder nicht beschmutzen wollte, fuhr er wieder davon, ohne auch nur eine welke Nelke auf die pompöse Grabstelle seiner Urgroßeltern und seiner Kleintante Agathe gelegt zu haben.
Dennoch hinterließ sein Mercedes Bewunderung bei Würdas Männern. Tagelang diskutierten sie über die Vorzüge dieser westdeutschen Nobelkarosse. Weil schließlich festgestellt wurde, dass man ein solches Auto nie und nimmer besitzen werde, erhob man den „Trabi“ zum besseren Fahrzeug. Der wäre fahrtüchtig auch dann, wenn man den gerissenen Keilriemen durch einen Perlonstrumpf der Ehefrau ersetzte. Der Verkehr bekäme dadurch neuen Antrieb.
Hugo Franski
Weil es unter der Würde des Herrn von Hummelshausen war, Würdaer in das Innere seines bestaunten Autos gucken zu lassen, lud Fahrschullehrer Franski zum Tag der Offenen Moskwitsch-Tür ein. Er war der Meinung, dass dieses Auto in allen seinen Eigenschaften der beste Wagen zwischen Wladiwostok und Würda sei. Um das zu beweisen, ließ er jeden, der das wollte, in das Wageninnere spähen. Jeder wusste natürlich, dass man einen Moskwitsch nicht zu kaufen bekam, und so war Hugo Franski der einzige im Ort, der ein solches Russen-Auto fuhr. Dass ihm das möglich war, verdankte er seinen Augen und Ohren, die er der Stasi zur Verfügung stellte.
Der Tag der Offenen Moskwitsch-Tür war ein voller Erfolg. Im Weckelnheimer Rundblick, Ausgabe Nr. 16, war zu lesen: Genosse Franski hatte wieder einmal die Tür seines Fahrschulautos für die breite Masse geöffnet. Das allgemeine Interesse war groß. Er ließ auch einige fahren.
Nicht geschrieben stand, dass am Kühlergrill des Moskwitsch am nächsten Morgen ein Mercedes-Stern prangte. Hugo erfuhr von dieser imperialistischen Schändung erst, als er im Hof der Stasi-Zentrale zu Hola vorgefahren war. Der Stasi-Oberst, der vom Fenster seines Verhörzimmers aus das neue Moskwitsch-Logo entdeckte, griff sofort zum Telephon und erkundigte sich bei den Genossen im Abhörraum, ob sowjetische Truppen in Stuttgart einmarschiert seien.
Als Franski wieder nach Hause fuhr, fehlte ihm zwar der Stern, nicht aber das Licht, das ihm aufgegangen war. Irgendein klassenfeindliches Subjekt hatte ihm dieses Symbol kapitalistischer Selbstgefälligkeit ans Auto geklemmt. Welcher Schweinehund versuchte ihn zu denunzieren?
Während seiner Schulungen zum 007 des Dorfes Würda war ihm auch der besonders wichtige Merksatz eingehämmert worden, dass Kinder und Betrunkene stets die Wahrheit sagen. Weil Otto Krugs Kneipe noch nicht geöffnet hatte, musste sich Franski wohl oder übel dem Kinderspielplatz zuwenden. Damit er von den im Sand spielenden Kleinen sofort freundlichst empfangen wurde, hatte er sich mit einem Plasteimerchen, einem Schippchen und drei kleinen Kuchenformen ausgerüstet. Wie er nun den Sand in den Förmchen festklatschte, dabei feinhörig auf die Unterhaltung der Kleinkinder achtend, hörte er, wie ihn ein Dreijähriger anbrabbelte: „Ontel Hudo, hatte widda Wanze an die Hut?“
Diese Fragestellung ärgerte Hugo, weil es für ihn nun sinnlos geworden war, weiter im Sand zu buddeln. Sein Gemüt heiterte sich auf, als er Emma Zunke über den Dorfanger watscheln sah. Vor sich schob sie einen Kinderwagen und hinten schleppte sie ihren ausgedehnten Hintern. Wenn man ihr folgte und zum Überholen ansetzte, musste man weit ausweichen, um nicht mit ihrem ausscherenden Gesäß zu kollidieren. Die Zunke war nicht nur füllig geraten, sondern auch ungeraten in ihrer Ausdrucksweise, wie der Leser bereits erfahren hat.
Hugo Franski fand das im Moment nicht hinderlich, im Gegenteil sogar, vielleicht ließe sich diesem Schandrachen eine nützliche Information entlocken. Mit der scherzhaften Bemerkung, ob sie für das Schieben eines Kinderwagens eine Fahrerlaubnis besitze, wollte er den Dialog entfachen.
Weil Emma heute nicht der Sinn nach Unterhaltung stand und schon gar nicht mit diesem Sandkasten-Sherlock Holmes, reagierte sie mit dem allseits bekannten „LmaA!“
Das aber wollte Hugo bestimmt nicht tun, weil er damit wertvolle Zeit vertan hätte. Eiligst notierte er in sein Notizbüchlein, dass Emma Zunke dem Einfluss des Klassenfeindes verfallen sei, weil sie sich nicht zur aktuell-politischen Lage geäußert habe.
Hugo war höchst unzufrieden. Während er das war, befand sich jenseits der innerdeutschen Grenze ein Mensch in noch schlimmerer Gemütsverfassung. Hummel von Hummelshausen wetterte über den moralischen Verfall der Lebewesen im Lande Ulbrichts. Seine Gemahlin, die welke Bordsteinschwalbe von St. Pauli, besänftigte. Doch half das nicht, denn Freiherr-Hummel konzentrierte sich in seinem Zorn auf die Würdaer. Die nämlich hätten ihm den Stern vom Mercedes gebrochen. Weder er noch Genosse Franski wussten, dass dies das Werk des Fahrschullehrersohnes war. Der wollte dem Vater eine innige Freude bereiten. Nun aber freute sich der Sohn des Stasi-Oberst in Hola, der den Stern unter seine Presley-Poster im Kinderzimmer gehängt hatte.
Hugo Franski wusste, dass ihm die Würdaer längst auf die Schliche gekommen waren. Er musste umdenken, nicht ideologisch, sondern im Umgang mit den Menschen. So kam er auf eine ganz abgefeimte Idee. Warum sollte er nicht einmal so tun, als hätte er sich dem Gedankengut des Klassenfeindes aus aufkommender Überzeugung genähert. Dabei wollte er sich den Anstrich eines ehrsamen Bürgers geben, denn ehrsam war in Würda nur der, der aus Unzufriedenheit stets meckerte.
Als Stasi-Hugo wieder einmal im Konsum Schlange stand, begann er so aus dem Nichts heraus zu stänkern, halblaut natürlich, damit sein Ärger glaubhaft wirke. Er raunzte, dass es eine Schände sei, in einer Republik leben zu müssen, in der es keine Bananen zu kaufen gebe. Wie wohltuend wäre es doch, wenn man in einer Bananen-Republik leben könnte. Nachdem er sich so geäußert hatte, schaute er listig um sich, doch niemand im Geschäft nahm Anstoß an seiner staatsfeindlichen Hetze. Nicht einmal Anna Stunk, die Meckerziege, ließ sich zu einem Disput hinreißen. Dabei wäre es doch ein Leichtes gewesen, bei ihr den Stachel der Unzufriedenheit noch tiefer zu bohren, denn diese eingetrocknete Vettel hechelte gern und oft mit den Dorftratschen.
Hugo, dem es nicht gelungen war, Unmut in die Schlange anstehender Menschen zu bringen, wandte sich nun direkt an eine Frau, die vor ihm stand. Von der versprach er sich mit Sicherheit Hilfeleistung für die Staatssicherheit, aus erster Hand, brandaktuell und unverbraucht. Wenn er sich Olga Zinkenbrink recht jovial näherte, dann könnte aus ihr eine wichtige Informantin werden. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür besaß sie bereits.
Olga Zinkenbrink hielt sich dafür zuständig, im Dorf den neuesten Klatsch zu verbreiten oder, wenn solcher nicht im Umlauf war, ihn zu erfinden. Es bereitete ihr tiefste innere Befriedigung, wenn aufgrund irgendwelcher Faschmitteilungen die Dorfbewohner in Angst und Schrecken versetzt wurden. Einmal hatte sie das Gerücht in die Welt gesetzt, es gebe bald keine Scheuerlappen mehr. Flugs hatten die Weiber beide Geschäfte des Ortes entlappt. Die unersättliche Irmhild Vogelbeer lagerte in ihrer Besenkammer 120 Stück. Als sie ihrem Mann vom Vorrat an Scheuerlappen berichtete, meinte der trocken: „Du bist bescheuert!“
Franski rieb sich die Hände. Mit der Zinkenbrink wäre was anzufangen. Der würde niemand zutrauen, dass sie sich als informelle Mitarbeiterin betätigt. Wie sollte man auch jemandem, der viel blödes Zeug redet und dumm wie Bohnenstroh ist, für den Überbringer hochwichtiger und hochgeheimer Nachrichten halten. Olga Zinkenbrink war also das Muster an Unverfänglichkeit.
Schon ihr Äußeres machte sichtbar, dass sie eher als Schlampe denn als Geheimnisträgerin gelten konnte. Die Schürze, die sie stets umgebunden hatte, war wohl ehemals weiß gewesen. Das konnte aber nur vage Vermutung sein, denn dieses Bauchlinnen glänzte in unterschiedlichsten Farben. Wer genauer guckte, wusste um die speckige Colorierung. Olga schnäuzte nicht ins Taschentuch; sie besaß keins. Sie wusch ihre schmutzigen Hände nicht unter Wasser, sondern rubbelte sie trocken etwas heller.
Wer so schmutzige Pfoten hat, dachte sich Franski, wird nicht auffällig, wenn er sie noch mehr beschmiert. Er steigerte sich in das widerwärtige Empfinden, das Hässliche schön zu finden. Bei dieser absurden Betrachtung kam er schließlich in Olgas Gesicht an. Ihr Blick glich der einer hinterhältigen Hexe, die unentwegt nach Hänsel und Gretel Ausschau hält. Warum sollten diese falschen und gierigen Augen nicht auch Unbescholtene bis aufs Gewissenskostüm entkleiden, frohlockte Hugo. Dann verharrte seine Betrachtung an Olgas Nase, die in Überlänge aus dem Gesicht stieß. Weil diese sehr spitz endete, frotzelte man, dass die Zinkenbrink ihren Zinken bequem in jeden Quark stecken könne, um in diesem herumzurühren. Die Schulkinder waren noch frecher und behaupteten, dass sie beim Zeitungslesen bequem Löcher ins Papier bohren könnte, um durch diese die Leute zu beobachten. Alles in allem, so Franski abschließend, ein Weib, mit dem sich zwar nicht Staat, aber Staatssicherheit machen ließe.
Wie er nun im Vollbewusstsein seiner gewonnenen Erkenntnis der Zinkenbrink vertraulich auf den schmächtigen Hintern tätschelte, fuhr diese wie von der Tarantel gestochen herum und plärrte: „Franski, du hinterhältiger Lustmolch!“
Hugo flüchtete ins Freie und noch einige Meter weiter. Als er sich eine Verschnaufpause gönnte, stand es für ihn fest, dass Olga der Sicherheit des Staates nicht dienlich sein konnte. Damit war für ihn diese Kaderfrage gelöst.
Nach Nächten unruhigen Schlafes wachte er endlich mit einem Entschluss auf, der bahnbrechend für die Findung subversiver Elemente sein konnte. Die fixe Idee, ein Transparent an der Wand des Gemeindeamtes anzubringen und es vor aller Öffentlichkeit anzuspucken, verwarf er recht schnell. Auch diese Arglist hätte kaum Glaubhaftigkeit erregt, zumal auf dem knallroten Spruchband zu lesen gewesen wäre: Wie der Kapitalismus auch geifert und speit – wir bleiben zu großen Taten bereit!
Mit seinem neuen Plan wollte Franski den Menschen nicht entgegentreten, sondern ihnen entgegen kommen. Nach ausgiebiger Unterredung mit Bürgermeister Hampel und Parteisekretär Stoffel war entschieden, eine Kommunikationszentrale (KKZ) einzurichten. So wurde das auch am Schwarzen Brett bekannt gegeben, mit der Bitte an die Bevölkerung, von dieser lebhaften Gebrauch zu machen.
Diese Aufforderung war noch keinen Tag alt, da ging beim Bürgermeister ein anonymer Brief ein, in dem gedroht wurde, dass die Einrichtung eines Doppel-KZs in Würda zu folgenschweren diplomatischen Schritten führen werde. Mit Resten faschistischen Gedankenguts müsse nun auch in dem Drecksnest Würda Schluss gemacht werden.
Hampel, Stoffel und Franski gaben sich daraufhin sehr verstört und änderten die Namensgebung in Begegnungsstätte (BGS). Hugo war zufrieden, weil er glaubte, mit BGS ließe sich der Stasi gut und diskret dienen. Aber auch der Schuss ging in die Hose, weil nun die Kreisleitung der SED mit aller Entschiedenheit festlegte, dass die Eröffnung einer BGS nicht in Frage komme. Man wisse in Würda wohl nicht, dass BGS die Abkürzung für Bundesgrenzschutz sei. Der 2. Sekretär der Kreisleitung ereiferte sich, man solle künftig RIAS hören, damit man genau wisse, was im kapitalistischen Westdeutschland vor sich geht.
Franski war nun mehr als ratlos. Mit irgendeinem günstigen Entschluss musste er sich beeilen, weil die Holasche Stasi-Zentrale festgestellt hatte, dass Würda im Wettbewerbs-Plan Wer bringt die meisten Staatsfeinde? das Schlusslicht bildete. Das ärgerte Hugo maßlos, denn im Falle eines Wettbewerbssieges wäre ihm eine zweiwöchige Auszeichnungsreise zu einem Feriendorf im wunderschönen Sibirien sicher gewesen. Weil er, vom gesunden Ehrgeiz getrieben, wenigstens einen Mittelplatz im Wettbewerbsfeld erreichen wollte, kam ihm die Idee, bei Emmi Pospischil vorzusprechen.
Emmi Pospischil
Diese Frau, eine Dame von der Ferse bis zur Zehe, leitete die örtliche Poststelle. Zwei Dingen frönte Emmi täglich, einmal dem langwierigen Frisieren vor dem Spiegel und zum anderen dem unerlaubten Öffnen von Briefen. Dabei war sie schon einige Male ertappt worden, und zwar von ihrem Sohn Dronthardt. Der wusste um die krankhafte Sucht seiner Mutter, das Postgeheimnis zu verletzen. Weil ihm das missfiel, ermahnte er sie immer wieder, das sein zu lassen. Doch Süchtige sind nur schwer zu bekehren.