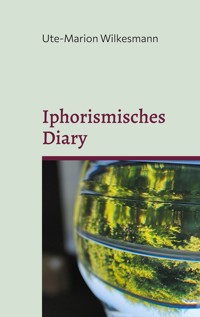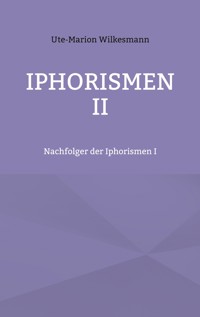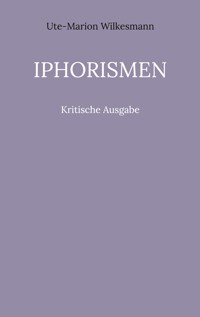Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn ich einen Krimi schreiben wollte, was müsste ich dann tun? - Im gewünschten Milieu recherchieren; - Charaktere erschaffen, überdenken und ausarbeiten; - einen Handlungsstrang konzipieren; - Figuren illustrieren und darauf achten, dass sie konsequent geführt werden (rote Haare müssen rot bleiben usw.); - Punkte beachten, die mir jetzt nicht einfallen; - anfangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
A wie Anfang
B wie Blut
C wie Caesar, Cedric oder Cornelius
D wie Dolch
E wie Ehemann
F wie Finanzen oder Friedhof
G wie Gericht, Gerichtsmedizin und Geld(gier)
H wie Herz
I wie Igel
J wie jäher Bruch
K wie Kalender, Kontaktlinsen und Kakao
L wie Lust, Lavendelduft und Luxusschlitten
M wie Mordlust
N wie das Nichts
O wie in Oh
P wie Psychologie oder modern: Profiler
Q wie Qualen, Quäker und Quasimodo
R wie Raub, Raubmord und Raben
S wie Spuren im Sand
T wie Tod, Totenschein und Testament
U wie Uhr und unheimlich
V wie Verdächtige und Verhöre
W wie Wasserleiche, Widerstand, Wissenschaft
X für ein U vormachen statt Xenophobie
Y wie Yakuza, Yacht oder Yucca-Palmen
Z wie Ziel und Zielgerade
Interview mit der Autorin
Publikationsliste
A wie Anfang
Wenn ich einen Krimi schreiben wollte, was müsste ich dann tun?
Im gewünschten Milieu recherchieren;
Charaktere erschaffen, überdenken und ausarbeiten;
einen Handlungsstrang konzipieren;
Figuren illustrieren und darauf achten, dass sie konsequent geführt werden (rote Haare müssen rot bleiben usw.);
Punkte beachten, die mir jetzt nicht einfallen;
anfangen.
Der Anfang ist das Tor zum Buch, hat mir mal ein Verleger gesagt. Es stimmt: Wenn die ersten Seiten mich nicht fesseln oder packen, lese ich gar nicht oder nur mit einem gewissen Widerstand weiter. Passt hingegen der Anfang, bin ich eher bereit, mich auf eine Geschichte einzulassen.
So ein Krimi bietet verschiedene Möglichkeiten des Einstiegs. Ich führe drei Beispiele auf:
1. Sofortiger Einstieg in den kriminellen Akt, eine Leiche oder ein schweres Verbrechen wird geschildert.
2. Beschreibung einer völlig harmlosen Szene, die durch das Wissen, dass es sich um ein Genre mit Spannung handelt, gerade aufgrund ihrer Harmlosigkeit unheimlich wirkt.
3. Einstieg durch das Aufeinandertreffen von Hauptakteuren, z. B. Beschreibung eines Detektivbüros/ des Kommissars im Büro usw.
So ein Anfang muss nicht sehr lang sein und kann, wenn die Umstände es erfordern, rasch in die Haupthandlung übergehen.
Variante (1)
Seine Augen waren weit geöffnet, als wollte er das Universum um die Beantwortung seiner dringlichen Fragen bitten. Sein rechtes Bein war merkwürdig verdreht, so wie es nicht von der Natur ins Gelenk eingehängt wurde. Sein halblanges Haar saß nass am Schädel, so als wäre er frisch aus der Dusche gekommen, einer Dusche aus Blut: seinem eigenen Blut. Wenn man sich über ihn beugte, konnte man die Einschussstelle erkennen. Über das hellgraue Hemd zog sich eine Blutspur von der Körpermitte zum rechten Arm, dort tropfte das Blut vom Körper auf den Asphalt. Der Ausgangspunkt des Blutflusses war ein Dolch, der in seinem Brustkorb steckte. Warum würdejemand einen anderen Menschen erschießen und zusätzlich erstechen? Ein Rätsel. Neben dem Körper gab es Fußspuren und Reifenspuren. Der Himmel war grau und schwer. Wenn nicht bald jemand die Leiche fände, würden die Spuren in Kürze durch einen heftigen Regenguss verwischt werden, es würden nur ein wenig Blut, der Dolch und die Schusswunde zurück bleiben. Es waren Schritte zu hören auf dem Asphalt, hohl und gleichzeitig schwer. Kamen oder gingen sie? War es nur ein Passant, der die nahegelegene Kreuzung überqueren wollte? Von der Kreuzung blinkte es gelb herüber. Die Stadtverwaltung stellte diese Ampel nachts auf Warnbetrieb. Es war zu teuer, um in dieser Kleinstadt die Ampelanlage am Ortsausgang rund um die Uhr eingeschaltet zu lassen. Nein, die Schritte kamen nicht näher, sie bewegten sich fort. Einsam war es hier, das nächste Haus lag noch hinter der Ampel, einige hundert Meter entfernt, wie das bei Ortsausgängen häufig so ist. Außerhalb der Reichweite eines Schreis, solange man vor dem Fernseher sitzt und nicht aufmerksam nach draußen lauscht. Wie lange schon lag der leblose Körper auf der Straße? Dies zu bestimmen würde die Aufgabe der Gerichtsmedizin sein, sobald ihnen der Mann zur Autopsie übergeben würde. Aber wann würde das sein? Im Morgengrauen würde man ihn spätestens finden, wenn der erste Berufsverkehr sich auf der kleinen Hauptstraße zur nächstgrößeren Ortschaft schlängelt. Der massige Körper lag halb auf dem Grasstreifen, halb auf dem Asphalt. Er war unübersehbar, dafür würde die Morgendämmerung reichen. Die ersten schweren Tropfen lösten sich aus den Wolken. Das Geräusch eines Motorrads war entfernt zu hören und ja – es schien in diese Richtung zu kommen. Wäre es noch früh genug, um wenigstens Spuren, wenn schon nicht ein Leben zu retten?
Variante (2)
Er seufzte. Sein Job als Postbote in ländlicher Gegend bot ihm zwar viel Freiheit, war aber auch recht lästig mit der ganzen Fahrerei. Manchmal wünschte er sich, in einer Stadt zu arbeiten: Da gehst du deine Strecke ab, und das war’s. So zockelte er mit dem Auto von einem Haus zum anderen, gelegentlich wurde er durch ein Schwätzchen oder eine Tasse Kaffee aufgehalten. Noch zwei Kilometer zum kleinen Anwesen von Familie Mustermann. Er fand es immer höchst amüsant, dass es wirklich Menschen gibt, die diesen Universalnamen tragen. Wie oft würden sie sich mit einem gequälten Lächeln Scherze darüber anhören müssen? Er wusste ziemlich genau, was seine Zielkunden – wie er sie nannte – an regelmäßiger Post bekamen. Es wurde immer weniger. Wann würde überhaupt keine Post mehr verteilt, alles per elektronischer Übermittlung weitergegeben? Er war noch zu keinem Schluss gekommen, ob er das positiv oder negativ einstufen sollte. Ganz ohne Zeitungen, Kataloge, Glückwunschkarten? Er schüttelte den Kopf, nein, so recht konnte er sich das nicht vorstellen. Aber hätten sich seine Eltern vorstellen können, dass man auch ohne Telefonzelle die Mutter nachts anrufen konnte „Ich habe die letzte Bahn verpasst, kannst du mich bitte abholen …?“
Noch etwa achthundert Meter. Heute hatte er für Frau Mustermann einen großen, prall gefüllten Umschlag dabei. Den Absender kannte er nicht. Nicht, dass er neugierig wäre, aber man schaut doch schon mal zufällig auf den Umschlag, tröstete er sich. Den Namen des Absenders oder der Absenderin hatte er nicht parat, er erinnerte sich jedoch später noch konkret, dass der Vorname abgekürzt war. So ein griffiger wattierter Umschlag. Er zog wattierte Umschläge diesen harten Kartons vor.
Noch wenige Meter. Und dann stand er vor dem Gartentörchen im Jägerzaun, der das Grundstück abgrenzte. Er sah sich um, irgendetwas war anders als sonst. Hatten die Vögel aufgehört zu zwitschern? Oder war es die Wäsche, die im Garten schlaff von der Leine hing, als hätte sie schon vor Stunden abgehängt werden sollen? Oder war es die Tür zum Gartenhäuschen, die lose in den Angeln hing und halb geöffnet war? Ungewöhnlich für die ordentliche Familie Mustermann. Er nahm den Umschlag, die beiden Zeitschriften und den Katalog aus der Tasche. Frau Mustermann bekam regelmäßig eine Strickzeitschrift, die jüngste Tochter so ein Teenie-Blättchen. Der Werkzeugkatalog war für Herrn Mustermann. Die Familie wohnte jetzt seit acht Monaten hier, Herrn Mustermann hatte er noch nie gesehen. Er erreichte die Tür, er klingelte, denn die Post passte nicht in den kleinen Briefkasten. Er wartete. Nichts, keine Schritte, kein lautes „Ich komme gleich!“. Als die Familie im Sommerurlaub gewesen war, hatte Frau Mustermann ihm vorher Bescheid gegeben. Aber vergangenen Samstag, als er das letzte Mal etwas auszuliefern hatte, hatte sie nichts davon gesagt. Er klingelte ein zweites Mal. Das Fenster oben links, so fiel ihm auf, stand offen. Also musste doch jemand im Haus sein? Er beschloss, einmal hinter das Gebäude zu gehen, vielleicht saß Frau Mustermann mit ihrem Strickzeug im Garten und hatte Kopfhörer in den Ohren.
Er schellte ein weiteres Mal, dann dreht er sich um und schritt links über den Kiesweg in Richtung Garten. Als er um die Ecke bog, gefror ihm das Blut in den Adern und er wünschte sich, er hätte diesen letzten Schritt nie getan.
Variante (3)
Er saß leicht gelangweilt an seinem Schreibtisch. Sollte er den Laptop aufklappen und den Bericht tippen, der schon gestern fällig gewesen war? Ja, eine blendende Idee, bitte kein Ärger mehr mit der neuen Chefin. Sie war gar nicht so übel, aber recht pedantisch, vor allem wenn es Termine betraf. Er seufzte. „Hoffentlich werde ich nach dreißig Jahren Betriebszugehörigkeit nicht mal so.“ Im Grunde arbeitete er gerne bei dieser Versicherung und hatte sich in seinen Job als ‚Versicherungsdetektiv‘ gründlich eingearbeitet. Es machte Spaß, es forderte die Kombinations gabe, aber es verstärkte leider allgemein das Misstrauen Mitmenschen gegenüber. Andererseits befreite es ihn vom Schreibtisch, den er nicht besonders mochte.
Es kam kein befreiender Anruf, die Chefin blieb in ihrem Büro, niemand klopfte an seine Tür. Er schielte in seine Kaffeetasse, die war halbvoll. Es gab also keinen Grund, das Büro zu verlassen und sich einen Kaffee zu holen. Der Kollege war seit zwei Wochen krank, also gab es rein gar nichts, was ihn ablenkte. Seufzend klappte er den Laptop auf und wartete, bis das Betriebssystem hochgelaufen war. Puh, das ging schnell. Er ordnete den Blätterstapel rechts vom Gerät und öffnete die Vorlage. Einmal drin im Schreiben, kam er gut vorwärts. So war er dann auch leicht verärgert, als es an die Tür klopfte. „Ja bitte?“, rief er etwas unwirscher, als es gemeint war.
Eine junge Frau steckte den Kopf durch die Tür, schaute ihn überrascht an, trat halb herein und sagte: „Entschuldigung, bin ich hier falsch? Wenn ich störe, tut mir leid!“
Er taxierte sie kurz, das gehört zum Beruf. Mittelgroß, mittelschlank, mittelhübsch. Das war die Schublade, in die er sie packen konnte. Wenig verblüffend: mittellange brünette Haare, etwas mehr als kinnlang. „Wo wollen Sie denn hin?“
Die Frau kam herein. „Zu einer Stelle, die sich mit Versicherungsbetrug beschäftigt. Ein Herr Dubczik soll dafür zuständig sein, der Name steht auch auf der Tür?“ Sie sah ihn fragend an.
„Ja, das bin ich, sorry, wenn ich etwas barsch war – ich war gerade in einen wichtigen Bericht vertieft.“ Die Frau war offensichtlich beeindruckt und er beglückwünschte sich, das Wort „wichtig“ in diese Erklärung eingebaut zu haben. Er lud sie mit einer Geste ein, sich auf den kleinen roten Sessel auf der anderen Seite des Schreibtischs zu setzen. Sie nickte kurz „Danke“, zog ihren beigen Mantel etwas hoch und setzte sich. Ihm fiel sofort auf, dass sie nicht die Beine übereinanderschlug, wie Frauen das meist machen. Sie kreuzte die Beine im männlichen Stil, wie sie das im Vor-Jeans-Zeitalter nie getan hätte. Jeans – keine besonders teure Marke, jedoch auch kein Sonderangebot. Das Sweatshirt, das er durch den halboffenen Mantel sehen konnte, hatte eine gute Qualität. Darauf prangte ein witziger Spruch, etwas Glitter, es war weder billig noch teuer. Den Mantel hatte sie vermutlich in einem besseren großen Laden gekauft, keine Boutique-Ware, aber auch kein Ramsch. Hatte er hier das Mittelmaß in Person vor sich sitzen?
„Was kann ich für Sie tun?“
Sie betrachtete ihr Gegenüber. Ein netter junger Mann, eventuell noch etwas zu jung für diesen Beruf? Sie taxierte ihn innerlich. Ein wenig Mittelmaß, so kam es ihr vor. Er würde ihr auf der Straße nicht auf fallen, weder positiv noch negativ. Er war ganz gut angezogen, aber sicherlich hatte er in diesen Anzug kein Monatsgehalt investiert. Sein Lächeln war allerdings sehr nett, sie lächelte und dachte „Das ist schon Obergrenze Mittelmaß“. Genug beobachtet, sie hatte nicht den ganzen Tag Zeit. Sie griff zu ihrem Lederrucksack, den sie bisher in der Hand gehalten hatte, und holte ein Papier heraus. „Schauen Sie selbst“, und schob es ihm über den Schreibtisch zu. Er schaute darauf, sah das Foto, las den kurzen Text und pfiff durch die Zähne. Er blickte hoch: „Das kann doch nicht sein!“
„Deswegen bin ich gekommen. Ich sollte mich vielleicht vorstellen, ich bin seine Großkusine!“
Das war aufregend. Man kennt diese Fotos, die beim Überfahren einer Kreuzung bei Rot oder zu schnellem Davonsausen gemacht wurden. Selten ist der Fahrer günstig getroffen, aber meist deutlich erkennbar. So auch hier. Das Foto war eindeutig, das Datum ebenso. Es begann, Spannung zu entstehen.
B wie Blut
Es gibt zweifelsohne spannende Krimis, die ohne Blut auskommen. Da ich selbst kein Blut sehen kann, bei Erzählungen davon schon ein mulmiges Gefühl bekomme und beim Fernsehen von Ärzteserien und entsprechenden Krimis Löcher in das nächstgelegene Regal starre, würde ich selbst nicht so gern über Blut lachen sprechen. Andererseits finde ich so ein bisschen von der roten Suppe schon wichtig, denn vieles lässt sich heute kriminaltechnisch aus Blut feststellen, Krankheiten, DNA-Spuren und was es da so alles gibt. Hier kommt der Punkt, an dem ich ordentlich recherchieren müsste. Und ehrlich: Das lockt mich nicht. Manchmal denke ich, dass ich deshalb niemals einen ‚vernünftigen‘ Thriller, Krimi oder eine andere Form von längerem Roman werde schreiben können, weil ich den Hintergrund nicht wirklich ausleuchte, sondern mich mit Informationen aus zweiter Hand begnüge. Diese Informationen habe ich aus anderen Krimis, dem Fernsehen oder allenfalls noch Wikipedia. Wissenschaftlich ist das nicht. Erzähltechnisch ist das ebenfalls keine Meisterleistung. Nichts ist doch peinlicher, als wenn man ein Berufsfeld falsch beschreibt, nicht einmal die Dienstränge bei der Polizei korrekt hinbekommt. Insoweit würde mir so ein Fantasyroman mehr liegen, da muss ich nur die Handlung und die Konsequenz beachten.
Es gibt verschiedene Beispiele dafür, warum Fernseh- bzw. Pressewissen und Realität auseinanderklaffen. Wer weiß es nicht, dass eine Lebensversicherung bei Selbstmord nicht zahlt und daher ein Selbstmord des todkranken Vaters zur Rettung der Familie seine Angehörigen tragischerweise dennoch verarmen lässt? Nur, dass dies leider nicht stimmt, ich weiß es aus dem persönlichen Umfeld. Mein Vater hat sich selbst das Leiden verkürzt, es wurde nicht als ‚normaler Tod‘ verschleiert. Dennoch bekam meine Mutter die Summe der Lebensversicherung voll ausgezahlt. Es gibt meist nur eine Sperrfrist von zwei Jahren – verständlich, denn wenn ich eine Versicherung mein Eigen nennen würde, hätte ich auch keine Lust auf Kunden, die auf einen Selbstmord spekulieren.
Zurück zum Blut. Ein wenig ist erlaubt, es darf an der passenden Stelle strömen oder eine Lache um den toten Körper bilden. Das gehört zur Atmosphäre. Aber ich muss als Autor nicht Stunden und Seiten mit der Beschreibung von Leichen und ihren Wunden verbringen. Ich mag zum Beispiel diese ganzen forensischen Untersuchungen mit ihren gruseligen Details nicht. Ich muss nicht sehen, wie eine Leiche nach der Autopsie wieder notdürftig zusammengenäht wird. Ich bin nur froh, dass in meiner Kindheit und Jugend im Fernsehen der Umgang mit Wunden und Blut wesentlich zurückhaltender war. Wenn ich mir das alles hätte anschauen müssen, was da heute so über den Bildschirm tropft, ich hätte ein schweres Trauma davongetragen.
Es würde also bluten in meinem Thriller, und zwar da, wo ich es für nötig halte, ohne dass es die Stimmung dominiert. Das Subtile ist heute nicht mehr gefragt, wer nicht eine oder zwei zerhackte Leichen detailliert beschreibt, wird nicht gerne gelesen. Dies ist ein weiterer Grund, warum mein Thriller, wenn ich ihn denn schriebe, zur Unverkäuflichkeit verdammt wäre. Vielleicht würde ihn, wenn die Idee genial sein sollte, ein Drehbuchautor aufgreifen und mit den nötigen Brutalitäten, Gewalttätigkeiten und ‚Blutergüssen‘ publikumsnah aufpäppeln. Es bleibt allein die Frage, wie hoch die Summe ist, damit ich das zu ertragen bereit bin. Wie bestechlich bin ich? Kurz in mich hineingehorcht: Solange ich mir das Machblutwerk dann später nicht anschauen muss, sollte ein Milliönchen reichen.
Bestechlichkeit beginnt ebenfalls mit B. Leider finde ich Bestechlichkeit eher langweilig, vielleicht, weil sie so lebensnah ist. Brutalität gehört zum B, aber auch das mag ich nicht, weder brachiale Brutalität noch verhaltene über die Psychomasche. So hat der Film Clockwork Orange mich jahrelang verfolgt. Das brauche ich nicht selbst zu fabrizieren.
Wenn schon Blut, ergibt sich die nächste Frage: Wie viele Leichen muss es geben? Reicht eine am Anfang für die ganze Geschichte? Oder ist es wie bei Inspektor Barnaby, bei dem immer eine Leiche auf die andere folgt? Mindestens zwei werden es dort, meist drei und gelegentlich vier, bis alle Verdächtigen tot sind. Das vereinfacht die Aufklärung. Beides hat seinen Reiz. ‚Nur‘ eine Leiche erfordert Handlungsnebenstränge, die den Leser wachhalten, das Geflecht der Geschichte muss dichter sein. Mehrere Leichen geben eine hilfreiche Sequenz vor und helfen dem Leser bei der Aufklärung, bevor der Autor sie auswalzt. Wenn ich einen Krimi lese, fange ich mit den ersten dreißig oder vierzig Seiten an und widme mich dann umgehend dem Ende. Sonst nimmt die unerträgliche Spannung mir das normale Lesetempo und ich überfliege den Text nur noch. Zu bedenken wäre daher, ob ich gleich das letzte Kapitel an den Beginn setze. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich solche drastisch neuen Pfade erst begehen werden, wenn ich das Erzählen von Kriminalgeschichten beherrsche.
Unabhängig von diesen Überlegungen bieten meine Beispielanfänge geeignete Aderlässe. Bei Anfang 1 ist es schon vorhanden, bei Anfang 2 erwarten wir alle, dass der Postbote beim Eintritt in den Garten jede Menge Blut sieht. Und im letzten, dem Versicherungsfall, liegt die Blutlache förmlich auf dem Schreibtisch, wenn dort von einem Toten gesprochen wird. Möglich ist auch folgendes Szenario: Der Versicherungstote liegt schon länger im Grab oder einem Kolumbarium, er wird womöglich exhumiert. Das funktioniert natürlich nur mit einem Grab, nicht dem humuslosen Kolumbarium. Schwirrt gar noch eine Blutprobe des Toten umher? Und wenn man die Geschichte gar nicht dahin bekommt, dass die erste Leiche Blut lässt, kommt eben eine zweite hinzu. Auf keinen Fall möchte ich unsere beiden Bis-Jetzt-Protagonisten dafür heranziehen. Sie sind mir schon zu sympathisch. Einmal böte sich die nette, aber Ach-so-genaue Chefin an. Zwar fällt mir momentan nicht ein, warum so eine Abteilungsleiterin blutig dran glauben muss. Gelegenheiten hierfür werden sicher auftauchen. Im Zweifelsfall wird die Mafia dafür herhalten, obwohl ich Krimis mit der Mafia weder lesen und außer „Dem Paten“ noch sehen mag.
C wie Caesar, Cedric oder Cornelius
Während ich in der Küche die Spülmaschine einräumte, überlegte ich, wie wohl der Krimi ein C aufnehmen könne. Über einen Namen? Da kam mir Caesar in den Sinn. Ja, eine der männlichen Hauptfiguren sollte diesen Namen tragen. Das gefällt mir, ohne dass ich einen Grund dafür nennen könnte. Wenn ich einmal gleich zum Versicherungsfall übergehe: An der Tür steht „Versicherungsfachmann C. Dubczik“. C wie Caesar, wie unser Freund gerne hinzufügt. Dritte Generation Deutschland, ursprünglich Slowakei. Dies gehört unter D wie Dubczik. Dubczik hieß übrigens in meinem Entwurf mit Nachnamen erst Dubiczek. Während ich über die Kombination mit Caesar nachdachte, gefiel mir das nicht, der Name hinterließ so ein Das-gibt’s-nicht-Gefühl. Also stieg ich um auf den handlicheren Dubczik. Eine nachträgliche Recherche im Internet bestätigte es: Dubiczek gibt es nicht, Dubczik recht häufig. Was einmal wieder zeigt, was unser Gehirn so alles aufnimmt, ohne dass wir es merken. Denn von irgendwo musste ich doch wissen, warum der eine Name mich überzeugt, der andere nicht, denn Kubiczek gibt es und ist mir auch bekannt (die Schauspielerin Ruth Maria). Und ich habe keinerlei Verbindungen zur Slowakei, weder in der Familie noch im Freundes- oder Bekanntenkreis.
Wenn ich es mir im ersten Fall (der Leiche) einfach machen möchte, heißt der Tote Cedric mit Vornamen. Das gefällt mir auch: ein Mann so um die fünfzig, massiver Körperbau, aber nicht dick, fülliges Haar, ein teurer Anzug, eine prall gefüllte Brieftasche (wenn sie noch am Tatort liegt). Cedric Cornelius könnte er heißen, was mir dann doch zu albern ist, auch wenn es diese Kombinationen gibt, nicht zuletzt in Walter Wilkesmann (auch ein Stabreim). Cedric Beier oder Beyer wiederum erscheint mir ein geeigneter Leichenname. Und ja, seine Brieftasche sollte am Tatort sein, sie liegt offen im Gras. Und hier fängt es schon an, dass ich zurückblättern muss: Lag der Tote wirklich im Gras oder war da nicht was mit Asphalt? Ich habe nachgeschaut: Die Leiche liegt halb auf der Straße, aber am Ortsausgang, die Brieftasche könnte also mit Glaubwürdigkeit durchaus im Gras liegen. Offen, durchsucht, etwas fehlt, seine Frau weiß erst gar nicht, was das sein könnte, als man sie befragt. Die Fotos der Kinder sind noch da, ihres auch – fehlt da nicht eine Visitenkarte? Es fällt ihr schwer, sich zu erinnern, während sie mit den Tränen kämpft. Oder war es die Karte zum Bankfach? Cedric Beyer ist seit sechsundzwanzig Jahren mit seiner Frau Kirstin verheiratet, sie haben drei Kinder. Da ist die Älteste, jetzt vierundzwanzig, mit dem schönen Namen Elaine. Das mittlere Kind, ein Sohn, ist vierzehn, da klafft eine kinderlose Lücke. Es wäre interessant zu erfahren, warum es solange bis zum zweiten Kind gedauert hat. Der Name Dragon (des Sohnes) ist ebenfalls ausgefallen. Was war der Grund für die Lücke? Karriere? Es klappte nicht wegen Stress, mangelnder Gesundheit? Da es nicht direkt etwas mit dem Fall zu tun hat, können wir das hier vernachlässigen. Das Nesthäkchen der Familie ist zwangsläufig verwöhnt, was zu ihrem Namen Naomi passt. Die Zehnjährige sitzt mit großen Augen neben ihrer Mutter, während diese die Lücken in der Brieftasche zu klären sucht. Naomi hat noch nicht begriffen, wie umfassend sich ihr Leben ändern wird. Der Cedric ist hier passend eingebettet.
Bleibt die Familie Mustermann. Dazu gefallen mir weder Cornelius noch Carlo. Der Postbote, der zu einem Schicksalsboten zu werden scheint, wäre für den Namen Carlo geeignet. Es ließe ihn aus der Masse der Postboten mit seinem klassischen Namen herausragen. Es würde auch bedeuten, dass er mehr sein müsste als nur der Entdecker einer blutgerinnungsfördernden Szene, das wäre sonst Verschwendung eines Namens. Der Übeltäter kann er nicht sein, dafür geht er zu unschuldig an den Schauplatz heran. Es bestünde die Möglichkeit, dass er sich als Hobby-Detektiv betätigt. Allerdings müsste dann am Ende ein Happy End stehen, vielleicht mit einer Caroline? Nein, das ist albern. Andererseits könnte auch Frau Mustermann geborene Hellerwiesen einen jüngeren Bruder haben, Cornelius Hellerwiesen. Er ist – wie könnte es anders sein? – das schwarze Schaf der Familie. Vor allem Familie Mustermann schaut auf Cornelius H. herab, weil er sein Studium nicht beendet hat, abgerutscht ist, sich aber am Ende bekrabbelt hat. Derzeit besitzt er ein großes Fitness-Studio, dessen Finanzierung der mustermannschen Seite suspekt ist. Er ist so eine Mischung aus Lebemann, Charmeur und Finanzjongleur, immer bester Laune, selten sieht man ihn ernsthaft. Bis auf die letzte Szene, in der er seiner Traumfrau seine Liebe gesteht. Wobei zu überlegen wäre, wie diese in die Geschichte passt, denn so eine Traumfrau fällt im Krimi nicht vom Himmel. Wollte man den Leserinnen der Geschichte einen Gefallen tun, so ist die Traumfrau eine eher unscheinbare Gestalt, die schon einige Jahre in Cornelius Hellerwiesens Umfeld vorhanden ist, die er aber nie wahrgenommen hat. Während sie nun gemeinsam vom Schicksal gerüttelt durch die Krimiwogen geschwappt werden, entdeckt Caesar, dass die junge Frau gar nicht so unscheinbar ist, wie er immer dachte. Ihr ganzes Gesicht wird bildschön, wenn sie lächelt, vor allem, wenn sie ihn anlächelt. Ein Traum aller unscheinbaren Frauen oder solcher, die es werden wollen.
D wie Dolch
Der Name Dubczik fiel. Dabei ist dies nur eine falsche Schreibweise für Dubczuk, womit unser Caesar zeit seines Lebens zu kämpfen hatte. Eigenartig ist, dass es am Tag des ‚C‘ viele Hinweise auf Dubczik gab, die überraschenderweise dann am Tag des ‚D‘ wie von Geisterhand gelenkt aus dem Internet verschwunden waren. Dennoch gebe ich Caesar Dubczik eine slowenische Herkunft, dritte Generation. Er hat eine ältere Schwester mit Namen Catharina, ein Name, der von den Eltern in alter Tradition ausgewählt wurde. Sie wird hier nur durchs Bild wirbeln, ohne echten Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Festzustellen ist eben nur, dass das Ehepaar Dubczik seinen Kindern Namen mit den gleichen Anfangsbuchstaben gegeben hat. Hätten sie geahnt, dass sie ein zweites Kind bekommen, hätten sie ihre Tochter vermutlich Mareike, Stefanie oder Vera genannt, weil die entsprechenden männlichen Vornamen leichter zu finden und zu merken sind: Mario oder Michael, Stefan oder Stanislaus und Viktor. Die Namensgebung lässt daher darauf schließen, dass nur ein Kind geplant war. Der ungeplante Caesar hat sein ganzes Leben lang damit gekämpft, dass er sich so überflüssig vorkam, auch wenn ihm seine Eltern stets versicherten, dass er zwar ungeplant, aber keinesfalls unerwünscht sei.
Zwischendurch hatte ich die, meiner Meinung nach: brillante Idee, die drei möglichen Anfänge in einer einzigen Geschichte miteinander zu verweben. Dass sie alle Stück eines Ganzen sind, das sich wie ein Mosaik fein zusammenfügt. Das hat nur einen Haken: Erstens war mir nicht klar, wie ich sie zusammenfügen sollte, und zweitens erschien mir das ein immenser Arbeitsaufwand. Das heißt, ich müsste die Geschichte vor dem Schreiben konsequent durchplanen. Das erfordert zu viel Denkarbeit für ungewissen Ausgang.
Weiterhin habe ich rückwärts etwas geändert, mir fiel nämlich in diesem Moment auf, dass Dolch so ein perfektes D-Wort ist. Also habe ich bei Anfang (1) nachgeschaut, da wurde nur ein Messer erwähnt. Wofür gibt es die Suchfunktion? Ihr werdet jetzt nur von einem Dolch lesen, das Messer ist förmlich den Tisch heruntergefallen.
Im Gegensatz zum Messer, das primär zum Schneiden ausgelegt ist, ist der Dolch als Stichwaffe konzipiert. Bei Dolchen ist der Schneidenwinkel 1,69- bis 2-mal so groß wie bei einem einschneidigen Messer derselben Klingenbreite und -dicke. Aus diesem Grund sind Dolche tendenziell stumpfer als Messer; dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Schneidenwinkel kein allein entscheidendes Kriterium für die Schärfe einer Klinge ist.1