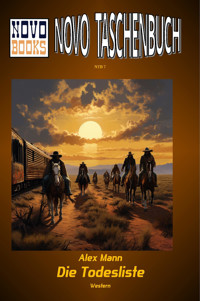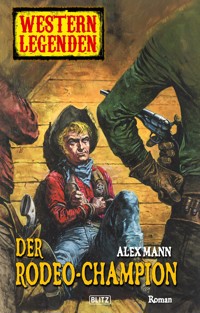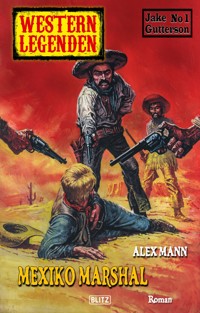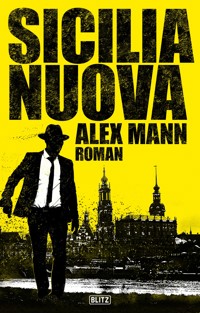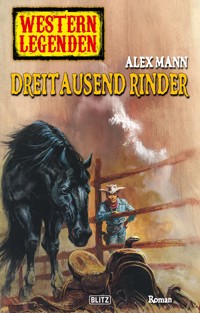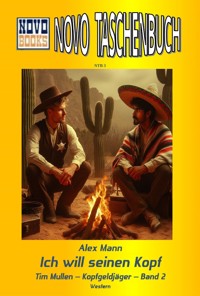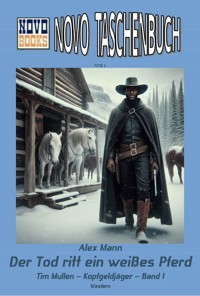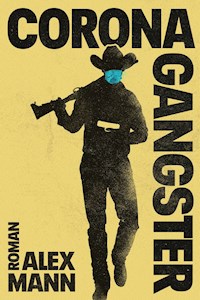3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lobo
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Pike Summer und seine Bande überfallen den Rancher Palmer und stehlen eine wertvolle Herde schwarzer Pferde, um sie an die Armee zu verkaufen. Als Lobo den sterbenden Rancher findet, kann dieser ihm noch den Namen seines Mörders nennen. Lobo folgt der Spur und deckt ein Netz aus Intrigen und Korruption auf. Wie immer ist ihm das Gesetz keine Hilfe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Ähnliche
LOBODer Einzelgänger
In dieser Reihe bisher erschienen
4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen
4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz
4203 Dietmar Kuegler Todesfährte
4204 Alfred Wallon Victorios Krieg
4205 Alex Mann Schwarze Pferde
Alex Mann
Schwarze Pferde
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-395-7Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Kapitel 1
Gibt es einen majestätischeren Anblick als schwarze Mustangs, die über das Land dahinpreschen? Die blauschwarzen Mähnen flattern im Wind, das glatte Fell glänzt in der Sonne, die vier Beine im perfekt koordinierten Zusammenspiel, wie sie den großen, kräftigen Körper vorantreiben. Das leichte Wippen des Kopfes, das Schnaufen, das aus der Anstrengung erwächst, das zufriedene Wiehern, wenn eines der Tiere seinen Lauf abbremst und sich selbst an seiner Freiheit und seiner Kraft zu berauschen scheint?
Ambrose Palmer saß auf der Veranda seiner Ranch und beobachtete, wie ein halbes Dutzend seiner schwarzen Mustangs über einen nahegelegenen Hügel jagten. Viele Jahre hatte er gebraucht, um seine Ranch aufzubauen, und sein ganzer Stolz waren seine schwarzen Mustangs. Die meisten Pferdebesitzer, die er kannte, liebten Schimmel, doch kein solches Tier konnte sich in der Reinheit seines Fells mit dem seiner schwarzen Mustangs messen, und auch hinsichtlich Kraft und Ausdauer würde es schwer sein, nur ein einzelnes Tier, geschweige denn eine ganze Herde zu finden, die seiner gleichkam. Seine Mustangs waren über die sanften Hügel des südlichen Texas galoppiert und hatten von Jahr zu Jahr an Stärke gewonnen.
Wehmütig seufzte Ambrose Palmer auf. Wehmütig, weil er selbst schon lange nicht mehr in der Lage war, ein solches Tier an seine Grenzen zu treiben. Er konnte zwar noch reiten, aber nicht mehr so gut wie in jungen Jahren, als er in General Jo Shelbys Iron Brigade gekämpft hatte. In irgendeinem kleinen Gefecht an einem unbedeutenden Ort, den er mit Macht aus seiner Erinnerung zu verdrängen suchte, hatten ihn zwei Kugeln im linken Bein getroffen. Eine hatte sein Knie zertrümmert, und letztendlich musste er Gott für ihren erstklassischen Chirurgen danken, der mit all seinem Können dafür gesorgt hatte, dass er das Bein behielt. Aber dafür war das Knie steif geblieben. Die andere hatte seinen Oberschenkelknochen durchschlagen, und derselbe geniale Chirurg hatte seltsamerweise nicht dafür sorgen können, dass dieser Bruch richtig ausheilte, sodass Ambrose Palmer stets Schmerzen hatte, wenn er beim Reiten etwas Schenkeldruck ausüben musste. Letztendlich konnte er ein Pferd im Trab gehen lassen, aber nicht mehr galoppieren, nicht mehr diese unbändige Kraft zwischen den Schenkeln spüren. Dabei war er vollkommen davon überzeugt, dass sich kein Pferd mit jenen schwarzen Mustangs würde messen können, die er in über fünfzehn Jahren seit Kriegsende auf seiner Ranch heranzüchtete.
Der Gedanke daran machte ihn von Zeit zu Zeit wehmütig, aber allein der Anblick seiner Tiere, die die mit dornigen Büschen übersäten Hügel hinauf galoppierten oder auf den saftigen Wiesen in den Tälern grasten, an den blauen Teichen, die diese Wiesen speisten, ihr Wasser soffen oder die wilde Unbekümmertheit, mit der die Fohlen mit den älteren Tieren spielten und mit der sie ihre noch nicht vollständig kontrollierte Kraft erprobten, trösteten ihn darüber hinweg.
Was ihn wirklich traurig machte, war, dass er einen Großteil seiner Herde bald verkaufen würde. Dafür hatte er sie jahrelang aufgebaut. Doch jetzt fiel ihm dieser Schritt schwer, vor allem, da er seine Pferde nur ungern an die Armee abtrat. Für die Kavallerie waren seine Mustangs eigentlich viel zu gut, aber die Armee war nun einmal der einzige Käufer, der ihm eine große Herde als Ganzes abkaufte, und obwohl er für jedes seiner Tiere einzeln einen viel höheren Preis hätte erzielen können, kannte sich Ambrose Palmer doch auch gut genug auf dem Markt aus, um zu wissen, dass sie ihm mehr zahlten als anderen Züchtern. Die Armee war daran interessiert, eine große Zahl möglichst gleichfarbiger Tiere für eine komplette Schwadron zu bekommen, und Ambrose Palmers Mustangs genossen im ganzen Land einen unvergleichlich guten Ruf. Viele Offiziere hatten sich bereits Pferde bei ihm gekauft, ebenso wie eine Reihe von Senatoren. Daher hatte der Rancher genügend Fürsprecher, die sich dafür einsetzten, dass die Armee etwas mehr Geld für den Ankauf seiner Pferde locker machte.
Ein groß gewachsener, hagerer Cowboy kam mit leicht wiegenden Schritten und klirrenden Sporen von einem der Corrals auf das Ranchgebäude zu. Er trug ein weites blaues Flanellhemd, das sich im sanften, warmen Sommerwind blähte, ein weißes Halstuch und Jeans, die fast vollständig von seinen abgewetzten braunen Lederchaps bedeckt wurden. Ein breitkrempiger, hochkroniger grauer Stetson schützte das braune Gesicht von der Sonne. Er kaute auf einem langen Grashalm herum, den er sich aus dem Mund zog und zu Boden warf, bevor er die drei Stufen zur Veranda erklomm, bevor er sich etwas linkisch mit der linken Hand an die Hutkrempe fasste und mit einem Kopfnicken einen leichten Gruß andeutete.
„Wir sind fertig, Mister Palmer, Sir. Alle für den Verkauf vorgesehenen Pferde sind markiert. Zwanzig haben wir im großen Corral, die anderen grasen wieder auf der Südweide, aber die können wir morgen rasch zusammentreiben.“
„Sehr gut. Danke, Will. Setz dich zu mir, oder nein …“, Ambrose Palmer sah auf das leere Tischen neben sich, auf dem nur seine Kaffeetasse und eine kleine Porzellankanne standen, „geh doch rein und hol meine Zigarren. Sie stehen auf dem Schreibtisch. Willst du einen Kaffee? Dann bring dir eine Tasse mit, einverstanden?“
„Jawohl, Sir“, sagte Will, tippte sich wieder an den Hut und ging durch die offenstehende Tür ins Innere des Hauses, nur um kurz darauf mit einem Holzkistchen unter dem Arm wieder nach draußen zu treten. Er reichte die Kiste an Ambrose Palmer, der jedoch abwehrend die Hand hob. „Nimm du dir erst eine. Willst du keinen Kaffee? Möchtest du einen Drink?“
Der Cowboy schüttelte mit dem Kopf, öffnete die Kiste, nahm sich eine Zigarre heraus und reichte sie dann an Ambrose Palmer, der sich ebenfalls eine herausnahm. „Hast du Feuer, Will?“
Der Cowboy griff in die weite Brusttasche seines Hemdes, holte eine kleine Messingbox hervor und ließ ein Streichholz in seine Hand gleiten, dass er auf dem von der Sonne ausgedörrten Holz des Verandageländers entzündete, bevor er es seinem Boss reichte.
Als Palmer seine Zigarre entzündet hatte, war das Streichholz niedergebrannt. Will ließ es fallen, holte ein neues hervor und zündete auch seine Zigarre an, ehe er an dem Tisch vorbeischritt und sich langsam in den bereitstehenden leeren Stuhl gleiten ließ.
„Das war gute Arbeit“, sagte Ambrose Palmer und ließ den Blick über sein Land streifen. Die Mustangherde war hinter der Kuppe des fernen Hügels verschwunden, aber in dem großen Corral, der genau zwischen dem Ranchhaus und einem großen Stallgebäude lag, tummelten sich zwanzig erstklassige Tiere mit einem frischen P-Brandzeichen auf der linken Flanke. Sie suchten den Schatten einiger Bäume, die ihre grünen Äste über den Corral streckten und deren frisches Grün im sanften Wind rauschte.
„Vielen Dank, Mister Palmer“, sagte Will Childs, der vom Anblick der Ranch beinahe ebenso fasziniert war wie sein Boss.
„Wie lange arbeitest du jetzt schon für mich, Will?“
„Seit 69, Mister Palmer, Sir.“
„Und in dieser Zeit hatte ich nie Ärger.“
„Sie bezahlen uns gut, und sie behandeln uns fair, Mister Palmer, Sir. Grund genug, sich zusammenzureißen. Gibt nicht viele Rancher im Süden, die einen schwarzen Mann so behandeln wie sie.“
„Wie behandle ich euch denn?“
„Wie Cowboys. Die Weißen, wie die Schwarzen. Gleich nach dem Krieg hab‘ ich für ‘nen Mann gearbeitet, für den war ich immer noch nichts anderes als ein Baumwollpflücker.“
Ambrose Palmer nickte langsam und sog an seiner Zigarre. Dann musterte er seinen Cowboy. Tatsächlich war Will Palmer schwarz wie die meisten, wenn auch nicht alle seiner Cowboys. Allerdings war seine Haut nicht von dem gleichen tiefen Schwarz wie das seiner anderen Arbeiter. Es war von einem milchigen Braun, weswegen sich Ambrose Palmer für einen Moment fragte, ob irgendeiner seiner Vorfahren nicht doch ein Weißer gewesen sein könnte. Es war eine dieser Fragen, die einen interessierten, ohne dass sie relevant waren, weswegen sie nicht gestellt wurden.
Stattdessen stieß Ambrose Palmer blauen Rauch aus und sagte: „Weißt du, vor dem Krieg habe ich selber mal einen Sklaven besessen. Ich hatte eine kleine Farm im Osten von Texas und hab‘ versucht, Baumwolle anzubauen. Hat sich aber nicht gelohnt. Der Krieg hat mich gezwungen, den Schlussstrich zu ziehen, der notwendig war.“
„Verstehe“, sagte der Cowboy und versuchte, möglichst unbeteiligt zu klingen, was Ambrose Palmer ein leichtes Schmunzeln entlockte.
„Ich hab‘ mich seitdem manchmal gefragt, ob ich seit dem Krieg anders über die Schwarzen denke. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Vielleicht hat‘s nie eine Rolle gespielt. Jack, so hieß mein Sklave damals, hat mit mir in derselben schäbigen Hütte gewohnt, am selben Tisch gesessen und aus derselben Flasche billigen Fusel getrunken. Er gehörte mir, und ich hätte mit ihm machen können, was ich will. Für mich hat das nie eine Rolle gespielt. Aber für ihn schon, denn als der Krieg ausbrach, ist er abgehauen. Ich hab‘ das lange nicht begreifen wollen, denn ich war überzeugt, dass es ihm bei mir gut ging, dass wir beinahe so was wie Kameraden waren und dass Besitzverhältnisse keine Rolle spielen. Aber aus seiner Sicht war das wohl anders. Das tut mir bis heute sehr leid.“
„Haben Sie ihn so behandelt wie uns?“, fragte Will und reckte sich in seinem Stuhl.
Ambrose Palmer seufzte und kniff leicht die Augen zusammen, als er sich eine Antwort zurechtlegte. „Darüber habe ich öfters nachgedacht, und wenn ich irgendwann vor meinem Schöpfer stehe, wüsste ich nicht, was ich sagen sollte.“
Für einen Moment schwiegen beide Männer. Dann fragte Will Childs unsicher: „Warum erzählen Sie mir das?“
Ambrose Palmer wog den Kopf hin und her. „Du hast so gut von mir gesprochen. Da dachte ich, du solltest das wissen.“
„Wie ich schon sagte, Mister Palmer, Sir. Sie haben mich und die Jungs immer fair behandelt. Wenn Sie sagen, Sie haben diesen Jack auch fair behandelt, spielt‘s wohl kaum eine Rolle, denk ich.“
„Danke“, sagte Palmer, nickte zufrieden und klopfte den ersten Aschering von seiner Zigarre ab. „Das beruhigt mich ein wenig. Denn eigentlich wollte ich fragen, ob du mein Vormann werden willst?“
Die runden Augen von Will Childs weiteten sich überrascht. „Vormann? Ich?“
„Wer denn sonst? Du hast den Job gemacht, seit Pike gegangen ist. Wenn wir das Geschäft abgeschlossen haben, würde ich gerne für ein paar Monate zu meiner Tochter gehen. Ich vermisse sie sehr. Aber dann brauche ich jemanden, der hier alles am Laufen hält. Jemandem, dem ich vertrauen kann. Ich kann‘s mir nicht leisten, jetzt jemand Neues dafür anzuheuern. Er mag noch so gut sein. Aber Vertrauen erwirbt man sich nur mit Zeit. Du arbeitet seit über zehn Jahren für mich, bist mein bester Cowboy, und wie ich in den letzten Wochen sehen konnte, hast du auch die Leute gut im Griff.“
Will Childs räusperte sich verlegen und fuhr sich mit der Hand unter der Nase lang. „Ich würde es schon gern machen, Mister Palmer, Sir, und Ihr Angebot ist auch eine große Ehre. Trotzdem weiß ich nicht, ob das so ne gute Idee ist.“
„Warum sollte es keine gute Idee sein?“
„Ein Vormann hier auf der Ranch zu sein, ist das eine. Was anderes ist es, in der Stadt als Ihre rechte Hand aufzutreten. Der Marshall hasst Nigger, Mexikaner und Indianer, der Bürgermeister denkt nicht viel anders. Da hätte ich es schon schwer, wenn Sie hier wären. Aber wenn Sie gehen … nie würden diese Männer einen Schwarzen als Boss der Palmer-Ranch akzeptieren.“
„Ich verstehe deine Bedenken. Ich werde mit dem Bürgermeister reden und ihm noch einmal klarmachen, wer dafür sorgt, dass ein gut ausgebildeter Lehrer an unserer Schule arbeitet, wer dem Doktor monatlich Geld überweist, damit er nicht in eine größere Stadt zieht, wo es mehr Arbeit gibt. Ich werde ihnen begreiflich machen, dass man es sich mit solchen Männern nicht verscherzen sollte.“
Will Childs Blick senkte sich betrübt auf seine Schuhspitzen. „Ich danke Ihnen wirklich, Mister Childs, aber es ist einfach keine gute Idee.“
„Ich werde das schon richten, Will.“
„Ja, das ist es eben. Sie werden es richten. Der Vormann dieser Ranch sollte die Dinge aber selbst klären können und sich nicht hinter Ihrem Rücken verstecken müssen.“
Die Blicke der beiden Männer kreuzten sich, und Ambrose Palmer erkannte den Zorn in den Augen seines Cowboys. Zorn darüber, dass er, was immer er auch tun würde, wieviel Vertrauen ihm sein Patron auch schenken würde, von der Masse der weißen Gesellschaft nie als gleichwertig angesehen werden würde.
Der Rancher wog den Kopf hin und her, suchte nach einer überzeugenden Antwort, während Will Childs wütend an seiner Zigarre zog und den Blick starr zum Corral richtete, als er plötzlich das leise, aber schnell lauter werdende Donnern von Pferdehufen vernahm. Ambrose Palmer beugte sich ein wenig in seinem Stuhl nach vorn, und kurz darauf sah er eine Kavalkade von einem halben Dutzend Reitern, die, eine im Wind verwehende helle Staubwolke hinter sich herziehend, durch das Ranchtor zogen und direkt auf das Haupthaus zugeritten kamen. Ambrose Palmer kannte den Mann an der Spitze, der eine schwarze Weste über seinem grünen Hemd trug und der den ebenfalls schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen hatte. Es war Pike Summer, der für drei Jahre bei ihm als Vormann gearbeitet, ihn aber im Frühjahr verlassen hatte, um eine eigene Ranch aufzubauen. Ambrose Palmer hatte ihn gemocht. Pike war ein gut gelaunter, hervorragender Cowboy, der seine Arbeit stets zu seiner vollen Zufriedenheit getan hatte. Er hatte ihn daher nur ungern gehen lassen, auch, weil er davon überzeugt war, dass Pike Summer noch nicht bereit war, um es selbst zum Rancher zu bringen. Zumindest nicht auf die Art, in der er die Dinge angehen wollte.
Der Trupp Reiter verhielt genau vor der Veranda. Pike Summer legte grüßend die Hand an den Hut. Er war groß gewachsen, hatte breite Schultern, blonde Haare, blaue Augen und einen kurzen Schnurrbart. Ein gutaussehender Mann von Anfang dreißig, der keine Probleme damit haben sollte, eine Frau zu finden, wenn er denn eine haben wollte.
„Guten Morgen, Mister Palmer“, sagte Pike Summer.
Der Rancher erwiderte den Gruß und musterte die anderen fünf Reiter. Es waren allesamt junge Weiße in Cowboykleidung, mit Chaps und umgeschnallten Coltgürteln, in deren Schlaufen die Messing- und Kupferhülsen der Patronen blinkten. Auch Pike Summer trug einen Colt quer vor den Bauch geschnallt.
Aber Ambrose Palmer entdeckte noch zwei ihm bekannte Gesichter unter den Männern und nickte ihnen bedächtig zu. „Clint. Burt. Ihr arbeitet jetzt für Pike?“
„Ja Mister Summer, Sir“, sagte einer der beiden Cowboys, der sich mit beiden Armen auf seinem Sattelhorn abstützt. „Pike war immer ‘n guter Boss und ‘n guter Kumpel, und er setzt uns keine Nigger vor.“
Aus den Augenwinkeln sah Ambrose Palmer, wie sich Will Childs Hände bei diesen Worten in der Lehne seines Stuhls festkrallten. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn sein neuer Vormann in diesem Moment auch eine Waffe an der Hüfte gehabt hätte.
Lag es daran, oder war es die ein Leben lang antrainierte Selbstbeherrschung des Schwarzen gegenüber den Beleidigungen eines Weißen, die dafür sorgten, dass er dennoch still sitzen blieb?
Ambrose Palmer schaute zu Pike Summer auf. „Du bist mir immer willkommen, Pike. Aber wenn du oder deine Männer meinen Vormann oder einen meiner Cowboys beleidigen, provozieren oder es sonst an dem Respekt missen lassen, der jedem ehrlichen Menschen zusteht, muss ich dich auffordern, meinen Grund und Boden zu verlassen.“
„Tut mir leid, Mister Palmer, Sir“, sagte Pike Summer und warf dann einen freundlichen Blick auf Will Childs. „Meinen Glückwunsch, Will. Bist ‘n guter Mann. Hast es verdient.“
„Kann ich was für dich tun, Pike? Wie laufen die Geschäfte?“, fragte Ambrose Palmer, um das Gespräch so rasch wie möglich in neue Bahnen zu lenken.
Der Cowboy seufzte schwer, richtete sich in seinem Sattel auf und ließ einen sehnsuchtsvollen Blick über das Ranchgelände schweifen, auf dem er drei Jahre lang gearbeitet hatte.
„Leider nicht so gut, Mister Palmer. Mein Zuchtbulle hatte die Seuche gehabt. Ist eingegangen. Aber erst, nachdem er fast alle meine Kühe angesteckt hat.“
„Ich hab dir gesagt, dass ich das Vieh nicht kaufen würde“, sagte Ambrose Palmer und wies mit der rechten Hand, zwischen deren Fingern die Zigarre steckte, auf Pike Summer. „Ein glänzendes Fell und starke Muskeln konnten mich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Preis viel zu niedrig war. Ich wusste, dass das Vieh was haben musste.“
„Ja, Sie haben es von Anfang an gesagt. Aber ich konnte mir keinen teureren Bullen leisten.“
„Wer keine Tiere fangen will, muss welche kaufen. Fürs Kaufen braucht man Geld, und davon hattest du nicht viel. Verstehst du mich jetzt, Pike? Es ist nicht so, dass ich dir deine eigene Ranch nicht gegönnt habe. Aber du wolltest unbedingt ins Viehgeschäft, weil es dir einfacher vorkam als eine Pferdezucht, doch dafür fehlte dir das Geld. Ich hab‘s dir von Anfang an gesagt. Du hattest doch kein schlechtes Leben bei mir. Noch drei, vier Jahre, dann hättest du was Vernünftiges aufbauen können.“
„In drei, vier Jahren kann sich ein Cowboy aber auch mächtig die Knochen ramponieren, Mister Palmer.“
„Und du hast gedacht, dass ich dich dann hängen lasse? Hast anscheinend eine ziemlich schlechte Meinung von mir, Pike. Und was jetzt? Möchtest du zurückkommen? Dann muss ich dich enttäuschen. So ungern ich dich damals habe gehen lassen, aber jetzt kann ich dich nicht mehr zurücknehmen. Ich verkaufe einen Teil der Herde und werde für eine Weile nicht mehr so viele Cowboys brauchen.“
Pike Summer seufzte schwer, sah sich noch einmal auf dem Ranchgelände um und verschränkte dann beide Hände auf seinem Sattelhorn. „Vielen Dank, Mister Palmer. Aber ich hab Gottseidank ‚ne neue Geschäftsidee. Hab` ich vor ein paar Tagen eingefädelt und soll mir helfen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“
„Und dafür brauchst du meine Hilfe? Brauchst du Geld? Oder weswegen kommst du hierher?“
„Ich brauch ihr Geld nicht, Mister Palmer. Ich hab ‘nen Vertrag mit der Armee geschlossen. Ich soll hundert Pferde nach Fort Davis bringen. Für zehntausend Dollar.“
Ambrose Palmer kniff die Augen zusammen und fixierte seinen ehemaligen Vormann. „Wie soll das gehen? Ich soll eine Schwadron in Fort Bliss mit neuen Pferden beliefern, allerdings für 13.000 Dollar. Willst du damit sagen, du willst mir meinen Vertrag wegnehmen? Aber wie willst du an hundert Pferde kommen.“
Pike Summers Gesicht entspannte sich. Er richtete sich in seinem Sattel auf. „Naja, meinem Kontaktmann bei der Armee sagte ich, ich könnte ihm erstklassige Pferde aus Mexiko beschaffen.“
Ein Schauer fuhr Ambrose Palmer über den Rücken. Denn er wusste sofort, dass Pike Summer die Pferde nicht aus Mexiko beschaffen würde.
„Tut mir wirklich leid, Mister Palmer, Sir“, sagte Pike Summer, zog seinen Revolver, legte auf seinen entsetzten ehemaligen Boss an und drückte ab. Das laute tiefe Dröhnen des Schusses zerriss die friedliche Ruhe des Sommertages. Die Kugel bohrte sich in Ambrose Palmers Bauch, drückte ihn in seinen Stuhl, der nach hinten kippte, bis die Lehne gegen die Rückwand des Hauses stieß. Der Stuhl kippte wieder nach vorn, und mit einem überraschten Blick sackte Ambrose Palmer in sich zusammen.
Will Childs sprang entsetzt auf seine Beine und griff instinktiv an seine Hüfte, an der er in der Regel einen Revolver trug. Doch heute war ein ganz normaler Arbeitstag. Niemand rechnete damit, dass er eine Waffe brauchen würde. So bot Will Childs jetzt nur ein einladendes Ziel für die fünf Männer von Pike Summer, die auf das Signal ihres Bosses hin zu den Waffen griffen und auf den schwarzen Cowboy feuerten.
Ambrose Palmer drehte den Kopf leicht zur Seite, sah den Körper seines Vormanns unter dem Einschlag der Kugeln zappeln und zittern, sah die Blutfontänen herausspritzen und wie Will Childs schließlich über das Geländer der Veranda geschleudert wurde und in die, jenseits davon angepflanzten, Rosenbüsche stürzte.
Er nahm noch alles wahr. Das Krachen der Revolver, das schrille Lachen der Cowboys, das entfernte Wiehern seiner Pferde, doch es war, als würde sein noch wacher Geist bereits neben seinem leblos wirkenden Körper sitzen und alles unbeteiligt mit ansehen. Die Männer ritten zu den Corrals hinüber. Wieder krachten die Revolver. Ambrose Palmer hörte das Lachen der Banditen und die Schreie seiner Cowboys. Er sah, wie einer zu einer am Corralgatter bereitstehenden Winchester griff, den Repetierhebel durchdrückte, sich umdrehte und einen Schuss abfeuerte, im selben Moment, als ihm selbst drei Kugeln die Brust aufrissen und gegen den Lattenzaun schleuderten. Sein Schuss schien einem der Banditen in die Schulter gefahren zu sein, denn Ambrose Palmer sah, wie der Mann mit der Hand danach griff, sah, wie sich die Lippen bewegten, als sie vermutlich einen Schwall unsäglicher Flüche ausstießen und wie der Mann schließlich wütend mit der linken Hand seinen Revolver auf den bereits am Boden liegenden Cowboy anlegte und seine letzten drei Kugeln in den Mann feuerte.
Einer seiner schwarzen Cowboys, der ebenfalls unbewaffnet war, versuchte, zum Bunkhouse zu rennen. Ob er sich verstecken oder seinen Revolver holen wollte, konnte Ambrose Palmer nur erahnen, doch er sah, wie einer der Banditen ihn verfolgte, das Lasso hoch über dem Kopf schwingend. Er sah, wie die Schlinge auf seinen Cowboy zuschoss, sich um seinen Hals legte und wie der Reiter sein Pferd hart herumriss und ihm die Sporen gab. Sein Cowboy wurde über den Boden geschliffen. Seine Beine strampelten wild, seine Hände versuchten, die Schlinge zu lockern, doch nach wenigen Augenblicken war er nur noch ein lebloses Bündel, welches über den Boden geschleift wurde.
Seine Wahrnehmung wurde schwächer. Die Stimmen kamen wie aus weiter Ferne, das Lachen der Banditen verschwamm zu einem Rauschen. Er sah noch, wie Pike Summer einige Befehle brüllte, hörte es aber nicht mehr. Die Banditen trieben die Pferde aus dem Corral zusammen und ritten dann den Weg zum Ranchtor zurück, als wäre nichts geschehen.
Ambrose Palmer sah seinen stolzen, schönen schwarzen Mustangs hinterher, und das letzte, was er spürte, war die feuchte Wärme einer einzelnen Träne, die seine Wange hinunterlief. Den schuldbewussten Blick, den Pike Summer ihm zuwarf, als er an der Veranda vorüberritt, sah er nicht mehr.
*
Er hätte so in seinem Stuhl sitzen bleiben und sterben können, mit der Erinnerung an seine schwarzen Pferde. Doch dann riss ihn der scharfe Klang klirrender Sporen aus der Todesdämmerung. Ambrose Palmer öffnete die Augen und spürte sofort das höllische Brennen in seinem Bauch, fühlte das warme Blut, dass sein Hemd und seine Hose durchnässt hatte. Das Sporenklirren kam näher, mischte sich mit dem sanften Rauschen des Windes.
Sein Blick schärfte sich, und aus der verschwommenen Masse bunter Farben löste sich die Silhouette eines Mannes, die langsam an Konturen gewann. Er trug einen Poncho, den er ein wenig zurückgeschlagen hatte, sodass die rechte Hand, seine Schusshand, hervorlugte, die nahe an einem abgewetzten Revolverholster baumelte. Der Mann hatte einen dunklen, kupfernen Teint, war er ein Halbblut? Tiefe Furchen durchzogen sein Gesicht, und ein schmaler schwarzer Oberlippenbart hing müde über die Mundwinkel herab. Zwei tief in den Höhlen liegende blaue Augen musterten ihn. Der Mann entzündete ein Streichholz an einem der Stützbalken für das Verandavordach und hielt es an ein Zigarillo.
Kapitel 2
Irgendwo im fernen Südwesten von Texas zog ein einsamer Reiter auf einem Morgan-Hengst durch die karge Berglandschaft. Der warme Wind fegte über das Land, riss immer wieder vereinzelte helle Staubwolken zwischen den trockenen Büschen hervor und trieb sie in kleinen Wirbeln dem blauen Himmel entgegen, von dem die Sonne gnadenlos herunterbrannte. Zum Schutz vor diesen Staubwirbeln hielt der Reite seiner Arme unter einem weiten Poncho vergraben. Sein ausgeblichenes Halstuch bedeckte Mund und Nase, und der tief in die Stirn gezogene Hut schützte die Augen vor der Sonne. Der Wind säuselte in seinen Ohren und bildete zusammen mit dem gleichmäßigen Klopfen der gemütlich vor sich hin trabenden Pferdehufe eine eintönige musikalische Untermalung, gelegentlich durchbrochen vom fernen Schrei eines Adlers, der am Himmel seine Kreise zog oder eines müden Kojoten, der wie der Reiter durch die Wüste wanderte.