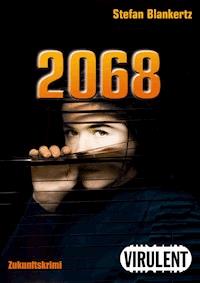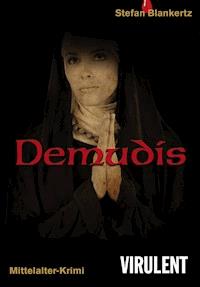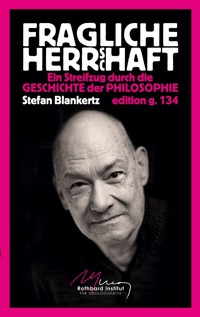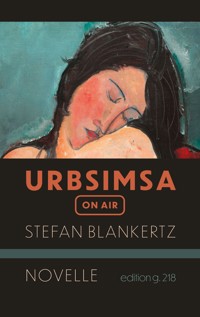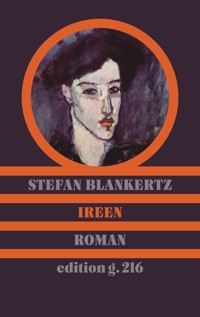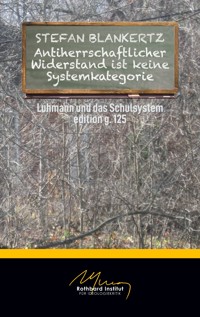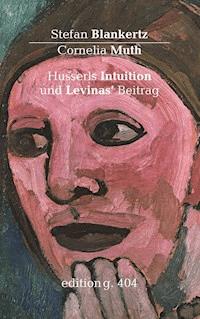Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ratten mit Biowaffen, ein nach Macht strebender Computer, eine Roboterarmee, die das Ausschalten von Elektrogeräten verhindert. Kein Zweifel: Köln steckt in Schwierigkeiten. Überlegen Sie das nächste Mal, bevor Sie Ihren Computer ausschalten! Attila, der grausame Hunnenfürst, greift wieder nach der Macht in Köln – in Gestalt eines zu Bewusstsein gekommenen Computers. Aber nicht nur das: Eine neue Pest, die durch Ratten übertragen wird, versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Die Ratten scheinen einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegen die Menschen zu führen. Kann die heilige Ursula in der Gestalt einer Ratte die Stadt vor beiden Gefahren beschützen? In seinem Urban-Fantasy-Roman verknüpft Stefan Blankertz augenzwinkernd alte Mythen vom ewigen Kampf zwischen Gut und Böse mit den Absurditäten des heutigen Medienzeitalters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Um Moral zu machen, muss man den unbedingten Willen zum Gegenteil haben.«
Friedrich Nietzsche
Inhalt
Das Miriamsfest
AUF BEWÄHRUNG
DER COMPI
SCHNELLE PEST
DIE RATTE
DER EX
FAMILIENGLÜCK
VERGEGNUNG
HEILUNG 1
NACHRICHTEN
HEILUNG 2
FRÜHSTÜCK
ROTTEN
IM KRANKENHAUS
RATTENERWACHEN
DAS ÄLTESTE MIRIAMSLIED
Das Miriamsfest
An jedem 12. November um 17:15 Uhr wird das Miriamsfest begangen. Es ist der höchste Feiertag der Ratten. Dieses Jahr darf das Miriamsfest im Dom der Menschen stattfinden. Das hat der Kölner Erzbischof gestattet, der nun auch schon greise zweite Nachfolger seiner Eminenz Lufred Kardinal von Traums. Alle, die die blutigen Kriege zwischen Menschen und Ratten noch selbst miterlebt haben, sind überwältigt von dem friedlichen Eindruck, den das Miriamsfest heute macht.
Kerzen und andere Lichtquellen sind gelöscht. Bis auf eine restliche Dämmerung, die wie heiliges Dreckwasser durch die bunten Glasfenster sickert, ist es dunkel. Das Hauptportal bleibt verschlossen, damit sich keine Menschen in den Dom verirren. Ihre zarten, schutzbedürftigen Seelen könnten Schaden nehmen, sollten sie unvorbereitet Zeugen des für sie eventuell befremdlich wirkenden Rituals werden. Die Ratten finden ihren Weg, irgendwie.
Einen geheimen Zugang durch eine Seitentür gibt es für die Gruppe der Metten, eine Kreuzung aus Ratten und Menschen. Die Zahl dieser Wesen, die übergroße Rattenköpfe auf Menschenleibern tragen, wächst trotz aller vergangenen Anfeindungen und Verfolgungen steil an. Die Metten sind allesamt Kinder, Kindeskinder und Kindeskindeskinder von Kordula.
Zehntausende Ratten strömen zusammen. Keine will sich das Miriamsfest entgehen lassen. Die Ratten wimmeln durcheinander, denn nach wie vor sind sie jeder Ordnung abgeneigt. Im für Menschenohren unhörbaren Ultraschallbereich quieken sie herum, als könnten sie nicht normal und ordentlich sprechen – »normal und ordentlich« sind weiterhin Worte, die sich auf den menschlichen Maßstab beziehen.
Ruhiger geht es bei den Metten zu, die links neben dem Altar Stellung bezogen haben. Hinter diesen rattenköpfigen Mischlingen befindet sich ein Bereich, der mit Laken aus weißem Leinen abgehängt ist.
In Reih und Glied dagegen marschieren die letzten überlebenden Rotten auf, Roboter mit Rattengehirnen. Die Produktion von Ratten-Maschinen-Hybriden in den Kölner Ford-Werken ist schon seit dem ersten einer langen Serie von Friedensverträgen vor gut fünf Jahrzehnten untersagt worden. Der Stolz der Rotten, noch der ursprünglichen »Miriamslegion« anzugehören, ist für die heutigen Generationen der anderen Rattenvölker kaum noch nachzuvollziehen.
Der Altar ist festlich mit heiligem Unrat geschmückt. Ein faulig-süßer Duft vermengt sich auf einzigartige Weise mit dem Weihrauch, der von der letzten Menschenmesse noch in der Luft hängt. Auf dem Altar stehen an jeder Seite Bildschirme, die Dr. Mara und Micha bedienen. Sie hocken ruhig vor ihren Computern, blicken sich jedoch missbilligend um. Auf ihren Bildschirmen lassen sie schließlich erscheinen:
»Ehrfürchtige Ruhe bitte …«, auf Dr. Maras Seite.
»… für die Hohepriesterin!«, auf Michas Seite.
Dr. Maras Ruhm ist in wissenschaftlichen Kreisen unumstritten. In ihrer Doktorarbeit gelang ihr der Aufsehen erregende Nachweis, dass auch das Bewusstsein der künstlichen Intelligenzen wie der Computer eine klare geschlechtsspezifische Ausrichtung aufweist. Dabei ist Dr. Mara eine erklärte Maskulinistin, die dagegen protestiert, dass das Männliche allein schon durch die ungerechte Sprache – »die« Ratte – ausgeschlossen wird. Die allgemein auch bei weiblichen Ratten anerkannte Intelligenz von Micha ist ihr eine unschätzbare Hilfe im Kampf gegen Diskriminierung. Dr. Maras Vorschlag, die Bezeichnung »der Ratt« einzuführen, weil der humanoide Ausdruck »Rattenbock« eine unwürdige Erniedrigung und »animalische Herabsetzung« darstelle, konnte sich allerdings bislang noch nicht durchsetzen.
Micha gilt als die zurzeit klügste lebende Ratte, obwohl er keinen akademischen Titel führt. Er kann jedem Menschen den Honig reichen. Viele hoffen sogar auf ein baldiges Kräftemessen zwischen Micha und dem führenden Computer, »Fenestra« mit selbstgewähltem Namen. Einen solchen Wettstreit haben beide bislang jedoch vermieden. Michas Hauptanliegen ist die völlige Gleichstellung aller Geistwesen, seien sie nun tierischen, menschlichen oder künstlichen Ursprungs. Großzügig lässt er geschlechtsspezifische Fragen außen vor, wie beispielsweise die sogenannte »Männchendiskriminierung« unter den Rattenvölkern.
Aus der Sakristei tritt nun Kordula Letzter-von-Traum, die erste Menschenratte überhaupt. Kordula ist inzwischen sehr alt. Wie alt genau, ist nicht bekannt. Der einzige bei dieser Feierstunde zugelassene Humanoid, Kordulas Mann Dr. Hans Letzter, stützt sie auf dem Weg zum Altar, obwohl er selbst kaum jünger ist als seine Frau.
Besonders Menschen streiten heftig darüber, ob eine Mette im fortgeschrittenen Alter ihren Körper noch so aufreizend darbieten sollte, wie Kordula es tut. Allerdings müssen selbst Menschen zugeben, dass man einer Mette den körperlichen Verfall nicht ansehen kann. Wobei Menschenaugen, nebenbei bemerkt, bei den gegebenen Lichtverhältnissen sowieso nichts erkennen würden, schon gar nicht die Farbe von Kordulas Kleidung. Die meisten Ratten halten diese ganze Diskussion für eitel. Sie haben immer noch keinen Sinn für Textilien entwickelt, während goldene Vorderpfotenringe in letzter Zeit groß in Mode gekommen sind. Das Wort »aufreizend« verstehen sie zwar vom Kopf, nicht aber vom Herzen her. Kordula ist wie den meisten Metten im Laufe ihres Lebens ein dichtes Fell gewachsen. Anstatt sich jedoch wie die anderen Metten in einen Stoff ihrer jeweiligen Fellfarbe zu hüllen, bedeckt Kordula ihr seidiges schneeweißes Fell mit nichts als einem knappen nachtschwarzen Bikini, wie ihn die Menschenfrauen nur dann nutzen, wenn sie sich an heißen Tagen sonnen.
Vier Metten tragen hinter Kordula einen Tresor her und stellen ihn dann vor dem Altar ab. Dieser Tresor ist das höchste miriamistische Heiligtum. Er stammt aus Miriams Labor, und niemand weiß, was er enthält. Es käme einer Beleidigung der Weisen Mutter Miriam gleich, ihn aufzubrechen; das würde der Legende nach das Böse freisetzen und ewige Verdammnis über alle Rattenvölker bringen. Kaum jemand lässt es sich nehmen, dennoch eine eigene Theorie über den Inhalt des Tresors zu äußern.
Die Rattendoktorin und Micha spielen die Melodie des »Miriamsliedes« ein. Nur ausgesprochene Miriamistik-Experten wissen, dass es sich bei der Melodie um eine Version des Lieds »Wharf Rat« handelt, von Kordula selbst abgewandelt und aufgenommen. Dass Kordulas Wahl auf dieses Stück gefallen ist, zeigt, dass sich der miriamistische Kult eher um sie selbst als um ihre Mutter Miriam dreht, die sicherlich den Song einer anderen Band ausgesucht hätte.
Die Ratten setzen sich zum größten Teil nun doch ruhig auf die Hinterpfoten, recken die Hälse und richten ihre Blicke auf den Altar. Kordula und Hans heben die Hände. Die Ratten tun es ihnen mit den Vorderpfoten nach, soweit es ihnen möglich ist, während die Metten damit ihrer Natur gemäß keine Probleme haben. Dr. Mara und Micha lassen das Miriamslied langsam ausklingen.
»O Mächtige Miriam, unsere Weise Mutter …«, beginnt Kordula mit ihrer feierlichen Stimme.
»… und o Heiliger Tresor, der das Böse auf ewig vor uns verschließt …«, brummt Hans.
»… und o Heilige Prinzessin Ursula …«, piepst es aus Tausenden von Rattenkehlen im Dom.
»… zu euch lassen wir unseren Duft aufsteigen«, fährt Kordula fort. »Du, o Mutter Miriam, hast die reinen Ratten in deiner überbordenden Freigiebigkeit aus dem ewigen Schweigen erweckt, als du ihnen Speise warst.«
»Und in uns sollst du auf ewig weiterleben«, deklamieren die Gläubigen.
»Wie es geschrieben steht im ›Ersten Buch Miriam‹«, beendet Hans mit seinem rauchigen Bariton das Gebet.
Kordula und Hans senken die Arme. Kordula lehnt sich mit gekreuzten Beinen an den Altar und lässt in ihrer gefürchteten, leicht spöttischen Art den Blick über die anwesenden Rattenvölker schweifen.
»Bevor ihr das heilige Fleisch zu euch nehmen könnt, müsst ihr euch eine Mahnung anhören«, sagt Kordula. Sie versteht es, ihrer Stimme trotz ihrer Höhe eine Note von großmütterlicher Strenge zu geben. Der blumige Geruch des Neids, der auf der Zunge bitter schmeckt und in den Ohren dröhnt, bekümmert sie. Dieser Geruch geht vor allem von Micha aus, wirkt jedoch ansteckend auf die ganze Gemeinde. »In letzter Zeit haben wir leider immer häufiger vernehmen müssen, dass im Namen der heiligen Geschwisterlichkeit auch Metten vom heiligen Fleisch naschen. Dem humanoiden Magen von Metten wie uns bekommt diese Speise jedoch nicht. Wir geben also allen Metten laut, sich kein heiliges Fleisch einzuverleiben. Sie duften darum aber nicht weniger nach unseren Schwestern und Brüdern als die reinen Ratten. Das kann ratte auch bei den letzten Rotten erschnuppern, die noch unter uns zu riechen sind und die, Miriam sei Dank, der Versuchung nie erliegen. Das schmeckt keineswegs nach Herabwürdigung. Jede Ratte mag sich als Beweis auf der Zunge zergehen lassen, dass die reinen Ratten auf eine Mette wie uns als ihre Hohepriesterin hören. Wenn die Mächtige Mutter Miriam gewollt hätte, dass auch wir Metten in den Genuss des heiligen Fleisches kommen, hätte sie wohl anderes verkosten lassen. Jede Mette, die an der Speisung teilnimmt, verpestet damit also in unglaublicher Weise den heiligen Willen unserer Mächtigen Mutter Miriam.«
Auf Michas Display erscheint das Wort »Einspruch!« in grellgelber Farbe auf schwarzem Grund.
»Kannst du nicht wenigstens am Fest der Heiligen Miriam aufhören, den Geruch des Störenfrieds anzunehmen?«, fragt Kordula und hebt den Kopf, um anzudeuten, dass ihre Geduld, die vielen als unendlich erscheint, kurz vor dem Ende steht. Sie benutzt ihre gefürchtete tiefe Donnerstimme. Aufgrund einer Laune ihrer Schöpferin Miriam verfügen Metten über drei Kehlen, mit denen sie wahlweise sprechen können. Kordula verfällt in ihre böse Tonlage umso seltener, je älter sie wird. Wenn sie auf sie zurückgreift, ist sie allerdings kraftvoll wie eh. »Die Metten haben ihren ureigenen Duft. Darum könnt ihr nicht im Namen der heiligen Geschwisterlichkeit verlauten lassen, dass sie in die Speisung einbezogen werden sollten. Die Mächtige Mutter Miriam hat im Verein mit der Heiligen Ursula den Tisch so gedeckt, dass jedes Rattenwesen das zu schmecken bekommt, dessen es bedarf. Das ist der miriamische Klang der heiligen Geschwisterlichkeit. Sticht uns da das Gleiche in die Nase?«
Die Schrift verschwindet von Michas Display und jedes der im Dom versammelten Rattenwesen fühlt, welches Opfer Micha damit für die gemeinsame Sache bringt.
»Danke«, stöhnt Kordula erleichtert, auch wenn sie durchaus wahrnimmt, wie sich in den süßen, schön ranzig angehauchten Geruch der Freundschaft eine dunstig-saure Note der Heuchelei mischt. »Obwohl die reinen Ratten euch nicht mehr als Sprachrohr benötigen, liebe Metten, habt ihr immer noch einen herausgehobenen Geruch in unserer großen miriamischen Gemeinschaft. Also, hört, riecht und schmeckt selbst, wie gut die Große Mutter Miriam ist. Bitte, die Tabletts mit der heiligen Speise.«
Die Metten öffnen die weißen Laken hinter sich. Sie ergreifen die bereitstehenden Tabletts mit den metallenen Schälchen. In den Schälchen befindet sich das heilige Fleisch von mindestens vor sieben Tagen eines natürlichen Todes Gestorbenen. So ist es im letzten, ewigen Friedensvertrag zwischen den Rattenvölkern und den Menschen festgeschrieben. Nicht ohne Hindernisse bahnen sich die Metten ihren Weg durch das Gewühl der reinen Ratten und verteilen die Schälchen. Gierig fallen die reinen Ratten über das Dargebotene her. Dabei gehen viele Schälchen zu Boden. Das Geräusch, das jedes Schälchen beim Aufschlagen auf den Boden verursacht, würden Menschenohren zwar nicht als laut empfinden; aufgrund der großen Zahl entsteht allerdings ein Klang, der den ganzen Dom erfüllt.
»Auf dass du ewig in uns weiterlebst, o Mächtige Mutter Miriam«, schallt es einmütig von allen Seiten. Die aufbrandende Ergriffenheit teilt sich Kordula als Geruch nach süßem Anis und als Töne von hoher Klarheit und Schönheit mit. Sie könnte nicht zufriedener mit sich sein.
Der Kult um Kordulas Mutter Miriam hatte den Rattenvölkern während der zermürbenden Auseinandersetzungen mit den Menschen Halt gegeben. Wie aber ist der Mythos entstanden? Was ist vor rund einem halben Jahrhundert in Kordulas Jugend wirklich geschehen?
Um diese Fragen beantwortet zu bekommen, müssen wir uns zunächst ins Jenseits begeben, weil wir dort erfahren können, wie dem grausamen Hunnenfürsten Attila und der heiligen Prinzessin Ursula eine neuerliche Bewährungsprobe im Diesseits auferlegt wird. Das Schicksal von Miriam und ihrer Tochter Kordula ist nämlich eng verbunden mit der unerwarteten Wiederkunft dieser beiden legendären Gestalten aus jenen alten Zeiten, in denen das Wissen um die Bedeutung des Über- beziehungsweise Unterirdischen für die Menschen noch lebendig war.
AUF BEWÄHRUNG
Das Übernatürliche stellt sich den Menschen dar, als entspreche es ganz genau ihren jeweiligen kulturellen Gegebenheiten; denn die Wirklichkeit steht nicht zur Verfügung, um einen kritischen Abgleich vorzunehmen. Betrachten wir das Beispiel der Außerirdischen. Wenn sie sich der Erde nähern, benutzen sie zwar uns »unbekannte Flugobjekte«; diese aber scheinen der uns nur allzu bekannten neuesten Designmode nachgebildet worden zu sein. (Vielleicht wollen sie bloß höflich sein. Doch das wäre eine andere Geschichte.)
Wenige Gedanken werden auf den Umstand verschwendet, welche Verunsicherung es unter den unsterblichen Seelen stiftet, wenn die Ansichten von Himmel und Hölle derart drastischen Veränderungen unterworfen sind wie im letzten Jahrhundert. Diese Verunsicherung fällt umso nachhaltiger aus, je überlasteter die jenseitigen Institutionen sind, weil aufgrund der weltweiten Bevölkerungsexplosion die Fallzahlen unaufhörlich steigen. (Dass ein kleines Volk wie die Deutschen derzeit ein wenig schrumpft, führt bei den Gerichten des Jenseits kaum zu einer Entspannung der Situation.)
Prozesse ziehen sich in eine schier unzumutbare Länge. Das trifft auch auf das Verfahren um den Hunnenkönig Attila und die heilige Ursula zu. Die Lebensläufe, die zu bewerten sind, liegen inzwischen ja immerhin gut anderthalb Jahrtausende zurück. Erst nach einer gewonnenen Musterklage der Totenrechtsorganisation »Rights of the Dead Watch« vor dem Verfassungsgericht der »Monotheistischen Jenseitsunion« (MoJu) kam die Sache wieder ins Rollen.
Bitte beachten Sie auch die Werbeeinblendung der MoJu in der zweiten Hälfte dieses Buches.
Attila zwirbelte sich nervös den roten Bart. Oder besser: Er dachte, dass er es täte. Er hatte sich immer noch nicht daran gewöhnen können, im Jenseits eine Seele ohne Körper zu sein. Vor ihm saß auf brodelndem Magma ein Weib im Lichte des Höllenfeuers. Attila nahm das Weib männlich interessiert in Augenschein. Er war mit den eigentümlichen Riten der Welt, in die er geschickt werden würde, noch nicht vertraut. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass das Weib nicht mehr so jung war, wie es den Anschein erweckte. Dafür sehr, sehr ansehnlich, stellte er mit Kennermiene fest und wiegte bedächtig das, was er für sein Haupt hielt. Sehr. Das Weib trug kein Gewand, wie es ihm bekannt war. Seine Beine hatte es lässig übereinander geschlagen. Sie steckten in sonderbaren, fadenscheinigen blauen Röhren, die um die Hüften auf bemerkenswerte Art zusammengenäht worden waren. Der Oberkörper war in ein nicht minder sonderbares Stück Stoff gehüllt, unter dem sich eine üppige Oberweite abzeichnete. Attila verwirrte das, obwohl er doch stets damit geprahlt hatte, dass ihm nichts Menschliches zwischen Himmel und Erde fremd sei. Zipfel des Stoffes waren über dem keck vorgewölbten Bauch so verknotet, dass der Nabel zu sehen war. Dort prangte ein kleiner goldener Ring mit einem grasgrünen Jaspis. Der Stoff war im Prinzip weiß, wenn auch an manchen Stellen von der Glut versengt; auf der rechten Brust prangte zudem eine grässliche blutige Teufelsfratze, die unablässig die Augen rollte. Links war mit einer Nadel eine Namensplakette befestigt, die besagte: »Miriam, Bewährungshelferin.« Darunter die neue Firmenbezeichnung: »MoJu – Monotheistische Jenseitsunion.« Dass sie neu war, konnte man daraus schließen, dass sie als Aufkleber etwas schief einen schwach durchscheinenden, darunter befindlichen Schriftzug verdeckte.
Attila wunderte sich, dass er die Zeichen entziffern und verstehen konnte, obwohl er sich nicht bewusst war, jemals solche Buchstaben gesehen zu haben. Eigentlich kann ich doch gar nicht lesen, rief er sich ins Gedächtnis, sondern habe mir immer von meinem Leibsklaven Walther vorlesen lassen. Der Slogan gab Attila ein weiteres Rätsel auf: »One Second Past Eternity.« Den Slogan hatte die jenseitige Werbeagentur, die aus allen verstorbenen Kreativen bestand, soeben entwickelt. Er wurde freilich erst vorläufig benutzt, denn noch war er nicht letztinstanzlich abgesegnet worden. Man munkelte, ein Teil der im obersten monotheistischen Rat vertretenen Götter würde die Alternative »Trust Us« bevorzugen, die allerdings eher altbacken wirkte. Der Einwand eines antiken Philosophen – der aus Angst vor Sanktionen ungenannt bleiben will – es bestehe ein logischer Widerspruch zwischen »mono« und »us«, wurde allerdings einhellig als überkommene Haarspalterei abgewiesen.
Miriam drehte etwas an einem geheimnisvollen Kasten, aus dem ohrenbetäubender Krach und eine undefinierbare Art von Gesang drangen. Irgendwie ging es bei dem reichlich schräg klingenden Lied um etwas wie Sympathie für den Teufel, der ein weltgewandter reicher Mann mit guten Manieren sei, soweit Attila es mitbekam. Die sonderbaren Töne wurden leiser und Attila überlegte, wie klein die Zwerge in dem sachte auf den Magmawellen schaukelnden Kasten wohl sein mussten, die dort jaulend musizierten und mit heiserer Stimme sangen. Hinter dem Kasten gewahrte Attila verschwommen eine Person mit Römerhelm, die unendlich langsam und durch viele Pausen unterbrochen mit einem Besen kleine Flämmchen auf eine Kehrschaufel fegte. Attila meinte sich zu entsinnen, dass der Römer Faulus hieße, kam jedoch nicht auf den Zusammenhang, in welchem ihm der Name schon einmal begegnet war. Seit die Monotheistische Jenseitsunion der terrestrischen Copyrightkonvention beigetreten war, wurden die Erinnerungen strengstens von Verletzungen der Markenrechte gereinigt.
»Rolling Stones«, erklärte Miriam. Mit einer derartigen Information wusste Attila nichts anzufangen. Stattdessen sprang ihm ins Auge, dass auf Miriams linker Schulter eine Ratte hangelte. Erstaunlicherweise empfand Attila die Ratte als überaus anmutig. »Ich dachte, Sie gewöhnen sich gleich mal ein wenig an das, was Sie erwartet.«
Nettes Gesicht, dachte Attila. Doch warum trägt das Weib die Haare so kurz wie die römischen Männer? Und was sollte das heißen, »Sympathie für den Teufel«? Verkehrte Welt: Weiber, die sich wie Männer geben, und ein Teufel, in dessen Namen man keinen Schrecken verbreiten konnte – da sollte sich noch jemand auskennen!
»Herr Attila«, begann Miriam. Gedankenverloren ließ sie die linke Hand durch das Magma gleiten, nahm ein wenig von ihm auf und ließ es durch die Finger rinnen. »Oder ist Ihnen der Name ›Etzel‹ lieber, unter dem Sie auch bekannt sind … ähm … waren?«
Attila überlegte, wie er das Weib ansprechen könne. Er ließ sich herab, ihm ein gnädiges Lächeln zu schenken, denn er spürte, wie lange es schon her sein musste, dass er bei einem Weibe gelegen hatte. Vage erinnerte er sich daran, dass sein letztes, eine Gotin namens Ildiko, ihn in der Hochzeitsnacht vergiftet hatte. Es musste selbstverständlich zur Rechenschaft gezogen werden, das Satansweib. Attila wollte das seltsame Beinkleid von Miriam begrapschen, merkte dabei jedoch, dass sie ebenso ein Geistwesen war wie er selbst. Gleichwohl warf ihm Miriam einen vernichtenden Blick zu. Na warte, Weib, dachte er, das lässt der Herr der Hunnen nicht mit sich machen. Sein untrügerischer Machtinstinkt bedeutete ihm allerdings, so lange vorsichtig zu sein, bis er wüsste, was hier gespielt wurde. Als Erstes musste er den Grund für die vorgetäuschte Körperlichkeit sowohl von dem Weib als auch von ihm selbst herausbekommen.
»Warum, o Weib, betreibt Ihr diese Maskerade?« Attila versuchte, seine Stimme milde klingen zu lassen, was ihm allerdings durchaus schwer fiel.
»Miriam«, entgegnete das Weib kühl und blieb ihm eine Antwort schuldig. »Miriam ist der Name, wie Sie durchaus wüssten, wenn Sie denn lesen könnten. Und das ›Ihr‹ gewöhnen wir uns flugs mal wieder ab. Immerhin sind mehr als eintausendfünfhundert Jahre verflossen seit Ihrem unrühmlichen Auftritt in der Körperwelt.«
Was hatte das Weib gesagt? »Unrühmlich«? Und das zu ihm, dem rühmlichsten aller ruhmreichen Helden? Attila fühlte Zorn in sich aufsteigen. Er sprang so nachdrücklich auf, dass er etwas in das Magma der ehemaligen Hölle einsank. Erschrocken stellte er fest, dass er im Stehen kaum größer war als Miriam, wenn sie saß. Sie war eine Riesin! Er musste sich also zurückhalten.
»Jetzt nehmen wir aber doch bitte mal wieder Platz!«, befahl Miriam mit mütterlichem Nachdruck.
Das Weib ist in Wirklichkeit gar nicht gewohnt, so scharf zu sprechen, meinte Attila herauszuhören, es tut nur so.
»Herr Attila, Ihnen ist doch die Schwere Ihres Versagens bewusst?«
»Versagen?« Attila war jetzt eher verdutzt als verletzt. Das konnte nur ein Scherz sein, wenn auch einer von der übelsten Sorte. »Habe ich meinem Hunnenvolke nicht auf alle Ewigkeit ein Riesenreich hinterlassen? Und mir auf ehrliche Weise den Titel der ›Gottesgeißel‹ verdient?«
Miriam runzelte die Stirn. »Wie ich sehe, ist mit Ihnen noch nicht gesprochen worden. Oder sind Sie einfach nur verstockt und uneinsichtig?«
»Viele Seelen sind durch mich ins Verderben gestürzt und dem Herrn der Finsternis zugeführt worden, nicht zuletzt elftausend selbstmörderische Jungfrauen in Köln. Ein Glanzstück, das ich zusammen mit den Römern vollbracht habe«, beharrte Attila.
»Na, es scheint so, als hätte man mir mal wieder die Drecksarbeit überlassen, und ich muss die schlechte Nachricht übermitteln. Überall Zeitdruck, und man kommt gar nicht nach, vor allem seit dem Zusammenschluss, der selbstredend nur dazu da war, Arbeitsplätze abzubauen … und die damit einhergehende Verpflichtung, sich gegenseitig Personal auszuleihen, führt bloß zu zusätzlichem Durcheinander. Da soll es einen noch wundern, dass Fälle gut und gerne mehrere tausend Jahre liegen bleiben, bevor sie bearbeitet werden können. Man muss sich ja erst einmal hineinfinden, wenn man hier unten arbeitet, wo man früher die ›Gegenseite‹ vermutet hat.« Miriam grummelte vor sich hin. Dann hielt sie inne, atmete tief durch und sagte: »Schön, Sie entsinnen sich also der elftausend Jungfrauen, Herr Attila. Lassen Sie es uns sicherheitshalber noch einmal durchgehen. Im Jahre 448 nach Christus hat der englische Prinz Conanus von der unwiderstehlichen Schönheit der bretonischen Prinzessin Ursula …«
»O ja.« Attila seufzte. Doch diese Miriam ist tatsächlich auch nicht zu verachten, dachte er, wenn ich nur wüsste, wie ich sie erreichen könnte.
»Zu Ihrem unzweifelhaften Fehltritt kommen wir später.« Die Teufelsfratze auf Miriams Bluse streckte Attila die Zunge hinaus. »Prinz Conanus hielt also um Prinzessin Ursulas Hand an, genauer gesagt: Er ließ um sie anhalten. Die englischen Gesandten übten am Hof von Ursulas Vater, dem König der Bretagne, ordentlich Druck aus. Prinzessin Ursula war nicht nur schön und jung, sondern auch« – Miriam verzog den Mund abschätzig, bevor, während und eine Zeit nachdem sie das folgende Wort ausgesprochen hatte – »keusch. Entschuldigen Sie bitte, dass ich meine Gefühle so wenig unter Kontrolle habe. Mir geht aber erst langsam auf, dass vor dem Zusammenschluss zur Monotheistischen Jenseitsunion wohl eine ziemliche Unkenntnis über die Werthaltungen der jeweils anderen Seite geherrscht haben muss. Das nur am Rande. Zurück zur Sache: Das Ansinnen von Prinz Conanus, Prinzessin Ursula zu freien, konnte schwerlich abgelehnt werden, ohne der Bretagne größere Schwierigkeiten oder sogar militärische Scherereien mit England einzubringen. Darum dachte Prinzessin Ursula sich aus, ihrem fernen Verehrer eine Bedingung zu stellen. Der englische Prinz solle sich taufen und drei Jahre im christlichen Glauben unterrichten lassen, während sie in der Zeit eine Pilgerfahrt nach Rom unternehmen würde. Conanus willigte ein; warum er das tat, war bis heute nicht zu ermitteln. Er zog nach Mainz, wo er auf den Namen ›Aetherius‹ getauft wurde, und Ursula schiffte sich mit zehn von ihrem Vater und von dem zukünftigen Schwiegervater ausgewählten Jungfrauen ein, um den ersten Teil der Reise auf dem Seeweg zurückzulegen. Jeder der elf Jungfrauen wurden noch tausend Begleiterinnen beigestellt. Es handelte sich wohlgemerkt um eine verdammt seltsame Sorte von Jungfrauen. Sie waren nämlich als Ritter ausgebildet. In der Nordsee erfasste ein schwerer Sturm die Flotte der Pilgerinnen und trieb sie in die Rheinmündung. Schließlich langte man außerplanmäßig in Köln an.«
Attila gähnte und malte sich aus, wie Miriam wohl aussähe, wenn sie ihres zugegebenermaßen ohnehin schon spärlichen Stoffes entkleidet wäre. Ein Weib mit einem derartigen Busen überstieg jedoch seine Einbildungskraft.
»Hören Sie ruhig genau zu, Herr Attila.« Miriam zog verärgert ihre Bluse etwas fester zu. »In Köln wurde Ursula freundlich aufgenommen. Und dort, in Köln, erschien Ursula ein Engel. Der Engel verkündete der Naiven, sie solle zunächst wie geplant nach Rom pilgern, dann aber umgehend nach Köln zurückkehren. Denn in Köln habe der Herr für sie den Märtyrertod vorgesehen.«
»Sage ich doch«, unterbrach Attila. Er lächelte großtuerisch. Vielleicht war es ja möglich, Miriam zu beeindrucken, wenn sie von seinen Heldentaten erfuhr, hoffte er. »Selbstmörderinnen. Durch ihre Rückkehr haben sie doch die – wie die Christen sagen – ›schwerste Sünde‹ auf sich geladen, weil nur ihr Gott Herr über Leben und Tod sein dürfe. Kann man solche Dummheit, in sein Verderben zu laufen, als etwas anderes als ›Selbstmord‹ bezeichnen?«
»So ist das von unseren Vorgesetzten auch gesehen worden.« Miriam verkniff den Mund.
»Aber?«, fragte Attila. Er wurde jetzt wieder unsicher, weil Miriam nichts sagte.
Schließlich brachte sie es doch über sich, fortzufahren: »Nun, die Pilgerschar kehrte tatsächlich zurück, mit allerlei weiteren Frommen, die sich ihnen in Rom angeschlossen hatten; unter den Männern und Weibern, die Ursula folgten, befand sich übrigens auch der damalige Papst höchstselbst, so sehr wurden ihre Reinheit und ihre Unschuld bereits bewundert – für unsereins nicht ganz nachzuvollziehen: Bewunderung wofür? Für das Hinausschieben einer Heirat, die unvermeidlich war? Oder für den prophezeiten Märtyrertod, dem sie sehenden Auges entgegen zog? Was daran ist bewunderungswürdig? Das zu beurteilen, ist zum Glück nicht meine Angelegenheit. Auch Prinz Conanus-Aestherius, der zukünftige, nun ganz vom christlichen Geist durchdrungene Gatte, eilte aus Mainz herbei, um Prinzessin Ursula in Köln zu treffen.«
»Daraus wurde aber nichts!« Attila lachte hohntriefend. Er führte die rechte Hand an seiner Kehle vorbei. »Alle elftausend und wer-weiß-wie-viele-noch auf einmal! Vor allem waren diese angeblichen Jungfrauen, wie Ihr dankenswerterweise schon zugegeben habt, bis an die Zähne bewaffnet und wehrhaft wie ein Heer. Der Sieg über sie war hervorragende Feldherrnarbeit, denn immerhin waren wir Hunnen ihnen heillos unterlegen, jedenfalls zahlenmäßig.«
»Die eine haben Sie überleben lassen«, erinnerte ihn Miriam.
»Zunächst ja, die kleine Prinzessin Ursula war so anmutig, die wollte ich mir gönnen. Doch war sie nicht willig. Selbst schuld, dass sie dann ebenso dran glauben musste.«
»Fehler über Fehler!« Miriam schüttelte den Kopf. »Unverzeihlich. Weil Prinzessin Ursula den Tod gefunden hat, um sich die Unschuld für ihren Bräutigam zu bewahren, wurde sie damals durch die ehemalige Gegenseite vom Suizid-Vorwurf freigesprochen. Bei dem Zusammenschluss zur Jenseitsunion wurde eine ›multilaterale Anerkennung‹ aller bereits ergangenen Urteile vereinbart; der Rechtssicherheit wegen, wie Sie wissen.«
»Freispruch? Für Ursula, die Selbstmörderin?«, rief Attila entsetzt, der sich auf alles, was Miriam nach diesem verheerenden Wort gesagt hatte, keinen Reim machen konnte.
»Für alle elftausend«, bestätigte Miriam.
»Ist das nicht etwas übertrieben?« Attila jammerte jetzt verzagt. Er musste einsehen, dass Miriam genauso unerreichbar war wie Prinzessin Ursula, nur auf eine ganz andere Weise. In dem Maße, in dem sich Attilas Körper materialisierte, spürte er die Hitze der Umgebung.
»Ganz richtig, Freispruch; wenn auch zweiter Klasse, sozusagen«, präzisierte Miriam. »Dazu kommen wir noch. Auch sonst sieht Ihre Bilanz alles andere als rosig aus. Später ließen Sie sich von Papst Leo um den Finger wickeln: Sie gaben den Bitten des Papstes nach und verschonten entgegen der Anordnung Ihres Auftraggebers während Ihres Eroberungs- und Zerstörungszugs durch Europa die Stadt Rom.«
Attila brach der Schweiß aus. Doch das konnte er so nicht auf sich sitzen lassen. »Wir waren geschwächt. Ich erinnere an die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern. Dort musste das tapfere Heer der Hunnen eine Niederlage hinnehmen, die wir dem feigen Verrat von jemandem verdankten, den ich für einen edelmütigen Freund gehalten hatte. Danach wäre es uns sowieso nicht gelungen, Rom zu besetzen. So war es durchaus angeraten, das Wohlwollen des Papstes zu erlangen, um unser Reich zu schützen.«
»Ach, auf diese Weise reden Sie es sich schön.« Miriam stellte das mit einem verächtlichen Zug um den Mund fest. »Als Ihre Bewährungshelferin muss ich schon sagen, dass ich die Chancen Ihrer Resozialisierung für äußerst schlecht einschätze. In Wirklichkeit haben Sie bei der erwähnten Schlacht auf den Katalaunischen Feldern Ihren alten Kumpel, den römischen Heerführer Aetius, verschont, das war alles: Sie haben sich ohne Not zurückgezogen und so getan, als sei Ihr Heer geschlagen. Und bei der Belagerung Roms sind Sie nur vor den Strapazen einer Erstürmung zurückgeschreckt, so verhält es sich doch! Sie waren der Feigling und haben die Befehle verweigert. Nach Ihrem geradezu peinlichen Tod in den Armen einer Frau ist Ihr verdammtes Reich sofort in sich zusammengefallen. Gänzlich schweigen wollen wir an dieser Stelle von dem Murks, den Sie unter Ihrem Decknamen Etzel bei der Nibelungen-Affäre gebaut haben. Keine einzige Menschenseele ist damals bei uns eingegangen; ich meine: in der Hölle, in der ich jetzt nun mal als Aushilfe tätig bin. Da muss ich ja auch deren Standpunkt einnehmen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ach nein, das ist selbst für das Personal zu verwirrend. Wie dem auch sei: Alle wurden begnadigt, weil sie auf der Erde schon genug gelitten hätten, wie die Gegenseite meinte. Das sind die nackten Fakten.«
Attila brütete eine Weile vor sich hin und versuchte dabei, den stechenden Blicken von Miriam auszuweichen.
»Nun denn«, sagte er schließlich. »Dass ich hier sitze, scheint irgendeine Bedeutung zu haben.«
»In der Tat.« Miriam nickte. Ihre Ratte drehte sich, verschwand hinter ihrem Hals und tauchte dann auf der anderen Schulter wieder auf. »Man hat höheren Ortes im Einvernehmen der beiden Seiten beschlossen, Ihnen eine zweite Chance zu geben. Um das klarzustellen: Ich halte Sie für einen hoffnungslosen Fall. Das bloß so nebenbei.«
»Zweite Chance«, griff Attila den Strohhalm auf, der ihm hingehalten worden war. »Was ist damit gemeint?«
»Die elftausend entgangenen Seelen schmerzen am meisten. Ursula ist übrigens zu einer der beliebtesten Heiligen weltweit geworden. Ein spanischer Seefahrer, der mehr als tausend Jahre später neue Welten entdeckte, benannte sogar eine Inselgruppe nach ihr, die ›Jungfraueninseln‹. Damit werden Sie bei Ihrer Rückkehr zur Erde nichts zu tun haben, doch ein wenig Hintergrundwissen kann ja nicht schaden«, stellte Miriam fest. »Also, es wird einen neuen Kampf mit Ursulas Seele geben.«
»Hervorragend«, freute sich Attila und rieb sich die Hände. »Ort? Waffen?«
»Köln. Alles Weitere ist Ihre Sache.« Die Teufelsfratze auf Miriams Bluse kicherte bösartig. »Ich rate Ihnen, sich mit Bedacht in Ihrer neuen Welt umzutun.«
»Ich bin doch kein Anfänger«, knurrte Attila. Er fühlte sich jetzt ganz im Besitz seiner Kräfte und war voller Tatendurst. »Woran erkenne ich Ursula?«
»Das werden Sie herausfinden.« Miriam zuckte mit der Schulter.
Attila stutzte. »Und wie lautet der Auftrag?«
»Nehmen Sie ihr die Unschuld«, sagte Miriam und entließ Attila mit einer Handbewegung. Dazu wackelte die Teufelsfratze auf Miriams Bluse neckisch mit den langen Ohren. »Viel Spaß.«
»Den werde ich haben.«
Als Attila schon fast auf dem Weg durch die Glut zur Erdoberfläche war, rief Miriam ihm noch nach: »Denken Sie dran, Herr Attila, keine Schwachheiten diesmal! Wenn’s schief geht, wissen Sie ja, was Ihnen blüht: Dann müssen Sie ab zur Gegenseite – in den Himmel!«
Attila hörte Miriams Ratte fiepen und spürte einen kalten Schauer seinen Rücken hinunterlaufen, während er in der Ferne schon die markanten Türme des ihm unbekannten Kölner Doms gewahrte.
Ursula tollte ausgelassen durch die Wolken, freute sich des Lebens und wunderte sich kein bisschen über ihre ungewöhnliche Fähigkeit, über dem Boden schweben zu können. Ihr kindliches Gemüt nahm sie als gegeben. Das Schwert an ihrer Seite zeigte allerdings an, dass sie eigentlich den Kindesbeinen entwachsen sein sollte, auch wenn es ein kleines Schwert war, das ihrer geringen Körpergröße entsprach.
Lufred legte umständlich seine wertvolle Pfeife aus echtem schneeweißem Blockmeerschaum auf dem Wolkenschreibtisch neben dem unvermeidlichen Laptop ab. Dann erhob er sich von seinem luftigen Bürostuhl. Schwerfällig setzte er Ursula nach. Ursula lief zunächst weg, hielt schließlich inne, drehte sich um, lachte neckisch, ging breitbeinig in Kampfstellung und griff nach ihrem Schwert.
»Lass stecken, Prinzessin«, winkte Lufred augenzwinkernd ab, kehrte zu seinem Laptop zurück und ließ einen Videoclip laufen, der den neuen, geschlossenen BMW Z4 zeigte. Der Videoclip hatte irgendetwas mit seinem wahren Leben auf der Erde zu tun, von dem er bloß vorübergehend beurlaubt war, um an dieser himmlischen Außenstelle der »Monotheistischen Jenseitsunion« Hilfsdienste zu leisten. Er konnte sich allerdings nicht genau erinnern, wie das alles zusammenhing. Es war ihm auch egal. Autos sind einfach die wunderbarste Sache der Welt, dachte er. Nun ja, berichtigte er sich, Ursulas Schönheit wäre ja tatsächlich ebenso atemberaubend, sofern ich denn atmen müsste. Wenn ich es dürfte, würde ich gern mal wieder auf Fleischliches umsteigen … Was für ein lausiges Cockpit das hier oben doch ist, ich beneide die Kollegen keineswegs, die immer im Himmel Dienst tun und nicht nur ab und zu.
Lufred nahm seine Pfeife wieder auf und klemmte sie zwischen die Zähne. Ein süßer Hauch von Vanille-Karamell und eine Note von trockenem Champagner waberte durch die Wolken. »Dort, wo du hinfahren wirst, trägt man keine Schwerter«, erklärte er. Der Buchstabe »s« in den Worten zischte, denn damit ihm die Pfeife nicht aus dem Mund fiel, musste er mit seinen gelb-bräunlich verfärbten, aber nach wie vor kräftigen Zähnen fest auf das Mundstück aus schwarzem Kautschuk beißen.
Ursula beäugte Lufred neugierig, der wie ein Mönch in eine braune Kutte gewandet war. Ihr fielen zwei gerötete kreisrunde Stellen auf seiner Stirn auf. Sie hätten sich am Haaransatz befunden, hätte der Mönch noch Haare gehabt. »Hey, Alde, was haste auf deine fette Kiste da? Voll korrekte FarCry? Aus England; net vollspast scheißdeutsche FarCry, die nur was is für die Maso-Wixer, isch schwör.«
Lufred schaute Ursula verständnislos an.
»Was guckstu, Alde? Bin isch Kino oder was? Null Peilung, was die FarCry is? Bistu dumm oder was? Die is die voll korrekte Ballerspiel, isch schwör, net masoschistisch oder was. Was bistu für eine Stahlkopp eigenlisch?«
»Nenn mich einfach Vater Lufred«, antwortete der Gefragte und konnte ein Glucksen kaum unterdrücken, »dein Bewährungshelfer von der MoJu, der ›Monotheistischen Jenseitsunion‹.« Das fängt ja heiter an, dachte er und versuchte vergeblich, in die innere Zerknirschung zu gehen. Es ist schon erstaunlich, dass die Modetrends, die den Kids Spaß machen, sich selbst in den luftleeren Höhen des Geistes so schnell herumsprechen. Der hier herrschenden Hausordnung zufolge müsste ich sie ja »eigenlisch« tadeln, das bringe ich aber nicht übers Herz. Wer, verflixt noch mal, sollte sich noch sicher sein können, was richtig und falsch ist – bei dem ganzen Durcheinander, das die Reorganisation des Jenseits und das »Change Management« durch die MoJu-Bürokratie verursacht hat.
Ursula streckte herausfordernd ihr Kinn vor, was sie nur noch anmutiger erscheinen ließ. »Hastu Problem oder was, Alde? Wie soll isch mitohne die Schwert misch Unschuld verteidigen? Deine Vater ist wohl Spießertochter oder was, isch schwör.«
Lufred ließ sich provozieren. Abrupt fiel seine nachsichtige Fassade ab und er sagte mit spöttisch heruntergezogenen Mundwinkeln: »Als du sie gebraucht hättest, haben sie dir nichts genützt, dein Schwert und deine ganze Ausbildung in den ritterlichen Künsten.«
»Is misch doch von die so gesacht worn, isch schwör! Isch schwör!«, entschuldigte sich Ursula und riss die Augen auf. So redet man doch nicht mit Kindern, fuhr es ihr durch den Kopf, die verstehen bekanntlich keine Ironie! Oder hat der blöde Bewährungshelfer etwa keinen blassen Schimmer von Entwicklungspsychologie? »Sonst hättisch schon gemacht die Propellerkick in Fresse rein von die voll masochistische Attila, isch schwör!«
Lufred runzelte die Stirn, ging aber nicht darauf ein. Vielmehr zischte er: »Gesagt? Von wem?«
»Von die Stimmen!«, rief Ursula vorwurfvoll, als müsse er das wissen. »Von die Engel.«
Lufred seufzte. Wie sollte er Ursula beibringen, dass es diese Stimmen nicht gab? Dass sie Einbildungen waren, die aus ihrem eigenen überspannten Gehirn stammten? Wie konnte er ihr das beibringen, ohne ihren Glauben zu erschüttern und ohne ihrem zarten kindlichen Gemüt Schaden zuzufügen? In Situationen wie diesen verfluchte er die Neuregelung, die eine plattformübergreifende Austauschbarkeit des jenseitigen Personals einschloss. Er war dieser Art von Aufgaben nicht gewachsen. Das würde wieder Punktabzug beim Mitarbeitergespräch über die Zielvereinbarung geben und sein schwerer Dienst würde um eine weitere Ewigkeit verlängert werden. Vor allem, weil die Bewertungen immer strenger ausfielen; und das war nichts anderes als eine wohlkalkulierte Gemeinheit. Schließlich brauchte man die Arbeitskräfte, an denen nach all den Rationalisierungen und den vielfältigen Lean-Management-Programmen überall in der Jenseitsunion Knappheit herrschte. Die MoJu war nun gewissermaßen von einer erschreckenden »Untermotorisierung« gekennzeichnet.
»Wie konntest du annehmen, die Person, die du unter der Bezeichnung ›Herr‹ kennst, würde von dir und deinen elftausend und soundso vielen Begleiterinnen und Begleitern verlangen, wie Schlachtvieh in den Tod zu ziehen?«, hielt Lufred ihr matt vor.
Ursula rang mit den Tränen. »Was hab ischn gemacht? Was hab ischn gemacht? Bin isch jetzt heilige Tuss oder net?«
»O ja!«, versicherte ihr Lufred ohne Begeisterung. »Und was für eine heilige ›Tussi‹, wenn du dich so bezeichnen willst! In der ganzen Christenheit verehrt man dich, die heilige Ursula. Doch schon seinerzeit hatte Beelzebub im Namen der ehemaligen höllischen Gegenseite eine einstweilige Verfügung erwirkt. Er argumentierte, es habe sich um Selbstmord gehandelt, eine schwere Sünde, wie du sehr wohl weißt. Ihr seid Attila und den Hunnen in der vollen Absicht in die Arme gelaufen, dort den Tod zu finden.«
»Normal, die Märtyrertod«, beharrte Ursula und setzte eine kindliche Unschuldsmine auf. »Is doch voll korrekt, Alde, oder hastu hart die Schwanz wie Speer oder was?«
»Ihr habt sie mit euren Waffen gereizt und euch dann niedermetzeln lassen«, erinnerte Lufred sie. »Aber man konnte diesseits etwas für dich herausschlagen: Dir wird als mildernder Umstand angerechnet, dass ein so junges Weib noch kein geeigneter Heerführer ist.«
»Scheiß mir egal! Dass isch misch Unschuld oberkorrekt bewahrt hab, zählt wohl gar nets mehr, weisstu wie isch mein?« Ursula war empört. Übertrieben verzog sie das Gesicht, als habe sie Schmerzen, und griff nach dem imaginären Pfeil, den Attila ihr ins Herz geschossen hatte. Plötzlich hielt sie inne und murmelte: »Normal müsstisch tot sein, isch schwör. Komisch, wie sisch die anfühlt.«
»Wie gesagt«, wich Lufred aus, »anderen Ortes wurde beschlossen, dass es unentschieden steht.«
»Bistu Maso oder was, Alde?« Ursula begann zu frösteln und den Mangel an Sauerstoff in der Höhe zu spüren. Sie japste nach Luft.
Auch Lufred tat so, als atme er tief durch. »Der Kampf mit Attila geht in die zweite Runde.«
Ursula zog erneut ihr Schwert und fuchtelte wild damit herum, so weit wie es ihr beschränkter Atem zuließ: »Wo is die Spießertochter? Spuck aus, Alde, mach schon! Die kick isch in die Orbit. Die schlag isch mit eine Kick um. Korrekt?«