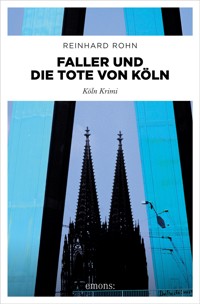7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Sänger Georg Arden wird brutal hinter der Kölner Oper zusammen-geschlagen. Georg verliert seine Stimme und flieht in panischem Schrecken nach Königswinter. Dort lernt er Nora, eine junge Klavierlehrerin, kennen. Doch Nora trägt ein dunkles Geheimnis mit sich, das sie sehr belastet und Georg ahnt nicht, wie sehr Noras Schicksal mit dem seinen verknüpft ist und wie bedrohlich ihrer beider Lage ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Ähnliche
Über das Buch
Der Sänger Georg Arden wird brutal hinter der Kölner Oper zusammen-geschlagen. Georg verliert seine Stimme und flieht in panischem Schrecken nach Königswinter. Dort lernt er Nora, eine junge Klavierlehrerin, kennen. Doch Nora trägt ein dunkles Geheimnis mit sich, das sie sehr belastet und Georg ahnt nicht, wie sehr Noras Schicksal mit dem seinen verknüpft ist und wie bedrohlich ihrer beider Lage ist ...
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Mord unter dem Drachenfels
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil 1: Fünf Monate später
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 2: Zwei Tage später
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Impressum
Handlung und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Bei der Schilderung real existierender Schauplätze habe ich mir einige kleinere Freiheiten gestattet.
Prolog
Stella liebte den Zufall. Sie wusste, dass der Zufall sie früher oder später zu Philipp führen würde. Sie musste nichts anderes tun, als sich durch die Stadt treiben zu lassen und irgendwann einen Platz zum Schlafen zu suchen. Um sich in einem Hinterhof in einer ruhigen Ecke zusammenzurollen, war es allerdings noch zu kalt. Am liebsten hätte sie sich in den Dom geschlichen und da übernachtet. Faszinierende Vorstellung – eine Nacht neben dem Schrein der Heiligen Drei Könige oder in dem Gestühl der Domherren. Brannten auch nachts Kerzen im Dom, oder lag man dann in völliger Dunkelheit da, als sei man an einem fernen Ort jenseits von Raum und Zeit gelandet? Sie hatte jedoch gleich vermutet, dass es mit der Nacht im Dom nicht klappen würde. Ihr Zahlentick hatte es ihr verraten. Wenn sie es vom Ausgang des Hauptbahnhofs bis zum Domportal, ohne zu betrügen, in genau hundertfünfzig Schritten schaffte, wäre der Weg frei für sie, hatte sie sich gesagt. Leider hatte sie neunundachtzig Schritte gebraucht, eine ungerade Zahl, zu allem Überfluss auch noch eine Primzahl. Das brachte Unglück. Kein Wunder, dass die rotgewandeten Aufpasser im Dom sie mit ihrem Rucksack nicht hereingelassen hatten. Immerhin hatten sie nicht die Polizei gerufen. Als Ausreißerin hätte Stella sonst wohl die Nacht auf einem Polizeirevier verbringen müssen – bis ihr Stiefvater sie abgeholt hätte.
Sie sah, wie der Mond sich in einem Baugerüst spiegelte. In einer dunkleren Seitengasse abseits vom hell erleuchteten Dom wurde anscheinend eine alte Kirche oder ein Kloster renoviert. Sie rüttelte an einer Holztür, die in einen Bretterzaun eingelassen war, aber die Tür war fest verschlossen. Ein altes, baufälliges Kloster wäre ihr als Schlafplatz auch eine Spur zu unheimlich gewesen. Allerdings hätte sie Philipp am nächsten Morgen, wenn sie ihn dann gefunden hätte, wirklich beeindrucken können. Was tat sie nicht alles, um ihm zu beweisen, dass sie ihn liebte. Ihm zuliebe war sie ohne ein Wort aus Hameln verschwunden. Sie würde zum ersten Mal nicht die beste Mathematikarbeit ihrer Schule schreiben.
Ein alter Mann schlich mit einem Hund, der sich genauso schwerfällig bewegte wie er selbst, die düstere Gasse entlang. Wie zwei Geisterwesen sahen sie aus, die sich gleich wieder in Luft auflösen oder gar in furchtbare dämonische Kreaturen verwandeln würden. Vor Stella blitzten die Scheinwerfer der Autos auf, die ein Stück weiter auf einer Schnellstraße vorbeijagten.
Wenn sie es mit zwanzig Schritten bis zu dieser Straße schaffte, würde sie einen Hinweis finden, wo Philipp steckte, sagte sie sich. Sie versuchte die Strecke abzuschätzen, machte mit ihren abgelaufenen Turnschuhen große, raumgreifende Schritte. Trotzdem reichte es nicht. Obwohl sie sich zu ihren Gunsten mehrmals verzählte, brauchte sie dreiundzwanzig Schritte bis zu der vierspurigen Straße. Schon wieder eine ungerade Zahl!
An einer Ampel, an der sie auf das grüne Signal für Fußgänger warten musste, entdeckte sie keinen Hinweis auf eine Bar oder einen Club, wo eine Band mit Namen »Luxusliner« spielte. Lediglich ein orangefarbener Automat mit den Morgenzeitungen stand da. Die Schlagzeile handelte von einem grausamen Mädchenmord auf einem Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof. Vielleicht hätte sie doch eine Kerze im Dom anzünden sollen. Auch ein Gebet hätte nichts schaden können! Was würde sie tun, wenn sie Philipp nun wider Erwarten nicht fände? Er hatte ihr nicht einmal seine Telefonnummer gegeben. Vermutlich passierte es ihm ständig, dass ihm irgendwelche Mädchen nachreisten, die sich in seine langen schwarzen Haare und in sein scheues Lächeln verliebt hatten. Nein, er hatte ihr eine Kette geschenkt und sie mit auf sein Hotelzimmer genommen, und er hatte ihr zugeflüstert, sein nächster Song werde den Titel »Stella sings« tragen.
Mit dreißig Schritten hatte sie die Straße überquert. Immerhin, die Zahlen waren wieder auf ihrer Seite. Sie spürte jedoch, wie sie allmählich müde wurde. Auch der Hunger kehrte zurück. Wenn ihr der Zufall doch nicht zu Hilfe käme, würde sie sich auf die Kreditkarte ihrer Mutter besinnen müssen, die sie zur Sicherheit eingesteckt hatte. Damit würde sie zwar eine Spur hinterlassen, aber dieses Risiko musste sie zur Not eingehen.
Sie hatte immer gewusst, dass ihr mit siebzehn ein großes, einzigartiges Abenteuer widerfahren würde. Eine Wahrsagerin hatte es ihrer Mutter vor ein paar Jahren prophezeit. »Passen Sie auf Ihre Tochter auf! Noch während ihrer Schulzeit wird sie ein einschneidendes Erlebnis haben!« Wie ihre Mutter glaubte Stella an solche Weissagungen, auch wenn sie es vor all ihren Freundinnen abgestritten hätte.
Als sie Philipp an seiner Bassgitarre gesehen hatte, waren ihr die Knie weich geworden. So einem Jungen war sie noch nie begegnet. Mit abwesendem, beinahe leerem Gesichtsausdruck beugte Philipp sich über sein Instrument, als halte er ein lebendiges Wesen in seinen Händen, mit dem er eine Art geheimen Tanz aufführen musste. Pulsierend dröhnte der Bass aus den Lautsprechern und ließ sie regelrecht erzittern. Der Boden unter ihr begann zu schwanken, und für einen Moment fürchtete sie, ohnmächtig zu werden. Dann schaute Philipp sie an; ein großer, heiliger Zufall, dass ihre Blicke sich trafen und seine schwarzen, geheimnisvollen Augen sie förmlich aus einer groben, wogenden Menschenmenge herausschnitten. So fängt die Liebe an, hatte Stella gedacht. Ihr Glück hatte begonnen. Der Tag war der siebte April, und die Sieben war immer ihre Lieblingszahl gewesen.
Nachdem sie die Straße überquert hatte, schritt Stella auf ein hässliches graues Gebäude zu, das auf den ersten Blick wie eine Behörde aussah, dann entdeckte sie die Schilder »Opernhaus Köln – Heute wegen Generalprobe keine Vorstellung – morgen: ›Fidelio‹.«
Spielte Philipp mit seiner Band vielleicht in der Oper? Nein, undenkbar. In so einen spießigen Kulturtempel würden ihn keine zehn Pferde hineinbekommen. Auch in den Programmankündigungen in einem Schaukasten fand sich kein Hinweis auf das Konzert einer Band namens »Luxusliner«.
Erneut spürte Stella, wie sie unsicher wurde, und diesmal verflog diese Unsicherheit nicht sogleich wieder. Vielmehr kam ihr der unliebsame Gedanke, dass der Zufall ihr nicht helfen würde, weil Philipp sie angelogen hatte. Er war mit den anderen Musikern gar nicht nach Köln weitergereist, sondern hatte sich nur einen Spass daraus gemacht, ihr falsche Geschichten zu erzählen und sie mit auf sein enges, schmutziges Hotelzimmer zu nehmen. Sein Körper war viel älter gewesen als sein Gesicht, mit Narben an den Unterarmen und zwei riesigen Tätowierungen auf seiner Brust, die wie giftige Kraken ausgesehen hatten.
Stella schritt um das Opernhaus herum und geriet in eine Straße, die voller Schatten war. Ja, es sah so aus, als bewegten sich in einem feinen silbrigen Licht Gebilde aus Dunkelheit. Sie ließ den schweren Rucksack von ihrer Schulter gleiten und lehnte sich an die Hauswand. Dann schloss sie die Augen. Ich werde bis sechzig zählen, und wenn ich dann die Augen wieder öffne, wird sich alles verändert haben, redete sie sich ein.
Mit gesenktem Kopf zählte sie flüsternd vor sich hin, fast wie als kleines Kind, wenn sie mit den anderen Mädchen in ihrer Straße Verstecken gespielt hatte. Damals war ihr Vater bei ihnen gewesen und hatte sich noch nicht nach Spanien auf eine Sonneninsel abgesetzt, um Tauchlehrer oder Fremdenführer zu sein. Es tat ihr gut, die Zahlen auszusprechen. Sie fühlte sich wohl, wenn sie mit Zahlen zu tun hatte. Auf Zahlen war Verlass. Sie hatte nie verstanden, dass ihre Freundinnen Mathematik hassten. Eine Zeitlang hatte sie nichts lieber getan, als allein in ihrem Zimmer Mathematikaufgaben durchzuspielen. Sie hatte sogar eine Geheimsprache erfunden, die auf Zahlen beruhte. Leider hatte sie niemanden gekannt, dem sie diese Sprache beibringen konnte.
Als sie bei der spröden, durch und durch langweiligen Zahl Einundvierzig angekommen war, glaubte sie, ein Geräusch vor sich wahrzunehmen, hastige, zielstrebige Schritte, die dennoch eine gewisse Wankelmütigkeit verrieten. Dann bei Siebenundvierzig, viel zu früh und gegen jede Abmachung, die sie mit sich selbst getroffen hatte, sprangen ihre Augen auf, als habe ein schmerzhafter elektrischer Impuls sie getroffen.
Die Szenerie vor ihr hatte sich tatsächlich verändert. Eine Gestalt näherte sich einem Mann, der offensichtlich aus einem Seitenausgang der Oper auf die Straße getreten war. Nichts Bedrohliches lag in dieser Annäherung, eher wirkte es, als schiebe sich ein später, eiliger Passant an einem anderen vorbei. Trotzdem ahnte Stella, dass der Schein trog. Sie lief los, ohne selbst zu ahnen, warum sie lief. Kaum hatte die erste Gestalt sich der zweiten genähert, zog sie unter ihrem langen Mantel einen länglichen Gegenstand hervor.
Stella öffnete ihren Mund zu einem Schrei, aber vor Erstaunen drang ihr kein Laut über die Lippen. Sie wurde Zeugin eines kaltblütigen Überfalls. Der Angreifer schlug zweimal kurz und routiniert zu. Eine seltsame, fließende Eleganz lag in seinen Schlägen. Wie in einem Film, schoss es Stella durch den Kopf, als habe er diese Szene schon oft geprobt, und für einen Moment kam ihr der Gedanke, sie könnte tatsächlich mitten in nächtliche Filmaufnahmen geraten sein. Man hörte gelegentlich davon, dass unbedarfte Passanten ahnungslos in eine Filmszene hineinliefen und dann in vollkommenem Ernst einen Schauspieler jagten, der einen flüchtenden Mörder mimte. Doch die zweite Gestalt schrie mit einer Heftigkeit auf, die nicht gespielt sein konnte. Während sie ins Taumeln geriet, riss sie die Hände in die Höhe, nicht um selbst anzugreifen, sondern um sich vor weiteren Schlägen zu schützen, aber diese abwehrenden Gesten beeindruckten den Angreifer überhaupt nicht. Er brachte zwei, drei gezielte Hiebe an, die endgültig dafür sorgten, dass sein Opfer zu Boden ging. Dann hatte Stella ihn erreicht.
»Hören Sie auf!«, rief sie und wunderte sich über die Wut, die in ihrer Stimme lag. Der Angreifer wandte sich um. Sein Gesicht war bleich, fast weiß, er sah beinahe wie ein Vampir aus und irgendwie, als habe er kein Alter und kein Geschlecht. In seinen Augen glänzte ein Ausdruck von Überraschung und Entsetzen. Anscheinend hatte er Stella in der menschenleeren Straße vollkommen übersehen.
»Warum tun Sie so etwas?« Stella bemerkte, wie offenkundig absurd ihre Frage war. Sie packte die Gestalt an ihrem schwarzen Mantel, meinte den Geruch von Blut wahrzunehmen und hörte zugleich das Röcheln des Mannes, der zusammengesunken an der Hauswand lehnte. Dann begriff sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie hatte ihre linke Hand in den Mantel geklammert, als wolle sie den Angreifer festhalten. Mit einer leichten, mühelosen Bewegung schüttelte er sie ab, und das Glänzen in seinen Augen erlosch. Im nächsten Moment beobachtete Stella mit einer Intensität, die nur bedeuten konnte, dass ihre Sinne mit größtmöglicher Präzision arbeiteten, wie ein länglicher funkelnder Gegenstand auf sie zuraste – der Metallstock in der linken Hand der bleichen Gestalt. Ihr Kopf zuckte zurück, doch obwohl sie die Gefahr gespürt hatte, war sie nicht schnell genug. Ein wilder, heftiger Schmerz explodierte an ihrer Schläfe, und während er sich wie eine riesige Welle ausbreitete und sie das Gefühl hatte, den Boden unter ihren Füßen zu verlieren, bemerkte sie zugleich ein kühles, distanziertes Mitleid in den Augen ihres Peinigers.
Stella schwankte wie ein todkranker Baum, in der nächsten Sekunde kam es ihr vor, als schwebe sie ohne Beine über dem Asphalt, dann hatte sie die Zahl Siebzehn vor Augen, eine rote, pulsierende, schreckliche Zahl, die größer und größer wurde, bis sie sich wie ein wildes Tier auf sie zu stürzen schien. Plötzlich erkannte Stella ein paar Wahrheiten; sie erkannte, dass Philipp sie angelogen hatte, dass ihre Mutter schon den ganzen Abend um sie weinte und dass die Zahlen ihr in dieser Nacht nichts als Unglück gebracht hatten.
Teil 1 Fünf Monate später
1
In der Nacht hörte er sich singen. Georg sah, wie er auf die Bühne hinaustrat und einen kurzen, gleichmütigen Blick ins Publikum warf, bevor er sich in einem Flecken aus Licht postierte. Dann breitete er die Arme aus und stimmte den ersten Ton an. Zu seiner eigenen Verwunderung sang er keine Arie, sondern ein Kinderlied. »Der Mond ist aufgegangen« von Matthias Claudius. Für einen Moment glaubte er, ein Lachen seiner Zuhörer zu ernten. Das Publikum musste eine ganz andere Darbietung erwartet haben, etwa den Florestan in »Fidelio« oder den Prinzen aus Dvořáks »Rusalka«, doch aus dem Saal atmete ihm nur eine angespannte Stille entgegen. Jeder, der da in der Dunkelheit saß, schien wie gebannt an seinen Lippen zu hängen. Er gestattete sich auch keinen Fehler, sang dieses schlichte, schöne Kinderlied mit einer solchen Hingabe, dass ihm selbst die Tränen in die Augen traten. Als die letzte Zeile verklungen war – »… und unsern kranken Nachbarn auch« –, erwachte er, und erst dieses Erwachen bewies ihm, dass er überhaupt geschlafen hatte.
Die Hündin lag zu seinen Füßen und wimmerte leise vor sich hin, und über seinem Schreibtisch brannte eine winzige Lampe. Vor dem Fenster war der Mond aufgezogen, beinahe so, als habe sein Lied, das er im Traum gesungen hatte, ihn angelockt. Langsam erhob Georg sich, und während er zum Fenster ging, versuchte er, kein Geräusch zu verursachen. Er hatte sich angewöhnt, sich möglichst geräuschlos zu bewegen. Geräusche waren seine Feinde geworden. Vor ein paar Wochen hatte er sich dabei ertappt, wie er mehrmals die Tür seines Hauses geöffnet und geschlossen hatte, um sich selbst auf die Probe zu stellen. Zweimal war es ihm gelungen, die Tür so zu schließen, dass kein Knarren, nicht das leiseste Geräusch zu hören gewesen war. Stumm und beinahe schwerelos war die Tür ins Schloss geglitten. Es war ihm wie ein Sieg vorgekommen.
Als er sein Spiegelbild im Fenster sah, bemerkte Georg eine dicke Träne auf seiner linken Wange. Wie ein durchsichtiges Geschwür sah sie aus, das absolut nicht in sein Gesicht gehörte. Mit einer hastigen Handbewegung wischte er die peinliche Träne weg, und dann vernahm er ein dumpfes Jammern und Stöhnen, das ihn nur beim ersten Mal irritiert hatte, zwei Tage nachdem er in dieses windige Gartenhaus geflüchtet war. Tom, sein Sohn, war aufgewacht und weinte. Seit sie in diesem fremden Haus wohnten, quälten ihn häufig Albträume, über die er nicht sprechen wollte.
Georg seufzte und löschte die Lampe an seinem Schreibtisch. Für ein paar Sekunden ließ er sich vom Mondlicht einfangen. Fast meinte er, seinen Atem silbrig vor seinen Lippen flimmern zu sehen. Dann ging er in den engen Flur hinaus. Eine Holzdiele knarrte unter seinen nackten Füßen. Er hörte, wie Tom Worte vor sich hin flüsterte; es klang, als würde sein ängstlicher Sohn Zauberformeln murmeln, um das Böse zu bannen, das in sein Leben getreten war. Draußen schrie ein Vogel. Dann öffnete er die Tür zum Zimmer seines Sohnes. Er atmete tief ein und wusste, dass er wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zumachen würde.
Der Nachtzug war beinahe leer, jedenfalls der Wagen mit den billigen Liegesitzen. Fünf Japaner hatten sich auf der anderen Seite breitgemacht; ein Junge mit einer altmodischen Nickelbrille und vier -Mädchen, die sich glichen, als seien sie alle aus demselben Ei gekrochen. Der Junge hatte es nicht leicht mit seiner weiblichen Gesellschaft; immer wenn er sich ein wenig zusammengerollt hatte, um zu schlafen, ohne allerdings seine Brille abzunehmen, schob sich eines der Mädchen neben ihn und begann ihm über den Rücken oder das Gesicht zu streichen. Einmal bemühte ein Mädchen auch eine weiße Feder, um ihn an der Nase zu kitzeln. Als der Junge sie sanft wegschob und dann die Faust ballte, fingen die Mädchen an zu kichern; es hörte sich an, als stimmten vier -Kanarienvögel ein Konzert des Lachens an.
Nora tat es gut, ein paar Stunden allein zu sein. Über acht Stunden brauchte der Nachtzug von Berlin bis Köln. Dann würde sie eine Stunde Aufenthalt haben, Zeit genug für einen Kaffee und einen Blick auf den Dom. Gegen neun Uhr wäre sie in Königswinter. Sie wandte sich zum Fenster und starrte hinaus, um ein paar Sterne am Himmel auszumachen, aber alles, was sie sah, waren zwei Straßen-laternen, die sich in der Landschaft verloren.
Ihr Telefon hatte sie ausgeschaltet. Niemand würde sie anrufen und zurückhalten können. Aber wahrscheinlich würde Mike es auch gar nicht versuchen.
»Ich will kein Kind!«, hatte er gesagt. »Was soll ich mit einem Kind anfangen?« Er hatte dabei die Augen zusammengekniffen, als hätte er sie am liebsten ins Gesicht geschlagen. Ein paar Haare an seiner Schläfe glänzten silbrig. Er wurde grau, ein grauer, bissiger Wolf. Fast hätte diese Beobachtung sie zum Lachen gebracht, aber dann stand sie wortlos auf und ging zu dem Stuhl hinüber, auf dem ihre Kleider lagen. Noch nie war sie sich unter seinem Blick so schutzlos vorgekommen. Sie spürte selbst, wie mager und bleich sie geworden war. Seine dunklen -Augen verfolgten sie, als seien sie zwei Waffen, die sie töten könnten.
Nachdem sie ihren Slip und das T-Shirt angezogen hatte, fühlte sie sich zu ihrem Erstaunen ein wenig sicherer. Sie drehte sich zu ihm um, streifte sich ihre Hose über, und dann sprach sie diesen Satz aus, der sie hinterher selbst überraschte. »Mike«, sagte sie ein wenig keuchend vor sich hin, »mit dreißig muss ein Mensch etwas gefunden haben, an das er glaubt, doch du glaubst an gar nichts, nicht einmal an dich selbst.«
Er hatte spöttisch aufgelacht, aber gleichzeitig, als hätten ihn ihre Worte schmerzhaft getroffen, hatte er sich abgewandt und ihr seinen nackten Rücken zugekehrt.
Später am Bahnhof hatte sie gemerkt, dass er den vorletzten Fünfzig-Euro-Schein aus ihrem Portemonnaie genommen hatte, während sie im Bad gewesen war, aber dieser kleine Diebstahl hatte ihre Wut nicht neu entfachen können. Sie hatten sich ohne ein Wort, allein mit einem kalten, abschätzigen Blick verabschiedet.
Mike hat nicht geglaubt, dass ich wirklich gehen würde, dachte Nora. Plötzlich entdeckte sie doch einen hellen Stern am Himmel und den halbrunden Mond, der wie durch einen Schleier aus Wolken zu sehen war. Ein gutes Zeichen, fand sie, als leite sie ein Stern.
In Hannover stiegen noch zwei Fahrgäste zu. Dann wurde das Licht heruntergeschaltet; Stille senkte sich über den Wagen. Selbst die Kräfte der vier Japanerinnen waren erlahmt. Eine schlief mit offenem Mund und schnarchte vornehm asiatisch vor sich hin.
Zwischendurch war es so dunkel um sie herum, dass Nora glaubte, überhaupt nicht von der Stelle zu kommen oder in einem Raumschiff zu sitzen und durch das schwarze Weltall zu fliegen. Doch eigentlich war es eher eine Zeitreise – vom lauten, nervösen Berlin zurück ins stille, beschauliche Königswinter am Rhein. Über neun Jahre war sie nicht mehr in dem Haus am Fluss gewesen. Nein, einmal war sie drei Tage zu Weihnachten gekommen, und vor drei oder vier Jahren, in einem verregneten Sommer, hatte sie ihre Tante auf der Durchreise nach Frankreich besucht – mit rotgefärbten Haaren und ihrem neuen Tattoo auf der Schulter, das aber nur aufgemalt gewesen war. Keiner hatte sie erkannt, und keinem, den sie näher gekannt hatte, war sie begegnet.
Ansonsten war ihr eine Rückkehr immer zu beschwerlich gewesen. Manche Lügen ließen sich lediglich aus der Entfernung ohne größere Schwierigkeiten aufrechterhalten. Gelegentliche Telefonate konnte man mit leichter Hand erledigen. Ja, sie war nach der Schauspielschule tatsächlich Schauspielerin geworden. Ja, sie spielte meistens Theater und war auch schon in einem Videoclip aufgetreten. Ja, wenn sie einmal eine größere Rolle im Fernsehen bekäme, würde sie der Tante Bescheid sagen. Außer der Geschichte mit dem Videoclip war alles gelogen. Nach der Schauspielschule hatte sie einige Male bei freien Theatern und Produktionsfirmen vorgesprochen, aber man hatte ihr nur gelegentlich eine Rolle als Komparsin angeboten. Nicht einen einzigen Satz hatte sie bisher auf einer Bühne aufsagen dürfen. Auch dass sie noch immer Klavier spielte, war eine Lüge. In Wahrheit hatte sie wegen Mike vor zwei Jahren sogar ihren Job als Pianistin in einem noblen Restaurant am Gendarmenmarkt verloren. Freitags abends hatte sie sich da an ein Keyboard gesetzt und süßliche, unaufdringliche Melodien vor sich hin gespielt. Irgendwann aber war Mike aufgetaucht, war zeternd und polternd durch das Lokal gelaufen und hatte sie beschimpft, sie mache sich vor Parteibonzen und Arschkriechern zum Affen. Natürlich war das Unsinn; die Gäste im Restaurant be-achteten sie gar nicht; ihr Spiel war so eine Art gefälliges Geräusch im Hintergrund gewesen, wie das un-aufhörliche Plätschern eines Wasserfalls, nur ein wenig vornehmer und kultivierter. Doch so war Mike manchmal oder glaubte, es sein zu müssen – laut, rebellisch und ungerecht. Der Geschäftsführer hatte sie ausbezahlt und Mike und ihr dann Lokalverbot erteilt. Lächerlich, als wären sie freiwillig in so einen Nobelschuppen gegangen.
Nora hatte keine Ahnung, ob sie überhaupt noch ein vernünftiges Lied zustande brachte, aber nun würde sie Klavierlehrerin werden. Zumindest solange ihre Tante im Krankenhaus bleiben musste.
Verschwommen sah sie ihr Spiegelbild im Fenster; es war, als blicke eine heimliche Zwillingsschwester sie aus der Nacht heraus an. Dann schloss sie die -Augen und lauschte dem Rumpeln und Rauschen des Zuges.
Als Nora erwachte, glänzte der Himmel in einem satten, tiefgründigen Blau. Sie brauchte einen Moment, um sich zu orientieren, und tastete nach Mike neben sich, aber ihre Hand griff ins Leere. Dann erst fiel ihr ein, wo sie sich befand. Sie richtete sich auf und erblickte den kleinen Japaner neben sich. Er hockte auf dem Boden und studierte ein paar Notenblätter, die offenbar von Noras Sitz gerutscht waren.
Mit einem Lächeln hielt er sie ihr hin. »You are a piano player«, sagte er. »Great!«
Sie nickte und nahm die Blätter entgegen. In der Nacht hatte sie sich ihr altes Übungsheft angeschaut. Am Rande hatte sie noch die krakeligen Anmerkungen ihrer Tante entdeckt.
»Do you have a concert in Cologne?«, fragte der Japaner, während er sich aufrichtete. Er sah sie mit einem ehrfürchtigen Funkeln an, als habe er tatsächlich eine berühmte Pianistin vor sich.
»Yes«, erwiderte Nora. » Tonight I play a concert on television.«
Der Japaner neigte den Kopf und lächelte noch eine Spur intensiver, dann wandte er sich wieder seinen vier Begleiterinnen zu und schnatterte ihnen fröhlich etwas zu. Ein helles, vierstimmiges Lachen antwortete ihm.
Eine berühmte Pianistin im Fernsehen – ich lüge zu gerne, dachte Nora. Die Lüge hatte zu ihrem Leben mit Mike gehört. Wenn man Leute traf, die man noch nicht kannte, entwarf man sich zunächst eine neue Biographie. Das machten viele Leute, Mike jedoch war ein Meister darin. Was hatte er nicht alles vorgegeben zu sein? Schauspieler, Maler, Fotograf, Konzeptkünstler. In seinen Lügen hatte er wirklich Phantasie gehabt. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er ihr erzählt, er sei Boxer, sein erster Profi-Kampf stehe unmittelbar bevor. Dabei hatte er lediglich in einer Bar als Türsteher gearbeitet und am Wochenende Häuser renoviert. Später, nach der dritten gemeinsamen Nacht war es ihr gleichgültig gewesen, nein, eigentlich hatte es ihr sogar gefallen, dass er sich eine Lüge hatte einfallen lassen, um sie, das in seinen Augen sanfte, blonde Mädchen, zu beeindrucken.
Die Japaner schnallten sich kichernd ihre Ruck-säcke auf, und Nora bemerkte, wie der Zug über den Rhein fuhr und auf den Kölner Dom zusteuerte. Der Fluss sah im frühen Sonnenlicht aus, als habe man silberne Perlen über ihm ausgeschüttet. Möwen tanzten in der Luft. Zum ersten Mal freute sie sich, bald im Haus ihrer Tante zu sein. Fast wie eine richtige Heimkehr, dachte sie. Niemand außer Mike wusste, dass sie schwanger war.
Sie nahm ihre Notenblätter, steckte sie in ihre Tasche und strich sich über ihr kurzes Haar. Dann schaltete sie ihr Telefon an. Zehn Minuten nach Mitternacht war eine Kurzmitteilung eingegangen. »Komm zurück«, hatte Mike geschrieben, »ich kann ohne dich nicht leben.«
2
In Königswinter war der Himmel aus Beton. Zumindest hatte Nora immer diesen Eindruck gehabt, wenn sie aus dem Zug stieg. Eine Autobahnbrücke zog sich am Rand der Stadt dahin. Tag und Nacht hing das monotone Rauschen des Verkehrs in der Luft. Nachdem sie eine Weile vergeblich nach ihrer Tante Ausschau gehalten hatte, lief Nora die Straße hinunter, die an den Gleisen entlangführte. Wie eine Schlafwandlerin kannte sie ihren Weg, als habe sie die Stadt niemals wirklich verlassen. Ein Zug raste donnernd vorbei; in ihrer Kindheit hatte der Lärm, den die Züge in der engen Schlucht zwischen den Häusern verursachten, sie so erschreckt, dass ihr vor Angst die Tränen gekommen waren, und später, in der Nacht vor ihrem sechzehnten Geburtstag, war Lukas, der verdammte, alberne Lukas aus ihrer Klasse, an der Bahnschranke auf die Gleise gelaufen und hatte seinen Kopf auf die Schienen gelegt, um ihr zu beweisen, dass er sie liebte. Eine Mutprobe, die ihn beinahe den Kopf gekostet hätte. Er hatte so lange gezögert, bis er sich herumwarf, dass er fast von einem Güterzug überrollt worden wäre.
Das Haus ihrer Tante schien verlassen. Ein paar Kinder hüpften mit Schulranzen auf dem Rücken über die Straße, ansonsten entdeckte Nora lediglich eine alte Frau, die mit einem Besen vor einer halb offenen Haustür stand und ihr misstrauisch nachblickte. Ihre Tante schien ihre Ankunft vergessen zu haben. Dann fiel Nora ein, dass sie vielleicht zu spät gekommen war. Vielleicht war Hanna schon tot; ihr krankes Herz hatte sie im Stich gelassen, bevor die Ärzte sie hatten operieren können. Oder vielleicht hatte sie nicht geglaubt, dass Nora wahrhaftig kommen werde.
»Es handelt sich um einen Notfall«, hatte Hanna ihr vor drei Tagen am Telefon gesagt. »Ich bin noch nie richtig krank gewesen, aber nun brauche ich jemanden, der mich für zwei, drei Wochen bei meinen Schülern vertritt.« Ihre Stimme hatte noch leiser und zaghafter als gewöhnlich geklungen. Es gab ein paar Dinge auf der Welt, die sie perfekt beherrschte: Klavier spielen, beten, Blumen trocknen und Apfelkuchen backen; jemanden um einen Gefallen zu bitten gehörte eindeutig nicht dazu. Für Noras Zögern und ihre Ausflüchte hatte sie auch sofort Verständnis gehabt. Plötzlich war ihr Zustand nicht mehr so bedrohlich, und ihre Schützlinge konnten ebensogut eine Weile ohne sie auskommen. Nora erinnerte sich, dass die letzte große Bitte ihrer Tante fast zwanzig Jahre zurücklag. »Geh zum Grab deiner Eltern«, hatte sie kurz vor Weihnachten gesagt, während es regnete und ein heftiger Sturm über das Land zog. »Vergiss sie nicht!« Sie selbst besuchte mindestens einmal in der Woche das Grab ihrer Schwester, gleichgültig, ob es schneite, stürmte oder eine mörderische Hitze herrschte.
Die Bahnschranke war wie üblich geschlossen. Links führte eine schmale Straße zum Drachenfels. Noch war es zu früh für die Touristen, den Berg hinaufzupilgern, um von dort die Aussicht auf das Rheintal zu genießen. Nora wandte sich nach rechts und sah zum Fluss hinunter. Auch die Andenkenläden hatten noch geschlossen. Die Auslagen hatten sich nicht verändert. Immer noch wurden kitschige Porzellan- oder Zinnteller angeboten, billige Rheinromantik auf Postkarten und Burgen und Kirchen aus Plastik. Nur die Autos, die in den Straßen parkten, sahen anders aus als bei ihrem Weggang vor neun Jahren, und von einigen Fassaden blätterte der Putz. In zwei Schaufenstern las sie die handgeschriebenen Schilder »Zu vermieten«. Die Zeit war nicht stehengeblieben, aber der Stadt hatte sie nicht gutgetan.
Am Ende der Gasse, jenseits der Hauptstraße, lag schimmernd der Rhein. Sie hatte seinen Geruch schon am Bahnhof wahrgenommen. Nach Wind, Seetang und nassem Sand roch der Fluss. Diesen Geruch würde sie niemals vergessen, nicht einmal, wenn sie fünfzig Jahre in der Wüste leben würde. Auf der Uferpromenade sammelte ein Straßenkehrer Papier auf. Eine alte Frau schob einen Holzkarren, auf dem sich anscheinend alle ihre Habseligkeiten befanden. In Berlin war Nora an den Anblick von Obdach-losen gewöhnt gewesen; hier jedoch irritierte er sie. Träge und zugleich imposant floss der Rhein dahin. Wie ein lebendiges, gigantisches Fabeltier kam er ihr vor, ein ewiges Wesen, das immer gleich war und sich doch mit jeder Sekunde veränderte. Nachts hatte sie bei Mondlicht oft am Ufer gesessen und dem Rhein ihre Geheimnisse anvertraut; auch ihren ersten Kuss hatte der Fluss mit angesehen. Lukas hatte sich unvermittelt über sie gebeugt, er hatte nach Minze gerochen und sie unsicher angelächelt, bevor er seine Lippen auf ihren Mund gepresst hatte. Es hatte sich eher wie eine Kollision denn wie eine zärtliche Berührung angefühlt.
Der Fährmann war der erste, den sie wiedererkannte. Er stand an der Rampe und blickte zur Hauptstraße. Sie wusste seinen Namen nicht mehr und war auch nicht sicher, ihn jemals erfahren zu haben; trotzdem war er ein fester Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. Von ihrem Fenster aus hatte sie beobachten können, wie die Fähre viermal in der Stunde den Fluss kreuzte und auf der anderen Seite in Bad Godesberg festmachte. Noch immer trug der Fährmann eine schwarze Schirmmütze und eine blaue Joppe. Er musste weit über sechzig sein, ein alter Kapitän, der nie auf große Fahrt gegangen war. Als sie ihn grüßte, winkte er ihr zu, aber so mechanisch und unbestimmt, wie man den Gruß einer fremden Passantin erwidert. Dann wandte er sich ab und ging zu seinem Führerhaus. Auch wenn die Fähre leer war, musste er den Fahrplan einhalten und zum anderen Ufer übersetzen.
In der Straße ihrer Tante fielen Nora drei blütenweiße Schmetterlinge auf, die sich aus einer Wiese erhoben und zu Hannas Haus hinüberflatterten. Sie bewegten sich so gleichförmig, als seien sie gar nicht echt. Nora erinnerte sich, dass sie einmal, um -Lukas zu ärgern, einen Schmetterling gefangen, in den Mund genommen und gegessen hatte. Pelzig, wie ein besonders trockenes Stück Löschpapier hatte der Schmetterling geschmeckt.
Das Haus hatte sich nicht verändert: eine graue Fassade mit grünen Fensterläden, die dringend einen neuen Anstrich gebraucht hätten. Allein die beiden Kastanien am Ende des Gartens hatten sich mächtig ausgebreitet und warfen einen einzelnen langen Schatten. Als Nora klingelte, öffnete niemand. Sie rief den Namen ihrer Tante und zog, während sie um das Haus ging, ihr Mobiltelefon hervor. Zwei weitere Kurzmitteilungen waren eingegangen, die sie jedoch nicht beachtete. Ein paar Momente nachdem sie die Nummer ihrer Tante eingetippt hatte, hörte sie, wie ein schrilles Läuten durch das Haus drang. Dieses Geräusch hätte unweigerlich jeden aus dem letzten Winkel herangerufen, aber niemand hob ab. Nora drückte ihr Gesicht an die Terrassentür. Wieder stieg ein ungutes Gefühl in ihr auf: Im Geiste sah sie ihre Tante vor Schmerzen zusammengesunken am Klavier hocken oder reglos, mit verrenkten Gliedern auf dem Teppich liegen. Innen war nichts Auffälliges zu erkennen. Alles stand an seinem Platz: die Standuhr, die alte Couch mit dem Bezug aus braunem Cord, der schmale Holztisch, auf dem wie üblich Zeitschriften und Bücher lagen, sowie der Ledersessel neben der Leselampe. Der Anblick beruhigte Nora ein wenig, dann ging sie zur Kellertreppe. Wie vor neun Jahren fand sie unter einer rostigen Dose den Kellerschlüssel. Sie schloss die Tür auf und betrat das Haus.
Eine tiefe, irgendwie unheilvolle Stille wehte ihr entgegen. Nach wenigen Schritten durch die Wohnung bemerkte sie, dass ihre Tante anscheinend überstürzt aufgebrochen war. In der Diele stand ein gepackter Koffer, und auf dem Küchentisch lag eine saubere Liste ihrer Klavierschüler, die sie aber nicht zu Ende geführt hatte. Dreizehn Namen zählte Nora, doch nur hinter die ersten drei hatte Hanna Bemerkungen geschrieben – über das bisherige Pensum ihrer Schüler, wann sie ihre Stunde hatten und die Stücke, die sie üben sollten. Dann entdeckte sie vor der Spüle eine zerbrochene Kaffeetasse und einen Rest Kaffee auf dem Linoleumboden. Niemals wäre ihre Tante aus dem Haus gegangen, ohne die Scherben zu beseitigen. Auch eine leere Einwegspritze und eine achtlos weggeworfene Plastikhülle lagen auf dem Boden.
Nora nahm ihr Telefon hervor, doch dann fiel ihr niemand ein, den sie anrufen und um Rat fragen konnte. In Berlin wäre alles anders gewesen. Mike wäre sofort gekommen. Ihn hätte sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen können. Nein, den Gedanken an Mike verbot sie sich. Sie ging in das Klavierzimmer, den größten Raum im Haus. Hier stand der kostbarste Gegenstand, den es im Haus gab: ein Bechstein-Flügel, dem man sein hohes Alter nicht ansah.
Obwohl kein Sonnenlicht ins Zimmer fiel, glänzte das Klavier, als sei es aus schwarzem Marmor. Nora nickte ihm zu, wie einem alten Bekannten, den sie lange nicht gesehen hatte. Der Hocker knarrte leise, als sie sich setzte. Dann legte sie ihre Hände auf die Tasten und starrte müde vor sich hin. Ich muss die Polizei anrufen, dachte sie.
Er wusste selbst, dass er einem Wahn verfallen war und dass er früher oder später einen Fehler machen würde. Dann käme alles ans Licht und er geriete ernsthaft in Schwierigkeiten. Kaum, dass Tom seine Schultasche genommen hatte und aus dem Haus war, lief er in den Ort hinunter. Er stellte seinen Wagen immer unten an der Uferpromenade ab, niemals in der Nähe des Hauses. Eine Vorsichtsmaßnahme, sagte er sich. Ein Krankenwagen jagte mit Blaulicht am Fluss entlang, als er den Wagen startete. Wenn er sich beeilte, konnte er in dreißig Minuten in Köln sein. Nachts ging es sogar noch schneller.
Nicht einmal im Auto schaltete Georg das Radio an. Er wollte nichts hören, keine Musik, keine Nachrichten, nur den unvermeidlichen Fahrtwind und das monotone Geräusch des Motors. Obwohl er es eilig hatte, fuhr er vorsichtig, um kein Aufsehen zu erregen. Erst nach fünfzig Minuten war er in Köln, weil es an der Abzweigung zum Flughafen einen Stau gegeben hatte. Auf dem Postamt in der Nähe seiner alten Wohnung vergewisserte er sich, dass sich niemand besonders augenfällig für ihn interessierte, dann holte er drei Briefe ab. Noch immer gingen alle Schreiben, die an ihn adressiert waren, an ein Postfach. Nicht einmal Leggewie, seinem ehemaligen Agenten, hatte er seine neue Anschrift verraten.
Anschließend fuhr er in die Pfeilstraße; es war zwanzig Minuten nach neun. Die meisten Geschäfte hatten noch nicht geöffnet. Er hatte Glück und konnte so parken, dass er Eileens Laden im Blick hatte. Ihr Vorname stand in großen, roten Buchstaben über der Boutique. Es wirkte protzig und unpassend, genau wie die riesigen Spiegel im Schaufenster, die sie um ihre Modepuppen aufgestellt hatte. Eileen übertrieb zu gerne; an einer zweitklassigen Kölner Einkaufsstraße tat sie so, als sei sie im Quartier Latin in Paris.
Sie kam um fünf vor zehn. Obwohl es für einen Tag im September sehr warm war, ging sie ein wenig vorgebeugt, als fröstelte sie. Sie war allein, kein männlicher Beschützer an ihrer Seite. Von Viktor Brun, dem Mann, den er hasste und am liebsten getötet hätte, war nichts zu sehen. Ihre langen blonden Haare hatte Eileen mit einem gelben Band zu einem Zopf zusammengebunden. Die leichte Bräunung ihrer Haut verriet, dass sie neuerdings in ein Sonnenstudio ging. Ansonsten wirkte sie noch schlanker als früher. Mit einer ruhigen, geschäftsmäßigen Bewegung schloss sie die gläserne Ladentür auf, dann schaute sie sich kurz um, und er wandte hastig den Kopf. Ahnte sie, dass er ihr manchmal auflauerte, dass er wissen wollte, was sie tat und mit wem sie sich traf?
Bei seinem ersten heimlichen Besuch war Eva, ihre Schwester, bei ihr im Geschäft gewesen. Eva sah aus wie eine in die Jahre gekommene Tänzerin, hager und unerbittlich, mit dunklen, streng zurückgekämmten Haaren. Er erinnerte sich nur noch ungern daran, dass er einmal mit ihr geschlafen hatte, als Eileen schwanger gewesen war. Damals hatte er seinen ersten kleinen Auftritt in der Oper gehabt, und Eva hatte mit ihm gefeiert. Er hatte es aus Dankbarkeit getan, hatte er sich hinterher gesagt. Mehr als Eileen hatte Eva an ihn geglaubt und ihm, weil sie Dramaturgin am Schauspielhaus war, einen Termin zum Vorsingen verschafft. Später hatte sie ihn manchmal nachts angerufen, wenn sie wusste, dass er allein war. Sie trank zu viel und hatte das Talent, sich immer die falschen Männer auszusuchen.
Als er zwei Tage später wieder auf der Lauer lag, war Eileen aus ihrem Laden gestürmt, genau auf ihn in seinem Wagen zu. Georg war so verwirrt gewesen, dass er zu keiner Regung fähig gewesen war, doch sie war mit einem angestrengten Lächeln an ihm vorbeigelaufen und hatte einer Frau, die in ihrem Geschäft gewesen war, eine vergessene Einkaufstüte hinterhergebracht. Trotzdem glaubte er zu wissen, dass sie seine Gegenwart erahnen konnte.
Nachdem Eileen in ihrem Geschäft verschwunden war, atmete er unwillkürlich auf. Er konnte nichts dagegen tun, dass sich sein Herzschlag beschleunigte, sobald er sie sah. So war das mit Liebe und Hass. Er hatte sie geliebt, und sie hatte sein Leben zerstört. Um zwanzig nach zehn betrat die erste Kundin das Geschäft, eine ältere, sehr gepflegte Frau, die zielstrebig, ohne einen Blick auf die Kleider in den Schaufenstern zu werfen, die Eingangstür ansteuerte. Genau dreiundzwanzig Minuten später tauchte sie wieder auf. Eileen begleitete sie zur Tür und küsste sie auf die linke Wange. Die Frau trug in jeder Hand eine weiße Tüte mit der roten Aufschrift Boutique Eileen.
Ihm gefiel es, Eileen zu beobachten. Wenn er sie so sah, dann war sie doch kein Dämon, sondern eine schöne Frau, in die man sich mit Leichtigkeit verlieben konnte. Mit geschlossenen Augen konnte er sich auch eine ganz andere Wirklichkeit vorstellen. Da wäre er ausgestiegen, wäre lächelnd über die Straße gelaufen, hätte sie umarmt und auf den Mund geküsst. Zwei weitere Frauen betraten den Laden. Er sah Eileen wie einen Schatten von einer zur anderen eilen. Zwischendurch trank er einen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Sein Hals schmerzte wieder. Dann, während ein Lieferwagen vor dem Laden stoppte, fiel sein Blick auf die drei Umschläge, die man ihm auf dem Postamt übergeben hatte. Obschon er seine Post regelmäßig abholte, hatte er sich seit einiger Zeit angewöhnt, keine Briefe mehr zu öffnen. Der erste trug einen amtlichen Stempel, und Georg legte ihn sofort beiseite. Der zweite stammte von Leggewie und interessierte ihn ebenfalls nicht. Den dritten hatte Eileen geschrieben. Sie musste sich vor einiger Zeit seine Postanschrift vom Büro der Oper besorgt haben.
Eileen war ungewohnt hartnäckig: Es war der vierte Brief innerhalb von zwei Wochen. Dabei musste sie eigentlich wissen, dass er keinen Brief -lesen würde, der ihren Namen als Absender trug. Sie war eine Lügnerin, jedes Wort, das sie sagte oder schrieb, diente nur dazu, alle Schuld von sich zu weisen. Der Umschlag fühlte sich an, als sei er leer. Er hielt ihn gegen das Licht und tastete ihn vorsichtig ab. Warum schickte sie ihm einen leeren Umschlag? Als er ihn zurücklegen wollte, bemerkte er, dass sie die Lasche nicht zugeklebt hatte. Der Brief bestand nur aus einem schmalen Zettel, kaum größer als eine Briefmarke. Georg, stand da in ihrer wunderschönen, grazilen Handschrift, wir müssen überTOMreden.
Sie brauchte keine langen Erklärungen, um eine Drohung auszustoßen. Es reichte bereits, wenn sie in Großbuchstaben den Namen ihres Sohnes aufschrieb. Er spürte, wie sich sein Herzschlag erneut beschleunigte, und drehte den Zündschlüssel herum, als sei er auf seinem Beobachtungsposten entdeckt worden und müsse plötzlich fliehen. Es war Viertel nach elf. Er dachte an Tom und wusste, dass sein kurzer, falscher Frieden zu Ende war.
3
Nora öffnete alle Fenster, als sei das Haus viel zu lange unbewohnt gewesen. Sie war einigermaßen beruhigt. Die Polizei hatte Bescheid gewusst. Um sieben Uhr dreiundfünfzig war ein Notruf eingegangen. Ihre Tante hatte einen Schwächeanfall erlitten und war nach Bonn in die Universitätsklinik eingeliefert worden. Eine genauere Auskunft konnte man nicht erteilen, und in Bonn befand sich Hanna noch in der Aufnahme. »Es besteht keine Lebensgefahr«, erklärte eine Krankenschwester in routiniertem Tonfall. »Bleiben Sie zu Hause und rufen Sie später wieder an.«
Als Nora sich genauer im Haus umsah, bemerkte sie, dass ihre Tante alt geworden sein musste, nicht nur, weil sich ein unangenehmer, muffiger Geruch eingeschlichen hatte. Das Bad war schmutzig, graue, leicht gelockte Haare lagen im Waschbecken, und die Seife war vollkommen verklebt. So etwas wäre Hanna früher nie durchgegangen. Auch die Küche machte lediglich auf den ersten Blick einen aufgeräumten Eindruck. Die Blumen in der Vase drohten zu vertrocknen, Zeitschriften waren unter die Sitzbank gefallen, und im Schrank standen Tassen mit Kaffeeflecken. Als sei es gar nicht das Herz, sondern die Augen, die ihrer Tante zu schaffen machten. Trotzdem hatte Nora das Gefühl, in ihre Kindheit zurückgekehrt zu sein. Bevor sie nach Berlin gegangen war, hatte sie kaum etwas anderes gekannt als dieses Haus. Ihre Welt war sehr klein gewesen. Schon eine Fahrt nach Bonn oder in die Philharmonie nach Köln war ihr damals wie eine weite, abenteuerliche Reise erschienen. Da ihre Tante geschworen hatte, niemals mehr Auto zu fahren, hatten sie alles auf beschwerliche Weise mit der Bahn erledigen müssen.
Ihr Zimmer in der ersten Etage sah beinahe genauso aus, wie sie es vor neun Jahren verlassen hatte. Ein typisches Mädchenzimmer. Sogar die Bilder hingen noch an der Wand, billige, ausgeblichene Kunstdrucke von van Gogh und Dalí. Das Nachtcafé und die zerlaufene Uhr, die über einem Ast hing. Dabei war ihr damals überhaupt noch nicht bewusst gewesen, wie flüchtig und kostbar die Zeit war. Die Zeit war vergangen, damit man endlich in der eigenen, wunderbaren Zukunft ankam. Nun war sie fast dreißig, und aus ihr war keine große Pianistin, keine Tänzerin, keine Schauspielerin geworden.
Auf ihrem kleinen, schäbigen Holzschreibtisch lagen noch ganz verstaubt ein Notenheft und ein -Taschenbuch: Das Tagebuch der Anne Frank. Die anderen Bücher und Zeitschriften, die sie las und die ihrer Tante nicht ganz so gefielen, hatte sie immer unter ihrer Matratze verstecken müssen. In ihrem Nachttisch fand sie ihren alten Kassettenrekorder, den sie sich mit vierzehn von ihrem ersten selbst verdienten Geld gekauft hatte, und ein paar Kassetten. Als sei es ein Spiel, in der eigenen Vergangenheit herumzustöbern, legte sie eine Kassette ein und schaltete das Gerät ein, das zu ihrem Erstaunen sofort ansprang. Plötzlich hörte sie sich selbst Klavier spielen. Es knisterte und rauschte, und sie versuchte sich ungelenk und mit zahlreichen Stolperern an einem Walzer von Grieg. Mit dem Rekorder und einem winzigen Mikrophon in der Hand hatte ihre Tante neben ihr gestanden und ihr im Takt freundlich zugenickt. Da hatte sie noch gehofft, dass Nora aus ihrem Talent etwas machen werde.
Nur der Blick aus dem Fenster hatte sich verändert. Der Rhein lag nun hinter den beiden Kastanien verborgen. Die Schreie der Möwen drangen mit dem Wind herüber. Der Garten machte ebenfalls einen ungepflegten Eindruck. Das Gras stand hoch, und in den Blumenbeeten wucherte Unkraut. Nora räumte die wenigen Sachen, die sie mitgenommen hatte, in ihren alten Kleiderschrank, und dann ging sie in den Garten hinunter. Zwischen den Kastanien, dort, wo sie vor zwölf Jahren Charlie, ihren Kater, begraben hatte, stand eine grüne Holzbank, die sie noch nicht kannte. Sie setzte sich und hätte sich am liebsten eine Zigarette angesteckt, dabei hatte sie das Rauchen vor drei Wochen aufgegeben, ohne dass es Mike aufgefallen war. Früher hatte sie auch heimlich im Garten geraucht. So blau wie über dem Rhein war ihr der Himmel in Berlin nie vorgekommen. Überhaupt wirkten die Farben hier ganz anders. Das Grün der Kastanien war viel kräftiger und dunkler, und daran, wann sie das letzte Mal einen Schmetterling gesehen hatte, konnte Nora sich gar nicht mehr erinnern. Ein weißer Falter stand flügelschlagend vor ihr in der Luft, als nehme er Witterung auf oder als betrachte er sie. Das Klingeln ihres Mobiltelefons vertrieb den Schmetterling.
Sie hatte das Bild ihrer zerbrechlichen, grauhaarigen Tante vor Augen, die in einem Krankenbett lag und mühsam einen Telefonhörer hielt, aber sie irrte sich. Hanna hätte sie nicht auf dem Handy angerufen.
»Na, also«, sagte Mike. »Wo bist du? Wann kommst du zurück?«
So klar wie niemals zuvor begriff Nora, was ihr an Mike nie gefallen hatte. Er konnte sanft und verständnisvoll sein, aber meistens behandelte er Menschen, die ihm nahestanden, wie seinen Besitz.
»Ich bin nirgendwo«, sagte sie leise und vollkommen ernst.
Er lachte, als habe sie sich einen Scherz erlaubt, und sie hörte, wie er sich eine Zigarette anzündete. Er war ihr auf einmal so nah, dass sie glaubte, seinen Geruch wahrzunehmen. Er war vor ein paar Minuten aufgestanden, hatte geduscht und roch nach Seife und Kaffee. Im Hintergrund lief Radiomusik.
»Wir sollten unseren kleinen Streit vergessen«, sagte er wie beiläufig. »Ich habe einen richtig guten Auftrag bekommen: vier Zimmer in Friedrichshain, tapezieren, Leitungen verlegen, bringt locker zweitausend Euro. Danach können wir eine Woche in Urlaub fahren, wenn wir wollen.«
»Nein«, sagte sie. »Ich will nicht in Urlaub fahren.« Sie schloss ihre Augen und hielt ihr Gesicht in die Sonne. Plötzlich spürte sie den Geruch des Wassers noch intensiver.
Mike lachte wieder, nun aber, um seine Verlegenheit zu überspielen. Als irgendwo auf dem Rhein ein Schiff ein lautes, warnendes Hupen ausstieß, fragte er irritiert: »Bist du gar nicht in Berlin?« Er war tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, sie könnte wirklich wegfahren und die Stadt verlassen.
Sie schwieg und hielt die Augen geschlossen. Zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass sich das Kind in ihrem Bauch regte, aber das war wahrscheinlich Einbildung. In der zwölften Woche war das Kind noch viel zu winzig, als dass man es hätte spüren können.
»Warum sagst du mir nicht, wo du bist? Bist du bei einer Freundin, oder hast du dir ein Hotelzimmer gemietet?« Seine Stimme klang auf einmal ungewohnt flehend. »Ich habe vielleicht ein wenig zu heftig reagiert, aber ich war überrascht … Ich meine, wir sollten …« Er verstummte, weil er das Wort »Kind« nicht über seine Lippen brachte. Fast sechs Wochen hatte sie gezögert, bis sie es ihm gesagt hatte, und ihm war nichts anderes eingefallen, als von einer Abtreibung zu reden. Ab wann war ein Kind ein Kind, das man nicht mehr wegmachen konnte?
Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, dass der weiße Falter zurückgekehrt war und sich neben ihr auf der Bank niedergelassen hatte. Reglos, wie eine schöne, seltene Blume saß er da.
»Ich möchte, dass du mich eine Weile in Ruhe lässt«, sagte Nora leise und mit einer Entschlossenheit, die sie Sekunden vorher noch nicht gehabt hatte. »Ruf im ›Cibo matto‹ an und erkläre ihnen, dass ich nicht mehr kommen werde. Sie sollen sich eine neue Kellnerin suchen.«
Sie hörte, wie Mike tief Luft holte. Dann fragte er wütend: »Machst du Witze?«
»Nein«, sagte sie und unterbrach die Verbindung.
Für ein paar Momente empfand Nora eine Erleichterung, die sie ganz übermütig machte. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Vielleicht war es kein Zufall gewesen, dass ihre Tante sie ausgerechnet jetzt gerufen und um ihre Hilfe gebeten hatte. Sie zog ihre Schuhe aus und kletterte in die größere der beiden Kastanien hinauf. Von Ast zu Ast zog sie sich, stützte sich mit den nackten Füßen ab. Ein leichter Wind glitt durch die Blätter, und dann hockte sie in der Baumkrone wie auf dem Mast eines Schiffes. Unvermittelt, ohne darüber nachzudenken, begann sie, mit ihrem Kind zu reden, als habe sie nun seine Anwesenheit registriert. Sie erzählte ihm, was sie sah: den Fluss, der wie ein glänzendes Band vor ihr lag, ein weißes Ausflugsschiff mit winkenden Passagieren, das sich langsam vom Ausleger entfernte, und die Promenade, wo ein Mann mit zwei schwarzen Hunden spazierenging. Nie hatte sie in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, so ganz bei sich zu sein. Doch nun gab ihr Kind ihr wieder einen Sinn, etwas, das Mike niemals verstehen würde, selbst wenn er sich besonders verständnisvoll und sanftmütig gab.
In der Nacht, in der ihre Eltern gestorben waren, hatte sie auch frierend in einem Baum gehockt. Eigentümlicherweise hatte sie nur mit ihrer Mutter gesprochen, hatte ihr von ihrer Angst erzählt und sie gefragt, wo sie nun sei. Bist du ein Engel geworden oder vielleicht ein Vogel, der über den Wolken wohnt? Oder ein Wassergeist, der durch den Rhein schwebt? In der Phantasie einer Neunjährigen existierten Wesen, für die Erwachsene keine Verwendung mehr hatten. Unten in der Stadt hatte man sie gesucht und ihren Namen gerufen. Nora – wo ist die kleine Nora? Sie war so erschöpft gewesen, dass sie auf ihrem Baum eingeschlafen war. Ein Spaziergänger hatte sie am frühen Morgen auf dem Drachenfels in der Nähe der Burg entdeckt. Später war ihre Tante dagewesen und hatte ihr all das erklärt, was sie schon wusste und doch nicht begreifen konnte. Das Auto ihrer Eltern war von der Straße abgekommen, wahrscheinlich weil ein Sportwagen, der ihnen entgegengekommen war, sie geblendet hatte. Genaueres hatte die Polizei nicht herausgefunden. Ein Schuldiger war nie ermittelt worden.
In der Nacht auf dem Baum hatte sie keine Trauer empfunden, nicht einmal bei der Beerdigung, als sie beobachten musste, wie zwei dunkle Särge in einem noch dunkleren Erdloch verschwanden. Nein, ein anderes Gefühl war mit der Kälte unter ihre Haut gekrochen und hatte sie seither nicht mehr verlassen. Sehnsucht hieß dieses Gefühl oder Fernweh oder Nicht-bei-sich-Sein. Selbst in den ersten, glücklichen Nächten bei Mike war sie aufgewacht und hatte gedacht, ihre Koffer packen und verschwinden zu müssen, irgendwohin, aber natürlich hatte sie es nie getan.
In den Monaten nach dem Tod ihrer Eltern hatte Hanna es schwer mit ihr gehabt. Nora sagte kaum ein Wort und verschwand nach der Schule oft in die Wälder am Drachenfels, und wenn sie redete, dachte sie sich meistens Lügen aus. Eigentlich redete sie mehr mit den Vögeln und den Bäumen. Die Lehrer verloren schnell die Geduld mit ihr; allein ihre Tante schien ihren Schmerz und ihre Sehnsucht zu verstehen. Manchmal dachte Nora sogar, dass sie die Schuld am Tod ihrer Eltern trug. Viel zu spät waren die beiden am Abend des Unglücks losgefahren; ihr Vater hatte Nora angeschrien, weil sie nicht im Haus bleiben, sondern unbedingt mitkommen wollte. Die Adern an seiner Stirn hatten zu pulsieren begonnen, wie es immer geschah, wenn er sich aufregte. Er musste in die Philharmonie nach Köln. Zum ersten Mal sollte er die Geige am ersten Pult spielen. Während er sich mehr und mehr erregte, war ihre Mutter immer stiller geworden. Ihrem Mann zu sagen, dass sie zu Hause bleiben werde, hatte sie sich nicht getraut, obwohl genau dieser Wunsch in ihren Augen gestanden hatte. Wunderschön hatte sie in ihrem schlichten schwarzen Kleid ausgesehen, die blonden Haare streng nach hinten gekämmt. So würde ihre Mutter ihr immer in Erinnerung bleiben – wie sie in der Tür lehnte, einen traurigen Zug um den Mund, weil sie ihr Kind zurücklassen musste, und ihr einen Kuss zuhauchte.
Das laute Klingeln des Telefons drang aus dem Haus herüber. Nora erschrak in ihrem Kastanienbaum. Hatte Mike bereits herausgefunden, wo sie war und rief sie nun auf dem Anschluss ihrer Tante an? Vorsichtig stieg sie hinunter. Plötzlich hoffte sie, dass sie niemand beobachtet hatte. Es war töricht, wenn eine erwachsene Frau, die noch dazu ein Kind erwartete, in einem Baum herumkletterte. Das Telefon klingelte unaufhörlich weiter. Erst als sie die Terrasse erreicht hatte, verstummte es abrupt. So eine neumodische Einrichtung wie einen Anrufbeantworter besaß ihre Tante nicht. Vielleicht aber war es gar nicht Mike, sondern ein Anruf aus dem Krankenhaus gewesen? Aber nein, da hatte sie erst vor einer Stunde angerufen.
Das nächste Geräusch erschreckte sie noch mehr. Kaum war das aufdringliche Läuten des Telefons verklungen, schrillte die Türglocke. Fast, als treibe da jemand ein Spiel mit ihr, dachte Nora. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie zur Tür schritt und sie langsam öffnete. Beinahe erwartete sie, einen -Polizisten dort zu sehen, weil ein aufmerksamer Nachbar sie beobachtet und für eine Einbrecherin gehalten hatte. Doch es stand niemand vor der Tür. Eine einzelne Rose lag am Fuß der schmalen Treppe und eine Karte, auf der in kitschigen goldenen Lettern Herzlich willkommen zu lesen war. Nichts sonst, kein weiterer Gruß, keine Unterschrift.
Nora blickte die Straße hinunter. Unten am Fluss glaubte sie, den Schatten einer Person zu sehen, allerdings so weit entfernt, dass die Gestalt geflogen sein musste, wenn sie die Rose vor ihre Tür gelegt hatte.
4
In dem Schlafzimmer unter dem Dach konnte Georg kaum aufrecht stehen. Im Winter würde man es hier vor Kälte wahrscheinlich nicht aushalten. Weder in seinem noch in Toms Raum gab es eine Heizung. In dem Schuppen hinter dem Haus hatte er einen alten, zerschrammten Holztisch gefunden, den er vor das Fenster geschoben hatte. Ein idealer Ort, um zu arbeiten, hatte er sich eingeredet. Nur gelegentlich nahm er die Motoren der Reisebusse wahr, die dröhnend durch den Ort fuhren, oder die Stimmen einer besonders ausgelassenen Wandergruppe, die zum Drachenfels hinaufstieg.
Georg setzte sich an seinen Schreibtisch und versuchte sich zu konzentrieren, statt unentwegt an Eileen und ihren bedrohlichen Brief zu denken. In einer Stunde würde Tom aus der Schule kommen. Leggewie hatte ihn überredet, einen Auftrag anzunehmen, als sie sich in einem Café in Köln getroffen hatten. »Du musst etwas tun«, hatte er zu ihm gesagt und ihm beschwörend die Hände entgegengestreckt. »Außerdem wirst du das Geld gut gebrauchen können.« Leggewie war ein hässlicher Zwerg mit einem grauen Zopf und gelben Fingernägeln, weil er jeden Tag mindestens zwei Schachteln Zigaretten rauchte. Chancen und Schwierigkeiten roch er wie ein hungriger junger Wolf, obwohl er schon fast sechzig war. Mitunter jedoch leistete er sich eine sentimentale Schwäche und tat Dinge, die nichts mit Geld oder hübschen Kontobewegungen zu tun hatten. Ein anderer Manager hätte Georg längst fallengelassen. »Es ist eine ganz einfache Sache«, hatte Leggewie gesagt und seine fahlen, gelben Zähne zu einer Art von Lächeln entblößt. »Wird dir Freude machen, Georg, und dich auf andere Gedanken bringen.« Dann hatte er ihm ein Manuskript von knapp hundert Seiten in die Hand gedrückt.
Ein Sender plante, einen Film über Richard Tauber zu drehen, und er sollte das Drehbuch aus dem Englischen übersetzen. Leggewie redete und drängte, und um ihn zum Schweigen zu bringen, hatte Georg das Manuskript schließlich angenommen. Dabei konnte er Richard Tauber nicht leiden. Er war ein großer Sänger gewesen, gewiss, aber er war meistens den leichten Weg gegangen, hatte den Kitsch geliebt und sich in Operetten verloren. »Dein ist mein ganzes Herz« – Lehar zu singen war keine Herausforderung; da kam man mit Routine und ein paar handwerklichen Tricks durch, wenn es sein musste. Was die Stimme anging, waren die meisten Operetten nicht sonderlich anspruchsvoll.
Seit vier Wochen hatte Georg nicht mehr in das Manuskript geschaut. Zwei magere Seiten hatte er bisher übersetzt. Der Film begann in London an Taubers Totenbett. Der einstmals berühmte Sänger war pleite, konnte nicht mehr singen, sein Körper war voller Metastasen, zwei Frauen, die sich nicht ausstehen konnten, sahen ihm beim Sterben zu.
Eileen mochte Richard Tauber und besaß sogar ein paar historische Aufnahmen von ihm. Sie war es auch gewesen, die Georg überredet hatte, etwas anderes zu singen, und Leggewie hatte sich gleich daran gemacht, alles vorzubereiten, wie immer, wenn er ein besonders gutes Geschäft witterte. Er hatte sich mit einem Arrangeur zusammengesetzt, hatte eine Handvoll Musiker engagiert und ein Studio gebucht. Die ersten Lieder, alte Jazz-Songs, die sie aufgenommen hatten, waren tatsächlich gar nicht übel gewesen. Noch immer bedrängte Leggewie ihn, die Aufnahmen freizugeben. Vermutlich hatte er aus diesem Grund wieder einen Brief geschrieben.
Vorsichtig klappte Georg den Laptop auf, den Leggewie ihm mit dem Manuskript übergeben hatte, und schaltete ihn an. Der Text erschien auf dem Bildschirm, die zwei dürftigen Seiten leuchteten auf, doch statt mit der Übersetzung fortzufahren, schrieb er das Wort Katastrophe. Er reihte die Buchstaben aneinander, sodass sie zu einer scheinbar endlosen Kette von Zeichen wurden, die keine Bedeutung mehr besaßen.
Unten jaulte die Hündin freudig auf, als jemand die Tür leise öffnete. Tom war also pünktlich aus der Schule gekommen und trieb sich nicht wieder am Rhein herum. Der Junge verhielt sich schon beinahe genauso geräuschlos wie er. Georg wusste, dass er zu streng mit seinem Sohn war. Vielleicht sollte er mal mit ihm ins Kino gehen oder mit ihm eine Fahrt den Rhein hinauf machen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Jeden Abend lag Tom in seinem Bett und redete mit seiner Mutter, als sitze sie vor ihm und halte seine Hand, aber zumindest hatte er aufgehört, Fragen zu stellen. Anscheinend hatte er mit der Klugheit eines Neunjährigen begriffen, dass er warten musste und es auf seine Fragen keine Antworten gab.
Georg schaltete den Laptop wieder aus. Dann ging er die Treppe hinunter.
Tom stand an der Tür und erwartete ihn mit einem aufmerksamen Blick, jedoch ohne etwas zu sagen. Etwas war anders an ihm. Nicht nur, dass er eine Kappe auf dem Kopf trug, die Georg nicht kannte; es war seine Haltung, nicht so niedergeschlagen und gebückt wie in den letzten Wochen. Dann sah er, dass Tom nicht allein war. Ein blondes, etwa gleichaltriges Mädchen verharrte unschlüssig vor der Tür im Garten.
»Das ist Annika«, sagte Tom leise. »Sie geht in meine Klasse. Sie will mir das Zelt zeigen, das sie im Garten aufgebaut hat, und vielleicht auch ihre Zwergkaninchen.« Sein Tonfall verriet, wie unsicher er war. Sie hatten eine Abmachung getroffen: keine Besuche im Haus. Und nun hatte er dagegen verstoßen.
Das Mädchen hob die Hand und lächelte ängstlich vor sich hin. Sie trug rote, elegante Turnschuhe und hatte keine Schultasche bei sich. Georg lächelte nicht zurück, aber er nickte ihr zu, worauf sie hastig den Blick senkte, als habe er sie zurechtgewiesen.
»Ich bin bald wieder da«, fügte Tom eifrig hinzu. Dass sein Vater genickt hatte, wertete er eindeutig als eine Einwilligung, die es schnell auszunutzen galt, bevor sie zurückgezogen werden konnte.
Georg nickte wieder. Es freute ihn, seinen Sohn so lebendig zu sehen, auch wenn er sein Verbot missachtet hatte. Erst als er sich bereits umgedreht hatte und aus dem Garten gelaufen war, fiel ihm auf, dass Tom ihm nicht gesagt hatte, wohin er gehen werde. Zum Glück jedoch war Königswinter so klein, dass man sich nicht verirren konnte, und solange Eileen nicht wusste, wo sie sich versteckt hatten, bestand keine Gefahr.
Obwohl sie ihr unheimlich war, nahm Nora die Rose und steckte sie in eine Vase. Eine einzelne Rose legte man eher auf einem Grab ab; als ein unverfänglicher Willkommensgruß taugte sie nicht. Wer hatte ihr die Rose gebracht? Irgendjemand musste sie im Haus gesehen haben; es war höchst unwahrscheinlich, dass ihre Tante, eine ehemalige Nonne, einen Verehrer hatte, der ihr Blumen vor die Tür legte.