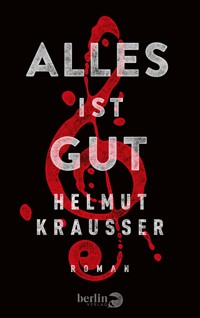8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1915 kommt ein Zwillingspaar zur Welt, das gegensätzlicher nicht sein könnte: Max und Karl sind zeit ihres Lebens Kontrahenten und bleiben doch eng verbunden. Als es ihnen im Deutschland der dreißiger Jahre zu eng wird, fliehen sie mit der Prostituierten Ellie nach Frankreich. Als Illegale suchen sie in Paris ihr Glück – und finden das Leben. Zwischen liebeshungrigen Hoteliers und schach spielenden Buchhändlern, zwischen Mordanschlägen und Affären geraten die drei in einen rasenden Reigen, der sie schwindelig werden lässt. Dass Karl aufbricht, um im Spanischen Bürgerkrieg für eine bessere Welt zu kämpfen, macht die Lage nicht einfacher. Helmut Kraussers neuer Roman verflicht meisterhaft die Erschütterungen der 1930er-Jahre mit den turbulenten Lebensläufen dreier Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Helmut Krausser
NICHT GANZ SCHLECHTE MENSCHEN
Roman
eBook 2014 © 2012 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © plainpicture/Millenium/Lena Modigh
Pray thou thy days be long before thy death,
And full of ease and kingdom; seeing in death
There is no comfort and none aftergrowth,
Nor shall one thence look up and see day’s dawn
Nor light upon the land wither I go.
Live thou and take thy fill of days and die
When thy day comes; and make not much of death
Lest ere thy day thou reap an evil thing.
(Swinburne)
Um viele Jahre bitte vor dem Tod,
die sorglos sind und königlich. Im Tod
ist weder Trost noch Nachhinein. Du wirst
den Tag nicht dämmern sehn, es gibt kein Licht,
wohin du gehst. Leb aus der Fülle deiner
Zeit, und wenn dein Tag gekommen ist,
dann stirb. Mach aus dem Tod kein großes Ding,
ZWEI BRÜDER
Am 1.August 1914, dem Tag der Mobilmachung des Deutschen Reiches, als der Kaiser keine Parteien mehr kannte und der Jubel in den Straßen keine Grenzen, wurden, motiviert vor allem durch patriotisch-erhabene Gefühlswallungen – auch weniger hochgestochene Beweggründe spielten eine gewisse Rolle – in Potsdam zwei Brüder gezeugt, die am 26.Februar des darauffolgenden Jahres im Abstand weniger Minuten den Leib der erschöpften Mutter verließen.
Der zum Doppelvater beförderte Erzeuger, der fünfzig Jahre alte Amtsgerichtsrat Theodor Loewe, gab seiner Frau Hedwig, sobald es der Arzt ihm erlaubte, einen salzigen Kuß auf die Stirn, denn Tränen der Rührung, die ihn übermannten, waren von den Aug- zu den Mundwinkeln geflossen, und er fühlte sich keineswegs verpflichtet, diese Zeichen entschiedener Anteilnahme schamhaft wegzuwischen.
Am 3.März 1915 wurden die beiden Nachwuchsdeutschen in der St.Peter und Pauls-Kirche auf die Namen Max und Karl getauft, von einem katholischen Priester, der nach dem Herunterbeten der üblichen Formeln seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, hier wüchse das Wertvollste heran, was das Reich in dieser schicksalhaften Lage benötige. Männliche Zwillinge von hörbar robuster Natur (er lächelte breit) seien ein Zeichen, ein gutes Zeichen, ein den Sieg verheißendes Gottesgeschenk. Theodor Loewe, kein sehr gläubiger Mensch, wunderte sich über das bellizistisch-rekrutierende Gerede des Pfaffen. So viel Welthaltigkeit schien nach seinem Geschmack zu einem vor allem spirituellen Akt nicht zu passen. Wenn er seinen Söhnen den Ritus der Taufe auch sicherheitshalber nicht hatte vorenthalten wollen, schaden konnte es ja nichts, befremdete, ja verstörte ihn die Idee, hier werde von einem Vertreter der Geistlichkeit über künftiges Kriegspersonal spekuliert. Gleich nach der Zeremonie, als die aus Sachsen und Brandenburg angereisten Verwandten sich mit den Säuglingen vor dem Kirchenportal fotografieren ließen, umarmte Theodor seine Hedwig liebevoll und raunte ihr ins Ohr, daß weder Max noch Karl jemals erfahren dürften, wer von beiden zuerst das Licht des Kreißsaals erblickt habe. Sie sollten nicht mit einer Erbfolgenummer gebrandmarkt sein, sondern absolut gleichberechtigt aufwachsen. Hedwig raunte zurück, daß das exakt ihrer Ansicht entspreche, schon weil sie selbst situationsbedingt nicht aufmerksam genug gewesen sei, um mit letzter Sicherheit sagen zu können, ob sie nun zuerst Max oder Karl herausgepreßt habe. Die beiden blutverschmierten Kreatürchen hätten sich von Anfang an zum Verwechseln geähnelt.
Hedwig Loewe fand es selten sinnvoll zu lügen, aber in diesem Fall machte sie eine Ausnahme. Es war definitiv Max gewesen, der als erster den Mut besessen hatte, sich kopfüber in den Geburtskanal zu stürzen. Und die Schwestern, die dem Arzt assistierten, hatten Max sogleich ein dementsprechendes Leistungsabzeichen an die Zehe geheftet. Kein Zweifel möglich. Hedwig, eine engelhaft niedliche, zart gebaute und meist gutgelaunte Frau von dreißig Jahren, sympathisierte mit den aufregend neuen, beängstigend demokratischen Ansichten ihres deutlich älteren Gatten, den sie aus Vernunftgründen geehelicht, dann jedoch schnell liebgewonnen hatte. Er war auf seine Weise ein ehrlicher und anständiger Mann. Wobei das nicht alle so beurteilt hätten.
Die Loewes lebten während des für Deutschland immer unglücklicher verlaufenden Völkerringens relativ komfortabel in einer Sieben-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Nauener Tors und konnten sich selbst während der härtesten Entbehrungszeit zwei Bedienstete leisten, ein Zimmer- und ein Kindermädchen. Von beiden machte Theodor Loewe körperlichen Gebrauch. Hedwig nahm ihm das aber nur anfangs und pro forma übel, sie war ja eingeweiht. Theodor hatte ihr freimütig von seinem Leiden berichtet, mittlere bis schwere, sagte er, und seine Stimme zitterte, Satyriasis, er könne nicht anders, nein, mit Liebe habe das nichts zu tun, es handle sich eher um die Verrichtung kloakischer Bedürfnisse, um eine Art sexuellen Brechdurchfalls.
Hedwig war dafür, die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Wenn einer über vierzig ist, schrieb sie ihrer Mutter einmal, änderst du ihn nicht mehr.
Insgeheim war Hedwig sogar froh, um nicht zu sagen: heilfroh, selbst nur noch an hohen Feiertagen sogenannte eheliche Pflichten auf sich nehmen zu müssen. Dergleichen hatte ihr selten Genuß, oft aber Schmerzen bereitet. Insgesamt gesehen war – und blieb – Theodor Loewe eine gute, ja prächtige Partie für das aschblonde Fräulein, eine Handwerkerstochter mit blassem Teint und Sommersprossen. Die Eheleute hatten sich alsbald für getrennte Schlafzimmer entschieden, nicht zuletzt, weil Hedwig oft heftig träumte und dabei um sich schlug, während ihr Gatte regelmäßig und ohrenbetäubend schnarchte. Mehr ist ihm nicht vorzuwerfen, schrieb Hedwig an die Mutter, wir haben soviel Freude aneinander am Tag, daß man in der Nacht dem Glück getrost eine Pause gönnen darf.
Lene, das Zimmer-, und Albertina, das Kindermädchen, besaßen noch weniger Grund, sich zu beklagen. Beide vergötterten den geistvollen, oft witzigen Juristen. Er hatte ihnen nicht nachstellen müssen, sie hatten sich ihm, unabhängig voneinander, nachgerade aufgedrängt – und wurden von Theodor Loewe für ihre Sonderleistungen großzügig entlohnt. Die beiden alleinstehenden jungen Frauen konnten die schlimmen letzten Kriegsjahre behütet verbringen, ohne existentielle Ängste zu erdulden. Und Theodor wußte seine außerehelichen Aktivitäten lange so geschickt zu arrangieren, daß beide, Lene wie Albertina, sich für seine einzige Geliebte hielten. Bis eines Nachts das Unvermeidliche geschah. Lene betrat ohne zu klopfen Theodors Schlafzimmer, wollte sich an ihn schmiegen, draußen donnerte es, und sie tastete nach seinem Leib, woraufhin eine schrille weibliche Stimme erst für Verwirrung, dann für Klarheit sorgte. Theodor bemühte sich vergebens, die beteiligten Parteien an einen Tisch, besser gesagt, in ein Bett zu bringen. Ihm blieb nichts übrig, als die ungeraden Kalendertage Lene, die geraden Albertina zu widmen und beide darum zu bitten, sich mit den Gegebenheiten abzufinden. Er rechnete darauf, daß die Mädchen im Angesicht des Krieges vernünftig und kompromißbereit sein würden. Das waren sie denn auch, eine gewisse Zeit über, aber sie blieben – Krieg hin oder her – Frauen.
Hedwig, die stets informiert war über die Lage, registrierte anfangs einigermaßen amüsiert, wie ihre weiblichen Domestiken aufeinander immer eifersüchtiger wurden, sich bald gegenseitig ins Pfefferland wünschten – und erst als der Loewesche Haushalt unter dem Konflikt zu leiden begann, bat sie den Gatten um einschneidende Maßnahmen zur Säuberung des, wie sie es nannte, entstandenen Saustalls.
Theodor Loewe erbat sich Bedenkzeit. Er liebte seine Hedwig, was uneingeweihte Beobachter vielleicht überrascht hätte, bedingungslos, und war selbst alles andere als froh über die entstandene Situation. Just in jener Ära gewaltigster politischer und gesellschaftlicher Umbrüche, als die alte Ordnung immer hilfloser dem Chaos wich, wurde er befördert und als Richter an den obersten preußischen Strafgerichtshof nach Leipzig berufen.
Was bedeutete, daß er in letzter Instanz Todesurteile bestätigen und Gnadengesuche ablehnen mußte, die eigentlich dem Kaiser zur Prüfung hätten vorgelegt werden sollen. Dieser indes hatte weiß Gott anderes zu tun, als sich in derart niedere Angelegenheiten einzumischen. Theodor Loewe wuchs über sich hinaus. Er weigerte sich, Dienst nach irgendeiner stillschweigend getroffenen Vorschrift zu leisten. Das Wesentliche an Preußen war ja eben die Vorschrift an sich, und was nicht von Vorschriften penibel geregelt war, besaß Zukunft, konnte so oder so interpretiert werden. Loewe tat alles, um etliche Akten neu zirkulieren zu lassen, er verschleppte Verfahren, überschätzte den ihm gegebenen Handlungsspielraum und rettete mit jener Selbstüberschätzung doch mindestens fünf in minderschweren Fällen angeklagten Mitmenschen das Leben, in einer Zeit, da zum höheren Wohl der Allgemeinheit angeblich Exempel statuiert werden mußten. Sein Engagement trug ihm in Kollegenkreisen einen fragwürdigen Ruf ein, als Besserwisser und Weichling, als subversives Element, und nach nur drei Monaten der Amtsausübung wurde er im Oktober 1918, vom Kaiser höchstpersönlich, das behauptete jedenfalls die Verabschiedungsurkunde, zurück nach Potsdam und in den Ruhestand geschickt.
Max und Karl, übrigens keine eineiigen Zwillinge und schon gut voneinander zu unterscheiden, waren da gerade dreieinhalb Jahre alt und übten sich in ersten Denkversuchen. Weil ihr Vater selten die Zeit erübrigen konnte, sich ernsthaft mit ihnen abzugeben, pflegten sie ein um so innigeres Verhältnis zur Mutter, doch letztlich war es Albertina, das Kindermädchen, das den entscheidenden Grundstein für die künftige Entwicklung der Brüder legte. Sie brachte ihnen, noch bevor sie eingeschult wurden, das Lesen bei, was zufällig geschah, aus Mangel an Spielzeug. Albertina schnitt die Schlagzeile der täglichen Zeitung aus, zerteilte diese mit der Schere in einzelne Buchstaben und forderte von den Buben, sie möchten jene Schnipsel wieder in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Beide, Max wie Karl, bewiesen außerordentliches Talent, sie waren im Alter von vier Jahren bereits fähig, mittels ausgeschnittener Buchstaben einen Geburtstagsgruß an die Mutter zu formulieren. Auch wenn das Ergebnis visuell einer anonymen Drohung glich, reagierte Hedwig mit geballtem Mutterstolz auf die erste schriftliche Botschaft ihrer Kinder, WIR HABEN DICH SO LIEB MAMA, die doch weniger zu Mutters Geburtstag gratulieren als auf sich aufmerksam machen wollte. Lene, der Kammerzofe, war gekündigt worden, statt ihrer bestellte nun eine kartoffelnasige und als erotisches Beutegut nicht ernstzunehmende Amalie das Haus. Im November 1918 war das Deutsche Reich am Ende, es folgte der Verzicht des Kaisers auf den Thron und alle Staatsämter, während Anfang Januar 1919 der Richter Loewe seinen vorherigen Posten überraschend zurückbekam. Es hatte eine Revolution gegeben, Deutsche hatten auf Deutsche geschossen, und Revolution wie Gegenrevolution beurteilten, in der Eile, die beiden charakteristisch ist, das dringend benötigte Personal nach eher plumpen Kriterien. Einer, den die alte Ordnung boshaft aussortiert hatte, konnte naturgemäß kein Feind der neuen Unordnung sein. So grobschlächtig dachte man auf Seiten der Umstürzler, egal, ob sie als heilbringende Linke auf die verderbte Rechte einschlugen oder umgekehrt. Viele, die einfach nur Krawall machen wollten, fanden sich, zu jedem Spaß und Raubzug bereit, auf irgendeiner Seite wieder. Allen gemeinsam war alsbald die Wut auf Theodor Loewe, der, anscheinend grundfeige, sich nirgendwo positionieren mochte. Die Leiche Rosa Luxemburgs war aus dem Landwehrkanal noch nicht wieder aufgetaucht, als Loewe im April 1919 erneut und diesmal endgültig in Rente geschickt wurde, was ihn ganz froh stimmte, denn die Zeit war seine nicht mehr, sie war ihm ebenso endgültig über den Kopf gewachsen, blieb unübersichtlich, auch im Rückblick, und er beschloß, sich künftig mehr um seine Söhne zu kümmern, was er, wie er sich eingestand, längst einmal hätte tun sollen.
Zwar schlief er manchmal noch mit Albertina, aber es war nie mehr wie früher, als er neben ihrem Körper auch ihre unmittelbare Dankbarkeit und Verehrung genießen durfte. Inzwischen war Albertina zu einer Art Familienmitglied geworden, oder betrug sich zumindest so, mit einem Selbstbewußtsein, als seien ihr aus Gewohnheit allerlei Rechte erwachsen. Als die Loewes im Sommer 1920 zur ersten Urlaubsreise nach dem Krieg aufbrachen, nach Ahrenshoop an der Ostsee, begehrte sie ernsthaft, mit Theodor das Hotelzimmer zu teilen. Das ging nicht an – Hedwig erhob Einspruch, wenngleich sie in ihrer natürlichen Gutmütigkeit zu allerhand Kompromissen bereit war. Sie sei einverstanden, schlug sie vor, wenn Albertina nach Mitternacht heimlich mit ihr den Platz tausche, solange diese tagsüber vor der Welt, ohne Ansprüche und Allüren, die Bedienstete spiele, die sie ja nun mal sei. Auf diese Weise könne jede der beteiligten Parteien nach Lust und Gusto leben, ohne vor den Argusaugen der Öffentlichkeit ihr Gesicht zu verlieren. Genau so wurde es gehandhabt. Max und Karl, die in einem eigenen Zimmer schliefen, bekamen die nächtlichen Rochaden mit und stellten diesbezüglich Fragen. So modern, um die Ménage à trois offen auszuleben, waren die Loewes nicht, selbst Albertina hätte sich dabei unwohl gefühlt. Theodor dachte lange darüber nach, wie eine Lösung aussehen könnte, und eines Morgens, am letzten Tag vor der Heimreise nach Potsdam, erklärte er Hedwig, daß sein Trieb nicht länger unter jenen gewissen Bedürfnissen leide, denen ein jüngerer Mann wehrlos ausgesetzt sei, weshalb er sich zum Entschluß durchgerungen habe, Albertina zu kündigen. Er wolle ihr eine großzügige Abfindung zahlen, sie sei noch – einigermaßen – jung und könne, mit etwas Glück, bald einen passenderen Mann fürs Leben finden. Hedwig Loewe reagierte gerührt, doch auch erschrocken darüber, wie kaltherzig Theodor eine Frau, die ihm einige Jahre viel bedeutet hatte, nun abzuschieben gedachte. Sie redete ihrem Gatten ins Gewissen, sich das sorgfältig zu überlegen, denn immerhin würde sie mit Albertina nicht nur eine Konkurrentin verlieren, sondern vor allem eine Freundin, ja eine nicht so schnell zu ersetzende Vertraute. Theodor Loewe wunderte sich über seine Hedwig nicht schlecht. Ihr Edelmut erschien ihm beinahe grotesk und nicht von dieser Welt. Aber wie so viele unfreie Väter entschied er letztendlich zu Gunsten seiner Kinder, die in geordneten, geklärten Verhältnissen aufwachsen sollten.
Albertina fiel aus allen Wolken, als ihr das Abfindungsangebot unterbreitet wurde. Sie sollte künftig in Berlin leben, als Eigentümerin einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Elendsstadtteil Moabit, und während der kommenden fünf Jahre monatlich fünfzig Mark erhalten. Ein Vorschlag, der vom neutralen Standpunkt aus recht großzügig genannt werden muß. Eigentlich hätte Albertina nichts zu erwarten gehabt, schlicht nichts, Punkt. Ihr Dienstherr, wäre er ein schlechter Mensch gewesen, hätte ihr kündigen, sie ohne einen Becher Wasser in die Wüste schicken können, sozusagen. Dann – und nur dann hätte Albertina Grund gehabt, sich zu beklagen, zu zetern und zu schreien. So aber blieb ihr, und darin bestand die subtile Brutalität der Offerte, nichts anderes übrig, als wortlos anzunehmen, was ihr geboten wurde. Natürlich beklagte sie sich dennoch, zeterte und schrie, aber die Flüche und Drohungen, selbst ihre flehentlichen Bitten, vermochten Theodor Loewes reines Gewissen nicht zu verletzen. Albertina fand alsbald eine neue Stelle als Garderobiere, und für die Zukunft war sie als Wohnungseigentümerin gewappnet. Nur besaß sie eben, außer dem unerbittlich herannahenden Alter, keine nennenswerte Zukunft mehr, schon gar nicht jene, die sie sich zwischendurch einmal eingebildet und angemaßt hatte, als Zweitfrau eines bedeutenden Staatsbeamten, dessen Kind sie einst beinahe, hätte er nicht immer so akkurat aufgepaßt, ausgetragen hätte. Sie wurde nie mehr wirklich glücklich, verfiel dem Alkohol, lebte aber noch dreißig Jahre lang unscheinbar dahin, bis sie im Januar 1950 erst einen Herzinfarkt, danach ein Armengrab bekam.
Im Herbst 1920, mit fünfeinhalb Jahren, wurden die Söhne der Loewes eingeschult. Sie überraschten ihre erste Lehrerin, das schmallippige Fräulein Koch, durch flüssiges Lesen und die sichere Beherrschung des kleinen Einmaleins. Letzteres hatte ihnen ihr Vater beigebracht. Um ihm eine Freude zu bereiten, waren die Buben oft eine halbe Stunde früher aufgestanden und hatten sich gegenseitig Zahlen an den Kopf geworfen, die multipliziert werden mußten. Wer den ersten Fehler beging, verlor an den anderen das Recht, vom Vater im Huckepack zur Haustür befördert zu werden, und sie haßten es, wenn der Vater als Spielverderber auftrat und auch noch den Verlierer auf seine Schultern nahm.
Max und Karl, wiewohl sie unzertrennlich waren und immer füreinander da, gestalteten ihren gemeinsamen Werdegang von Beginn an als brüderlichen, aber sehr ernst genommenen Wettkampf. Den Rat des Vaters, sich stets einen Vorsprung gegenüber den Mitschülern zu erarbeiten, um es später einmal leichter zu haben im Leben, hatten sie gewissenhaft verinnerlicht. Man hätte dabei nicht behaupten können, sie seien dazu von einem ehrgeizigen Erziehungsberechtigten angestiftet worden, nein. Der Wunsch, über den anderen hinauszuwachsen, beherrschte beide gleichermaßen. Wäre einer der beiden deutlich und dauerhaft ins Hintertreffen geraten, hätte der andere seinen Ehrgeiz vielleicht gezügelt, aus Mitgefühl, aus Scham, wer weiß. So aber gab es keinen Grund dafür, sie erwiesen sich in den meisten Fällen als ebenbürtig. Theodor Loewe konnte seine Söhne eine Zierde des jungen Deutschland nennen, ohne je Widerspruch hinnehmen zu müssen. Aufgrund ihrer häuslich erworbenen Kenntnisse durften sie denn auch beide die zweite wie auch die vierte Klasse der Grundschule überspringen, wurden vom dankbaren Vater an Weihnachten mit der Karl-May-Gesamtausgabe und je einem Fahrrad belohnt. Hedwig Loewe, die als einzige zur Mäßigung riet – erfolglos –, erkrankte im Jahr 1923 an Krebs. Weil sie die Amputation ihrer linken Brust immer wieder hinausschob, starb sie schnell und schmerzhaft. Bei der Beerdigung weinten Max und Karl, trauerten um die tote Mutter und stellten zugleich die Frage, ob Albertina nun nicht zurückkehren könne. Theodor Loewe gab, am Boden zerstört, seinen Söhnen keine Antwort. Er war in einem Alter, in dem man die eigene Zeit der Unreife so gut vergessen hat, daß kindliche Pragmatik einem unheimlich und taktlos vorkommen muß. Max und Karl hingegen konnten nicht verstehen, warum ihr Vater künftig lieber ohne eine Frau an seiner Seite leben wollte. Sie vermißten die fürsorgliche Zärtlichkeit, die sie sowohl von der Mutter als auch von Albertina erfahren hatten. Äußerlich wirkten sie kaum noch wie Zwillinge. Das kam, weil Karl einen viel größeren Appetit entwickelte als der oft kränkelnde Max. Auch in ihren Frisuren unterschieden sie sich auffallend. Max’ Haar war glatt und spröde und schien viel weniger schnell zu wachsen als die wuchernde, immer leicht fettig schimmernde Lockenpracht seines Bruders. Eine genetische Merkwürdigkeit, und nicht die einzige.
Beider Lieblingsfach war zum Befremden des Vaters weder Deutsch noch Mathematik, sondern – ausgerechnet – Religion. Sie ahnten früh, daß es hier um etwas nicht klar Faßbares ging, fanden sich mit vielen Behauptungen konfrontiert, mit denen sich wunderbar spielen und spekulieren ließ. Warum Jesus immer mit langen Haaren dargestellt werde, fragten sie ihren Lehrer, Herrn Vogel, wo doch der Apostel Paulus solche Frisuren ausdrücklich kritisiert hätte. Und warum nicht alle Männer in christlichen Ländern Jesus nacheifern würden, statt alle drei Wochen zum Friseur zu gehen? Sie fragten auch, woher man denn wissen könne, daß Jesus Gottes einziger Sohn gewesen sei. Aus der Lektüre der griechischen Götter- und Heldensagen wußten sie, daß der inzwischen abgesetzte Zeus in etlichen Verkleidungen vielfach für Nachwuchs unter menschlichen Frauen gesorgt habe. Der christliche Gott dagegen habe sich nur einmal hinreißen lassen, eine Ehe zu brechen? Vielleicht seien die anderen Male ja unentdeckt geblieben? Für solche Fragen und Äußerungen bekamen sie mächtig Ärger, und Theodor Loewe wurde dringend gebeten, die Elternsprechstunde zu besuchen. Dort beklagte man sich pflichtgemäß über die vorwitzigen Brüder, aber bei allem Unmut klang auch der Respekt durch, den achtjährige, zur Blasphemie neigende Kinder sich weißgott verdient haben. Theodor Loewe mußte lachen, als man ihm vortrug, auf welche Weise seine Söhne zu verdächtigen Subjekten geworden waren, und schlußendlich lachte der Schuldirektor mit, was auf Kosten des Lehrers Vogel ging, der in seiner senilen Renitenz einfach nicht zu begreifen gewillt war, um welche Ausnahmetalente hier Debatten entstanden. Max und Karl sollten, fand der Schuldirektor, nachdem er mit Loewe Senior im Kaiserkeller ein paar Gläser Riesling getrunken hatte, unbedingt auf eine bessere Schule gehen, die ihren Anlagen, welche man bemerkenswert, wenn nicht gar aufsehenerregend nennen müsse, eher entspräche. Er schlug das neugegründete Jesuitenkolleg vor, als härteste denkbare Zuchtanstalt, die die beiden Himmelsstürmer entweder bändigen oder zu neuen Ruhmestaten anstacheln könne. Loewe, schon etwas betrunken, willigte ein, und der Religionslehrer Vogel, ein banaler Mensch von bequemlicher Denkart, war einfach nur froh, die Kinder loszuwerden. Allen schien damit gedient.
Im Potsdamer Jesuitenkolleg herrschte eine strenge Zucht. Die Prügelstrafe war beliebt und gefürchtet zugleich. Nachts, im Schlafsaal, tobten sich etliche Schüler aus, holten nach, was der Tag ihnen vorenthielt. Es bildeten sich Banden, die um die Vorherrschaft kämpften und alle, die nicht dazugehörten, als potentielle Sklaven betrachteten. Max und Karl wurden früh mit Tatsachen konfrontiert, deren Verständnis eher der Spätpubertät vorbehalten sein sollte. Sowohl von seiten einiger präpotenter Mitschüler wie auch einzelner Lehrkräfte wurden, auf subtile oder drastische Art, Begierden an sie herangetragen, mit denen ihre jungen Seelen nicht umzugehen wußten. Miteinander darüber zu reden, vermieden die ansonsten so vertrauten Brüder, geschweige denn, daß sie sich einem Außenstehenden, und sei es dem Vater, offenbart hätten. Sie verstanden allerdings ganz gut, daß sie sich mit einer gewissen Willfährigkeit Vorteile verschaffen konnten, während sich sperrig zu geben, unmittelbare Nachteile mit sich brachte, in Form von unverdient schlechten Noten und noch sadistischerer Repressalien.
Lehr- seien keine Herrenjahre, meinte der Vater stets, wenn sie über das ihnen zugemutete Pensum klagten. Ihm genügte zu wissen, daß die Söhne – nach anfänglichen Schwierigkeiten – Fuß gefaßt hatten im System und ihren Notendurchschnitt auf das von ihnen gewohnte Niveau trieben. Überaus gern bekam er zu hören, daß es im Kolleg eine Mehrzahl latenter Atheisten gab, die die Theologie als eher theoretisches Spiel betrieben. Den leisen Hinweis, daß es sich bei einigen jener Gottlosen um überzeugte Hedonisten altgriechischer Natur handeln müsse, überhörte Loewe. Was verstünden Neunjährige denn schon von Hedonismus? Ein irgendwo aufgeschnappter Begriff, der zu Preußen nicht paßte.
Karl aß sehr viel, als ahnte er, daß ein dickes Kind weniger attraktiv wirken würde.
Und wirklich wurde er fortan in Ruhe gelassen.
An seinem zwölften Geburtstag trat er dem Potsdamer Schachclub Steinitz bei, wofür er eine Sondererlaubnis der Schule erbitten und eine Einverständniserklärung seines Vaters vorlegen mußte. Üblicherweise war es für Unter-Sechzehnjährige undenkbar, das meist verrauchte Ambiente eines Schachlokals zu betreten. In letzter Zeit hatte man auf höchster, heißt: ministerieller Ebene umgedacht, um die Vormachtstellung Deutschlands im Weltschach nicht weiter zu gefährden. Gerade bei Zöglingen zwischen acht und zwölf Jahren könne bei intensiver Betreuung der größte Leistungsschub erreicht werden. Dank der deutschen Weltmeister Steinitz und Lasker und der Vizeweltmeister Janowski und Tarrasch genoß das Schachspiel in jener Epoche hohes Ansehen im Reich, und es war eben erst zum Eklat gekommen – Emanuel Lasker hatte 1924 die Weltmeisterschaft gegen den Kubaner Capablanca verloren. Maßnahmen waren erforderlich.
Nach einigem Hin und Her wurde Karl gestattet, an Freitagen von 15 bis 18Uhr das Schulgelände zu verlassen, um im Hinterzimmer des Café Hohenlohe Schachunterricht zu erhalten. Prompt wurde er bei seiner ersten Teilnahme Jugendvereinsmeister, setzte sich gegen ein halbes Dutzend älterer Jugendlicher mühelos durch. Karl besaß für alle Arten von Brettspielen außerordentliches Talent. Mit ein wenig mehr Fleiß hätte er es zu einer Schach-Karriere bringen können, allein, soviel Freude er auch daraus zog, komplizierte Eröffnungen zu studieren und vertrackte Probleme zu lösen, so sehr kam ihm das Spiel auch als ein – wenn auch erhabener – Weg vor, das wirkliche Leben zu versäumen, zu vertändeln. Ältere Männer, die das reale Leben gegen eines zwischen Läufern, Türmen und Springern eingetauscht hatten, entsetzten ihn regelrecht. Er verzichtete infolgedessen auf Wettkämpfe und weitere Meisterschaften, zog sich aus dem Vereinsleben zurück. Nur manchmal noch, wenn er glaubte, sich eine Pause von seinen philosophisch-politischen Studien gönnen zu dürfen, holte er das kleine klappbare Taschenbrett hervor, baute irgendeine komplexe Problemstellung auf und ruhte nicht eher, bis er die Lösung gefunden hatte. Max hingegen war so gar kein Spieler. Abgesehen von ein wenig Rommé und Canasta im Urlaub mit den Eltern hatte er nie Karten in der Hand gehalten, selbst wo es in der Schule zum guten Ton gehörte, in den Pausen, nachts im Schlafsaal, ja manchmal sogar während der Schulstunden heimlich unter der Bank Skat zu spielen, um einen viertel Pfennig pro Punkt. Er hatte als Kind nicht einmal Murmeln besessen. Auch als Sportler zeigte er keinerlei Ehrgeiz. Die Turnerei war ihm gar so verhaßt, daß er sich strikt weigerte, Reck, Bock und Barren auch nur zu berühren. Er hockte sich abseits und ließ sich eine Vier geben. Und Rutenschläge auf den entblößten Hintern.
Anfang Februar 1928 kam es zum Skandal am Potsdamer Jesuitenkolleg. Ein Lehrer für Latein und Altgriechisch, Jonathan Fink, noch keine dreißig Jahre alt, entschloß sich zum Freitod durch einen Sprung in die eiseskalte Havel. In seinem Nachlaß wurden Dutzende nie abgeschickte Liebesbriefe an Max Loewe gefunden. Niemand war gewillt, darum ein Aufhebens zu machen, bis auf Jonathan Finks langjährige und vor der Welt geheimgehaltene Braut Anna Tritt, die erst auf der Herausgabe seiner persönlichen Habe bestand und dann, verständlicherweise, Aufklärung darüber begehrte, was mit ihrem Bräutigam los gewesen war. Sie konfrontierte den eben dreizehn gewordenen Max mit jenen Briefen, wobei sie ihm nur ein paar jugendfreie Passagen – im Grunde die einigen wenigen jugendfreien Passagen – auf einer Parkbank vorlas. Max tat erstaunt, als begriffe er überhaupt nicht, womit er es hier zu tun habe. Nein, der Herr Fink habe sich ihm nie indiskret genähert, was sie denn mit ›genähert‹ eigentlich meine? Diese Auskunft genügte dem dreiundwanzigjährigen Fräulein Tritt, um vorerst Ruhe zu finden. Jonathans Faible für den Jungen war demnach minniglich (wie sie es nannte) und platonisch gewesen, und die in den Briefen nicht etwa nur angedeuteten sodomitischen Sauereien hatten nie aus der Fantasie ins Reale gefunden, Gott sei Dank.
Die Wahrheit behielt Max für sich. Jonathan Fink hatte dem Jungen gegenüber sehr wohl seine obsessiven Gefühle offenbart und sich auch an ihm vergangen, sogar mit anfänglichem Erfolg, sofern man unter Erfolg verstehen konnte, daß die Begierde mehr auf Neugier als auf Gegenwehr stieß. Bis Max, dem das alles irgendwann über den Kopf wuchs, der täglich befürchten mußte, daß die Mitschüler dahinterkämen, endlich und deutlich Nein sagte. Was nicht genügte. Erst als Max genügend schriftliche Beweise für die Aberrationen seines Lehrers gesammelt und ihm gedroht hatte, diese publik zu machen, kam die Affäre zu einem Ende. Jonathan Fink, der unter fürchterlichen Seelenqualen litt und sich das frigide (so behauptete er) Fräulein Anna stets nur als Alibi vor sich selbst warmgehalten hatte, zog Konsequenzen, mit denen nicht zu rechnen gewesen war.
Max weinte nicht. In ihm war alles wie betäubt, die Todesnachricht nahm er äußerlich beinahe gleichgültig auf, wie jemand, der noch Angst haben muß, sich durch eine übertriebene Reaktion zu verraten. Sobald er wieder zu einem klaren Gedanken fähig war, zeigte er sich erstaunt, wie wenig genügt hatte, um einen erwachsenen Menschen derart und für immer aus der Bahn zu werfen. Statt eines Schuldgefühls erfüllte ihn der Suizid sogar mit einem gewissen Stolz, für den er sich, wie ihm durchaus bewußt war, hätte schämen sollen.
Gerne wollte er mit seinem Bruder darüber diskutieren, traute sich aber nicht. Zu vieles war bislang verschwiegen worden. Max hätte einiges berichten, beichten können, die sattsam bekannte Geschichte eines närrisch begehrten, ausgenutzten Zöglings.
Daß er Fink gemocht, bisweilen gar verehrt und etliche seiner angeblich so verderblichen Handlungen weidlich genossen hatte, war eine ganz andere Geschichte. Die dunkle Hälfte der Wahrheit, die er niemandem erzählen konnte.
Jonathan Finks gesammelte Briefe hätte Max verbrennen können, tat es aber nicht. Im Gegenteil – als nach dem Fund der Leiche das Zimmer des Lehrers tagelang unverschlossen war, betrat er es und legte das Briefkonvolut in einer der Schubladen ab. Vielleicht, um sich wichtig zu machen, vielleicht aus edleren Motiven – Max hätte das nicht begründen können. Damals nicht, auch später nicht. Karl, an dessen Ohren einige Gerüchte gedrungen waren, kommentierte den Tod des Lehrers mit einer Brutalität, zu der nur grüne Jungs fähig sind. Eine Schwuchtel weniger, sagte er, Schwamm drüber. Max gab keine Antwort. Aber aus seinen Augen blitzte Empörung.
Mit Beginn der Pubertät nahm der bis dahin sportlich-friedliche Zweikampf der Loewe-Brüder gallige Züge an. Sie eroberten sich die Welt der großen Gedanken durch fanatische Lektüre grade jener Bücher, die ihnen keine Lehrkraft als altersgerecht empfohlen hätte. Karls damals bester und einziger Intim-Freund Johann Münchinger, ein denkfauler Revoluzzer, dem es vor allem darum ging, die Obrigkeit zu provozieren, machte ihn auf die Schriften von Liebknecht und Marx aufmerksam. Karl, der sich erst an Schopenhauer (zu negativ), dann an Hegel versucht hatte, aber ohne Genuß, weil noch ohne tieferes Verständnis, sog die ihm viel plausibler erscheinenden Texte von Marx, später auch Lenin, gierig auf, er wußte von nun an bescheid über die kommenden Erfordernisse. Alles, restlos alles, war ihm klar geworden. Er verstand die Welt und ihre Defizite. Wußte, wie ihr zu helfen sein würde. Max war längst nicht soweit. Karls Erleuchtungsgehabe rief seinen Spott hervor. Auch Neid spielte eine gewisse Rolle. Die ehemals einander so verbundenen Brüder wurden, wenn auch noch im Mantel einer spielerischen Form, von Rivalen zu Gegnern. Denken war so eine feine Sache. Am Ende eines jeden Tages dachte man besser, tiefer, anders – und was bis dato als gesichert galt, das galt nichts mehr, war nurmehr Müll, der überwunden und entsorgt sein wollte. Die Selbstherrlichkeit allen anfänglichen Denkens gestaltete die Pubertät der Loewe-Brüder zu einem frivolen Spiel vermeintlicher Allmacht, geliehener Überlegenheit. Ein Rausch, dem nichts gleichkam.
Als Max sich vom radikalen Freiheitsbegriff des damals längst toten, aber in Mode kommenden Philosophen Stirner beeindruckt zeigte (nicht etwa überzeugt, nur eben beeindruckt), meinte Karl trocken, der sei an einem Insektenstich gestorben, und das nicht etwa im Dschungel, sondern mitten in Berlin. Max reagierte ob der substanzlosen Sottise beleidigt. Als sei aus Stirners Denken ein Luftballon erwachsen, der beim ersten Mückenstich zerplatzen müsse – Karls rücksichtsloses Von-Oben-Dahergerede war schwer zu ertragen.
Max liebte es, Schopenhauer zu lesen, allein er wußte daraus keine praktischen Schlüsse zu ziehen, es sei denn, gegen fast alles Mißtrauen zu hegen und der Lebenslust, vor allem in Form jugendlicher Gestaltungssucht, nicht zu vertrauen. Max fühlte sich, gerade dadurch, daß er noch kein System, keine höhere Wahrheit gefunden hatte, die er als Fahne vor sich hertragen konnte, seinem Bruder überlegen. Karls Verhalten erklärte er sich folgerichtig, wenn auch faktisch unzutreffend, mit dessen Frustration, auf dem Weg der geistigen Vervollkommnung nicht Schritt halten zu können. Er hätte sich nicht schlecht gewundert, hätte er erfahren, daß Karl über ihn ganz ähnlich dachte. Mit sogar noch etwas mehr Überheblichkeit.
Nach Jonathan Fink, der ihm Schopenhauer so erfolgreich wie Kant (zu blutleer) erfolglos anempfohlen hatte, wurde Friedrich Nietzsche zum entscheidenden Einfluß für Max. Mit vierzehn Jahren geriet er an ein Exemplar der »Fröhlichen Wissenschaft«, was in eine drei Jahre dauernde Ekstase mündete. Er betrat mit der Lektüre jenes Buches nicht etwa fremdes Terrain, nein. Er empfing eine zweite Taufe, stürmte, zitternden Herzens, den Palast eines Denkers, der alles, was zuvor für sicher und indiskutabel galt, zertrümmert hatte. Der mit dem großen Hammer der Vernichtung philosophierte und seine Leser losließ aufs tabulose Denken an sich. Der jedes Individuum, das ihm verfallen war, in eine von Gemeinplätzen und Vorurteilen unumstellte Zone zwang. Mit seiner Sprache, seinen fast ausnahmslos trinkbaren Sätzen, bewirkte er zugleich, daß sich das aller Sicherheiten beraubte Individuum in der neuen Freiheit nicht nur frei und nackt, sondern sogar wohl und kreativ fühlte, beinahe wie ein junger, aufbegehrender Prometheus, dem alles Allzumenschliche ebenso vertraut wie krank und überwindbar erschien. Bis am Horizont des neuen Denkens der drohende Nihilismus überwunden und eine neue Ordnung der Dinge entstanden sein würde, jenseits der paulinisch-christlichen Moral, der billigen und überkommenen Einteilung in Gut und Böse. Die Unschuld des Werdens, verbunden mit dem Willen zur Macht. Max konnte seinem Bruder endlich eine weit höhere Vision entgegensetzen, und wie so viele Jugendliche unter dem Einfluß dieses Denkers schnappte er über, glaubte sich dazu ausersehen, eines Tages die Papier gebliebenen Gedanken des Riesen in Taten zu übertragen. An ihm würde letztendlich die Umsetzung jener Neu-Ordnung der Welt liegen. Denn niemand sonst begriff Nietzsche so gut wie Max Loewe. Fand Max Loewe, der gebenedeit war unter den Jünglingen. Der sich im Stande der Gnade wähnte, wie alle Beseelten, die ein elitäres Ideal und Dogma für sich gefunden hatten. Denn ER hatte die Himmel geleert, hatte einen schon lange an seiner Ausgedachtheit leidenden Gott getötet und dem verwaisten Menschen dessen Krone aufgesetzt. Max fühlte sich wie einer jener zuvor blinden Sklaven, die plötzlich sehen und urteilen können, weil alle Sichtblenden und Kulissen abgeschafft sind und die Bühne wieder, wie in der Urzeit, das Wesentliche zeigt. Das wüste leere Land vor dem Zugriff der Spießer und Philister, der Moral und Metaphysik. Max war, wie viele seiner Zeitgenossen, auf dem langen Pfad hin zum Übermenschen gelandet und entwickelte eine jugendlich-starke Verachtung gegen alles, was ihn begrenzen, behüten, zurück in herkömmlich-triviale Lebensbahnen lenken wollte. Gott war tot und Nietzsche ein Prophet. Max’ Verehrung für den im syphilitischen Wahnsinn gestorbenen Philosophen ging indes noch einen Schritt weiter. Er hielt sich bald für den wiedergeborenen Nietzsche selbst. Denn Nietzsche war um zehn Uhr morgens geboren worden, genau wie Max, und er war auf dem linken Auge etwas kurzsichtiger gewesen als auf dem rechten. Genau wie Max. Da war kein vernünftiger Zweifel mehr möglich.
In diesen Jahren entwickelten sich die Loewe-Brüder in zwei fast gegenläufige Richtungen, wurden sich mehr als nur fremd. Karl, obwohl mehrmals mit Inbrunst darauf hingewiesen, vermochte der Lektüre Nietzsches nicht annähernd ähnliche Begeisterung abzugewinnen. Im Gegenteil. Er nannte dessen Tonfall schwärmerisch und wenig konkret, viel zu sprunghaft, pointiert, rein auf Wirkung geschrieben. Zu metaphorisch für Philosophie, zu aphoristisch für eine systematische Phänomenologie. Sektiererische, elitäre Zuckerwatte, die den einfachen Menschen außen vor ließ, ja verachtete. Max war über diese Beurteilung – Lästerung – derart entsetzt, daß er seinem Bruder eine Ohrfeige verpaßte. Die Brüder hatten noch kein einziges Mal miteinander gerauft oder sich gar geprügelt. Nun wäre es beinahe dazu gekommen. Aber Karl wandte sich nur ab und ging dem Konflikt aus dem Weg, wie jemand, der es nicht nötig hat, seine Überzeugung ohne Not mit Gewalt zu verhandeln.
Max schämte sich hinterher. Nietzsche wäre sicher nie die Hand ausgerutscht. Einen wie Karl zu berühren, und sei es nur mit den Fingerspitzen, wäre IHM nicht eingefallen. Wenn überhaupt, hätte ER ihn über den Haufen geschossen. Dachte Max. Man muß sich von seinen Blutsbanden befreien, hatte Nietzsche irgendwo gesagt. Sinngemäß. Muß sich eine neue Familie suchen, eine rein geistige Verwandtschaft. Alles andere behindere nur die Freiheit, das höchste Gut des Denkens. Max überlegte, von zu Hause auszureißen, in der weiten Welt nach jenem Glück zu suchen, das seiner Euphorie angemessen war. Die Welt erwies sich leider als rückständig. Für die Fremdenlegion war er zu jung. Wo hätte er sonst hingehen können? Und was hätte mit der Fremdenlegion, selbst wenn er sie durch aufpeitschende Brandreden zu Nietzsche bekehrt hätte, erreicht werden können? Zähneknirschend beschloß Max, noch einige Jahre auszuharren, bevor das erste Fanal möglich wurde, das erste zu setzende Zeichen auf dem Weg in die völlige Unabhängigkeit. Er war zu jener Zeit wild entschlossen, mehr aus seinem Leben zu machen als irgendein Mensch zuvor. Den Zarathustra vermochte er auswendig herzusagen, er hätte sich vor keiner Diskussion mit belesensten Nietzsche-Exegeten gescheut.
Erst die Gier auf das Mädchen Irmgard, eine drahtige Blondine aus der Nachbarschaft, die Max mit ihrer kleinen Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen schier wahnsinnig machte, brachte ihn der rückständigen Welt und dem verdorbenen Bruder wieder näher. Denn ausgerechnet Karl, als wollte er den Bruder ärgern, lud Irmgard, dieses geistig schlichte Gezücht einer Arbeiterfamilie, ins Kino ein, sie sahen sich Chaplins The Kid an, lachten und weinten zusammen, und am Ende bekam Karl zum Dank für den gelungenen Nachmittag einen Kuß auf die Wange. Wovon er Max voller Stolz, nicht ohne Bosheit, berichtete und das Geschehene sogar ein wenig ausschmückte. Irmgards verschwitzter Handteller habe, behauptete Karl, heiß auf seinem Nacken gelegen, sie habe ihn an sich herangezogen, und er hätte seine Zunge in ihren Mund stekken können, wenn ihm dergleichen nicht als zu frühe Verpflichtung vorgekommen wäre. In der darauffolgenden Nacht bekämpfte Max seine Eifersucht durch exzessive Masturbation, fand sich endgültig zurückgeschleudert in die Allzumenschlichkeit des Daseins. Irmgard, und das war die eigentliche Tragik der Episode, konnte mit dem etwas schüchternen, ungelenken Karl wenig anfangen, es kam nie zu mehr als jenem scheuen Wangenkuß. Wenn Max, den sie ungleich interessanter fand, sie fortan nicht demonstrativ geschnitten, wie eine Unterleibskranke behandelt hätte, wäre sie ihm aller Wahrscheinlichkeit nach verfallen, und er hätte seinen Wunschtraum, einmal mit der Zungenspitze in ihrer Zahnlücke zu wühlen, in die Tat umsetzen können. Jede Jugend ist eine Tragödie verpaßter Möglichkeiten, die widerwillig zur Komödie wird. Notierte Max einige Jahre später in seinem Sudelbuch. Karl hatte ihm inzwischen gestanden, damals geschwindelt und übertrieben zu haben, aber es war für fast alles zu spät. Irmgard hatte mit achtzehn Jahren einen Stahlarbeiter geheiratet, der sie sogleich schwängerte, somit jeglicher Attraktivität beraubte und in einen banalen Alltag zwang. Das Mädchen, aus dem womöglich viel mehr hätte werden können, wurde glücklich. Das immerhin. Zum Kotzen, dachte Max, als er Irmgard eines Tages auf der Straße traf und ein paar Worte mit ihr wechselte. Glückliche Menschen waren nach seiner Auffassung am Tiefpunkt des Bewußtseins angelangt und von Tieren im Zoo kaum unterscheidbar. Nur Irmgards immer noch irritierende Zahnlücke hielt ihn davon ab, ihr mitzuteilen, was er von so viel Verkommenheit hielt. Die Liebe, die er für das Mädchen empfunden hatte, trug er mit großer Anteilnahme zu Grab.
Ansonsten verlief die Schulzeit der Loewes weitgehend konfliktfrei. Um den Anforderungen der modernen Zeit zu entsprechen, auch weil sie nicht mehr mit katholischer Theologie belästigt und mit Ruten gezüchtigt werden wollten, wechselten sie (das Potsdamer Jesuitenkolleg wurde ohnehin aufgelöst und in Berlin neu gegründet) ab der Obersekunda an die Humboldt-Oberrealschule, wo sie nach Latein und Altgriechisch auch Englisch und Französisch lernten, die Sprachen der Weltkriegssieger.
Vater Theodor, der von Gicht und Arthrosen geplagt war, fand es eine gute Idee, seinen Söhnen den Weg zur Diplomatenlaufbahn zu ebnen, damit sie, anders als er selbst, einmal etwas sehen würden von der Welt.
Wer nicht mindestens ein oder zwei Auslandsaufenthalte hinter sich gebracht, wer nicht London und Paris besucht hatte, gelte in der gehobenen Schicht inzwischen nichts mehr. Behaupteten unisono die Loewe-Brüder, so wie umgekehrt Abertausende englischer und französischer Söhne aus besserem Hause behaupteten, daß man im sagenhaften Berlin gewesen sein müsse, um einen gewissen Grad an Weltläufigkeit zu erreichen. 1932 waren Max und Karl siebzehn und bestanden ihr Abitur mit Einserschnitten. Der Vater spendierte beiden eine Reise. Karl durfte im Sommer für vier Wochen nach London, Max nach Paris. Sie bekamen jeweils 400Mark Reisegeld, eine großzügige Summe. Karl hielt sich viel in der Londoner Staatsbibliothek auf, gab wenig Geld aus und legte am Grab seines Namensvetters Marx ein Bukett aus roten Rosen nieder. Wovon er dem Vater mit Rücksicht auf dessen politische Unbedarftheit nichts erzählte. Max verlor sein Kapital bei einem stark überteuerten Besuch im Bordell und sah sich leider gezwungen, dem Vater davon zu erzählen, damit der ihn auslösen konnte. Theodor Loewe hatte seine Liebe stets auf beide Söhne gleichermaßen verteilt. Doch wenn er ehrlich zu sich war, liebte er Max etwas mehr, allein, weil der viel öfter Gelegenheiten bot, ihm zu verzeihen. Theodor Loewe, der sich verbraucht und unnütz vorkam, verzieh so gern. Es war ihm ein Genuß, ja eine echte Lust, um Pardon gebeten zu werden und den auch zu gewähren. Karl hingegen geriet so gut wie nie in Bedrängnis oder in irgendeine Abhängigkeit zum Vater, er war der mustergültige Sohn, beinahe schon abstoßend reif. Max gewöhnte sich in Paris das Trinken an, Karl jedoch empfand jede Beeinträchtigung seines Denkvermögens durch Alkohol als Selbstverstümmelung. Max war nach Nietzsche sehr diffusen Einflüssen ausgesetzt, darunter Klages, Rilke, Spengler und Jünger, aber auch Trakl, Heym, die Futuristen um Marinetti und sogar einige Vertreter des Dadaismus hatten es ihm angetan, sein Lieblingsstück war der Baal, von dem noch jungen Kleistpreisträger Bertolt Brecht. Ein Drama, das Karl lange Zeit abscheulich fand, eine schwarze Messe aus Menschen- und Frauenverachtung, ein zur Selbstzerstörung anstiftendes Machwerk aus Weltekel und hysterischer Selbstüberschätzung.
Max Loewes Nietzsche-Engagement hatte an Verve eingebüßt, mangels sichtbarer Fortschritte. Hätte Deutschland den Weltkrieg nicht verloren, dann – glaubte er, wäre manches vielleicht ganz anders verlaufen. So aber regierte der Alltag die Menschen, zwang sie, kleinlichen Bedürfnissen nachzugeben, auf Kosten der großen Aussicht. Max’ ehrgeizige Vision, das deutsche Volk, die Kulturnation Nummer eins in der Welt, in einer Allianz mit den ja auch einigermaßen kultivierten Franzosen zu Vorreitern einer alles umwälzenden philosophischen Bewegung zu erziehen, auf welche Weise auch immer, wurde weniger und weniger wahrscheinlich. Die Menschen, das mußte er schmerzlich einsehen, strebten in der großen Mehrzahl nicht dem Übermenschen zu, sondern dem Stück Fleisch am Sonntag und genügend Brot und Kartoffeln unter der Woche.
Max suchte, schwer enttäuscht, nach einem Platz für sich, einem System von Relevanz, nach jenem festen Punkt im All, von dem aus der alte Archimedes einst die Erde aus den Angeln hatte heben wollen. Max lebte dahin, eine heimatlose, flatternde Seele, gepeinigt von der Sehnsucht, dem Geschehen anders denn als Außenseiter zusehen zu müssen. Wieder und wieder ertappte er sich bei dem doch eigenartigen Phänomen, auf etwas für minderwertig Befundenes Neid zu entwickeln, konkret auf seinen Bruder, für den der Kommunismus die einzig relevante humanistische Bewegung war und die Weltrevolution der einzig sinnvolle Kampf. Max hielt Karls Sowjet-Affinität für eine, wie er es nannte, Bübchenliebschaft, eine Utopie primitiver Denkart. Karl beurteilte seinen Bruder nicht weniger streng. Max habe den roten Faden noch nicht entdeckt im Labyrinth seiner Orientierungslosigkeit, paktiere mit extremen, elitären Positionen, die sich selbst nicht ganz geheuer seien und ihren irrationalen Kitzel aus überzogenem Pathos, glasigen Phrasen und expressionistischer Lyrik bezögen. Er suche verkrampft nach Fluchtwegen aus dem Großbürgertum, beharre auf einer fatalen und illusionistischen Überheblichkeit gegenüber seinen Mitmenschen, das sei nichts anderes als metrisch verbrämtes Köcheln im eigenen Saft, führe zwangsläufig zur Trunk- und Abenteuersucht und müsse letztlich in den fundamentalen Selbstzweifel, ja in den Selbstmord münden. Im Ergebnis drohe ein fahrlässig vergeudetes Leben. So redete der wütende Karl – im Gespräch mit seinem Vater – über den eigenen, einzigen Bruder.
Theodor Loewe nickte nur, er war durch Krankheiten und Lebenserfahrung zu alt und verlebt, um noch überzeugend eine Position zu beziehen, die er nicht anderntags schwer angezweifelt hätte. Politische Tiraden hinterließen in ihm ein Gefühl dumpfer Mattigkeit. Vielleicht hatte Karl recht, vielleicht auch nicht, wer vermochte das schon zu beurteilen, jetzt? Wo das Leben der beiden jungen Männer doch eben erst begonnen hatte und die Zukunft sich Optionen in jede Richtung vorbehielt. Theodor Loewe gab auf. Nicht wie man aufgibt im Bewußtsein, versagt zu haben. Eher so, wie man etwas losläßt, von sich stößt, das einem keine Freude mehr bereiten will.
Es war Zeit, fand er, zu sterben, und die Beantwortung drängender Fragen anderen zu überlassen. So starb der Gerichtsrat a.D., mit sehr gemischten Gefühlen, in seinem 67. Lebensjahr an einem Schlaganfall. Er war in der Todessekunde stolz auf seine Sprößlinge, und doch voller Sorge, nicht alles in seinem oder in ihrem Sinne geregelt zu haben, was wiederum – das war sein nun wirklich allerletzter, nicht ganz zu Ende gebrachter Gedanke – nun einmal das Los jeglicher zum Verfall bestimmten Entitäten ist, nämlich beleidigt zu sein (daß ohne einen alles irgendwie weitergehen wird, und oft ganz anders als vorhergesehen).
Beim Begräbnis, im September 1932, sprach Karl kaum ein Wort über den eigenen Vater, überließ die Leichenrede dem bestellten Priester. Dies hatte seinen tieferen, niemandem je offenbarten Grund darin, daß Karl bei öffentlichen Reden oft, egal worum es ging, die Tränen in die Augen traten, was ihm sehr peinlich war.
Hinterher, beim Leichenschmaus im Gasthof zur Eule, überraschte er die Verwandtschaft durch anhängliche Redseligkeit, als wäre er betrunken. Insbesondere überrumpelte er den Bruder durch sein absurdes Angebot, Brüderschaft zu trinken, und zwar mit Sprudelwasser, was denn auch geschah. Max war seinem Wesen nach zu sentimental, um gegen unvorhersehbare Versöhnungsangebote gefeit zu sein. Er ärgerte sich immens über seine Schwäche, wider jede Überzeugung gerührt zu reagieren, sobald er angemenschelt wurde.
Nietzsche, dachte er dabei, hätte das sicher nicht für gut befunden. Es fehlt mir an Härte, notierte er am Morgen danach in einer Art Tagebuch. Ich schleife mich ab an so vielem, das ich zerschneiden müßte. Ich werde nie ein Diamant sein. Spiegele das Licht nur wider, statt zu strahlen.
Karl fand unter anderem lobende Worte über den immer noch jungen Brecht, der sich politisch ja überraschend positiv entwickelt habe und nun endlich klare, verständliche Werke zur Aufklärung der Arbeiter verfasse. Den Baal müsse man nun definitiv anders lesen und bewerten, als eine Art Abgesang auf spätbürgerlich-dekadente individuelle Veitstänze. Max schwieg beharrlich und ließ sich auf Debatten nicht ein, die er als schwer deplaziert empfand.
Es ging doch darum, den Vater zu Grabe, nicht irgendwelche Gesinnungskämpfe auszutragen.
Dafür war nicht die Zeit und der Ort, hier, in einem Potsdamer Gasthof, bei Schweinebraten und dunklem Bier, an dem Max sich betrank, bis er sich übergeben mußte.
Das Testament des Gerichtsrats bedachte beide Söhne paritätisch. Irgendetwas anderes hätte die Zwillinge auch überrascht. Sie feierten eine von niederen Zwängen freie Zukunft, sahen sich imstande, die nächsten Jahre nach eigenem Gutdünken zu gestalten und die Pläne, die der entmachtete, nun verwesende Vater für sie gehabt hatte, erst einmal ruhen zu lassen. Max begriff, warum Karl auf dem Leichenbegängnis so euphorisch und mitteilsam gewesen war. Ihm, mit ein wenig Verspätung, ging es ja genauso. Man muß das als Geschenk begreifen, notierte Max in seinem Tage- oder Notizbuch. In einer Zeit wie dieser nicht hungern zu müssen, sondern versorgt zu sein, mehr als versorgt, beschert, wie an Weihnachten. Dadurch, daß die Alten abtreten, ohne die ihnen gegebene Zeit über Gebühr auszureizen, machen sie uns Nachgeborenen einiges möglich. Es lebe der Tod!
Max und Karl kamen überein, die riesige Potsdamer Wohnung samt biedermeierlichem Interieur zu verkaufen, den Erlös zu teilen und zwei kleinere Wohnungen in Berlin zu erwerben. Karl zog in den Wedding, ein schmutziges Arbeiterviertel und eine traditionelle Hochburg der Roten. Aber auch in diesem Stadtteil, vor allem dort, wo er an Mitte grenzte, fand man Straßen, in denen es sich leben ließ. Max bevorzugte die Gegend um den Nollendorfplatz in Schöneberg, wo es viele Bordelle und anrüchige Lokale gab, darunter auch solche mit homosexueller Klientel. Ernst Jünger hatte ein paar Jahre, gar nicht lange her, drei Hausnummern weiter gewohnt; Else Lasker-Schüler (die von Max aber so gar nicht geschätzt wurde) wohnte immer noch da, und man mußte mit der U-Bahn nur ein paar Stationen fahren, bis man vor der Arztpraxis von Gottfried Benn stand, der im Nebenberuf einer von Max’ bevorzugten bis schwer verehrten Lyrikern war. Um sich von ihm behandeln zu lassen, erwog Max ernsthaft, sich eine minderschwere Haut- oder Geschlechtskrankheit einzufangen, er wußte nur noch nicht, wo. Das würde sich mit der Zeit ergeben.
Max gewann an Welterfahrung vor allem im erotischen Bereich, was, wie er später in seinem Sudelbuch notierte, der schnellste Weg sei, jedwede schöne Illusion durch grauenvolle Wahrheiten zu ersetzen.
Er schlief mit Frauen, öfter aber mit Männern. Sein Wesen besaß auf unstete, brüchige Naturen große Anziehungskraft, verfügte über jenen verschattet moribunden Charme, dem man für Tage und Wochen verfällt, bevor er einem auf die Nerven zu gehen beginnt. Max pflegte etliche Beziehungen gleichzeitig. Keine dauerte lange, noch war je von Liebe die Rede. Physisch ähnelte er einem Schiele-Motiv, dürr, mit heraustretenden Rippen, riesigen Füßen und kurzgeschorenen Haaren. Sein trauriger, oft wie hilfesuchend im Zimmer umherwandernder Blick wirkte auf viele Betrachter unheimlich, auch gehörte er jener seltenen Sorte von Menschen an, die zu faszinieren imstande sind, obwohl sie bevorzugt schweigen, selten Bonmots und niemals Witze in die Konversation streuen. Karl war ganz anders, er rasierte sich nicht, seine eher pyknische Erscheinung wurde von einem Dschungel aus braunen Locken gekrönt, und er redete viel, während er selten masturbierte, nie ins Bordell ging und darauf hoffte, eines Tages in der vorüberschwappenden Menge die große Gefährtin zu erkennen, mit der er den Rest des Lebens verbringen würde. Kleinere Techtelmechtel zur Triebstillegung, dachte er, würden nur seinen Blick trüben, für die eine, Einzige, Wesentliche. Seltsamerweise deckte sich eine solche Erwartungshaltung, eine solche Fokussierung auf das Rarissimum, so gar nicht mit seinem Glauben an die Grundähnlichkeit aller Menschen. Ja, es schien, als hätten die Brüder jeweils ein sexuelles Dogma entwickelt, das sich konträr zu ihren weltanschaulichen Positionen verhielt.
Als ihr gesetzlicher Vormund wurde ein Onkel eingesetzt, Theodors älterer Bruder Ernst, der mit seinen 78Jahren kaum noch in der Lage war, den Freiraum der jungen Loewes einzuschränken, geschweige denn erzieherisch auszugestalten. Wo er eine Unterschrift leisten mußte, tat er dies wie eine lästige Pflicht, die ihn nichts weiter anging. Bald sparten sich Max und Karl denn auch den Brief oder die jeweilige Zugfahrt nach Leipzig und fälschten die Unterschrift des Onkels. Nicht, weil sie seinen Einspruch zu fürchten gehabt hätten, sondern weil die Prozedur ja doch nur reine Formalie gewesen wäre.
Ernst-Erich Loewe, ein ehemals mittelmäßig erfolgreicher Kolonialwarenhändler, der zeit seines Lebens auf emotionale Bindungen jeglicher Art verzichtet hatte und inzwischen damit zufrieden war, wenn er mit heißem englischem Schwarztee, in eine Decke gehüllt, vor seinem Weltempfänger hocken und am Sendersuchknopf drehen konnte, mochte keine Jugendlichen. Da machten selbst Max und Karl keine Ausnahme. Im Gegenteil, er mochte sie sogar noch etwas weniger. Sie würden eines Tages seine Erben sein, ohne jemals irgendetwas für ihn getan zu haben. Daß er nicht allzuviel zu vererben hatte, war eine andere Sache. Ernst-Erich wartete auf den Tod, von dem er sich vergessen fühlte. Sah belästigt eher als verbittert auf jenes folgenlose Nichts zurück, das sein Leben gewesen war. Ein grotesker Haufen ausgesessener Zeit. Die jungen Loewes verachteten ihn instinktiv, ohne genug über den Onkel zu wissen. Für ihr Verdikt genügte der Umstand, daß er keine Spur von sich hinterlassen würde. Wer in ihren Augen etwas gelten wollte, mußte mindestens einmal den Puls der Gegenwart erhöht haben, mußte mindestens einmal das Risko eingegangen sein, die eigene Existenz in die Waagschale zu werfen, auf doppelt oder nichts. Darauf konnten sie sich, trotz aller Unterschiede, einigen.
Beide fanden es bewegend, die erste eigene Wohnung auszusuchen, zu kaufen und zu beziehen. Leere Räume mit Teppichen und Tapeten auszukleiden, mit Möbeln und Lampen, mit Kissen und Bettbezügen, mit Geschirr und Besteck, mit Buchregalen, Schirmständern und Blumenvasen. Max fand bei einem Trödler zwei Kuhfelle zum Sonderpreis, auf denen lag er gerne, wenn er rauchte und nachdachte. Oder er verkroch sich zwischen den schwarzen und roten Plüschkissen auf der wuchtigen viktorianischen Recamiere. Karl entschied sich für eine kahle, streng funktionale Ästhetik des Notwendigsten. Klare Formen ohne Zierat. Den vier Quadratmeter großen Schreibtisch aus Stahl und Glas, der das Arbeitszimmer so herrlich transparent belassen hatte, tauschte er aber bald gegen einen aus Holz ein, an dem man nicht das Gefühl bekam, sich die Unterarme abzufrieren.
Die so unterschiedlich eingerichteten Wohnungen besaßen eine einzige Gemeinsamkeit – nämlich je ein Exemplar des ersten europäischen in Serie gefertigten Kühlschranks der deutschen Kühl-und-Kraftmaschinen-GmbH.
Karl kam mit dem ›roten‹ Wedding, der so rot gar nicht mehr war (dank des obsessiven Engagements von Dr.Joseph Goebbels waren bereits ganze Straßenzüge bräunlich verfärbt), wenig zurecht. Der Wedding war in weiten Teilen viel eher ein grauer und vor allem im Winter deprimierender Stadtteil. Hier hatte Karl sich unter die Arbeiter mischen, sie studieren und auf politische Versammlungen gehen wollen. Doch die meisten Arbeiter besaßen eine Nase für den jungen Mann aus gutbürgerlichem Hause, der ganz alleine zweieinhalb saubere, helle Zimmer bewohnte, sie reagierten mißtrauisch und oft berlinisch derb, machten sich über ihn lustig, er fand keine Freunde für seine Seele – und politische Versammlungen zu besuchen, das mußte er am eigenen Leib erfahren, war gefährlich. Bei seinem ersten Versuch geriet er prompt in eine wilde Saalschlacht, etwa fünfzig SA-Männer überfielen die Veranstaltung, skandierten Parolen, randalierten mit Schlagstöcken, die Polizei griff mit zwei Hundertschaften ein, die prügelten, politisch vorbildlich neutral, jeden nieder, der ihren Weg kreuzte, ob von links oder rechts, einerlei. Sogar Schüsse fielen und es gab mehrere Verletzte zu beklagen. Karl zog sich geschockt in seine Wohnung zurück.
Politisch motivierte Morde waren im Norden Berlins keine Seltenheit. Noch vor wenigen Monaten hatte, gleich eine Straße weiter, ein SA-Mann eine 37-jährige Frau auf offener Straße erstochen, einfach nur, weil er sie ihrem Erscheinungsbild nach für eine Kommunistin hielt. Karl vertiefte sich fortan um so lieber in die Lektüre marxistisch-ökonomischer Literatur. Für unüberschaubare und nervenzerfetzende Straßenkämpfe war ihm sein junges Gehirn denn doch zu wertvoll – und ein Raufbold war er ohnehin nie gewesen, inzwischen tendierte er zum Pazifismus. Beziehungsweise dazu, die vielleicht hier und da nötige Drecksarbeit anderen zu überlassen, die durch Muskelkraft und Hemmungslosigkeit dazu viel eher prädestiniert waren. Wie um sein Gewissen zu erleichtern, spendete er die stolze Summe von fünfhundert Reichsmark, gebunden an ein Hilfsprogramm für notleidende Proletarier, vulgo: eine Volkssuppenküche. Er zögerte noch, der KPD beizutreten. Die neu gegründete Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, die SAPD, eine linke Abspaltung der SPD, schien ihm intellektuell attraktiver, war aber von der Zahl ihrer Wähler her praktisch bedeutungslos. Er dachte lange darüber nach. Die SAPD, das war der größte Unterschied, forderte vehement eine Einheitsfront aller linken Parteien und Gewerkschaften gegen den aufkommenden Faschismus. Die KPD traute nur sich selbst. Wenn überhaupt.
Von der großen Depression der letzten Jahre der Weimarer Republik, von der Weltwirtschaftskrise und dem Leid der über fünf Millionen Arbeitslosen bekamen die Brüder höchstens soviel mit, wie man als Nichtbetroffener mitbekommen konnte. Sie lasen in der Zeitung darüber, sahen die langen Schlangen der Stempelgänger vor den Arbeitsämtern, staunten über Menschen, die breite Schilder auf dem Rücken trugen – SUCHE ARBEIT – MACHE ALLES –, doch die konkrete Armut und Verzweiflung ringsumher blieben in ihrer Wahrnehmung klein und namenlos, wie durch ein Fernrohr betrachtet. Selbst Karl spürte doch, bei allem Engagement für die Sache der Arbeiter, in keinem Moment echtes Mit-Leid im engen Wortsinn. Es ging ihm viel zu gut dafür, und das Elend ringsumher fand wie hinter einem Gaze-Vorhang statt, behielt etwas Abstraktes, das zwar Bedauern zuließ, echte Bedrückung aber nicht.
Die Krise tauchte eben nicht ganz Berlin in Schwermut, es gab genügend Inseln, auf denen das blühende Leben unvermindert weiterging, fast wie in jenen Jahren, für die gerade die Bezeichnung Goldene Zwanziger in Mode kam.
Ende Januar 1933 wurde, für die Loewes überraschend, Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt, während die Kommunisten als zweitstärkste Kraft das Nachsehen hatten. Die NSDAP, eine Partei, die beide Brüder über Jahre hin nicht wirklich ernstnehmen wollten, hatte aus Geldmangel kurz vor der Selbstauflösung gestanden, bevor sie sich im letzten Moment durch Finanzspritzen aus der Wirtschaft erholen konnte. Die SA, halb Schlägertruppe, halb Privatarmee, die im letzten Jahr für drei Monate verboten gewesen und vorschnell für tot erklärt worden war, zählte nun fast 400.000Mitglieder – wo kommt nur soviel Geld her, die alle zu ernähren und mit Uniformen auszustaffieren –, fragte sich Karl oft, wie geht das bloß? Jene sonderbar wiederauferstandene SA organisierte am 30.Januar einen Fackelzug als Siegesfeier. Sowohl Max wie Karl trieb es zum Brandenburger Tor, sie wurden, ohne sich zu begegnen, Zeugen des Aufmarsches und zeigten sich beeindruckt. Der eine, Max, ganz offen, aus der spontanen Empfindung heraus, der andere, Karl, gab immerhin zu, daß die Kommunisten, wenn sie bei der nächsten Wahl gewinnen würden, durchaus von dem Spektakel etwas lernen könnten.
Reklame beherrschen sie – leider – schrieb er seinem einzigen Freund, Johann Münchinger, der die Schule abgebrochen hatte und neben der Stütze von schwer durchschaubaren Geschäften in der Filmbranche lebte.
Du weißt, was Lenin sagte, schrieb er an Johann: Es ist eine alte Wahrheit, daß man in der Politik oft vom Feinde lernen muß. Und du weißt auch, was er zu dir gesagt hätte: Der Film ist für uns die wichtigste aller Künste.
Ein paar Tage darauf, die Einrichtung der neuen Wohnung stahl viel Zeit, wurde Karl formell Mitglied der KPD, als gelte es, ein Zeichen zu setzen gegen die jüngsten Entwicklungen in Deutschland. Er hatte sich pragmatisch für die mächtigste linke Partei entschieden, die ganz auf der Linie des großen, von Karl verehrten Genossen Stalin lag, während die gar nicht mehr zu den Wahlen angetretene, aber im Untergrund noch agierende SAPD etliche Trotzkisten in ihren Reihen duldete. Was an Trotzkisten eigentlich so verabscheuungswürdig sein sollte, nein, das hatte niemand Karl bisher erklären können. Und es tat auch nichts mehr zur Sache. Um elf Uhr dreißig morgens, am 4.Februar, setzte Karl Loewe seine Unterschrift unter eine lange Beitrittserklärung und bekam ein vorläufiges Parteibuch ausgehändigt.
Fast zeitgleich, im Grunde nur Minuten später, wurde die KPD als staatsfeindliche Partei geächtet, was immer das bedeuten mochte, denn es handelte sich nicht, wie man annehmen könnte, um ein Verbot. Praktisch bedeutete es, daß ohne legitime Grundlage, doch mit einer Entschiedenheit, die niemand für möglich gehalten hätte, die Jagd auf ihre ranghöchsten Mitglieder begann. Die neuen Machthaber griffen zu, errichteten für politische Gegner erste sogenannte Konzentrationslager, schreckten auch vor Verschleppung und Mord nicht zurück. Das Ausmaß der Brutalität, die Hemmungslosigkeit des Terrors, mit der eine radikale Partei die Gunst der Stunde für sich zu nutzen wußte, machte jeden Beobachter sprachlos. Manche sagten einen Bürgerkrieg voraus. Zu dem es nicht kam. Und niemand konnte überzeugend erklären, warum sich kein schlagkräftiger Widerstand zu organisieren wußte. Das Land war in einen revolutionären Taumel geraten, und viele Faktoren spielten, wie von einem Teufel kunstvoll jongliert, zusammen. Hindenburg, der schon greise und gesundheitlich schwer angegriffene Reichspräsident, unterschrieb mehrere Notstandsgesetze, die den Nazis in die Hände spielten. Der Protest der linken Parteien blieb seltsam kraftlos und unkoordiniert, bis zuletzt waren sich Kommunisten und Sozialdemokraten spinnefeind. Statt verzweifelter Gegenwehr boten sie ein jämmerliches Bild der Ratlosigkeit und Apathie.
Als ›rechts‹ galten übrigens Stahlhelm und Deutschnationale, als ›links‹ SPD und KPD, als mittig das katholische Zentrum und ein paar unbedeutende liberale Parteien. Die NSDAP, offiziell extrem-rechts eingeordnet, war dabei, objektiv betrachtet, irgendetwas anderes, mit dem konventionellen Parteien-Spektrum nicht zu fassen.
Max, an dem die Ereignisse eher abperlten, als daß sie ihn alarmiert hätten, erfüllte sich einen lange gehegten Traum und suchte Albertina auf. Sie war nicht allzuschwer zu finden, arbeitete noch immer als Garderobiere, seit neuestem im Femina, dem beliebten Ballsaal mit zweitausend Sitzplätzen, elektrisch hebbarem Parkett und drei Tanzkapellen. Er besuchte sie mittags bei ihr zu Hause in Moabit, klingelte aufs Gradewohl. Sie erkannte ihn kaum wieder, fühlte sich aber geschmeichelt, als der junge Mann mit der leisen Stimme und den dunklen, traurigen Augen ihr erzählte, wie sehr er unter ihrem Verlust gelitten habe. Sie kochte dem Gast Kaffee und betrachtete staunend den großen Strauß roter Rosen. Max stand vom Stuhl auf und setzte sich neben Albertina auf das Sofa. Ob er sich ein wenig an sie drücken dürfe, wie damals? Verwirrt ob dieser Bitte, sagte sie nicht ja noch nein und duldete es, daß Max ein Ohr zwischen ihre Brüste bettete. Ich kann deinen Herzschlag hören, flüsterte er. Wie ein fernes Echolot. Kann ich heute bei dir bleiben? Albertina begann zu weinen. Sie fühlte sich veralbert, und wenn nicht veralbert, dann war dieser junge Mensch doch eindeutig verschroben. Zu viele Erinnerungen an eine große, hoffnungsvolle Vergangenheit kehrten zurück. Er müsse jetzt gehen, sagte sie barsch, das führe zu nichts, sei doch verrückt. Nein, sie duldete keine Widerrede, sie schob Max, der sich eben mit offenem Mund in ihr verschwitztes Decolleté wühlen wollte, von sich fort und wies ihm die Tür. Er winselte und bettelte, bot ihr Geld für die Nacht. Sie ohrfeigte ihn, obgleich die Summe ihr an sich imponierte und sie für Sekunden ins Grübeln geriet. Doch Albertina war in jener Zeit mit einem Tischler befreundet, der, obwohl er nur alle paar Abende vorbeikam, die Eifersucht in Person war. Ihr blieb wenig anderes übrig, wenn sie sich nicht auf ein ganz und gar unvorhersehbares und närrisches Abenteuer einlassen wollte, als Max aus ihrer Wohnung – und – das war das Allerschlimmste – den riesigen, duftenden Rosenstrauß in den Müllkübel zu werfen.
Max suchte Trost im Nachtleben. Man sah ihm seine siebzehn Jahre nicht unbedingt an, er ließ sich einen Schnurrbart wachsen, um älter zu wirken. Einige Male war ihm der Einlaß in gewisse Etablissements verwehrt worden. Seitdem er einen eleganten Anzug trug, kam das kaum noch vor und ganz sicher nicht in den Clubs der Homosexuellen, wo er schnell Freunde fand und Kontakte zu den üblichen Vergnügungen – Kokain, Partys unter erotischen Motti, Transvestitenfeten, bis hin zu Hinterzimmerorgien jeglicher Couleur. Ein paarmal ging er mit älteren Herren mit und genoß das Gefühl, begehrt und beschenkt zu werden. Aus Gleichaltrigen machte er sich wenig, sie waren ihm in den allermeisten Fällen zu oberflächlich und charakterlos. Das Milieu des nächtlichen Berlin um den Nollendorfplatz herum war in ganz Europa berühmt und berüchtigt; jeglicher noch so entlegene Trieb konnte hier befriedigt werden, wenn man Glück hatte, sogar ohne dafür zahlen zu müssen.
Berlin, das war so viel. Berlin, das waren:
Die Dominas, die mit hohen, oft schillernd roten, goldenen oder giftgrünen Stiefeln samt obligatem Bubikopf vor dem Kaufhaus des Westens auf willige Opfer warteten.
Berlin, das waren:
Die Fünfuhrfrauen, die in der Sparte Geselligkeit regelmäßig Kontaktanzeigen schalteten und ihre diversen Cicisbeos