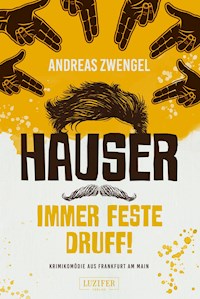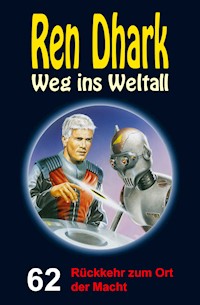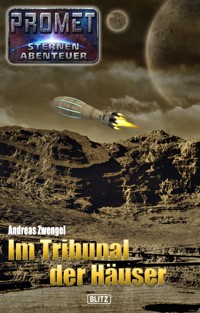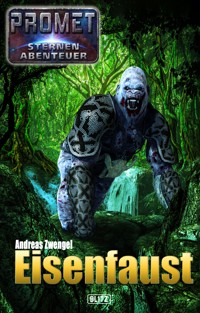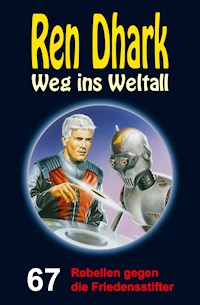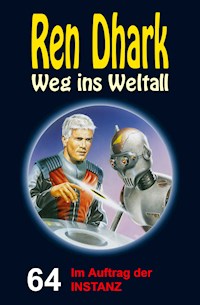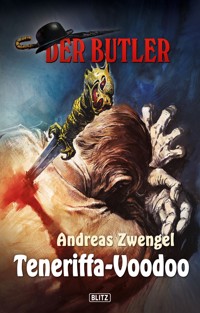Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schattenchronik - Gegen Tod und Teufel (Mystery Thriller)
- Sprache: Deutsch
Schattenchronik-Agent Martin Anderson verfolgt in den USA einen Serienkiller, der sich als Vampir entpuppt. Anschließend möchte er zurück nach Deutschland, wird aber von einer Autodiebin abgelenkt, die sich von einer Motorradgang verfolgt fühlt. Schon bald wird Martin klar, dass er es nicht mit gewöhnlichen Bikern zu tun hat. Die vier stammen aus den Tiefen der Unterwelt. Und die Hölle folgt ihnen nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHATTENCHRONIK – GEGEN TOD UND TEUFELBand 13
In dieser Reihe bisher erschienen:
2901 Curd Cornelius Die andere Ebene
2902 Curd Cornelius Die Riesenwespe vom Edersee
2903 Curd Cornelius & D. J. Franzen Die Ruine im Wald
2904 Curd Cornelius & Astrid Pfister Das Geistermädchen
2905 Curd Cornelius & G. G. Grandt Killerkäfer im Westerwald
2906 Andreas Zwengel Die Stadt am Meer
2907 Michael Mühlehner Gamma-Phantome
2908 Curd Cornelius & A. Schröder Dunkles Sauerland
2909 Andreas Zwengel Willkommen auf Hell-Go-Land
2910 Andreas Zwengel Tempel des Todes
2911 Andreas Zwengel Flussvampire
2912 Andreas Zwengel Die Barriere bricht
2913 Andreas Zwengel Die vier Reiter der Hölle
2914 Michael Mühlehner Der Voodoo-Hexer
Andreas Zwengel
DIE VIER REITER DER HÖLLE
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-559-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Kapitel 1
Bei der Beerdigung gab es keine Gäste. Die Trauer hielt sich bei den wenigen Anwesenden, die sich aus beruflichen Gründen dort aufhielten, in Grenzen. Ich beobachtete die Zeremonie aus dem Schatten eines Baumes. Die Sonne stieg über Phoenix, Arizona, empor und würde bald ihren Zenit erreicht haben. Schon jetzt war es heiß, und ich hatte das geliehene Jackett an den Ast des Baumes gehängt.
Der Mann in dem Grab hieß Billy Bob Watson und stammte aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Lafayette in Louisiana. Bis vor einem Jahr hatte er ein unauffälliges Leben geführt, bis er plötzlich seinen halben Heimatort abschlachtete und untertauchte. Die Polizei suchte vergebens nach ihm und das Morden endete nicht. Billy Bob zog eine Blutspur nach Westen und wurde einer der produktivsten Serienkiller in der amerikanischen Geschichte. Ein Titel, der nicht leicht zu erringen war.
Als er die erste Staatsgrenze überquerte und weitermordete, wurde das FBI hinzugezogen und scheiterte ebenso, wie die örtlichen Behörden. Es gab einen Mitarbeiter bei der Bundesbehörde, denen der Verdacht kam, es nicht mit einem gewöhnlichen Mörder zu tun zu haben. Der Mitarbeiter war Second Director Garth Wimmer, und er rief seinen alten Bekannten Robert Linder von der Schattenchronik an, meinen Boss. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich mich noch in den Staaten auf, weil meine Partnerin Leila und ich einen Anschlag am New Yorker Flughafen verhindert hatten.1
Seitdem war ich Billy Bob Watson auf der Spur gewesen. Quer durch den Süden der Vereinigten Staaten. Bis hierhin zu diesem Friedhof. Ich hatte den Pick-up der Terroristen behalten, weil er mir notfalls auch als Schlafplatz dienen konnte. Obwohl ich mir anfangs nicht vorstellen konnte, Schlaf zu finden, solange Leila mit dem Tod rang. Inzwischen war sie längst außer Gefahr, ich vermisste ihre Gesellschaft.
Als der Priester seine Rede beendete und sich zum Gehen wandte, erhob ich mich und zog mein Jackett wieder an. Ich schlenderte zu den beiden Totengräbern hinüber, die auf den Stielen ihrer Schaufeln lehnten und darauf warteten, ihre Arbeit beginnen zu können. Ich erklärte ihnen, dass ich gerne in Ruhe Abschied von dem Toten nehmen würde und zahlte ein großzügiges Trinkgeld, damit sie eine ausgiebige Mittagspause machten. Sie sahen mich zunächst skeptisch an, als versuchten sie zu erkennen, ob es sich bei mir um einen Grabräuber oder einen Perversen handelte, doch ich bestand den Test. Nachdem sie gegangen waren, trat ich an die offene Grabstelle. Ich blickte auf den billigen Sarg hinab, den der Staat Arizona spendiert hatte. Eine Handvoll Erde lag darauf, die der Priester hineingeworfen hatte. Ich nahm an, als Privatmensch hätte er gerne auf den Sarg gespuckt, aber als Priester musste er auch bei einem solchen Monster seinem Amt treu bleiben.
„Ich habe dich lange gejagt und kam jedes Mal zu spät“, sagte ich leise. „In Tulsa, Amarillo und Albuquerque bist du mir knapp entkommen, aber hier in Phoenix hattest du dieses Glück nicht mehr. Ich musste dir folgen, während zu Hause eine gute Freundin schwer erkrankt war und meine übrigen Freunde ihren wohl härtesten Kampf ausgefochten haben.“
Ich war wütend auf diesen Kerl. Wegen der vielen unschuldigen Opfer, aber auch wegen Leila und meinen anderen Freunden, die ich im Stich lassen musste, während sie gegen die andere Ebene kämpften.2
Ich hatte zuvor auf Helgoland einen Vorgeschmack davon bekommen, mit wem sie es zu tun gehabt hatten.3
Dass Billy Bob Watson nun in diesem Grab vor mir lag war nicht mein Verdienst. Er ging in einer Kleinstadt, keine zwanzig Meilen von hier, dem örtlichen Sheriff in die Falle. Zusammen mit drei seiner Deputys hatte er Billy Bob in die Enge getrieben. Allerdings zeigte der Serienmörder nicht die Absicht, sich lebend fassen zu lassen. Er griff die Polizisten an und starb in einem Kugelhagel. Die folgende Autopsie dauerte weniger als eine halbe Stunde, weil es keine Fragen über die Todesursache gab. Nachdem die Behörden den Leichnam freigaben, sollte die Leiche schnellstmöglich unter die Erde gebracht werden, wobei der Sheriff sich sehr dafür einsetzte, dass dies nicht auf dem kleinen Friedhof seines Städtchens passierte.
Die Mittagssonne stand nun direkt über der Grabstätte. „Jetzt liegst du hier in deinem Sarg und glaubst, du bist sicher. Du wartest auf den Schutz der Nacht, damit du deinem Grab entsteigen kannst. Aber da hast du falsch gedacht.“ Ich trat etwas Erde über den Rand der Grabstelle, die prasselnd auf den Sargdeckel fiel. „Ich nehme an, du kannst mich da drin hören. Ich habe mich an deinen Opfern entlanggearbeitet und jetzt bist nur noch du übrig. Alle anderen habe ich erlöst.“
Zuerst herrschte Schweigen, aber dann hörte ich ihn. „Vielleicht hätten sie lieber als Vampire weitergelebt“, drang seine gedämpfte Stimme aus dem Sarg.
„Oha, es spricht“, höhnte ich sarkastisch. „Nun, ich fürchte, wir haben ihnen beide nicht die Möglichkeit gelassen, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden.“
„Du bist der Bulle, der mir seit Texas folgt“, sagte Billy Bob Watson.
„Ich bin kein Bulle. Ich musste hinter dir aufräumen, weil du nicht allen deinen Opfern die Gnade erwiesen hast, sie zu töten.“
„Ich dachte, ein paar Vampire mehr könnten dich beschäftigen und von meiner Spur ablenken. Hat wohl nicht funktioniert.“
„Es hat mich nur aufgehalten. Und wütend gemacht“, antwortete ich. Eigentlich wäre dies ein Job für Mick Bondye gewesen. Er hasste Vampire, obwohl er selbst einer war. Ein Voodoo-Vampir, um genau zu sein. Eine seltene Unterart, die wenig mit den kaltblütigen Blutsaugern gemeinsam hatte.
Das Leichenschauhaus, in dem Billy Bob auf seine Beerdigung gewartet hatte, befand sich direkt unter der Polizeistation. Mir war das Risiko zu groß gewesen, beim Versuch hineinzukommen, erwischt zu werden. Ich hätte eine Menge erklären müssen. Vor allem, den angespitzten Holzpfahl. Also hatte ich stattdessen draußen Wache gehalten und in der Nacht darauf gewartet, dass er zu entkommen versucht. Was aber nicht geschah. Ich hatte einen guten Beobachtungsposten, von dem aus ich beide Kellerfenster und die Eingangstür sehen konnte. Vergebens schlug ich mir dort die Nacht um die Ohren. Offenbar waren seine Verletzungen so schwer gewesen, dass er länger zum Heilen brauchte. Vielleicht hatte ihn auch die Autopsie von der Flucht abgehalten. Schließlich wurden dabei Eingriffe am Körper vorgenommen, die man auch als Vampir nicht so einfach wegsteckte. Wäre er nur leicht verletzt worden, hätte man bei der Untersuchung unmöglich die Selbstheilkräfte des Leichnams übersehen können. Das wäre nicht nur für ihn ein Problem gewesen, denn in diesem Fall hätte ich in die Polizeiwache hineingemusst, um den Vampir zu beseitigen, bevor seine Existenz bekannt wurde. Obwohl das vielleicht keine so große Rolle mehr spielte. Nach allem, was ich im Internet über das Auftauchen der Flussvampire in Köln gelesen hatte, war zumindest in Deutschland die Existenz von Vampiren kein Geheimnis mehr.4 Aber ich hätte auch verhindern müssen, dass der Mörder über den Sheriff und die FBI-Agenten herfiel. Sonst hätte ich ganz schnell eine Vampirplage am Hals gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich wünschte, die Leiche wäre einfach eingeäschert worden, dann wäre das Problem gelöst. Eine Feuerbestattung empfand ich als angemessen. Ich trat einen Stein in das Grab, der über den Holzdeckel des Sarges polterte. „Noch Pläne, Billy Bob?“
„Ich dachte, ich lasse dich einfach weiterquatschen, bis es dunkel wird, und dann komme ich raus und reiße dir das Herz aus der Brust.“
„Daraus wird wohl nichts.“
Für einen Moment schwieg der Vampir. „Du hast gesagt, du bist kein Bulle, was dann?“
„Du willst mich wirklich bis zur Dunkelheit hinhalten, oder? Ich nehme an, du hast keine Uhr da drinnen? Es ist kurz nach Mittag und die Sonne scheint genau in deine Grube. Weißt du, zuerst hatte ich mir überlegt, während der Beerdigung zu rufen, ich hätte ein Klopfen aus dem Sarg gehört. Damit die Totengräber in die Grube springen und den Deckel öffnen, um dich zu retten. Aber ich wollte den Leuten den Anblick ersparen, wenn du verbrennst. Stattdessen habe ich mich für eine brachiale Methode entschieden. Vor kurzem hatte ich es mit ein paar sehr unangenehmen Typen in New York zu tun, die haben mir eine umfangreiche Waffensammlung hinterlassen.“ Mit diesen Worten zog ich eine Handgranate aus der Außentasche meines Jacketts. Ich sah mich kurz um, ob jemand in der Nähe war, dann ging ich in die Hocke, entsicherte die Granate und ließ sie auf die Mitte des Sargdeckels fallen. „Dein Weg endet hier!“, sagte ich und trat rasch zurück.
Die Explosion blies Erde und Holzreste aus der Öffnung hervor. Der Knall war schon laut gewesen, aber die hohen Schreie von Billy Bob Watson übertrafen ihn. Nach dem Qualm der Explosion stieg dichter Rauch von dem verbrennenden Vampir auf. Ich hatte für gewöhnlich keine Freude an der Bestrafung von Verbrechern, doch jetzt verspürte ich Genugtuung, denn ich hatte seine Opfer gesehen. Anstatt einen Menschen zu töten, um seinen Blutdurst zu stillen, hatte er immer mehrere auf einmal umgebracht, um so den immensen Blutverlust zu vertuschen. Aber diese Erklärung konnte nicht über seine Mordgier hinwegtäuschen. Er hatte nicht fürchten müssen, als Vampir enttarnt zu werden. Die wenigsten Menschen glaubten an deren Existenz und die Schattenchronik wollte dafür sorgen, dass es auch so blieb.
Die Schreie verstummten, es stieg kein Rauch mehr auf. Ich zog das Jackett aus und legte es auf einen Grabstein. Dann krempelte ich die Hemdsärmel nach oben, schnappte mir eine der zurückgelassenen Schaufeln und begann, Erde in das Grab zu schippen.
Kapitel 2
In der heißen Nachmittagshitze überquerte ich die Grenze nach Nevada. Die Klimaanlage leistete gute Arbeit, verbrauchte aber eine Menge Benzin. Ich gähnte so herzhaft, dass ich fürchtete, meine Kiefer könnten sich aushaken. Ich war hundemüde und konnte kaum noch die Augen aufhalten. Letzte Nacht hatte ich keinen Schlaf bekommen, aber nun könnte ich etwas davon nachholen. Ob ich heute nach Deutschland zurückkehrte oder erst morgen, spielte keine Rolle.
Die Tankanzeige hatte das letzte Viertel bereits erreicht. Ich könnte volltanken und mir in einem Motel ein Zimmer nehmen. Der Duft eines frischen Lakens erschien mir verlockend. Vor allem aber war es möglich, einmal ohne schlechtes Gewissen auszuruhen. In den letzten Wochen fürchtete ich, dass jede Stunde Schlaf zu viel weitere Menschenleben kosten könnte. Und dieser Gedanke hatte mich noch zusätzlich wach gehalten, sodass ich die ganze Zeit über zu wenig Schlaf bekam.
Panisches Hupen ließ mich aufschrecken, ich riss das Steuer zur Seite. Ich war einem vorbeifahrenden Wagen ziemlich nahegekommen, obwohl die kerzengerade Straße wirklich sehr breit war. Verdammt, ich hatte ihn nicht einmal bemerkt. Jetzt war Schluss, ich brauchte eine Pause. Ein Hinweisschild wischte vorbei, ich setzte den Blinker. Die Raststätten waren Oasen in dieser öden Landschaft, dabei machten sie nicht viel her. Ein paar überdachte Zapfsäulen und zwei, drei einstöckige Flachbauten, mehr war es meist nicht.
Erst als ich sicher in einer Parklücke stand und den Motor abgestellt hatte, atmete ich wieder aus. Ich nahm meine Sonnenbrille ab und rieb mir die Augen, dann stieß ich die Autotür auf und stieg in die Hitze hinaus. Mein Hemd klebte mir sofort am Körper. Ich überquerte den Platz und trat in die künstliche Kühle des Gastraumes. Dort setzte ich mich an den ersten freien Tisch. Der Luftzug der Klimaanlage fuhr unangenehm durch die verschwitzten Stellen meines Hemdes. Die Kellnerin kam vorbei und zeigte mir ein Lächeln, das keinerlei Gefühl vermittelte. Offenbar befand sie sich am Ende ihrer Schicht oder machte ihren Job schon zu lange, um anderen noch etwas vorzuheucheln.
„Etwas zu essen?“, fragte sie, während sie meinen Kaffeebecher füllte.
„Gibt es noch Frühstück?“
„Hier gibt es den ganzen Tag Frühstück.“
Ich wies auf eine Abbildung in der Karte, die Spiegeleier, Speck und Toast zeigte. Die Frau kritzelte eine Zahl auf ihren Block und war wieder verschwunden, bevor ich die Kaffeetasse anheben konnte. Ich widerstand der Versuchung, den Kopf einfach auf die Tischplatte zu legen und direkt hier zu schlafen. Ich riss mich zusammen und streckte den Rücken durch. Dabei begegnete ich dem Blick eines wild aussehenden Mädchens, dass ein paar Tische weiter saß und mich unverhohlen anstarrte, als betrachte sie ein Stück Auslegware. Ich wich ihrem Blick aus und schaute stattdessen auf die verschrammte Tischplatte und die dampfende Kaffeetasse. Das Getränk war mies und nicht heiß genug, um das zu überdecken. Ich nahm zwei große Schlucke, aber der Kaffee war zu dünn, um irgendeine Wirkung auf meinen Kreislauf zu haben. Genauso gut hätte ich versuchen können, mich mit gechlorten Leitungswasser aufzuputschen.
Ich sah mich gelangweilt im Raum um. Alles wirkte so kalt und steril, dass man sich unmöglich wohlfühlen konnte. Die Gäste sollten essen, trinken, zahlen und verschwinden, und das alles so schnell wie möglich. Die wenigen Menschen, die außer mir noch im Raum waren, schienen dieses Prinzip begriffen zu haben. Stumm schaufelten sie ihre Eier oder Bratkartoffeln in sich hinein, spülten es mit Bier oder Kaffee herunter und sahen zu, dass sie weiterkamen. Die Kellnerin, die mir den Kaffee gebracht hatte, schien auch nicht geeignet, einen Gast länger zu halten. Sie stellte den Teller vor mir ab, riss die Rechnung von ihrem Block und klemmte sie unter einen großen Zuckerstreuer. Sie machte keinen Hehl daraus, mit einem feuchten Lappen nur darauf zu warten, dass ich den letzten Bissen im Mund hatte, um den Tisch abzuwischen und für den nächsten Kunden freizumachen. Ich tat ihr den Gefallen und beeilte mich mit dem Essen. Ich ließ mir noch einen zweiten Kaffee einschenken, dann begab ich mich mit der Rechnung zur Kasse und tippte ein großzügiges Trinkgeld bei den Auswahlfenstern an. Als ich wieder ins Freie trat, traf mich die Hitze erneut wie eine Wand. Ich ging zum Wagen.
Sie musste schon eine Weile auf mich gewartet haben. Lässig lehnte sie am Kotflügel des Pick-Ups, die Hände in den Taschen ihrer Jeanslatzhose vergraben. Ihr blondes Haar war an den Seiten abrasiert. Am Hinterkopf und vorn trug sie es länger, was dafür sorgte, dass sie ständig die Haare aus ihrem Gesicht wischen musste. „Hallo“, grüßte sie gutgelaunt. „Wohin fährst du?“
„Wohin willst du?“
„Richtung L.A.“
„Dann kann ich dich mitnehmen.“
„Spitze.“
„Bist du allein?“, fragte ich.
„Denkst du, ich habe einen Freund, der im Gebüsch lauert, bis du mich einsteigen lässt?“
„Hast du?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich kann dich beruhigen, wir werden ganz allein sein.“
Die Art, wie sie das sagte, beruhigte mich überhaupt nicht. Ihre aufgesetzte Fröhlichkeit konnte nicht darüber hinwegtäuschten, wie nervös sie war. Gleich würde sie mir sicher eine Erklärung für ihren seltsamen Aufzug liefern. Darauf war ich sogar gespannt. „Du kannst deine Sachen auf den Rücksitz legen.“
„Ich habe nichts bei mir.“
„Kein Gepäck?“
Sie wusste selbst, wie seltsam das klang. Trotzdem bot sie mir keine Erklärung an, und ich fragte nicht nach. Sie nahm vorne Platz. Aus der Nähe sah sie noch um einiges extremer aus. Sie trug ein schwarz-blau kariertes Holzfällerhemd, das ihr mindestens drei Nummern zu groß war, und eine Jeans deren Löcher nicht bereits von der Herstellerfirma produziert wurden. Ich hatte sofort den Eindruck, dass es sich nicht um ihre eigene Kleidung handelte. Ich stellte mir vor, dass sie dringend irgendwo verschwinden musste und sich das Erstbeste gegriffen hatte, das sie finden konnte. Das wäre auch eine Erklärung für das fehlende Gepäck.
Wollte ich wirklich wissen, was dahintersteckte?
Ihr linkes Ohr war mehrfach durchstochen. Sie trug drei silberne Knöpfe und zwei Anhänger darin. Außerdem bemerkte ich einen Ring in ihrer Nase und einen weiteren, der aus ihrer Augenbraue herausragte.
„Was ist?“, fragte sie, als sie meinen Blick bemerkte.
„Nichts.“
„Du hältst nicht viel von meinem Schmuck, stimmt´s?“
„Geschmackssache“, sagte ich zurückhaltend.
„Frauen haben schön auszusehen für die Männer, die sie ansehen. Richtig?“
„Das habe ich nicht gesagt.“
„Ist auch nicht nötig.“
„Wenn du mich für einen Chauvinisten hältst, warum bist du dann bei mir eingestiegen?“
„Weil du der einzige Mann in der Raststätte warst, der der Kellnerin nicht in den Ausschnitt geglotzt hat.“
„Und?“
„Deshalb nehme ich an, du bist keiner von den Halbidioten, die sofort einen Annäherungsversuch starten, sobald sie mit einer Frau allein sind.“
Einen Annäherungsversuch konnte man das wirklich nicht nennen, was sich bisher zwischen uns abgespielt hatte. Sie gab sich hart, doch das wirkte gespielt. Verstohlen blickte sie sich immer wieder in alle Richtungen um. Als eine Autotür zugeschlagen wurde, zuckte sie zusammen. Sie hatte Angst, daran bestand kein Zweifel. Ich wusste nur noch nicht, vor wem oder was. Offenbar befand sie sich auf der Flucht und bemühte sich, dass man es ihr nicht anmerkte. In meinem Fall tat sie dies aus dem Grund, damit ich mir keine Sorgen machte und mein Angebot zurückzog. Ich überlegte, vor wem sie floh. Die Polizei schloss ich aus. Sie hatte keine Angst davor erwischt zu werden, sie fürchtete um ihr Leben. Jemand war hinter ihr her, um ihr etwas anzutun. Ihr Mann oder ihr Freund, mit dem sie Streit hatte? Möglich, aber mein Gefühl sagte mir, dass es hier sicher um mehr als nur einen Beziehungsstreit ging.
„Alles in Ordnung mit dir?“, fragte ich.
Sie sah sich immer noch um, plötzlich blieb ihr Blick an etwas hängen. „Wir müssen los!“
Ich schaute in die Richtung, in die sie zuletzt geblickt hatte, konnte aber nichts entdecken. Keine Bedrohung, überhaupt nichts. Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie unter psychischen Problemen leiden könnte. Nur weil ich um die Existenz des Übernatürlichen wusste, bedeutete das nicht, dass es nicht eine Menge Menschen gab, die sich solche Dinge nur einbildeten. Ich musterte sie skeptisch.
„Hör mal, ich will dich nicht beunruhigen“, sagte sie schnell. „Es ist alles in Ordnung. Ich habe es nur schrecklich eilig, können wir bitte fahren?“
Ich seufzte, weil ich mal wieder den Augenblick verpasste, an dem ich unbeschadet aus einer Geschichte aussteigen konnte. Aber das war wohl mein Schicksal, mir für ein erledigtes Problem, in diesem Fall Billy Bob Watson, sofort ein neues zu suchen.
„Die Karre ist ne Wucht“, sagte sie. „Er gehört nicht dir, oder?“
„Nein, ist geklaut.“
Sie lachte. „Genau das dachte ich mir.“
„Willst du ihn kaufen, ich mache dir einen guten Preis“, sagte ich lächelnd.
„Ich schätze, das würde meinen Geldbeutel etwas überfordern. Übrigens mein Name ist Alicia. Wie heißt du?“
„Martin“, sagte ich ohne zu überlegen.