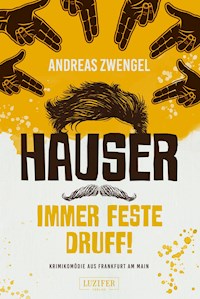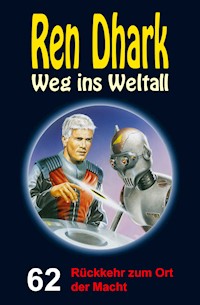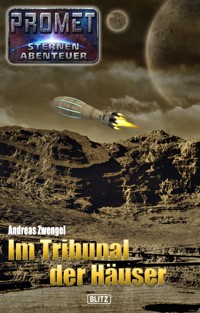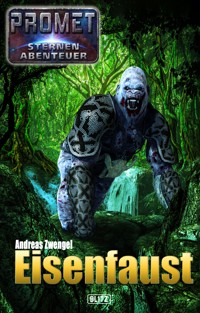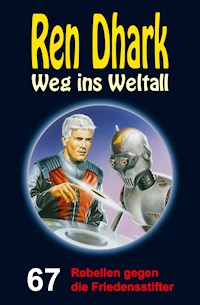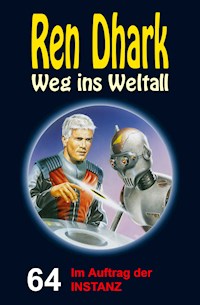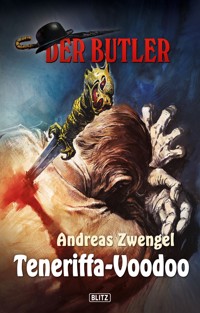3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
Mason, Violet und Oblomow kämpfen um ihr Leben und um den Schatz. Nach einer Belagerung im mexikanischen Grenzgebiet wird das Gold auf dem Colorado River weitertransportiert. Mehrmals wechselt es den Besitzer und das Ende der Verfolgungsjagd ist ungewiss. Ebenso wie das Schicksal aller Beteiligten.Die Printausgabe umfasst 218 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WESTERN LEGENDEN
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
Andreas Zwengel
Schlechte Verlierer
Historischer Western
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-415-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Nächtlicher Besuch
Als die Dämmerung begann, richteten die Mitglieder des Trecks ihr Lager ein. Es wurden Feuer gemacht, Wachen aufgestellt und Essen zubereitet. Einige Männer schickte man los, um Brennholz zu sammeln, was in einer nahezu baumfreien Umgebung durchaus eine Herausforderung darstellte. Vertrocknete Sträucher waren in Hülle und Fülle vorhanden. Doch die verbrannten laut knisternd und schneller, als man sie aufschichten konnte. Es gab die letzten Reste des vorgekochten Essens, das in der sengenden Hitze kaum noch länger genießbar war. In mehreren Töpfen brodelte der Eintopf als braune Masse. Die einzelnen Zutaten waren längst nicht mehr zu erkennen. Das schlichte Essen sollte wohl eine letzte Hürde darstellen, bevor man den Rest seines Lebens in Saus und Braus verbringen durfte. Eine letzte Lektion in Demut. Natürlich lag es auch daran, dass Piddock bei seiner Flucht aus Authority den Koch des California erschossen hatte.
Schweigend löffelten alle den Eintopf aus Blechnäpfen. Ein paar Männer verbesserten die zerkochte Brühe mit selbst gebranntem Schnaps. Nicht jedem bekam dieses Gebräu. Überrascht sahen die Männer am Feuer den Priester vorbeiflitzen. Er streifte die Hosenträger ab, knöpfte seine Hose auf und ging in die Hocke, kaum dass er den ersten Busch erreicht hatte. Gelächter übertönte die unangenehmen Laute der Darmentleerung. Lachen war ein seltenes Geräusch auf dieser Reise geworden und selbst der Priester musste darin einstimmen. Während er aus dem Gebüsch zurückstapfte, knöpfte er seine rote Unterkleidung hinten zu und erntete vereinzelt Applaus. Die gute Stimmung endete schlagartig, als der Wind die Ausdünstungen zu ihnen herübertrug.
Ein paar Männer waren mit Maultieren aufgebrochen, an denen unzählige Feldflaschen hingen. Sie verliehen den Lasttieren das Aussehen von unförmigen Phantasiewesen aus den Träumen eines Fieberkranken. Bis zur ausgekundschafteten Wasserstelle würden sie eine Stunde brauchen und etwas länger zurück. Bis dahin würde es dunkel sein. Wie lange die Männer brauchten, um etwa hundert Wasserflaschen zu füllen, würden sie erst bei ihrer Rückkehr berichten können. Aber wer sich im Sommer in eine solche Gegend wagte, sollte keine Mühe scheuen, an frisches Wasser zu gelangen.
Im Lager hatte Lupo Carlyle seine Leute zu höchster Aufmerksamkeit verpflichtet. Sie patrouillierten ständig um das Lager herum. Zusätzlich gab es Wachposten an allen vier Ecken des Lagers und Lupo hatte auch ein paar Leute in die Felsen geschickt. Sie konnten in der Dunkelheit nicht besonders viel sehen, aber wenn sie die Ohren spitzten, würden sie ihre nähere Umgebung kontrollieren können. Die übrigen Männer saßen um Feuerstellen herum. Sie schwatzten, rauchten, tranken, lachten und sangen. Es war unwahrscheinlich, dass sie irgendjemanden in ihrer Umgebung bemerkten, solange der nicht mit Fackeln jonglierte oder in die Luft schoss.
*
In der Nacht wurden zwei Wachposten ermordet, ohne den geringsten Laut. Einem wurde die Kehle aufgeschlitzt, dem anderen der Schädel mit einem ordinären Stein zertrümmert. Beides konnte nicht lautlos erfolgt sein, trotzdem hatte niemand etwas bemerkt. Lupo verdoppelte die Wachen, ließ die Männer zu zweit patrouillieren. Es gab viel Gerede im Lager, die Leute waren in heller Aufregung. Niemand wusste, wer sie angriff. Waren es Überlebende des Verfolgertrupps oder etwa Indianer? Was noch beunruhigter war, es handelte sich jeweils um eine Hälfte eines Wachtrupps. Die überlebende Hälfte schwor Stein und Bein, dass sie sich niemals weiter als fünf Schritte voneinander entfernt hatten. Nicht einmal um Wasser zu lassen oder die Notdurft zu verrichten. Doch dem oder den Angreifern schienen fünf Schritte auszureichen. Eine der Wachen blieb verschwunden. Ihr nächtlicher Besucher hatte sie verschleppt. Gegen Morgen hörten sie die grässlichen Schreie des Mannes, die niemanden im Lager kalt ließen. Bei Sonnenaufgang fanden sie dann die verstümmelte Leiche des Wachpostens und vergruben sie an Ort und Stelle, um den anderen den Anblick zu ersparen. Man hatte den Mann über einem Feuer an Armen und Beinen gehäutet.
„Diese Wilden sind einfach Monster, nicht besser als tollwütige Raubtiere“, hörte man aus mehr als einem Mund.
Die Morde zeigten bald Wirkung. Die ersten Mitglieder des Trecks wägten ab zwischen Reichtum und Sicherheit. Zuerst waren es einige Taucher, die sich absetzten. Manche offen, indem sie morgens am Lagerplatz zurückblieben, andere heimlich, in dem sie sich am Tag zurückfallen ließen. Sie verschwanden in alle Richtungen. Immer mehr Forderungen kamen auf, dass man mit einem Anteil des Goldes gehen durfte, doch in diesem Punkt ließ Lupo keine Diskussion zu. Jeder konnte jederzeit gehen, aber nur mit leeren Händen.
Zur Mittagszeit rasteten sie mehrere Stunden im Schatten, spannten Zeltplanen zwischen den Wagen auf und tränkten die Tiere. Trotz aller Vorkommnisse war Lupo zufrieden mit ihrem Fortkommen, und es hatte keine weiteren Verfolger gegeben. Vielleicht hatte das Schicksal der ersten Gruppe allen anderen als Warnung gedient. Eine Vorstellung, an die er nur zu gerne geglaubt hätte. Aber Lupo kannte die Natur des Menschen leider besser. Wenn es um Gold ging, noch dazu um eine solche Menge, wie sie auf ihren Wagen geladen hatten, war es sinnlos, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Die Leute würden versuchen, an das Gold zu gelangen oder bei dem Versuch sterben.
*
Als sie gesehen hatten, wie sich Oblomow in eine liegende Haltung auf einem der Wagen quälte, verspürten Violet und die Baronin Bedauern. Der russische Zwerg war beiden ans Herz gewachsen, Violet als Freund und der Baronin als Liebhaber. Die beiden Frauen waren zusammen auf demselben Wagen untergebracht. Ein Arrangement, das Lupo sicher diebische Freude bereitete, denn er hielt sich oft in Hörweite auf. Wenn er allerdings erwartet hatte, die beiden Frauen bei hitzigen Wortgefechten oder heftigen Rangeleien beobachten zu können, wurde er enttäuscht. In der gemeinsamen Notlage hatten die Frauen sehr schnell einen Waffenstillstand geschlossen. An Flucht dachten sie allerdings weniger, sondern ließen sich apathisch durch die Gegend ruckeln. Als sie am Abend endlich vom Wagen steigen durften, taten sie dies wie sehr alte Frauen. Jeder Knochen in ihrem Leib schmerzte von der ungefederten Fahrt. Ihr Nachtlager auf dem harten Erdboden erschien ihnen im Vergleich als willkommene Bequemlichkeit. Jeder Stofffetzen auf ihrem Leib war in der Hitze des Tages mehrmals vom Schweiß durchtränkt worden und wieder getrocknet. Die kühle Nacht ließ die beiden zusammenrücken und machte sie zumindest für die Dauer der Reise zu Verbündeten. Sie hielten abwechselnd Wache.
In Lupos Zelt tagte unterdessen sein Krisenstab.
„Was sollen wir tun, um uns zu verteidigen? Wir können nicht alle die ganze Nacht über wach bleiben“, sagte der Priester.
„Wir sollten Fallen bauen“, schlug jemand vor. Lupo schüttelte den Kopf.
„Jemand, der sich unbemerkt an bewaffneten Wachposten vorbeischleicht, soll in unsere Fallen tappen? Nicht einmal wenn wir professionelle Fallensteller unter uns hätten, würde ich glauben, dass das funktioniert.“
„Wir wissen nicht einmal, ob es nur einer ist. Es könnte genauso gut eine ganze Gruppe sein, die uns da angreift.“
Lupo sah von seinem Platz aus zu, wie sich einer seiner Ingenieure mit dem Priester stritt, der sich gerade nicht wie einer benahm. Allein die Menge der gotteslästerlichen Flüche hätte eine Exkommunizierung gerechtfertigt, von der Qualität ganz zu schweigen.
„Glaubst du, dass es Indianer sind?“
„Wer sollte es sonst sein? Kein Weißer könnte einem anderen Menschen so etwas antun“, sagte der Priester voller Überzeugung.
„Oder jemand will uns glauben machen, dass es sich um Indianer handelt.“
„Kein Christenmensch ...“, begann der Priester erneut. Lupo hob im Vorbeigehen die Hand und brachte ihn zum Schweigen. Er blieb bei Oblomow stehen.
„Denkst du, es ist Mason?“
Oblomow schüttelte den Kopf. „Nein. Das würde nicht zu ihm passen. Black dagegen würde ich es sofort zutrauen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es einem Brocken wie ihm gelingen würde, sich an jemanden heranzuschleichen, Blinde und Taube eingeschlossen.“
„Dann wird die Auswahl aber eng.“
„Ich denke immer noch, dass die Wilden dahinterstecken“, beharrte der Priester. „Bei allem Respekt: Die haben Grund genug, sich an uns rächen zu wollen.“
„Warum sollten sie das ausgerechnet jetzt machen, wo wir abziehen und sie ihren See zurückhaben können?“, fragte Lupo.
„Bei den Rothäuten können wir doch keine Maßstäbe wie Logik oder Vernunft anlegen.“
Lupo hatte keine Lust, weiter mit ihm zu diskutieren, und ging zu einem der Feuer.
Oblomow blieb an seiner Seite. „Wie viele deiner Männer kennen den genauen Weg?“, fragte er.
Lupo kniff misstrauisch die Augen zusammen. „Wieso willst du das wissen?“
„Ich habe so einen Verdacht. Also, wie viele haben unsere Route hier ausgekundschaftet?“
„Es sind drei. Wir wollten ganz sicher sein, dass nicht nur ein Mann Bescheid weiß.“
„Das war ein kluger Gedanke. Wer sind diese drei Männer?“
„Ihre Namen? Wieso willst du die wissen?“
„War Millerton einer von ihnen?“
Lupo blieb stehen und packte Oblomow an der Schulter. „Woher weißt du das?“
„Auf dieselbe Weise, wie es auch unsere Verfolger herausbekommen haben. Die drei Männer haben sich an der Spitze abgewechselt. Wenn man uns eine Weile beobachtet, muss das einfach auffallen. Millerton wurde während der Wache ermordet. Eine andere Wache, die starb, hieß Argayle. Er war der Mann, der gefoltert wurde. Gehörte er ebenfalls dazu?“
Lupos Schweigen war ihm Antwort genug.
„Dann gibt es nur noch eine Person, die den genauen Weg kennt. Ihr solltet gut auf sie aufpassen.“
Lupo sah zu einigen Männern am Lagerfeuer hinüber.
„Noch etwas“, sagte Oblomow. „Wir müssen davon ausgehen, dass der oder die Entführer von Argayle inzwischen das Ziel unserer Reise kennen.“
„Dann kann es Black nicht sein, denn der kennt es ohnehin. Er bräuchte niemanden zu foltern.“
„Was bedeutet, dass wir immer noch nicht wissen, wer uns angreift.“
Lupo war anzusehen, welchen Eindruck diese Überlegungen auf ihn machten und wie wenig dankbar er dem Überbringer dieser Erkenntnis war. Er teilte Oblomow zur nächsten Wache ein, gab ihm aber keine Waffe in die Hand, sodass dieser mit einem Stein und einem Knüppel bewaffnet in der Dunkelheit hockte und mit seinem Schicksal haderte. Oblomow schlief ohnehin nicht besonders gut. In den Jahren, die er nun unterwegs war, hatte er selten eine Nacht durchgeschlafen. Zuerst aus Angst, dann aus Vorsicht und schließlich aus Gewohnheit. Wenn man die meiste Zeit unter freiem Himmel oder in zwielichtigen Behausungen übernachtete, lernte man, auf jedes ungewöhnliche Geräusch zu reagieren, wenn man nicht von den gurgelnden Lauten der eigenen durchschnittenen Kehle erwachen wollte. Ganz selten, meist unter dem Dach von Freuden oder im Gefängnis, hatte er sich sicher genug gefühlt, um alle Vorsicht zu vergessen.
Eine andere Wache, ein ehemaliger Apachenscout, verließ seinen Posten und rückte an Oblomow heran. Er hatte ebenfalls keine Lust, sich von einem unbekannten Angreifer aufschlitzen zu lassen und so hockten sie Rücken an Rücken in der Dunkelheit, um sich gegenseitig zu decken. Oblomow und der Apache teilten sich eine Zigarette. Schweigend saßen sie hintereinander. Bisher hatten sie keine zehn Worte miteinander gewechselt. Trotzdem, oder gerade deswegen, verstanden sie sich blendend. Zwangsläufig kamen sie auf die Bedrohung zu sprechen.
Der Apache war überzeugt, dass es sich nicht um einen Indianer handelte. „Wenn du dich besser mit der Geschichte meines Volkes auskennen würdest, wäre dir klar, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als man in eurer Welt kennt. Der weiße Mann hat vor nichts Respekt. Weder vor der Natur noch vor den Tieren, nicht einmal vor sich selbst.“
Die Verbitterung war deutlich zu spüren, denn der Mann hatte bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Im Bürgerkrieg hatten beide Kriegsparteien Prämien auf Apachenskalps ausgesetzt, und es war kein angenehmes Gefühl, wenn man in einem Kriegsgebiet kauerte und selbst die eigenen Leute seinen Haarschopf in Whiskey umrechneten.
Oblomow spürte eine Bewegung an seinem Fuß und sah eine Schlange zwischen seinen Stiefeln hindurchgleiten. Er tippte seinen Nachbarn an. Doch der blieb ziemlich gelassen. „Hier leben allein dreißig Arten von Klapperschlangen. Man sollte sich eher wundern, wenn man einmal keine Schlange sieht.“
Ständig kontrollierten sie ihre Stiefel und Decken auf Schlangen und Skorpione. Der Biss einer Klapperschlange war zwar nur selten tödlich, aber trotzdem keine Erfahrung, die man freiwillig machte. Ebenso der Stich eines Skorpions, wobei man beachten musste: je kleiner die Biester, umso giftiger.
„Ist die Schlange in eurer Religion nicht ein Symbol für das Böse, kleiner weißer Mann? Vielleicht ist das unser Mörder, bloß in einer seiner anderen Erscheinungen.“
„Du scheinst dich gut auszukennen“, sagte Oblomow.
„Oh ja. Mister Carlyle hat oft die Worte seines Gottes bemüht, um uns zu verdeutlichen, wie er Versagen bestrafen würde.“
„Ich hätte Carlyle nicht für sonderlich religiös gehalten.“
„Er nutzt alles für seine Zwecke, was ihm nützlich erscheint. Dazu gehört auch die Religion. Als er den Stamm vom See fernhalten wollte, ließ er einige von ihnen kreuzigen. Ja, tatsächlich. Riesige Kreuze standen auf beiden Seiten des Weges und die toten Körper waren Richtung Berge gedreht.“
„Der Stamm ließ sich dadurch abschrecken?“
„Sie haben nachts die Leichen von den Kreuzen geholt, aber die Botschaft haben sie wohl verstanden. Er kann nur hoffen, dass er niemals in ihre Gewalt gerät.“
„Aber du glaubst nicht, dass die Schlange ein Bote unseres Gottes ist und die Wachen ermordet hat, oder?“
Der Indianer lachte leise. „Nein, natürlich nicht. Das ist doch Blödsinn“, er drehte sich zu Oblomow, „die Wachen wurden vom Skinwalker ermordet.1 Er wird uns alle töten.“
Oblomow fuhr herum. „Und was will dieser Skinwalker?“
„Der Skinwalker, an den ich glauben will, hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden weißen Mann zu töten. Jeden einzelnen von ihnen. Selbst wenn sie unser Land verlassen und sich nach Osten zurückziehen, der Skinwalker wird sie finden und töten. Selbst wenn alle weißen Männer über das Meer fliehen, wird er ihnen folgen.“
„Du meinst das große Wasser.“
„Ich meine den verdammten Atlantik.“
Oblomow sah den Scout überrascht an. „Komisch, du klingst gar nicht so verrückt. Also, wenn man das Inhaltliche mal weglässt.“
„Könnt ihr zwei da oben endlich mal die Schnauze halten?“, brüllte eine Stimme durch die Nacht. „Hier unten gibt es Leute, die schlafen wollen!“
Als die Sonne aufging, kehrte Oblomow ins Lager zurück und wurde für die nächste Nacht wieder zur Wache eingeteilt. Proteste waren sinnlos, und Lupo wies zwei Männer an, ihm eine gehörige Tracht Prügel zu verabreichen, wenn er weiter meckerte.
Sie lagen hinter ihrem Zeitplan, da sie bereits am Nachmittag einen Unterschlupf für die Nacht suchen mussten, der schwer zugänglich und leicht zu verteidigen war. Bis zum Einbruch der Dunkelheit würden sie es gegen jeden Eindringling gesichert haben. Das alles kostete Zeit. Doch wie sich in der folgenden Nacht zeigte, waren all ihre Bemühungen vollkommen sinnlos.
Nach den Toten der letzten Nacht verschwanden nun Dinge aus dem Lager. Zunächst belangloser Plunder, dann Waffen und Gold. Wer immer es war, er schien ihnen zeigen zu wollen, dass er im Lager ein- und ausgehen konnte, wie es ihm beliebte. Er konnte ihnen das Gold unter der Nase wegschnappen.
In der nächsten Nacht verschwand nichts, sondern Dinge tauchten im Lager auf, die dort vorher nicht gewesen waren. Gegenstände aus Authority, die sie zurückgelassen hatten. Längst glaubte niemand mehr, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Indianer handelte. Und am nächsten Morgen, dem sechsten Tag ihrer Reise, hing das blutverschmierte Kleid von Mathilde, Lupos Köchin, an einem der Pferde am Anfang des Zuges.
Es kam das Gerücht auf, dass Lupo hinter den Morden steckte, um die Ängstlichen zu vertreiben und dadurch um ihren Anteil zu prellen. Natürlich wagte es niemand, diesen Verdacht laut auszusprechen.
Blacks Kutsche
Black stieg aus der Kutsche und macht ein paar Schritte an den Abhang. Dort unten lag Lupos Lager. Aus der Ferne sah es ziemlich friedlich aus. Ein vernünftiger Mann wäre froh gewesen, dem Tod entronnen zu sein, und hätte seine Reise in die entgegengesetzte Richtung fortgesetzt. Doch Black folgte dem Treck. In einigem Abstand zwar, aber nicht mit der Absicht, Lupo ungeschoren davonkommen zu lassen. Seine Mitreisenden waren nicht allzu schwer zu überzeugen gewesen. Lincoln war kaum zu bremsen, weil er Mathilde als Gefangene bei dem Treck vermutete, und Blacks Kutscher Roscoe spekulierte auf einen ordentlichen Anteil am Schatz. Black hatte nicht vor, den Treck unterwegs anzugreifen. Er würde als Erster die nächste Etappe erreichen, das Kommando über die Söldner übernehmen, die er angeworben hatte, und dann auf Lupos Ankunft warten. Black war nicht wütend auf Lupo, weil der ihn um seinen Anteil geprellt hatte, sondern weil er ihm zuvorgekommen war. Denn nichts anderes hätte Carlyle am Treffpunkt erwartet, nachdem das Gold sicher verstaut gewesen wäre.
Lincoln war die ganze Fahrt über sehr unruhig. Er wollte so schnell wie möglich zu seiner Frau. Black musste ihn immer wieder beschwichtigen und vertrösten. Er beteuerte, dass Lupo viel zu sehr Gentleman sei, um Mathilde zu verletzen. Violet und die Baronin seien doch ebenfalls bisher unbeschadet geblieben. Daraufhin verlangte Lincoln das Fernglas, um das Lager nach ihr abzusuchen.
„Jetzt nicht. Wir wollen doch nicht auffallen. Roscoe wird sich nach ihr umsehen.“
„Glaubst du, ich würde mich erwischen lassen? Das Leben meiner Frau leichtsinnig riskieren?“
„Nicht so laut, verdammt“, zischte Black, „du machst genau das Falsche und kündigst uns als Echo an.“
„Ich will das Fernglas“, beharrte Lincoln und streckte seine Hand danach aus.
Blacks Gesicht nahm einen bedrohlichen Ausdruck an. „Du wirst jetzt zur Kutsche gehen und dortbleiben, sonst prügele ich dich dahin. Und anschließend kannst du dich alleine durchschlagen. Hast du das jetzt verstanden, Boy?“
Lincoln sah ihn hasserfüllt an.
„Sofort“, stieß Black zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. Lincoln hob die Hände, als wolle er sich auf ihn stürzen. Doch dann machte er kehrt und ging zur Kutsche. Lange würde Black den Mann nicht mehr unter Kontrolle halten können. Wenn er eine größere Bedrohung als eine Hilfe wurde, musste er sterben.
Black verspürte keine Gewissensbisse wegen Mathilde, höchstens eine leichte Verärgerung, weil es so unnötig gewesen war. Er hätte es sich verkneifen können, um es zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Wenn er auf Lincoln als Verbündeten nicht mehr angewiesen wäre. Angesichts der Anzahl von Lupos Truppe, brauchte er momentan jeden Mann.
Lincoln trat einen Stein aus seinem Weg, der bis zur Kutsche rollte und gegen ein Rad stieß. Er verstand nicht, weshalb Black sich so abweisend verhielt. Ihnen lief die Zeit in mehrfacher Hinsicht davon. In seiner Kutsche gab es alles, was er für eine lange Reise brauchte. Alles, außer Lebensmittel. Die hatten sie bei der eiligen Abreise nicht mehr einladen können. Ihre Wasservorräte waren sehr begrenzt und sie hatten sie sofort rationiert, aber für eine tagelange Verfolgung war es einfach nicht genug.
Lincoln ging unauffällig zur Kutsche, um nach Abbie zu sehen. Die junge Schwarze tauchte zögerlich auf, als er klopfte. Sie hatte einige Blutergüsse im Gesicht und ihr linkes Auge war geschwollen. Beide Träger ihres Kleides waren zerrissen, sodass sie es stets vor ihrer Brust festhalten musste. Lincoln wurde wütend bei ihrem Anblick, obwohl er bereits genug misshandelte Mädchen gesehen hatte. „Wie geht es dir?“, fragte er und ärgerte sich über die blöde Frage.
Am Vortag hatte Abbie versucht, sich zu wehren und Black in die Hand gebissen, als er nach ihr griff. Tief hatten sich ihre Zähne in das übel schmeckende Fleisch gegraben. Black hatte nicht reagiert. Mit ausdruckslosem Gesicht, scheinbar ohne Schmerzempfinden, sah er ihr ins Gesicht, während sich ihr Mund mit seinem Blut füllte. Sie versuchte, ihre Zähne noch tiefer in die Hand zu bohren, bis er zumindest einen kleinen Teil der Qualen verspürte, die er ihr bereitete. Dann geriet das Blut in ihre Kehle und sie musste ihn hustend und spuckend freigeben. Black versetzte ihr mit der verletzten Hand eine heftige Ohrfeige, die sie durch die Kutsche trieb. Noch bevor sie wie eine Puppe gegen die Wand prallte, war er bereits über ihr und füllte ihr gesamtes Sichtfeld aus. Zischend spie er ihr die Worte ins Gesicht und obwohl ihr linkes Ohr noch taub von dem Schlag war, verstand sie jedes Wort. Black beschrieb ihr in allen ekelerregenden Einzelheiten, wie er Mathilde zu Tode gefoltert hatte und weidete sich an der Angst in ihren Augen. Er schloss seine Schilderung mit einer Ankündigung, was ihr bevorstand, wenn sie Lincoln auch nur ein einziges Wort davon erzählte. Schließlich hatte er sie mit diesem Wissen zurückgelassen.
Abbie brauchte diese Ermahnung nicht. Kein Sterbenswort würde über ihre Lippen kommen, wenn auch aus anderen Gründen als Blacks Drohung. Abbie war sicher, dass Lincoln an der Wahrheit zerbrechen und den Tod seiner geliebten Frau nicht verkraften würde. Sicher wäre ein selbstmörderischer Angriff auf Black die Folge, und er würde Lincoln genauso sicher töten wie Mathilde. Abbie wich seinem Blick aus und gab vor, in der Kutsche Ordnung zu schaffen, bis er endlich ging. Sie war überzeugt, dass er in dem Moment die Wahrheit erkennen würde, in dem er ihr in die Augen schaute. Lincoln war immer gut zu ihr gewesen. Auch, wenn er manchmal etwas zu viel Zuneigung von ihr wollte. Er quälte sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, dass er sie nicht so beschützen konnte, wie er es auf ihrer bisherigen Reise über den Kontinent getan hatte.
„Möchtest du dir etwas die Beine vertreten?“
„Ich darf die Kutsche nicht verlassen. Mister Black hat es verboten.“
„Ich kann ihn von hier aus sehen und dich rechtzeitig warnen, falls er kommt.“
Abbie war vorsichtig. Black konnte unberechenbar sein, wenn er sich hintergangen fühlte, auch wenn es sich nur um eine Lappalie wie das unerlaubte Verlassen der Kutsche handelte. Sie hätte sich gerne einmal ausgestreckt, wäre mit Freuden ein paar Schritte gelaufen. Aber sie schüttelte bedauernd den Kopf. „Es ist nicht erlaubt“, sagte sie und erwartete in seinem Gesicht die Anzeichen von Enttäuschung, weil er Abbie für eine dumme Sklavin ohne eigenen Willen hielt. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie Verständnis.
„Du hast zu sehr unter diesem Monster gelitten, um ein Risiko einzugehen. Das kann ich verstehen.“
Black hatte seine Triebe bei Abbie ausgelebt, deren Schreie und Schluchzen in der Nacht oft die einzigen Geräusche waren und selbst gestandene Männer wie Roscoe und Lincoln die Hände auf die Ohren pressen ließen.
„Es wird Zeit, das Feld etwas auszudünnen“, sagte Black. Roscoe machte sich augenblicklich auf den Weg zur Kutsche. Er schob Abbie zur Seite, hob die Sitzbank und nahm ein matt schimmerndes Gewehr heraus. Mit einer Tasche voller Munition kam er zurück.
„Such dir einen guten Platz“, befahl Black.
Roscoe legte sich auf den Boden und kroch an den Rand des Abhangs. Er richtete das Gewehr auf das Lager, schwenkte den Lauf über die Wagen, die Zelte und die Reiter. Die Übermacht war einfach zu groß. Sie waren zu dritt. Das hieß, auf jeden von ihnen kamen mindestens ein Dutzend Gegner. „Was sollen wir machen? Angreifen können wir sie nicht, und ihnen den ganzen Weg weiter zu folgen, macht auch keinen Sinn.“
Black machte eine wegwerfende Handbewegung und hob sein Fernglas. „Wir könnten sie nach und nach ausschalten, Roscoe. Zwei, drei Abschüsse, dann Positionswechsel. Ein paar Stunden später, wenn sie wieder zur Ruhe gekommen sind, machst du weiter.“
„Wie lange soll das dauern? Da unten ist eine halbe Hundertschaft. Das sind genug, um mich einzukreisen.“
„Präg dir schon mal ein paar Gesichter ein. Falls du Lupo vor die Flinte bekommst, dann drückst du ab. Verstanden?“
Roscoe gab ein Grunzen von sich und marschierte los. Er hatte einen gewissen Ruf als Scharfschütze und traute sich zu, jedes Ziel zu treffen. Roscoe besaß ein Sharps Rifle Modell 1859, die bevorzugte Waffe der Scharfschützenregimente während des Krieges. Das Problem lag in der Anzahl der Ziele. Sein Gewehr war eine Präzisionswaffe. Aber die Patronen mussten einzeln in das Hinterladergewehr geladen werden, und das dauerte nun einmal viel zu lange, wenn etwa vierzig Gegner auf einen zustürmten. Allerdings betrug die Reichweite des Gewehres fast eine Meile. Auch wenn er zum Laden länger brauchte als die neuen Winchester-Repetiergewehre, konnte er sich durch die Reichweite seine Gegner lange genug vom Hals halten. Aber in einer Sache hatte Black recht: Wenn er es schaffte, Lupo zu erwischen, würde ihnen das einen gehörigen Vorteil verschaffen.
Roscoe war dankbar, diese Begabung zum Killer an sich entdeckt zu haben, ansonsten hätte er sich weiter als Gigolo und Witwentröster durchschlagen müssen. Wie gefährlich dies war, hatte er schnell festgestellt, als er eine Stadt nach der anderen hatte verlassen müssen, auf der Flucht vor gehörnten Ehemännern und erwachsenen Kindern, die um ihr Erbe fürchteten. Es hatte ihn immer weiter nach Westen verschlagen und seine Klientinnen waren immer weniger lohnend geworden. Er hatte sich einem Treck angeschlossen und auf die Großstädte an der Westküste gehofft. Seine einzige befestigte Behausung in diesen Monaten war eine Wagenburg gewesen. Er hatte sich darauf spezialisiert, bigotten Siedlerfrauen spitze Schreie zu entlocken, während die Ehemänner dem Abendessen nachjagten. Die Kinder wurden zum Pilze sammeln geschickt und alle wunderten sich bei ihrer Rückkehr über den verklärten Blick und das gerötete Gesicht der Mutter.
Im Schatten eines Felsens bezog Roscoe seine Position. Dort erreichte ihn kein Sonnenstrahl, der ihn durch eine Reflexion auf dem Gewehr verraten konnte. Fein säuberlich reihte er zehn Patronen auf den Steinen neben sich. Wenn er nach ihnen griff, musste es schnell gehen und sie durften nicht wegrollen. Aus seiner Tasche nahm er ein Tuch, das er zusammenrollte und auf den Felsen vor sich legte, um den Gewehrlauf darauf abzustützen. Er stellte die Kimme auf und begann, das Gewehr herumzuschwenken. Er suchte die Wachposten um das Lager herum. Es dauerte eine Weile, weil die Männer sich gut versteckt hielten. Roscoe wunderte sich darüber. Selbst in Anbetracht des Goldes waren dies außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen. Aber auch die Art, wie sich die Männer verteilt hatten, unterschied sich vom schlichten Wachestehen. Sie schienen auf jemanden zu lauern. Wussten sie am Ende bereits von ihnen? Kannten sie ihren Aufenthaltsort? Roscoe wollte Black warnen, als er weit oberhalb des Lagers eine Bewegung zwischen den Felsen bemerkte. Sofort zog er den Kopf ein und betete, dass man ihn nicht gesehen hatte. Die Tatsache, dass noch kein Schuss gefallen war, nahm er dabei durchaus als positives Zeichen. Langsam hob er wieder den Kopf und schwenkte das Gewehr in die ungefähre Richtung der Bewegung. Der Ring der Wachen um das Lager war noch größer, als er gedacht hatte. Gewissenhaft suchte er die Felsen ab. Kurz konnte er eine Gestalt sehen, die sofort wieder zwischen den Felsen verschwand. Viel zu schnell, um irgendwelche Details zu erkennen. Im ersten Moment hatte Roscoe sie für ein Tier gehalten, doch der Gang war halbwegs aufrecht gewesen. Ein Mensch. Aber krumm und irgendwie missgestaltet. Nicht einmal über Rasse oder Geschlecht hätte er eine Aussage machen können. Es war wie ein Schemen gewesen oder ein Geist. Das war keine Wache, sondern jemand, der das Lager ebenfalls beobachtete. Roscoe wartete, ob die Gestalt noch einmal auftauchte, doch nichts geschah. Hatte sie ihn bemerkt?
Hinter ihm knirschten einige Steine. Er ließ das Gewehr los und wälzte sich mit der Hand an seinem Revolver herum. Es war nur Lincoln. Geduckt lief er zu Roscoe und ließ sich schwer atmend neben ihn fallen. „Wir haben Besuch.“
Roscoe packte sein Gewehr mit der einen Hand und zog den Revolver mit der anderen. So rannte er zurück zum Lager, dicht gefolgt von Lincoln.
„Jemand von Lupo?“, rief Roscoe über seine Schulter nach hinten.
„Eher nicht“, antwortete Lincoln. Bevor er noch darüber nachdenken konnte, sah er bereits die Kutsche. Black stand mit zwei Männern davor. Einer von ihnen in einem lächerlichen Aufzug mit Melone. Der andere kam ihm sogar sehr bekannt vor. Roscoe sah zu den Indianern, die hinter der Kutsche hervorkamen. Zwei andere erhoben sich auf dem Dach der Kutsche und spannten ihre Bögen.
„Du machst jetzt besser keine falsche Bewegung“, sagte Mason.