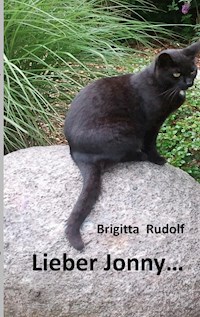Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vierzig Tiergeschichten von Haus- Wildtieren und Exoten.
Der Erlös des Buches soll für den Tierschutz verwendet werden.
Das E-Book Augen zu und durch... wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Tiere, Katzen, Hunde, Wildtiere, Tierschutz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Arik
Gina und Hansi
Willy Waschbär
Regine - Rettung in letzter Minute
Lea´s Großfamilie
Seehundmädchen Swantje
J.J., der spanische Herzensdieb
Das Waisenkind
Felipe
Lea
Kismet und Mirabell
Maisie
Rosi, das Glücksschwein
Die Hasenfamilie
Theossaja
Ein Eichkater hat´s nicht leicht
Ein Esel auf Sizilien
Auf den Spuren der Haselmäuse
Die dicke Bertha
Lupus
Die schöne Helena
Cathy
Der kleine Vampir
Bello
Luna und ihre Freunde
Der Schloss-Fuchs von Bellevue
Krümel, die Ratte
Elsa, die Schönheitskönigin
Ilja Igel
Ein tierischer Künstler
Uhus
Hetta und Kilian
Babou und seine Frauen
Mila und Sternschnuppe
Otto
Aufregung im Forsthaus
Nicky und Möppel
Chico´s Apell
Tegtmeier
Ernie und Bert
Gedanken einer Katzengöttin
Arik
Lange Zeit gab es in Deutschland gar keine Wölfe mehr, weil die Menschen meine Artgenossen komplett ausgerottet hatten, aber nun kehren wir langsam zurück. Zwar gibt es in freier Wildbahn noch nicht allzu viele Wölfe, aber dort wo wir jetzt ideale Bedingungen vorfinden, siedeln wir uns an. Darüber sind allerdings nicht alle Leute glücklich – leider! Das alte Märchen vom bösen Wolf spukt immer noch in den Köpfen vieler herum. Dabei sind nicht wir es, die, wie manche Menschen, aus reiner Mordlust oder Habgier töten, wir tun es nur aus Hunger. Trotzdem fordern viele Landwirte lautstark, dass Wölfe zum Abschuss frei gegeben werden, wenn sie eines ihrer Nutztiere gerissen haben. Aber Hunger tut weh, und wir sind ja überwiegend Fleischfresser, das ist nun mal von der Natur so vorgesehen. Um die Menschen machen wir am liebsten ohnehin einen großen Bogen, weil wir genau wissen, dass es besser für sie und auch für uns ist.
Natürlich sind Wölfe keine Schoßtiere, auch wir nicht, obwohl mein Rudel und ich nicht in freier Wildbahn leben, sondern in einem Tierpark. Zum Glück ist unser Revier recht groß, trotzdem wünsche ich mir manchmal, ich könnte die Zäune überwinden und versuchen ob ich auch in Freiheit überleben könnte. Natürlich werden wir hier gut versorgt, erhalten regelmäßig unser Futter, und wenn sich ein Tier verletzt hat, dann bekommt es auch Hilfe durch die Menschen, die hier arbeiten. Wir müssen nicht ums Überleben kämpfen, so wie unsere Brüder und Schwestern draußen. Das hat durchaus Vorteile, außerdem bin ich hier geboren und kenne dieses andere Leben nur aus Erzählungen, aber es muss wundervoll sein, ungebunden herum streifen zu können wohin man will.
Es kommen täglich viele Besucher, die mehr über uns, und auch das Leben der anderen Tiere hier, wissen möchten. Sogar, wenn wir gefüttert werden, wollen sie zuschauen. Wie gut, dass wir die Möglichkeit haben, uns ins Innere des Reviers zurückzuziehen, wenn wir unsere Ruhe haben möchten, denn manchmal ist mir der ganze Rummel einfach zu viel! Und natürlich ist es den Besuchern streng verboten über den Zaun zu klettern, und in unser Gehege einzudringen. Aber so ein Halbstarker hat es vor einiger Zeit trotzdem gewagt. Ich weiß nicht ob das Absicht oder ein Unfall war. Vielleicht sogar eine Mutprobe? Jedenfalls waren wir beide erschrocken, als wir uns ganz plötzlich gegenüberstanden. Menschen sind uns ja nicht fremd, aber außer dem Tierarzt und unseren Pflegern hatte es bis dahin noch niemand gewagt in unser Revier einzudringen. Als ich den schmächtigen jungen Mann sah, bin ich vorsichtshalber erst mal stehen geblieben und habe ganz ruhig abgewartet, was er tun würde. Er blieb ebenfalls stehen und sagte lange Zeit kein Wort, sondern schaute mich nur mit großen Augen an. Dann begann er mit mir zu sprechen. Natürlich habe ich nicht verstanden, was er mir sagen wollte, aber seine leise, einschmeichelnde Stimme gefiel mir. Ich wollte ihm deutlich machen, dass er von mir nichts zu befürchten hatte, deshalb habe ich mich behutsam auf den Boden gelegt. Daraufhin ist er ganz langsam Schritt für Schritt zurückgegangen. Ich glaube, meine Gegenwart hat ihn doch ein bisschen eingeschüchtert. In freier Wildbahn sind Wölfe sehr scheu, und wenn sie Menschen wittern, dann ziehen sie sich meistens von allein zurück, weil sie Angst vor ihnen haben. Zu viele von ihnen sind schon abgeschossen worden, denn unter Artenschutz stehen wir erst seit einigen Jahrzehnten. Diese unerwartete Begegnung mit einem fremden Menschen fand ich sehr aufregend. Ob er wohl irgendwem davon berichtet hat? Kurz darauf war er wieder da. Er stand auf der Holzbrücke, die sich über einen Teil unseres Geheges zieht, und schaute lange zu mir hinüber. Weil am Zaun von allen Wölfen Bilder hängen, kannte er den Namen, den die Tierpfleger mir seinerzeit gegeben haben.
„Arik“, rief er. Ich glaube, er hat sich richtig gefreut, als ich daraufhin zu ihm hochgeschaut habe. Seitdem kommt er häufiger und besucht uns. Ich wünsche mir sehr, dass die Menschen lernen auch mit den wild lebenden Wölfen klar zu kommen. Vielleicht können wir Wölfe und die Menschen eines Tages sogar noch Freunde werden...
Gina und Hansi
Gina, das bin ich, und mein bester Freund, das ist der Hansi. Nein, Hansi ist doch kein Kater, er ist ein Wellensittich. Ja, ich weiß, diese Freundschaft finden alle ungewöhnlich, aber uns beiden gefällt es eben so! Als ich damals zu Martha gekommen bin, da war der Hansi schon da. Er durfte überall in der großen Wohnung frei fliegen und hingehen wo er wollte, so wie ich auch. Angst vor mir hatte er von Anfang an keine, obwohl ich doch viel größer war als er, aber das hat ihn nie gestört. Mutiger kleiner Kerl! Das hat mir ganz schön imponiert, als ich zu den beiden gekommen bin. Ich war ja noch ein kleines Katzenkind, und so sind wir beide sozusagen zusammenaufgewachsen, der Hansi und ich. Bis Martha dann krank wurde, hatten wir eine schöne Zeit, wir drei. Aber eines Tages war sie einfach nicht mehr da. Stattdessen ist ihr Enkel gekommen, um die Wohnung aufzulösen. Alles hat er rausgeholt und mitgenommen.
Aber dann wusste er wohl nicht was er mit uns machen sollte, und da hat er mich einfach gepackt und aus dem Fenster in den Garten geworfen. Stellt Euch das nur vor, so ein gemeiner Kerl! Dabei habe ich mir das Pfötchen gebrochen, und einige innere Verletzungen hatte ich auch, das haben sie später im Tierheim gesagt. Dorthin hat uns Marthas Nachbarin nämlich gebracht, den Hansi und mich. Zum Glück hatte sie gesehen was mir passiert ist, und deshalb hat sie auch sofort eingegriffen. Im Tierheim haben sie mich erst mal untersucht und dann auch gleich operiert. Das war doof, weil ich danach ziemlich lange eine Halskrause tragen musste. Mit dem Ding konnte ich mich nicht mal putzen – wo ich doch sonst so sauber bin! Aber ganz schlimm war es, als die Wunden zuheilten und anfingen zu jucken. War richtig eklig, half aber nix, da musste ich durch. In der Zeit konnte Hansi nicht bei mir sein, die anderen Katzen hätten ihn ganz bestimmt nicht in Ruhe gelassen. Oh, wie ich ihn vermisst habe! Und ich weiß, er mich auch.
Zum Glück hat es nicht lange gedauert, bis meine Katzenmama gekommen ist, um mich zu sich nach Hause mitzunehmen. „Dann müssen Sie den Hansi aber auch gleich mit adoptieren. Allein gibt es die Gina nicht – das geht gar nicht!“, hat die Bille ganz energisch gesagt. Mann, war ich froh, dass meine liebe Katzenmama uns beide mitgenommen hat! Der Hansi auch! Endlich waren wir beide dann wieder zusammen.
Hansi fliegt hier auch gern durch die Wohnung, und wenn er davon genug hat, kommt er zu mir. Dann setzt er sich auf meinen Kopf und pickt ganz vorsichtig. So zeigt er mir, dass er mich ganz doll liebhat! Dafür lasse ich ihn ab und zu mal mein Futter probieren. Die Körnchen kommen aus einem Spender und fallen von allein nach, wenn ich einige gefressen habe. Die sind zu groß und hart für Hansi, aber, wenn ich Nassfutter kriege, das darf er kosten. Seine eigenen Körnchen schmecken ihm aber noch am allerbesten, denke ich. Wenn ich trinken will, dann springe ich einfach ins Waschbecken. Da kann ich inzwischen sogar den Wasserhahn mit der Pfote allein aufmachen. Wenn das Wasser dann läuft, kann ich trinken und Hansi darin baden. Aber meistens achtet unsere Mama doch darauf, dass das Wasser rechtzeitig wieder abgestellt wird, bevor der Spülstein überläuft. Ist schon mal passiert und Hansi konnte auf dem Fußboden in einer großen Pfütze baden. Ich fand das lustig und der Hansi auch, aber unsere Mama weniger. Zumachen kann ich den Wasserhahn nämlich nicht allein, aber vielleicht lerne ich das ja auch noch, wer weiß.
Jetzt haben wir wieder ein schönes Leben, der Hansi und ich. Wir wünschen uns nur, dass wir noch ganz lange hier zusammenbleiben können – bei unserer Hanna!
Willy Waschbär
Waschbären kommen ursprünglich aus Nordamerika, aber inzwischen haben wir auch andere Kontinente für uns entdeckt und als Lebensraum erobert. Mir gefällt es jedenfalls in meiner Schrebergartensiedlung absolut bestens. Nachdem meine Geschwister und ich von unserer Mutter entwöhnt wurden, mussten wir uns schließlich ein eigenes Revier suchen. Eine Weile habe ich im Wald gelebt und in einer Baumhöhle geschlafen. Das war bevor ich bei meinen Streifzügen die Holzhütte entdeckt habe, in deren Nähe ich mich jetzt häuslich niedergelassen habe. Sie steht in einem Garten und dort gibt es einen großen Komposthaufen. Da habe ich leckere Sachen zum Fressen gefunden. Wir Waschbären sind ja nicht wählerisch, und das von den Menschen weggeworfene Zeugs hat mir noch prima geschmeckt. Als ich satt war, bin ich zurück in den Wald gelaufen und habe es mir wieder in meiner alten Baumhöhle gemütlich gemacht. Zufrieden habe ich den nächsten Tag erst mal verschlafen. Als es dann zu dämmern anfing, meldete sich allerdings mein Magen zurück, und ich bin wieder auf die Suche nach etwas Fressbarem gegangen. Auf dem Kompost war noch nichts Neues gelandet, aber in einem der anderen Gärten bin ich fündig geworden. Da stand eine Mülltonne, die war umgekippt, und ich habe sie erst mal gründlich durchwühlt. Unfassbar, was die Leute so alles fortwerfen! Und deshalb bin ich am nächsten Tag gleich wieder dorthin gegangen, anstatt im Wald auf Nahrungssuche zu gehen. Es kam mir allerdings komisch vor, dass diese Holzhäuser offenbar alle unbewohnt waren. Ein paar Tage ging das gut, aber dann tauchten Menschen auf. Eine Frau hat mich sogar gesehen und nach ihrem Mann gerufen, da bin ich schnell weggerannt und habe mich erst mal versteckt bis die Luft rein war, und ich abhauen konnte.
„Haben wir hier Waschbären?“, fragte sie ganz erstaunt.
„Glaub´ ich nicht!“, rief eine Stimme zurück.
„Aber den helldunkel gestreiften Schwanz von dem Tier, den habe ich doch ganz genau gesehen“, meinte sie.
Stimmt, das hatte sie ganz richtig erkannt. Waschbären haben einen überwiegend grauen Pelz, eine schwarz gefärbte Gesichtsmaske, die weiß abgerundet ist, und die Ränder unserer Ohren sind ebenfalls weiß, so wie unsere Schnurrhaare. Aber unser absolut markantestes Merkmal ist und bleibt nun mal der Schwanz. Viele Menschen finden uns possierlich, andere nicht – leider, wie ich feststellen musste. Denn als ich mich zwei Tage später wieder her getraut habe, da hat ihr Mann mich ebenfalls gesehen und verjagt. Schade, es war so bequem ihre Reste zu fressen. Aber natürlich habe ich nicht aufgegeben und bin wiedergekommen. Dieses Mal war ich allerdings vorsichtiger und habe mich ganz langsam und vorsichtig näher herangepirscht. Außerdem habe ich auch vorsorglich hier und dort schon mal meine Duftmarke hinterlassen, falls hier noch andere Waschbären auftauchen sollten. Nach und nach habe ich alle Schrebergärten genauer unter die Lupe genommen. Danach wusste ich schnell wo das meiste zu holen ist. Außerdem habe ich bemerkt, dass ich ohne Probleme sogar in einer der Lauben schlafen kann, wenn ich Lust habe. Das Dach ist nämlich an einer Stelle undicht. Nachdem ich das Loch entdeckt hatte, habe ich mir dort ebenfalls einen neuen Schlafplatz eingerichtet. Anfangs kamen die Menschen immer nur für ein paar Tage hierher, dann war alles wieder ruhig. Je wärmer es wurde, desto häufiger blieben die Leute aber länger. Da musste ich manchmal schwer aufpassen, um nicht beim Fressen gestört zu werden. Ich glaube, es hatte sich inzwischen schon herumgesprochen, dass ich mich hier eingenistet habe, denn meine Spuren kann ich beim besten Willen nicht ganz verwischen. Ich habe auch gemerkt, dass einige Leute mir sogar extra Futter bereitgestellt haben, während andere mich verjagten, sobald sie mich sahen. Es gibt eben nicht nur Tierfreunde in meiner Siedlung. Aber das kratzt mich nicht, ich fühle mich hier jedenfalls sehr wohl, und deshalb bleibe ich auf jeden Fall!
Regine – Rettung in letzter Minute
An diesem kalten, sonnigen Dezembernachmittag gehe ich, wie beinahe jeden Tag, über den Hügelweg des Dorfes Rehmerloh. Wie so oft in den letzten zwei Jahren begleiten mich dabei meine beste Menschenfreundin Amelie und ihre Mutter Nicole. Alles hier ist mir vertraut, aber ich weiß, dass mein Leben sich bald erneut ändern wird.
Aber im Gegensatz zur Vergangenheit habe ich jetzt keine Angst mehr davor. Ich bin sogar voller Zuversicht und freudig erregt, wenn ich daran denke, dass neue Abenteuer auf mich warten. Es hat lange gedauert, aber ich weiß inzwischen, dass ich meinen Menschen voll und ganz vertrauen kann. Die wollen nur das Beste für mich, ganz bestimmt!
Ach ja, ich muss mich ja noch offiziell vorstellen: Ich heiße Regine und bin ein Welsh-Pony. An die ersten Jahre meines Lebens kann ich mich gar nicht mehr erinnern, darüber hat sich komplett der Nebel des Vergessens gelegt. Woran ich mich aber noch gut erinnere, das ist der Tag, an dem mein damaliger Besitzer sich von mir verabschieden musste. Das war ein freundlicher, älterer Herr, der sich bis dahin wirklich nach bestem Wissen und Gewissen um mich gekümmert hat. Er hat dafür gesorgt, dass ich immer genug Heu und andere Nahrung zur Verfügung hatte. Jeden Tag kam er auf seinem alten Fahrrad angeradelt, um nach mir zu sehen. Das war nicht leicht für ihn, denn es waren mehrere Kilometer, die er zu bewältigen hatte. An dem Tag stand ich ganz allein auf meiner Wiese, als er zum letzten Mal kam. Als er zu reden begann, spürte ich sofort, dass etwas Ungutes in der Luft lag. Dann sagte er mit leiser, trauriger Stimme: „Regine, es tut mir so leid, aber wir müssen uns trennen. Ich schaffe die Radtouren einfach nicht mehr. Ich werde wohl sogar demnächst eine Betreuerin bekommen, die meine Angelegenheiten regelt. Bitte sei mir nicht böse, aber ich kann mich einfach nicht mehr um Dich kümmern.“
Nachdem er gegangen war, fühlte ich mich völlig benommen und hilflos. Die Gedanken rasten nur so in meinem Kopf. Seitdem mein Gefährte vor einigen Jahren gestorben war, dachte ich die Einsamkeit wäre das Schlimmste was mir passieren konnte, aber weit gefehlt. Was würde nun mit mir geschehen? Würde man mich vergessen und verhungern lassen oder, beim Pferdegott nein, womöglich sogar töten?
Tagelang tat sich gar nichts, und zu meinem Glück lief an der Wiese ein Bach entlang, sodass ich meinen Durst stillen konnte und etwas Heu gab es auch noch. Außerdem fand sich auf der Wiese auch hier und dort noch etwas Gras. Ein Nachbar, der es gut mit mir meinte, warf mir täglich zusätzlich ein paar frische Scheiben Toastbrot auf die Wiese. Natürlich habe ich auch die verschlungen, obwohl sowas nicht die richtige Nahrung für ein Pferd ist. Eines Tages, mein Freund war gerade wieder da, um mir Brot zu bringen, hielt ein fremdes, schon recht altes Auto auf der anderen Straßenseite. Eine kleine, rothaarige Frau stieg aus und kam zu uns herüber. Sie funkelte meinen Wohltäter zornig an und sagte barsch zu ihm: „Was fällt Ihnen denn ein, das Pferd mit so einem ungesunden Dreckzeug zu füttern?“
Natürlich war der „Toastbrotmann“, so nannte ich ihn in Gedanken, erst mal beleidigt. Schließlich hatte er es nur gut gemeint, und dafür kassierte er nun Schelte. Er murmelte etwas Unverständliches und trollte sich. Die resolute Dame war allerdings noch nicht mit ihm fertig, denn sie rief laut hinter ihm her: „Oh Herr, lass Hirn regnen!“
Die wusste genau was sie wollte, und ich war mit ihr allein. Vor lauter Aufregung bekam ich Herzrasen und hatte nur den Wunsch, dass diese Frau endlich verschwinden sollte. Aber das Gegenteil geschah, sie wandte ihre Aufmerksamkeit nun wieder ganz mir zu. Seltsamerweise sprach sie mit mir ganz anders. Ihre Stimme bekam einen weichen und liebevollen Klang, als sie sagte: „Na, Reginchen, wie kommen wir beide denn nun zueinander?“
Träum weiter, dachte ich und wandte mich ab. Daraufhin ließ sie mich scheinbar erst mal in Ruhe. Aber sie marschierte über die Wiese und schaute sich die Gegebenheiten genau an. Wo eine Ein- und Ausfahrt war und dergleichen mehr, das schien sie sehr zu interessieren, wie ich verwundert feststellte. Warum bloß? Als sie sich zum Gehen wandte, rief sie mir noch freundlich zu: „Tschüss Reginchen“, und fuhr davon.
Erleichtert dachte ich, na das ist ja noch mal gutgegangen!
Am nächsten Tag rückte sie erneut an, allerdings in Begleitung eines großen Mannes, den sie Tom nannte. Dieser Tom entpuppte sich schnell als eine freundliche Witzfigur. Er hielt mich offenbar für etwas einfältig, denn zu meiner Überraschung holte er einen hölzernen Klappstuhl aus dem Auto und setzte sich mitten auf die Wiese. Aus seiner Jacke zog er eine Tageszeitung und versuchte darunter ein Halfter und einen Führstrick zu verbergen. Um mich anzulocken, hielt er mit einer Hand eine Möhre in die Luft, während er so tat, als würde er in der Zeitung lesen. Aber so leicht bin ich natürlich nicht zu überlisten. Innerlich habe ich mich ausgeschüttet vor Lachen, aber das habe ich mir nicht anmerken lassen. Glaubte dieser Blödel etwa tatsächlich, ich, Regine, würde auf einen so plumpen Trick hereinfallen? Wofür hielt der mich denn? Ich fühlte mich doch fast wie ein Wildpferd. Nee, das konnte er sich abschminken! Ich muss zugeben, er hat lange ausgehalten, und den Stuhl fast platt gesessen. Aber nachdem er einsehen musste, dass er so nicht weiterkam, versuchte er es mit „Action“, indem er Halfter und Führstrick hinter seinem breiten Rücken versteckte und mir die Möhre so nah wie möglich vor die Nüstern hielt. Das war natürlich eine starke Versuchung, und ich dachte, es wäre mal eine nette Abwechslung ihn meinerseits ein wenig zu necken. Daher tat ich ihm scheinbar den Gefallen und tänzelte einige Schritte auf ihn zu, aber gerade als er meinte, er hätte sein Ziel erreicht, wieherte ich kurz und galoppierte wieder davon. So viel Spaß hatte ich wirklich lange nicht gehabt. Nachdem wir das einige Male durchexerziert hatten, versuchte er sogar hinter mir her zu laufen und mich zu fangen. Das war natürlich völlig aussichtslos, ich bin doch viel schneller. Eigentlich schade, dass niemand das gefilmt hat. Mit solchen Sachen kann man doch im Internet eine Menge Geld machen, jedenfalls, wenn viele Leute zuschauen. Zum Schluss war der arme Tom aber entnervt, durchgeschwitzt und sowohl körperlich wie seelisch am Ende seiner Kräfte, und keuchend teilte er der Rothaarigen mit: „Geht nicht!“
Mehr brachte er nicht raus, weil er kaum mehr atmen konnte.
Woraufhin die Rothaarige entgegnete: „Schade, aber es war einen Versuch wert. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit, denn die Betreuerin des alten Herrn hat entschieden, dass Regine die Weide noch in dieser Woche verlassen muss. Es ist definitiv kein Geld mehr da für ihre Versorgung. Entweder übernehmen wir vom Tierschutz die Verantwortung für sie oder...“, den Rest ließ sie offen.
Dann verschwanden die beiden wieder und ließen mich ratlos zurück. Das klang nicht gut, gar nicht gut, fand ich und bekam nun doch mächtig Angst. Aber was wenig später mit mir passierte, das erleben sicher nur wenige Pferde. Auf der Zufahrtsstraße tauchte nämlich ein Pferdeanhänger auf und parkte direkt vor meiner Wiese. Meinten diese unterbelichteten Menschen etwa, ich würde schnurstracks da hinein marschieren und mich ihnen ausliefern? Da hatten sie sich aber geschnitten. Noch war ich frei und wollte es auch bleiben! Jetzt muss ich höllisch aufpassen, dachte ich, denn nach und nach tauchten noch drei weitere Fahrzeuge auf. Auch die Rothaarige war wieder dabei. Und, ich mochte es kaum glauben, auch Leute von der Feuerwehr. Wollten die mich etwa mit Hilfe von kaltem Wasser auf den Hänger bringen? So viele Gedanken schossen mir gleichzeitig durch den Kopf. Die Menschen schienen freundlich und sanft zu sein, aber trotzdem war ich in höchster Alarmbereitschaft. Ich fühlte, da wurde irgendetwas vorbereitet, und ich spürte auch, dass ich damit ganz und gar nicht einverstanden sein würde. So raste ich in Panik über die Wiese, aber als ich einen kleinen Moment stehen blieb, fühlte ich einen kurzen, stechenden Schmerz in meiner Brust. Dort steckte doch wahrhaftig ein kleiner Pfeil. Meine schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten, aber so einfach würde ich es ihnen bestimmt nicht machen, nahm ich mir vor, mobilisierte nun meine allerletzten Kraftreserven und raste erneut los. Aber wohin sollte ich fliehen? Durch den Weidezaun war so schnell kein Entkommen möglich, ich musste mir schnellstens etwas anderes einfallen lassen – aber was? Noch während ich fieberhaft überlegte, traf mich der zweite Pfeil. Das war´s – ich würde sterben, fürchtete ich. Kurz bevor ich das Bewusstsein verlor, hörte ich noch eine männliche Stimme, die klang wie aus weiter Ferne: „So, das müsste reichen!“
Und dann wurde es endgültig dunkel um mich.
Zum Glück stellte sich wenig später heraus, dass ein speziell für solche Fälle ausgebildeter Feuerwehrmann mich betäubt hatte, damit sie mich abtransportieren und fortbringen konnten. Die Betäubungsdosis war wirklich gut berechnet, denn während der Fahrt habe ich tief und ganz fest geschlafen und gar nicht mitbekommen, wie sie mich in den Hänger gehievt haben. Nachdem die Betäubung nachließ, wachte ich in meinem neuen Zuhause in Rehmerloh auf. Meine Erleichterung darüber noch am Leben zu sein war grenzenlos. Die Rothaarige, wie ich inzwischen weiß, engagiert sich beim Tierschutz. Sie hat dafür gesorgt, dass diese Leute mich in ihre Obhut nehmen konnten. Das war mein Glück. Ich gebe es ungern zu, aber ich glaube, sie und die Leute auf dem Hof haben mich von Anfang an sehr geliebt und wollten nur das Beste für mich. Aber mein Stolz ließ es nicht zu, dass ich das gleich eingesehen habe. Im Gegenteil, zunächst habe ich mich recht unversöhnlich gezeigt. Ich konnte einfach nicht anders, denn schließlich hatten sie mich ja gegen meinen Willen verschleppt.