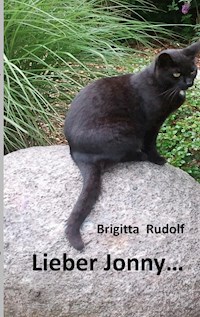Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
57 Geschichten, teils wahre Geschichten aus dem Leben.
Das E-Book Aus der Feder geflossen wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Geschichten aus dem Leben, Familienfreundlich, lesefreundliche Schrift, kurzweilig, Kurzgeschichten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Sinn des Lebens
Die Klinik unter Palmen
Der Anruf
Eine gute Idee
Die Rettung
Die Wittekindsquelle
Meine Brieffreundin
Lina
Halloween
Ludwig unter den Wölfinnen
Eine neue Chance
Künstliche Intelligenz
Familienbande
Muttertag
Sascha`s Traum
Tchipsy
Die Gnadenfrist
Nadeshda bedeutet Hoffnung
Der große Saugini und seine Madame Wischmopp
Kleine Gesten – große Wirkung
Die Puddingparty
Mein roter Fiat
One Night Stand
Schmuddeltage
Zeitenwende
Nächtliche Ruhestörung
Kleidergrößen können tückisch sein
Kindermund
Hundealarm
Wer steckt hinter der Maske?
Der alte Teddy
Begegnungen der besonderen Art
Das Geheimnis
Manfred auf Abwegen
Grüße aus dem Jenseits
Erinnerungen an Moskau
Mein Spiegelbild
Die Schatztruhe
Die wunderbare Welt der Bücher
Geocaching
Anglerlatein
Das Bild
Der Casanova
Deutsche Nationalbibliothek
Die große Ampelverschwörung
Wahre Freundschaft
Unendliche Liebe
Am Tag als der Regen kam
Geputzte Fenster
Wenn einer eine Reise tut
Der entlaufene Ehemann
Die Zwangspause
Augen auf bei der Berufswahl
Das lukullische Debakel
Am Scheideweg
Das Ich-Bewusstsein altert nicht
Vom Olymp auf die Erde
Der Sinn des Lebens
Warum sind wir geboren worden, und haben wir alle hier auf Erden eine ganz bestimmte Aufgabe? Gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod für uns? Das sind alles Fragen, die wohl jeden von uns, irgendwann in Laufe seines Lebens, bewegen. Niemand kennt die Antwort. Wir alle möchten doch Spuren hinterlassen – auf unsere ganz und gar persönliche und sehr unterschiedliche Art und Weise.
Von Anfang an sind unsere Chancen ungleich verteilt. Die einen werden schon mit dem sprichwörtlichen „goldenen Löffel im Mund“ geboren, die anderen in bitterer Armut. Wo sind da die gleichen Startbedingungen für ein erfülltes Leben? Es ist ein großer Unterschied, ob man in Europa zur Welt kommt oder in einem Entwicklungsland. Herrscht Friede oder Krieg, in dem jeder in erster Linie um sein Überleben kämpfen muss; was bedeutet da die Zukunft, wenn man denn überhaupt eine zu erwarten hat?
Ganz anders geht es den Kindern, deren Eltern Geld genug haben, ihre Sprösslinge auf Eliteschulen und die besten Universitäten zu schicken, und die noch dazu überall die besten Beziehungen haben – da sollte eigentlich nicht viel schiefgehen. Aber auch das ist keine Garantie für ein glückliches, erfülltes Leben. Das bedeutet für jeden Einzelnen ohnehin etwas anderes.
Für mich bedeutet es, eine glückliche Familie, sowie gesundheitlich und finanziell keine großen Sorgen zu haben und vor allem, etwas tun zu können, was mir Freude bereitet, die ich auch mit anderen teilen kann. Und so hoffe ich, dass Ihnen, liebe Leserinnen und Leser meine Geschichten viel Freude bereiten werden!
In dem Fall meine herzliche Bitte an Sie: Sagen Sie es weiter, posten Sie es auf Ihrer Facebook-Seite oder twittern Sie. Ich würde mit meinen Geschichten gern viele Menschen erreichen, und wenn möglich auch auf meine Weise diese Welt ein kleines bisschen fröhlicher machen! Deshalb sind alle meine Bücher geschrieben worden, und ich hoffe, es werden noch viele weitere folgen!
Herzlichst
Ihre Brigitta Rudolf
Die Klinik unter Palmen…
Wenn Einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen!
Sicher kennen Sie alle diesen Ausspruch. Zu der Zeit, als ich noch bei einer größeren Firma im Außendienst beschäftigt war, hätte ich dazu vieles berichten können. Wir waren damals nicht nur in ganz Deutschland unterwegs, sondern auch in Frankreich, Italien und sogar im fernen Osten im Einsatz. Eine Begebenheit jedoch wird mir ganz sicher unvergesslich bleiben.
Unser Chef hatte einen Teil der Fabrikation auf die Philippinen verlegt und damit etlichen Philippinos Arbeit und Brot gegeben. Auf dieses Projekt war er sehr stolz, und bot seinen Angestellten die Möglichkeit mit ihm dorthin zu fliegen, um die nagelneue Fabrik zu besichtigen. Danach sollten dort noch einige Urlaubstage angehängt werden, damit sich die weite Reise lohnte. Die Insel Boracay hatte ihm sehr gefallen, also wurde beschlossen, die freien Tage dort zu verbringen.
Unser Kollege Berthold, ein rotblonder Typ mit heller Haut, hatte vorsichtshalber kurz vorher einige Male die Sonnenbank besucht, um sich auf die zu erwartende Gluthitze dort vorzubereiten. Warum auch immer war ihm das letzte Mal, unmittelbar vor unserem Abflug, offenbar nicht so gut bekommen, denn seither klagte er über ein gewisses Jucken und Brennen an seiner Hinterfront. Schon im Flieger nach Manila rutschte er deshalb ständig unruhig auf seinem Sitz hin und her, bis ihm unsere mitleidige Stewardess endlich ein zusätzliches, dickes Kissen gab, welches ihm den langen Flug etwas erträglicher machte. Zu unserer Schande muss ich gestehen, dass wir Kollegen es uns nicht verkneifen konnten, ihn wegen seines Missgeschicks ein wenig zu hänseln. So fiel unter anderem die Bemerkung: „Unser Berthold ist wie eine Prinzessin auf der Erbse:“ Gutmütig und scheinbar gelassen nahm Berthold diesen Spott hin. Was blieb ihm auch anderes übrig? Außerdem war es gewiss nicht böse gemeint, das wussten wir ja alle. Als wir von Manila aus dann auch noch einmal in eine wesentlich kleinere Propellermaschine umsteigen mussten, um unser endgültiges Ziel zu erreichen, wurde die Tour für den armen Berthold keineswegs leichter. Die Sitze in dem Flugzeug waren aus hartem Plastik und daher noch erheblich unangenehmer als in der großen Linienmaschine. Wieder erbarmte sich eine freundliche Stewardess und holte ihm einige Kissen für sein schon arg strapaziertes, sensibles Hinterteil. Nach etwa einer Stunde Flugzeit kamen wir endlich auf unserer Trauminsel an. Um es vorweg zu nehmen – die Insel ist wirklich wunderschön. Allein die Vegetation dort ist unglaublich üppig. Überall stehen imposante, hohe Kokospalmen, blühen wunderschöne, großblütige Orchideen und noch viele andere traumhafte, uns absolut unbekannte Pflanzen. Allerdings ist dieses exotische Inselparadies, für uns an einen gewissen Luxus gewöhnte Mitteleuropäer, in vielerlei Hinsicht trotzdem durchaus recht anpassungsbedürftig. Allein den heimischen Flughafen fanden wir regelrecht abenteuerlich. Dort landen allerdings nur wenige kleine Maschinen, genauso wie die, mit der wir hierhergekommen waren. Deshalb gibt es dort nur einen winzigen, aus Holz errichteten mit einem Wellblechdach ausgestatteten Kiosk, der für die Fluggäste aus aller Welt sowohl als Restaurant, Abfertigungshalle und auch als Gepäckaufbewahrungsort genutzt wird. Eine weitere Hütte steht ein wenig abseits, dort ist die Feuerwehr untergebracht. Die rückt pflichtgemäß bei jedem An- und Abflug mit einem Rettungsfahrzeug aus, sobald die freilaufenden Hühner und Ziegen von der kleinen Start- beziehungsweise Landebahn verscheucht worden sind. Das stört dort niemanden! Überhaupt sind die Philippinos überwiegend sehr unkomplizierte, freundliche, geduldige und immer fröhliche Menschen.
Als wir in unserer Hotelanlage ankamen, waren wir begeistert von der ruhigen Lage direkt am Meer. Ebenso von der Blütenpracht, die uns auch dort erwartete. Für jeden von uns gab es einen eigenen Bungalow, der aus Bambusgeflecht errichtet und dessen Dach mit Palmenblättern gedeckt worden war. Diese Behausung war zwar nicht sehr groß, aber sauber und zweckmäßig eingerichtet, sodass man sich darin durchaus wohlfühlen konnte. Da es auf Boracay am Abend recht früh dunkel wird, ließen wir uns zum Abschluss dieses Tages an der Hotelbar einige leckere, bunte Drinks servieren, bevor wir uns schlafen legten. Am nächsten Morgen, als Berthold zum Frühstück erschien, waren seine Beschwerden keinesfalls abgeklungen, im Gegenteil! Er klagte darüber, dass er die ganze Nacht auf dem Bauch liegend verbracht hatte, weil alles andere zu schmerzhaft gewesen war. Die einhellige Meinung im Kollegenkreis war die, dass es das einzig Sinnvolle für ihn sei, einen Arzt aufzusuchen, der ihn von seinen Nöten befreien konnte. Von dieser Idee war Berthold zwar wenig angetan, aber schließlich sah er ein, dass es dazu keine Alternative gab, wenn er die Urlaubstage mit uns genießen wollte. Also fragten wir eine Hotelangestellte nach einem Taxi. Sie versprach, sich sofort darum zu kümmern, und nur wenig später hielt ein seltsames Gefährt vor dem Restaurant. Wie soll ich das nur beschreiben?
Es war eine Art Moped mit Seitenwagen und einer Sitzgelegenheit direkt hinter dem Fahrer. Etwas primitiv, aber ungefährlich, wie man uns glaubhaft versicherte. Diese eigenartigen Taxis fuhren überall auf der Insel umher. Berthold beäugte dieses ungewöhnliche Fahrzeug eher argwöhnisch, ließ sich aber dennoch überreden einzusteigen, um damit in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Da man auf der Insel natürlich kein Deutsch spricht, hatten wir dem Fahrer auf Englisch klar zu machen versucht, dass unser Freund einen Arzt brauchte oder in ein Krankenhaus gebracht werden sollte.
„Yes, yes, hospital“, nickte der Fahrer und brauste los.
Nach einer knappen Stunde war Berthold zurück und berichtet uns, was er erlebt hatte. Der Taxifahrer hatte ihn zwar zu dem Gebäude gebracht, auf dessen Dach ein riesiges, rotes Kreuz prangte, das wir schon beim Landeanflug auf die Insel gesehen und deshalb fälschlicherweise deshalb für ein Krankenhaus gehalten hatten. Leider erwies sich das vermeintliche „hospital“ als eine reine Filmkulisse für eine Fernsehserie, mit dem Titel „Klinik unter Palmen“, die derzeit dort gedreht wurde. Möglicherweise hätte man unserem Berthold dort, in ein Bett gesteckt, als Komparsen gebrauchen können, aber diese Möglichkeit verbot sich natürlich von selbst. Jedenfalls war er leicht angesäuert, weil wir ihn dorthin geschickt hatten, denn allein die Fahrt, auf den holprigen Sandwegen der Insel, war alles andere als angenehm für ihn gewesen.
Schließlich hatte unser Kollege Wolfram eine Idee.
„Meine Frau hat mir eine kleine Reiseapotheke mitgegeben. Da schaue ich mal nach, ob ich eventuell eine Salbe oder etwas anderes für Dich finde, was Du ausprobieren kannst“, schlug er vor.
Ergeben nickte Berthold und meinte nur ironisch: „Solange hier nicht noch Hans-Jürgen Wussow von der Schwarzwaldklinik auftaucht, um mich zu behandeln, ist mir inzwischen alles egal.“
Kurz darauf kam Wolfram mit einer kleinen Tube zurück.
„Die hilft angeblich gegen Sonnenallergie und Insektenstiche, das steht jedenfalls auf dem Beipackzettel“, informierte er Berthold. „Versuch es mal damit!“
Der arme Berthold war wirklich gebeutelt, und langsam verging sogar uns das Lachen. Nun waren wir hier in diesem zauberhaften Inselparadies, hatten uns auf ein paar unbeschwerte, gemeinsame Tage gefreut, und unser Freund Berthold konnte es gar nicht richtig genießen. Zum Glück erwies sich, dank der Umsicht von Wolfram´s Frau, die „Zaubersalbe“ aus seiner Reiseapotheke tatsächlich als hilfreich, denn am nächsten Tag ging es Berthold, zu unser aller Erleichterung, bereits erheblich besser.
Viel zu schnell verging die Zeit, und wir mussten wieder Abschied nehmen - von diesem wunderbaren Ort, mit etlichen, lustigen und schönen Erinnerungen im Reisegepäck.
Der Anruf
„Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Telefonseelsorge, Sie sprechen mit Johanna. Wie kann ich Ihnen helfen?“
Johanna war natürlich nicht ihr richtiger Name, aber im Dienst hatte sie sich, wie alle, ein Pseudonym aussuchen müssen. Warum also nicht Johanna, der Name gefiel ihr einfach.
Am anderen Ende der Leitung blieb es still. Dann sagte eine Stimme leise: „Guten Tag, Johanna.“
„Hallo, Herr? Wie darf ich Sie ansprechen?“
„Karl, ich heiße Karl.“
„Hallo, Karl! Was haben Sie auf dem Herzen?“ Wieder blieb es einen Augenblick still. Dann antwortete Karl: „Es ist die Einsamkeit, verstehen Sie? Ich habe vor Kurzem meine Frau verloren und Kinder hatten wir keine. Sechsundachtzig Jahre bin ich jetzt, meine Elfriede war fünfundachtzig. Dann ist sie gestorben; das war vor sechs Wochen.“
Er verstummte.
„Das tut mir sehr leid, Karl! Haben Sie niemanden, mit dem sie darüber reden können und der sie trösten kann; vielleicht Freunde oder Nachbarn?“
„Unsere Freunde sind fast alle auch schon gegangen oder nicht mehr so mobil wie früher, leider! Nein, in der Nähe habe ich niemanden mit dem ich mich treffen könnte“, brachte Karl stockend hervor.
Johanna schluckte. Solche Gespräche musste sie oft führen, viel zu oft, und obwohl sie es gewohnt und auch dafür ausgebildet war, fiel es ihr immer noch schwer, in solchen Situationen den nötigen Abstand zu wahren. Außerdem hatte sie das vage Gefühl Karl´s Stimme zu kennen. Woher, das wusste sie in dem Moment allerdings leider nicht. Das verunsicherte sie ein wenig. An Karl gewandt sagte sie: „Haben Sie eventuell schon mal daran gedacht, den Pastor ihrer Gemeinde anzusprechen? Es gibt doch sicher auch hier Besuchsdienste für die Gemeindemitglieder.“
„Ja, der Gedanke ist mir gekommen, aber dann bin ich doch davor zurückgeschreckt.“
„Warum denn?“
„Ach wissen Sie, meine Wohnung ist oft nicht mehr so wirklich präsentabel, und wenn ein Fremder die betritt, dann ist mir das eher unangenehm.“
„Ich verstehe“, antwortete Johanna. „Sind Sie denn in der Lage aus dem Haus zu gehen, Karl?“
„Ja natürlich, jedenfalls, wenn es nicht allzu weit ist. Ich gehe gelegentlich zum Bäcker. Da kann man eine Weile sitzen und einen Kaffee trinken.“
„Das ist doch schön. Da können Sie doch auch Leute treffen und mit einigen vielleicht ins Gespräch kommen.“
„Eher nicht, die meisten, die sich dort auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen niederlassen, die sind mindestens zu zweit. Da möchte ich mich dann nicht aufdrängen.“
Seine Stimme, wieso kam ihr dieser leise, etwas heisere Tonfall nur so bekannt vor?
„Es gibt doch auch Seniorentreffs, ich kann Ihnen gern einige Adressen geben“, schlug Johanna vor.
„Ach, ob das etwas für mich ist? Da drehen sich die Gespräche doch in der Hauptsache um Krankheiten. Das kann ich im Augenblick so ganz und gar nicht ertragen“, bekannte Karl.
„Wie wohnen Sie denn, Karl? Ist in ihrer Nachbarschaft eventuell Jemand, dem Sie sich gelegentlich anschließen könnten?“, forschte Johanna weiter.
„Ich wohne in einem großen Mietshaus am Stadtrand mit zwölf Parteien. Ab und zu treffe ich eine junge Frau an der Mülltonne. Mit ihr habe ich schon mal ein paar Worte gewechselt. Sie ist wirklich sehr nett! Wenn ich mit ihr geredet habe, dann ist es ein guter Tag. Sie ist ein rechter Sonnenstrahl, finde ich; immer fröhlich und guter Dinge, aber mehr weiß ich nicht über sie. Nicht einmal ihren Namen kenne ich, noch weiß ich in welchem Stockwerk sie wohnt. Es ist hier alles so anonym. Aber unser Haus mit dem schönen, großen Garten, das konnten wir nicht mehr allein bewältigen, deshalb mussten wir uns davon trennen. Eigentlich wollten Elfriede und ich uns noch einige schöne Reisen gönnen, aber kurz nach dem Umzug ist sie krank geworden.“
Seine Stimme brach ab, und plötzlich durchzuckte Johanna´s Hirn ein Geistesblitz. Sie wusste, mit wem sie sprach. Es war kaum zu glauben, aber Karl war Karl Fink, ihr Nachbar, der im Parterre wohnte. Klar, sie hatten sich schon mal im Hof getroffen und sich gegrüßt oder einige Worte über das Wetter gewechselt – mehr nicht. In dem großen Mietshaus hatte man untereinander nur selten Kontakt, und nach ihrem bisherigen Eindruck war das auch von den meisten Leuten so gewünscht. Wenn Sie ehrlich war, fand sie das selbst auch gut; aber vielleicht sollte man doch einmal ein Nachbarschaftsfest organisieren, das musste ja nicht automatisch heißen, dass man sich ständig traf. Sie nahm sich vor, bei einigen anderen Bewohnern zu klingeln und nachzufragen, was die von dieser Idee hielten. Laut sagte sie: „Karl, woran ist Ihre Frau denn gestorben, darf ich Sie das fragen?“
„Es war der Krebs, wissen Sie, der hat sie aufgefressen, meine Elfriede. Sechsundfünfzig glückliche Jahre hatten wir beide, stellen Sie sich das nur vor! So etwas schaffen die jungen Leute heutzutage überhaupt nicht mehr – und jetzt bin ich allein!“
Wieder verstummte er.
„Es gibt doch Selbsthilfegruppen für verwaiste Angehörige. Wäre das eventuell etwas für Sie?“
„Möglich, ich weiß nicht. Aber Sie haben mir ja auch einige andere Alternativen aufgezeigt. Ich werde mir das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich danke Ihnen, dass sie mir so geduldig zugehört haben, Johanna.“
„Bitte, das habe ich gern getan, außerdem ist das ist mein Job, Karl. Ich wünsche Ihnen alles nur erdenklich Gute. Sie schaffen das schon!“, ermutigte sie ihn noch einmal.
„Danke, dass wünsche ich Ihnen auch, Johanna. Darf ich Sie noch einmal anrufen?“
„Natürlich! Jederzeit gern, Karl. Es könnte allerdings sein, dass Sie dann mit einer anderen Kollegin oder einem Kollegen verbunden werden.“
„Vielleicht darf ich trotzdem nach Ihnen fragen, Johanna. Sie waren so nett zu mir.“
„Wenn ich dann hier bin, lässt sich das gewiss einrichten, aber wir arbeiten im Schichtdienst. Ich wünsche Ihnen wirklich das Allerbeste, Karl. Auf Wiederhören.“
„Ja, auf Wiederhören, Johanna, und nochmals vielen Dank!“
Nachdenklich legte Johanna den Hörer auf. Sie musste ja noch ein Protokoll von diesem Gespräch anfertigen. Und vielleicht sollte sie es sogar einmal bewusst einrichten, den Herrn Fink im Hof zu treffen – er war ein so netter alter Herr.
Eine gute Idee…
Seitdem Petra kürzlich während ihrer Schicht bei der Telefonseelsorge ihren Nachbarn, Herrn Fink, an der Strippe gehabt hatte, ließ ihr der Gedanke an dieses Gespräch keine Ruhe. Es gab so viel Traurigkeit und menschliches Elend, sogar in ihrer unmittelbaren Nähe. Im Dienst nannte Petra sich Johanna, und zum Glück hatte Herr Fink ihre Stimme nicht erkannt, als er ihr sein Herz ausschüttete. Dass seine Frau vor einigen Wochen verstorben war, hatte höchstwahrscheinlich außer ihr bisher auch niemand der anderen Hausbewohner mitbekommen. In dem großen Mietshaus, in dem sie lebte, kannte man allenfalls seine Nachbarn auf der gleichen Etage, häufig noch nicht einmal das. So wusste sie selbst auch nicht, wer nach der alten Dame, die vor ein paar Monaten in ein Pflegeheim umsiedeln musste, dort eingezogen war. Bisher war ihr das auch sehr recht gewesen, aber das Gespräch mit Karl Fink hatte sie aufgewühlt, und der Gedanke eine Nachbarschaftsfete zu organisieren, damit sich bei der Gelegenheit alle einmal treffen und kennenlernen konnten, ließ sie seitdem nicht mehr los. Daher nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und klingelte an der Wohnungstür gegenüber. Krause, der Name stand auf dem neuen Klingelschild. Einen Moment später öffnete sich die Tür, und eine kleine, sehr ausgefallen und bunt gekleidete Dame mittleren Alters wurde sichtbar.
„Ja, bitte?“, fragte sie zurückhaltend.
Petra nannte ihren Namen und trug ihr Anliegen vor.
„Ich denke, das wäre eine gute Idee, zu wissen mit wem man Tür an Tür wohnt“, erklärte sie Frau Krause abschließend.
Die nickte wohlwollend.
„Warum nicht, ich bin dabei!“, entschied sie kurzerhand.
„Das ist schön! Sagen Sie, kennen Sie zufällig schon jemanden aus dem Haus?“, erkundigte Petra sich.
„Nein, bisher nicht, aber ich lebe ja auch erst seit Februar hier“, antwortete Frau Krause.
Zu der Zeit hatte Petra ihren Resturlaub genommen und war für einige Tage nach Ibiza geflogen. In die Sonne, um dem trüben Schmuddelwetter hier zu entgehen. Sie wollte für ihren vielseitigen Arbeitsalltag bei der Telefonseelsorge wieder neue Kraft schöpfen. Ibiza hatte ihr wahrhaft gutgetan – in jeder Hinsicht. In dieser Zeit musste die neue Nachbarin, von ihr unbemerkt, eingezogen sein.
„Frau Krause, hätten Sie eventuell Zeit und Lust das Fest mit mir zu organisieren?“, machte Petra einen erneuten Vorstoß.
Frau Krause überlegte einen Moment, bevor sie antwortete.
„Ich bin selbstständig und arbeite von zuhause aus, als freie Illustratorin für Kinderbücher. Derzeit habe ich keinen eiligen Auftrag. Vielleicht tut mir zwischendurch sogar eine Beschäftigung mit etwas ganz anderem gut“, erklärte sie und fuhr fort: „Ich mache mir in den nächsten Tagen ein paar Gedanken und entwerfe ein Rundschreiben, das wir dann in jeden Briefkasten stecken können. Was halten Sie davon?“
„Oh ja, das wäre natürlich eine großartige Hilfe!“, bedankte sich Petra. Auf so ein fabelhaftes Angebot hatte sie überhaupt nicht zu hoffen gewagt. Ihre Sympathie für die neue Nachbarin stieg.
„Ich dachte, wir könnten im Hof Tische und Stühle aufstellen, und möglicherweise haben auch einige Männer Spaß daran, ein paar Bratwürstchen zu grillen. Wenn jeder zu der Feier etwas beiträgt, dann wird das auch für keinen zu teuer.“
„Das ist eine gute Idee“, gab ihr Frau Krause recht. „Wie sieht es mit einem Termin aus? Den müssen wir auf jeden Fall festlegen, haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?“
„Stimmt, das sollten wir“, antwortete Petra und bat Frau Krause um einen Augenblick Geduld, damit sie ihren Terminkalender holen konnte.
„Oder möchten Sie auf einen Sprung mit zu mir kommen?“, lud sie ihre Nachbarin ein.
„Warum nicht, gern!“, mit diesen Worten zog Frau Krause ihren Hausschlüssel aus der Tür und ging mit Petra hinüber zu deren Wohnung. „Hübsch haben Sie es hier“, stellte sie fest, nachdem Petra sie höflich ins Wohnzimmer gebeten hatte.
„Danke, ich fühle mich hier auch sehr wohl“, entgegnete Petra. „Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee oder einen Tee anbieten?“, erkundigte sie sich.
„Ich nehme gern eine Tasse Tee, vielen Dank“, antwortete ihre Besucherin. Wenig später saßen sich die beiden Damen bei Tee und Keksen gegenüber und beratschlagten, wie sie ihre Pläne am besten umsetzen könnten.
„Wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen?“, fragte Frau Krause.
Petra überlegte. Sie durfte ja niemandem von ihrem Gespräch mit Karl Fink erzählen. Also sagte sie nur: „In meinem Job bekomme ich viel von der Einsamkeit der Menschen untereinander mit, vor allem, wenn sie so anonym leben wie wir in diesem großen Haus.“ „Das stimmt; ich habe bis vor Kurzem in einem winzigen Dorf auf dem Land gelebt, bevor ich mich von meinem Partner getrennt habe. Dort kannte man alle anderen Bewohner des Ortes. Jeder wusste über jeden Bescheid, das war mir auf die Dauer einfach zu eng. Aber hier ist es auch nicht ideal, da haben Sie irgendwie schon recht.“
Zwei Stunden und eine weitere Kanne Tee später, hatten sie ein Anschreiben an die Bewohner des Hauses aufgesetzt, in dem sie alle zu einer großen Nachbarschaftsfete als „Kennenlernfest“ am Samstag in drei Wochen einluden. Es wurde darum gebeten, dass jeder Mieter einen kleinen Beitrag dazu leisten möge, der in Form einiger Getränke, eines Salates oder einfach aus mitgebrachten Knabbereien bestehen konnte. Außerdem wurde gefragt, ob jemand bereit sei, ein paar Würstchen auf den Grill zu werfen. Sehr willkommen waren auch Tische und Stühle, die unter der großen Linde im Hof für dieses Nachbarschaftsfest aufgestellt werden sollten. Auf dem unteren Teil der Einladung wurde um eine kurze Rückmeldung gebeten. Außerdem konnte man Vorschläge machen, was man gegebenenfalls mitbringen würde. Diese Antwortzettel sollten wahlweise bei Petra oder Frau Krause in den Briefkasten geworfen werden.
„Ich tippe das nachher noch ab, drucke es aus, und morgen stecke ich es in die Postkästen“, schlug Frau Krause vor.
„Danke, das wäre prima, weil ich gleich zur Arbeit muss“, freute sich Petra.
„Kein Problem, geht klar!“, versprach ihre neue Nachbarin, bevor sie sich verabschiedete. Als Petra spätabends von ihrem Dienst zurückkehrte, schaute sie noch einmal nach Post. Zu ihrer freudigen Überraschung fand sie in ihrem Briefkasten bereits die fertige Einladung für das geplante Fest. Frau Krause hatte ganze Arbeit geleistet und sogar einige kleine Vignetten darauf gezeichnet. In der linken oberen Ecke des Blattes lachte dem Betrachter eine strahlende Sonne entgegen, auf der anderen Seite sah man einen Grill, auf dem einige Bratwürstchen brutzelten und mehrere gut gefüllte Salatschüsseln standen auch bereit. Alles war so liebevoll und detailgetreu gezeichnet, dass man die Würstchen fast riechen konnte. Wie gut, dass sie Frau Krause um Hilfe gebeten hatte!
Als Karl Fink am nächsten Morgen diese Post in seinem Briefkasten entdeckte, stutzte er. Sonst fischte er in der Regel hauptsächlich Reklame oder ab und zu eine Rechnung daraus hervor. Auf beides war er nicht sonderlich erpicht. Umständlich suchte er seine Lesebrille hervor, putzte sie gründlich und setzte sich an den Küchentisch, um sich diesen Brief genauer anzusehen. Einladung, schon das Wort klang verheißungsvoll, fand er. Dann las er weiter und war begeistert; natürlich würde er an diesem Abend teilnehmen! Das war keine Frage für ihn, wie schade, dass seine Elfriede das nicht mehr erleben konnte. Bei diesem Gedanken wischte er sich verstohlen eine kleine Träne aus dem Auge. Aber gleich darauf rief er sich zur Ordnung, sie hätte nicht gewollt, dass er traurig war, im Gegenteil, darum hatte sie ihn oft genug gebeten. Sofort füllte er den Anmeldezettel aus und bot an seine Balkonmöbel zur Verfügung zu stellen, sofern ihm jemand helfen würde, sie in den Hof zu tragen. Außerdem wollte er seinerseits gern einen kleinen Geldbetrag spenden, das sei das Einfachste für ihn. Den Schein fügte er seiner Antwort gleich bei. Ich freue mich! Diesen Satz hatte er noch schnell an den Rand geschrieben, bevor er den Umschlag mit seiner Antwort verschloss und ihn in Petra´s Briefkasten warf. Als sie diese Zeilen las, war sie sehr gerührt. Nur wenige Tage später hatten insgesamt zehn der zwölf Parteien zugesagt. Nur Herr Falke und Frau Schmöller konnten leider nicht teilnehmen, weil sie, zu ihrem größten Bedauern, an dem Tag bereits andere, wichtige Verpflichtungen hatten. Beide fanden diese Idee dennoch prima und hofften auf eine Wiederholung, damit sie beim nächsten Mal mit dabei sein konnten. Alle anderen Bewohner des Hauses Nr. 17 freuten sich, hatten Vorschläge gemacht wo man die Grills aufstellen konnte, und einige hatten auch ihre tatkräftige Hilfe versprochen. Mit so viel Engagement hatte Petra gar nicht gerechnet. Einer der Männer, der seine Unterstützung angeboten hatte, war Christian Dülmen. Den rief Petra an und bat ihn, zusammen mit ihr und Katharina, denn inzwischen duzte sie sich mit Frau Krause, einige Besorgungen zu machen. Zudem wollte er sich darum kümmern, dass mehrere Grills aufgestellt wurden und auch genug Tische und Stühle für alle Gäste vorhanden waren. So war alles bestens geplant und vorbereitet. Der große Tag konnte kommen.
Zum Glück hatten sie sogar den launischen Wettergott auf ihrer Seite. Schon in den frühen Nachmittagsstunden wurde Karl Fink Zeuge geschäftigen Treibens auf dem Hof. Einige Zeit später klingelte es auch an seiner Tür. Ein junger Mitbewohner, der sich ihm als Andreas Lessing vorstellte, bat darum seinen Tisch und die Stühle von der Terrasse mit in den Hof nehmen zu dürfen.
„Natürlich, gern“, antwortete Karl Fink eifrig und erbot sich, die Auflagen für die Stühle mit nach draußen zu tragen. Endlich konnte er sich ein wenig nützlich machen – ein schönes Gefühl war das, fand er. Nach und nach trudelten alle anderen Bewohner des Hauses auf dem Hof ein. Einige kannten sich natürlich, aber es dauerte nicht lange, bis sich auch die anderen Teilnehmer dieses Festes miteinander bekannt gemacht hatten. Und schon bald entwickelten sich lebhafte Gespräche. Alle tranken ein Gläschen zusammen und ließen sich die Salate und Bratwürstchen schmecken. Karl Fink strahlte, als er Petra sah, und sie freute sich ebenfalls ihn gesund und munter anzutreffen.
„Wir kennen uns doch vom Sehen, nicht wahr?“, begrüßte sie ihn freundlich.
„Aber ja“, stimmte er freudig zu. Dann fragte er: „Dieses Fest heute, war das Ihre Idee?“
„Ja, ich wollte gern alle meine Nachbarn endlich mal kennenlernen“, antwortete Petra verschmitzt.
Sie freute sich, dass Karl Schmidt sie offenbar noch immer nicht mit der Telefonseelsorge in Verbindung brachte. Als sie ihn im Verlauf des Abends öfter mit anderen Nachbarn sprechen sah, war sie sehr zufrieden mit sich.
„Es ist wirklich ein sehr gelungenes Fest“, meinte Katharina, und Petra konnte ihr nur beipflichten. Als es zu dämmern begann, wurden auch die mitgebrachten Windlichter angezündet, und es war schon weit nach Mitternacht, als die ersten Gäste sich verabschiedeten, unter ihnen Karl Fink.
„Ich danke Ihnen – Johanna“, raunte er Petra leise zu. Also war ihm im Laufe des Abends ihre Identität doch nicht verborgen geblieben. Sie lächelte vielsagend und legte ihren Zeigefinger an die Lippen, zum Zeichen, dass er über sein Wissen Stillschweigen bewahren sollte. Karl Fink nickte verstehend und wünschte laut allen eine gute Nacht, bevor er im Haus verschwand. Petra war sich ziemlich sicher, dass sie, als Johanna, so schnell nichts mehr von ihm hören würde. -
Die Rettung
Unschlüssig stand Renata auf der regennassen Straße. Sie wusste nicht wohin. Ihre ganze Welt schien zusammengebrochen zu sein. Sie hatte gekämpft, es ehrlich versucht wieder Fuß zu fassen in diesem Leben, aber es gab einen Rückschlag nach dem anderen, und nun war sie müde – so müde. Sie konnte und wollte einfach nicht mehr. Wenn sie an die freudlose Zukunft dachte, die vor ihr lag, dann blieb ihr nur noch eines – aufgeben, was sonst. Das Leben war so verdammt ungerecht, fand sie, und ballte wütend ihre Fäuste in der Manteltasche. Aber auch das Aufgeben war nicht so einfach, das wusste sie genau. Man konnte sich nicht einfach ins Bett legen und hoffen zu sterben, da müsste man schon nachhelfen, aber dazu fehlte ihr der Mut. Während sie über ihre Lage nachdachte und mehr oder weniger einfach ziellos durch die Straßen stolperte, war sie irgendwann am Fluss gelandet. Träge floss der Strom dahin, nahm alles mit sich was ihm anvertraut wurde. Sollte sie...? Nein, das war doch keine Lösung. Es war ein warmer Sommerabend, und viele Leute würden jetzt zusammensitzen, grillen, etwas trinken und ihn genießen. Das hatte sie früher mit ihren Freunden oft getan, aber nachdem sie zuerst durch ihre Krankheit und später durch die folgende Erwerbsunfähigkeit so abgestürzt war, hatte sie sich immer mehr von allem zurückgezogen. Wenn man aus Finanznot nicht mehr viel unternehmen konnte, wurde man einsam. Und irgendwann gaben die Anderen es auf, zu fragen ob man mit ihnen ins Kino oder in ein Restaurant gehen wollte.
Die Ruhe des Flusses tat ihr gut. Einfach nur dasitzen und die sorgenvollen Gedanken für eine Weile ausblenden, mehr wollte sie in dem Augenblick gar nicht. Sie setzte sich ans Ufer und begann sie in ihrer Handtasche zu kramen. Schnell fand sie, was sie suchte. Sie holte Stift und einen Block hervor, denn sie erinnerte sich plötzlich daran, dass ihre längst verstorbene Mutter ihr einmal geraten hatte, wenn es ihr schlecht ging, sich ihren Kummer einfach von der Seele zu schreiben. Das wollte sie nun tun. Eigenartig, dass dieser Rat ihr gerade jetzt einfiel. Aber was konnte es schaden? Also setzte sie sich hin und schrieb. Seite um Seite füllte sich. Renata war wie besessen, konnte einfach nicht aufhören. Als sie den Stift endlich absetzte, begann sie zu weinen. Es waren erlösende Tränen, das spürte sie - und irgendwie auch die tröstliche Gegenwart ihrer Mutter. Eine ganze Weile saß sie noch am Fluss und als sie sich erhob, wusste sie, dass sie wider Erwarten wohl doch noch eine kleine Kraftreserve in sich trug, die sie mobilisieren konnte. Dann machte sie sich langsam auf den Heimweg.
Als sie zuhause ankam, hockte eine junge Katze vor dem Gartentor. Renata beugte sich unwillkürlich zu ihr hinunter, und das winzige Geschöpf trippelte langsam auf sie zu. Es hob hilfesuchend das Pfötchen. Ein zaghaftes Lächeln stahl sich in Renata´s Gesicht.
„Bist Du auch so mutlos?“, fragte sie leise.
Die kleine Katze strich ihr um die Beine und Renata konnte einfach nicht anders, spontan nahm sie das Kätzchens hoch. Was für ein reizendes Tier. Braun getigert und mit einem rötlichen Streifen auf dem Rücken, soviel konnte sie im Licht der Straßenlaterne erkennen. Die niedliche, kleine Katze schmiegte sich vertrauensvoll in ihre Arme.
Wie um Himmels Willen sollte sie sich in ihrer Situation auch noch um ein Tier kümmern, fragte sich Renata. Aber im gleichen Moment wusste sie, diese heimatlose Katze hatte bei ihr Schutz und Hilfe gesucht – wie konnte sie ihr die verweigern; also nahm sie das Kätzchen mit. Renata überlegte: Hatte sie nicht eine angebrochene Dose mit einem Rest Thunfisch im Kühlschrank? Den bot sie ihrem Gast an und wie erwartet, fiel ihr Schützling gierig darüber her, leckte sich anschließend das Mäulchen und sah Renata erwartungsvoll an. Wie geht´s nun mit uns weiter, schienen die ausdrucksvollen grünen Augen der Kleinen sie zu fragen. Ja, wie sollte es weitergehen?
Am nächsten Morgen las Renata noch einmal durch, was sie am Tag zuvor notiert hatte. Sie war sicher, dass ihre Gefühle von vielen Leuten geteilt wurden, denen es ähnlich ging wie ihr. War das nicht überhaupt die Lösung? Sie würde sich an ihren alten PC setzen und ihre ganze Geschichte ausführlich aufschreiben, möglicherweise konnte sie die veröffentlichen. Allein der Gedanke daran tat ihr gut. Selbst wenn dieser Versuch scheitern sollte, so wären diese Aufzeichnungen doch etwas, das sie der Welt hinterlassen konnte.
„Etwas Geld habe ich noch, ich gehe nachher einkaufen, und dann kriegst Du richtiges Futter!“, versprach sie dem Kätzchen, dass sich nach einer kleinen Portion reichlich verdünnter Sahne und ihrer letzten Scheibe gekochten Schinken, den Renata für sie zum Frühstück in kleine Häppchen geschnitten hatte, neben ihr zusammenrollte. Das war bestimmt nicht die richtige Nahrung für eine Katze, aber es war nichts anderes mehr im Haus. Philomena, so hatte Renata die kleine Katze genannt, blinzelte zustimmend, bevor sie einschlief. Renata schmunzelte, und plötzlich wusste sie, dass dieses verregnete, kleine Wesen, das sozusagen vom Himmel gefallen war, ihre Rettung bedeuten würde. Daher begann sie ihr Buch mit den Zeilen:
„Als ich die Hand eines Menschen brauchte, reichte mir stattdessen jemand tröstend seine kleine Pfote...”
Die Wittekindsquelle
Es war recht einsam geworden um den Sachsenherzog Wittekind. Im Laufe der langen Jahre des Kampfes gegen Kaiser Karl, den die Geschichtsbücher später „Karl, den Großen“ nennen würden, waren nur noch wenige Getreue an seiner Seite geblieben. Die letzten Sachsen und ihr Anführer Wittekind waren geächtet und jedem, der ihm und seinen Männern Unterschlupf oder Hilfe gewährte, drohten schwere Strafen. Sie lebten in den Wäldern des Wiehengebirges und blieben nie lange an einem Ort, um nicht von den Schergen Karls dort aufgestöbert zu werden. Sein Widersacher war absolut unerbittlich. Wenn er Gefangene in seine Gewalt bekam, stellte er sie vor die Wahl sich zum Christentum zu bekennen und taufen zu lassen oder zu sterben. So hatte es in Verden an der Aller ein unbeschreibliches Massaker gegeben, weil Tausende Sachsen an diesem Tag lieber in den Tod gingen, statt sich Karl und seinem Willen zu unterwerfen. Von denjenigen, die es getan hatten um ihr Leben zu retten, huldigten viele heimlich weiterhin den alten Göttern. Aber die Macht und der Einfluss Karls wuchsen unaufhörlich, trotz seiner Grausamkeit. Die neue Religion, zu der er seine Untertanen mit allen Mitteln bekehren wollte, sagte Wittekind nicht zu. Er hing nach wie vor an den alten Göttern und vertraute ihnen, obwohl Wotan, der Kriegsgott, ihm in den Schlachten gegen die Franken längst nicht immer hilfreich zur Seite gestanden hatte.
An diesem Abend war er allein unterwegs. Es war schon sehr spät, die Dunkelheit war hereingebrochen und um ihn herum wallten Nebelschwaden. Fröstelnd zog Wittekind seinen Umhang enger um den ausgemergelten Körper. Müde war er, nicht zuletzt vom Kämpfen. Er fragte sich, ob er überhaupt noch eine andere Wahl hatte, als die sich Karl zu unterwerfen. Immer öfter stieg die leise Ahnung in ihm auf, dass er am Ende verlieren und sich ergeben würde. Er wusste einfach nicht mehr, ob der Weg, den er eingeschlagen hatte, der richtige war. Es hatte schon zu viele sinnlose Opfer gegeben, und diese Erkenntnis schmerzte ihn zutiefst. So waren inzwischen die meisten seines Stammes tot oder hatten sich taufen lassen. Angeblich war dieser neue Gott nicht grausam und forderte keinerlei Opfergaben seiner Anhänger. Im Gegenteil, er liebte und verzieh allen Menschen, wenn sie ihre Sünden aufrichtig bereuten. So eine Denkweise war Wittekind absolut fremd. Er verstand auch nicht, warum Kaiser Karl sich, im Namen dieses angeblich so liebevollen Gottes, das Recht nahm, den Menschen, die sich weigerten ihn anzubeten, das Leben zu nehmen. Das passte nicht zu dem, was er über das Christentum gehört hatte. Tief in Gedanken versunken ritt er durch den Wald und merkte irgendwann, dass er vom Weg abgekommen war und sich verirrt hatte. Er war sehr hungrig, und vor allem quälender Durst machte ihm zu schaffen. Da schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Sollte es wahr sein, dass der Christengott jedem half, der ihn aus vollem Herzen darum bat? Die Götter der Germanen waren launisch; sie taten nur was ihnen gefiel. Schließlich entschloss er sich den Versuch zu wagen und den fremden Gott um Hilfe zu bitten. Was konnte es schaden?
„Gott der Christen, wenn Du mich hörst, dann hilf mir und lass mich Wasser finden. Mein Pferd und ich sind erschöpft, durchgefroren und vor allem durstig. Ich weiß nicht mehr weiter...“, flehte er voll Verzweiflung.
Sein Pferd tänzelte unruhig hin und her, sodass Wittekind Mühe hatte, sich im Sattel zu halten. Aber dann, oh Wunder, trat der Huf seines getreuen Kameraden einen Stein los, und plötzlich sprudelte an der Stelle eine Quelle. Herzog Wittekind riss die Augen auf. Er mochte es kaum glauben, sein Gebet war erhört worden. Dann ließ er sich aus dem Sattel gleiten, ging in die Knie und trank. Das klare Wasser erfrischte seinen Körper und ebenso seinen Geist. Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, ließ er sein Pferd ebenfalls trinken und gelobte, sich Kaiser Karl zu stellen, um sich taufen zu lassen. Das Morden sollte endlich ein Ende finden. Wenn er, der Anführer der letzten Sachsen, sich taufen ließe, dann würden sie ihm gewiss folgen und sich ebenfalls zum Christentum bekehren lassen. So gut es ging, machte er sich ein Schlaflager zurecht, denn heute konnte er nicht mehr weiter reiten. In dieser Nacht fand er lange keine Ruhe. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um das Wunder, dass er erlebt hatte. Wie gütig und mächtig musste dieser Gott sein, der ihn und sein Pferd auf solche Weise gerettet hatte.
Wittekind hat sein Gelübde wahrgemacht und sich mit Kaiser Karl getroffen. Er hat sich taufen lassen und ist in der Stiftskirche in Enger begraben.
Diese Wittekindsquelle existiert noch heute. Sie befindet in meiner Heimatstadt Bad Oeynhausen, im Ortsteil Bergkirchen. Direkt unterhalb der Kirche kann man sie besichtigen, innehalten und darüber nachdenken ob sich dieses Geschehen um Wittekind und sein tapferes Pferd tatsächlich so abgespielt hat.
Meine Brieffreundin
Seit vielen Jahren habe ich nun schon eine Brieffreundin - Beate. Zwanzig Jahre sind es mindestens inzwischen, eher noch ein paar mehr. So ganz genau wissen wir das beide nicht mehr. Unsere Lebensumstände sind sehr verschieden, aber trotzdem verbindet uns eine Menge. Sie lebt in unserer interessanten und vielseitigen Hauptstadt Berlin, ich hier am Rande einer kleinen Kurstadt im tiefsten Ostwestfalen. Ein Jahrzehnt trennt uns, sowie eine Kleidergröße; aber ist das wichtig für eine Freundschaft? Für uns war das nie ein Thema – im Gegenteil, wir hatten uns von Anbeginn unserer Brieffreundschaft immer sehr viel zu berichten.
Die Familie, natürlich, diverse Hobbys und manchmal haben wir beide auch über das Weltgeschehen philosophiert. Es gibt so vieles was wir uns gegenseitig mitteilen möchten, und ich freue mich immer sehr, wenn ich wieder einen liebevoll verzierten Brief von ihr aus dem Briefkasten nehmen kann. Wir teilen unser Leben – Freude und auch Sorgen!
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Beates Enkelkind voller Vorfreude erwartet wurde, inzwischen ist eine junge Dame daraus geworden. Die Hochzeit unserer Tochter war natürlich für unsere Familie ein großes Ereignis! Dazu schickte mir Beate einen entzückenden Brautteddy, den sie selbst für diesen Anlass genäht hatte. Welch eine schöne Überraschung! Wir lieben beide Trödelmärkte. Natürlich haben wir uns darüber ausgetauscht, welche Schätze wir dort aufgestöbert haben. So richtet Beate leidenschaftlich gern ihre Puppenhäuser ein und sammelt auch altes Silberbesteck. Ich liebe antikes Porzellan und bin immer auf der Suche nach ausgefallenen Blumenvasen.
Beate und ihr Mann haben einen großen Schrebergarten, den sie mit Hingabe pflegen. Von den Obst- und Gemüseerträgen werden Freunde und Nachbarn von Beate regelmäßig mitversorgt. In jedem Frühjahr erstrahlen Hunderte von Tulpen, Narzissen und anderen Frühlingsblühern in allen Beeten. Sie hat mir schon etliche wunderschöne Fotos davon gesandt. Wir leben hier auf dem Land in einem Haus mit Garten. Da ich halbtags arbeite, fällt