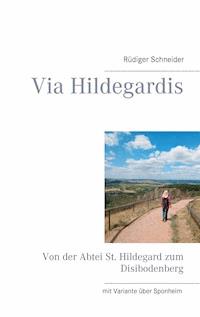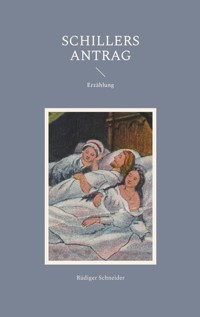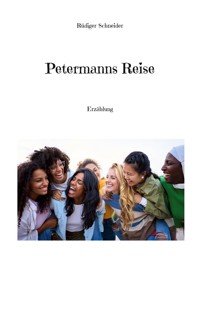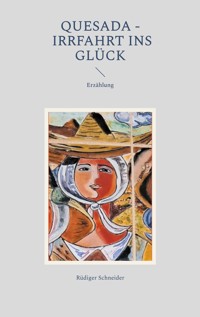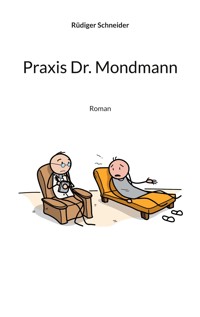Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sonne im November! Max Winter verkauft seinen Buchladen und wandert nach Spanien aus, an die Costa del Sol bei Málaga. In Torrox, im Campo, mietet er ein kleines Landhaus. Es kommt zu einer schicksalhaften Begegnung, die sein Leben auf den Kopf stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Nachwort
1
Spätestens im November wird die Sehnsucht nach Sonne größer. Wenn Deutschland im Grau versinkt und das Wetter einem neben dem stündlichen Stakkato schlechter Nachrichten das Gemüt belastet. Meinen kleinen Buchladen am Bonner Konrad-Adenauer-Platz hatte ich aufgegeben, aufgeben müssen, da die Konkurrenz durch Medienkonzerne und das Internet übermächtig geworden war. Der Verkauf des Ladens und des dazu gehörenden Mietshauses bescherte mir ein kleines Barvermögen, und da ich gerade 65 geworden war, kam noch eine bescheidene Rente hinzu. Wie die Bremer Stadtmusikanten sagte ich mir: „Max, was Besseres als den Tod findest du allemale!“ Aber ich zog nicht wie die Märchenfiguren nach Norden, sondern nach Süden, nach Spanien an die Costa del Sol. Mir die Rente auf eine spanische Bank zu schicken, würde kein Problem sein. Es gab nur ein paar bürokratische Unannehmlichkeiten. So beschied mich zum Beispiel die Rentenkasse: „Sehr geehrter Herr Winter, wir benötigen eine jährliche Bescheinigung, dass Sie noch leben.“ Nun ja, dachte ich mir, das wird kein Problem sein und rief bei meiner zuständigen Rentenkasse an. „Reicht es, wenn ich mich einmal im Jahr bei Ihnen telefonisch melde?“ fragte ich die Sachbearbeiterin. „Aber Herr Winter, ich bitte Sie! Da kann ja jeder anrufen. Wir brauchen das schriftlich. Da, wo Sie wohnen und gemeldet sind, gehen Sie zum Einwohnermeldeamt und lassen es sich bestätigen. Das schicken Sie uns zu. Sie müssen natürlich persönlich auf dem Amt erscheinen, Ihren Ausweis vorlegen, sonst geht das nicht. Die werden dann sehen, ob Sie noch leben oder nicht mehr.“ Ich zeigte mich einsichtig. Denn im Grunde hat die Rentenkasse recht. Sie können ja nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag Geld ins Ausland überweisen, wenn diejenigen, die der Heimat den Rücken gekehrt haben, schon lange abgenippelt sind.
Ach ja, Heimat. Darüber dachte ich nach. Was ist eigentlich Heimat? Ist es die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft? Möglich. Aber dann kommt es darauf an, mit wem man sich etwas zu sagen hat und worüber man redet. Auf diesem Gebiet sah es bei mir nach dem Verkauf des Buchladens ziemlich mau aus. Die paar Freunde, die ich hatte, hockten in biederen Ehen und mussten für Unternehmungen erst um Erlaubnis fragen. Ich selbst war unverheiratet und hielt es eher mit Goethes Spruch aus dem West-Östlichen Divan: „Denken in Besitz und Liebe machen mir die Sonne trübe.“ Eine Freundin hatte ich seit langem nicht mehr gehabt, wohl aber ein paar kurze Affären, von denen hier jedoch nicht die Rede sein soll. Bindungs- und beziehungsmäßig war ich also frei. Ein ausgeprägtes Nationalgefühl hatte ich auch nicht. Es beschränkte sich auf die Freude, dass Deutschland 2014 Fußballweltmeister geworden war. Gab es eine kulturelle Heimat? Goethe und Schiller waren tot. Was sie geschrieben hatten, konnte ich mit nach Spanien nehmen. Das war sozusagen ein unveräußerlicher Besitz, der überall zugänglich war. Dann gab es noch die fast komische Frage nach der religiösen Heimat. Die gab es in Deutschland nicht mehr. Das Christentum war abgeschafft. Gott wohnte nur noch im Supermarkt. Hatte ich eine politische Heimat? Auch nicht. Ich ging zwar alle vier Jahre wählen, machte auf dem Wahlzettel aber kein Kreuz, sondern schrieb nur den Namen des jeweiligen Papstes aufs Papier. So äußerte ich meinen Unmut darüber, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Außerdem dachte ich, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Liebst du ein Eskimomädchen, kannst du auch in einem Iglu glücklich sein. In der Bilanz aller Dinge war ich also heimatlos, konnte leichten Herzens ein paar persönliche Dinge in meinen Wagen verfrachten und mich aus dem immer trüber werdenden Bonn verabschieden. Das Auto hätte ich mir bei meinem schmalen Verdienst als Buchhändler eigentlich nicht leisten können. Es war ein schon in die Jahre gekommener 2 CV, eine Ente also. Ich hing an dem Wagen, vermochte ihn nicht einzutauschen gegen ein moderneres Fahrzeug. Den Motor hatte ich schon zweimal erneuern lassen. Vieles andere wie Bremsen, Auspuff und so weiter auch. Ebenso war die Lackierung neu, kirschrot. Eigentlich war es ein gepflegter, schnuckliger Oldtimer, mit dem ich, war ich unterwegs, immer auffiel. Freunde hatten mir schon viel Geld dafür geboten, aber ich hatte immer abgewunken. „Verkauf ich nicht! Tausche ich auch nicht gegen einen Mercedes ein.“
2
Was mir die Liebe verdächtig machte beziehungsweise mich an ihrer Beständigkeit zweifeln ließ, war das Schicksal meines Freundes Paul Bernhardt, den wir alle nur Kongopaul nannten. Kongopaul war 68 und in Bonn-Duisdorf zu einer bezaubernd schönen Afrikanerin gezogen, die 39 Jahre jünger war als er. In einer kleinen Zweizimmerwohnung lebte er mit ihr und ihren fünfjährigen Zwillingen Ben und Micky zusammen. Es waren nicht seine Kinder, sondern eben ihre, die von einem Mann stammten, der sich abgesetzt hatte. Täglich gab es rasante Eifersuchtsszenen, das Vertrauen bröckelte. Alle drei Monate war Kongopaul auf der Flucht. Dann besuchte er einen der Freunde, bat: „Bitte helft mir!“, hatte aber stets sein Smartphone eingeschaltet und wartete auf das Signal zur Rückkehr. „Was soll ich bloß machen?“ meinte er. „Sie ist doch schön wie die junge Whitney Houston. Ich bin so stolz, wenn ich mit ihr spazieren gehen kann. Alle drehen sich nach uns um.“ Kongopaul blieb eine Nacht bei einem der Freunde, trug das Smartphone am Körper und kehrte am nächsten Tag dann dorthin zurück, wo das Dilemma begonnen hatte. Beim letzten Mal war er bei mir gewesen. Ich hatte versucht, ihn mit Bitburger zu trösten, hatte ihm auch vorgeschlagen mit nach Spanien zu kommen und hatte, als er wieder mit seiner Isabell telefonierte, verständnisvoll geäußert: „Ja, ja, es gibt eine Schönheit, die einen als Mann verwundet.“ Paul murmelte irgendetwas von Verfallensein. Fünf Minuten nach diesem Spruch war er weg. Ich weiß nicht, wie man in einem solchen Fall helfen soll. Ich kann den Paul ja schlecht anketten, und auch der Rat, sein Smartphone in den Rhein zu werfen, verfing nicht. So bringt er also wieder Ben und Micky in die Kita, fragt sich, wo seine schöne, junge Frau tagsüber ist, und ernährt seine exotische Familie mit seiner bescheidenen Rente. Dass das Glück heißer Nächte eine solche Aufgeregtheit besänftigen kann, bezweifle ich. Mir würde es die Schönheit des Tages trübe machen und so lasse ich lieber die Finger davon. Obgleich ich gestehen muss, dass auch ich diese Lust auf eine romantischheiße Liebe wie einen Virus in mir trage. Es könnte ja ausnahmsweise einmal gutgehen. Aber das ist genau der Punkt, wo meine Bedenken wurzeln. Nichts ist dauerhaft im Leben. Die Zeit und eben auch die Zeit des Verfalls hat noch niemand aufhalten können. Um diesen Pessimismus überwinden zu können, müsste ich wenigstens einmal die Ausnahme von dieser Regel gesehen haben. Vorher glaube ich nicht an die Beständigkeit der Liebe, vermute eher, dass einen dieser Affekt ins Unglück stürzt. So hatte ich also beschlossen, mich lieber in einem moderaten Schatten aufzuhalten, statt von einem Sonnenbad in Eiswasser zu stürzen. So zu leben ist natürlich kein Hit, aber es garantiert eine erträgliche Balance. Man durchlebt eine eher ruhige Gelassenheit, statt auf einer Achterbahn dahinzusausen. Sicher, es gibt auch bei mir Phasen von Langeweile. Aber die erschien mir erträglicher als das Schicksal des Kongopaul. Insbesondere vermeide ich Frauen, die einem wie ein Irrlicht ins Leben treten können. Als Buchhändler, der viel lesen musste und es auch gerne tat, kenne ich alle diese Fälle. Den armen Brentano hat es zwanzigmal erwischt. Goethe wusste sich nur durch raffinierte Fluchten zu entziehen. Mörike hat Zeit seines Lebens einer rätselhaften Zigeunerin nachgetrauert. Allein Odysseus wusste sich zu helfen und ließ sich von seinen Gefährten an den Mast binden, als sein Schiff am Felsen der Sirenen vorbeifuhr.