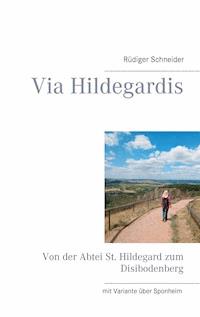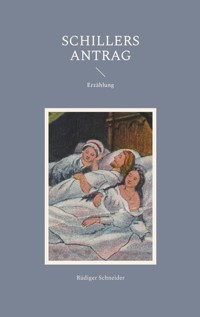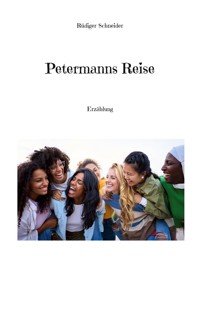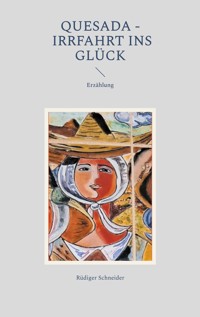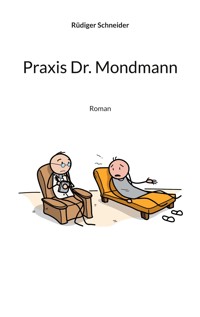Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Severin Buurmeester wächst in einem evangelischen Pastorenhaushalt auf. Sein Vater war sechs Jahre Missionar am Amazonas, hat eine Indianerin geheiratet und ist mit ihr nach Deutschland gezogen, wo Severin zur Welt kommt. Als er Zwölf ist, verschwindet die Mutter. Sie meldet sich nicht mehr. Er bekommt auch keine Briefe. Die entdeckt er erst im Nachlass des Vaters. Der hatte sie ihm vorenthalten. Severin fliegt nach Manaus und will seine Mutter wiedertreffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen und Handlung sind frei erfunden, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Namen rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 1
Es war Anfang Oktober 2024. Severin Buurmeester hatte seine Hängematte auf dem Oberdeck des Schiffes aufgespannt, so dass er den Sternenhimmel sehen konnte. Die Nacht war tief und klar und warm. Die weit auseinander liegenden Ufer des Amazonas waren in der Dunkelheit nur zu erahnen, gaben sich gelegentlich durch das Licht einer einsam stehenden Hütte zu erkennen. Manaus lag jetzt schon über zweihundert Kilometer hinter ihm. Am nördlichen Himmel entdeckte er das Kreuz das Südens, sah zu, wie die Mondsichel, gefolgt von einer strahlenden Venus, dem Horizont zuwanderte. Buurmeester lauschte auf das gleichmäßige Stampfen des Dieselmotors, mit dem die ‚Amazonia‘ stromabwärts Parintins entgegenfuhr. Am frühen Morgen würde sie dort anlegen. Dann musste er umsteigen in das kleine Schnellboot nach Mocambo. Mocambo, an einer Lagune gelegen, war mit dem Amazonas nur auf einem schmalen Nebenarm zu erreichen.
Das Pendeln der Matte, die er sich in der Markthalle am Hafen von Manaus besorgt hatte, erinnerte ihn an das sanfte Wippen der Wiege, mit der ihn die Mutter noch bis in das dritte Lebensjahr hin und her geschaukelt hatte, während der Vater, den Kopf schüttelnd, ihr missbilligend vorwarf: „Der Junge soll endlich laufen lernen! Verwöhne ihn nicht!“
Severin Buurmeester nahm ab und zu einen Schluck Cachaça aus einer kleinen, flachen Flasche, die er sich neben der Hängematte ebenfalls an einem der Stände der Markthalle gekauft hatte. Auf dem Etikett stand ‚Cachaça Velho Barreiro‘, was so viel bedeutete wie ‚Cachaça alt und lange gereift in einem Fass‘. Cachaça war ein Zuckerrohr-Schnaps von 39% Alkoholgehalt. Er feierte damit seinen 52. Geburtstag, während er zugleich in den Sternenhimmel sah und versuchte durch das Tuckern des Dieselmotors hindurch die Geräusche der tropischen Nacht zu vernehmen. Mit einem leisen Schaudern dachte er dabei an die Geschichte, die er am Kai von Manaus gehört hatte. Da war eine Anaconda aus dem dunklen Wasser geschnellt, hatte sich um den Hals eines Fischers, der in einem Kahn saß, geschlungen und ihn in den Amazonas gezogen. Aber so etwas konnte auf dem
Oberdeck der ‚Amazonia‘ natürlich nicht passieren. Das gab es nur in einem Hollywood-Film. Es war besser, ganz anderen Gedanken und Erinnerungen nachzuhängen, als sich solchen Vorstellungen hinzugeben.
Wie sie jetzt wohl aussah? Vierzig Jahre hatte er sie nicht gesehen. Er rechnete nach. Damals war er Zwölf gewesen, als die Mutter in einer heimlichen Flucht das Bonner Pfarrhaus verlassen hatte. Der Vater hatte seine pastorale Mäßigung und Höflichkeit in einem ersten Moment vergessen und geflucht: „Die Hure ist zurück in den Regenwald.“ Danach war er in eine wochenlange Depression gefallen, war unfähig gewesen, den sonntäglichen Gottesdienst in der evangelischen St. Stephanus Kirche zu halten. Er litt lange unter dem Verlust. Martin Buurmeester, der Missionar in Manaus gewesen war, hatte die Indianerin, die erst achtzehn war, als Ehefrau mit nach Deutschland gebracht und noch im selben Jahr war Severin zur Welt gekommen. Im Nachlass des Vaters hatte er ein Foto entdeckt. Da sah man sie in einem schlichten, beigefarbenen Leinenkleid an einem Klavier sitzen. Dem Betrachter hatte sie ein schönes, lächelndes
Gesicht zugewandt, das umrahmt war von langem, glatten, schwarzem Haar. Auf der Rückseite des Fotos stand in einer schon etwas verblassten und für den Vater typischen Handschrift: ‚Iraçema, Mocambo 1970‘.
Kapitel 2
Drei Tage war Severin in der Millionenstadt Manaus geblieben, war nach der Landung auf dem internationalen Flughafen im zentral liegenden Hotel
‚Casa Teatro‘ abgestiegen und schon am nächsten Tag dem Tipp gefolgt, den man ihm an der Rezeption gegeben hatte:
„Sie sollten unbedingt das ‚Encontro das Aguas‘ besuchen. Die Begegnung der beiden Wasser. Der Rio Negro und der Amazonas treffen dort mit ihren unterschiedlichen Farben aufeinander. Die Fahrt dauert nur eine Viertelstunde. Und wenn Sie mit einem anderen Boot noch ein Stück weiterfahren wollen, kommen Sie in ein Indianerdorf mit Tanzvorführungen.“
Er hatte abgewunken. „In eine Art Indianerdorf komme ich noch. Morgen geht es nach Mocambo.“
Mit einem schnellen Fährboot war er zum ‚Encontro das Aguas‘ gekommen, hatte gesehen, wie die beiden Flüsse eine Weile nebeneinander fluteten, mit widerwilligem Wellenschlag, als wollten siesich nicht vermischen. Der dunkle Rio Negro und der hellere, lehmbraune Amazonas, auf brasilianischem Gebiet zuvor noch Solimões genannt. Erst ein paar Kilometer weiter war der Widerstand gebrochen und unter dem Namen
‚Amazonas‘ strömten sie gemeinsam dem
Atlantik entgegen.
In dieser Gegend also, dachte Severin, ist der Vater Missionar gewesen, ein sogenannter Schiffsmissionar, da man die Dörfer, die meist an einem Nebenarm des Rio Negro oder des Amazonas lagen, nur per Boot erreichen konnte. Der Vater hatte ihm ab und zu davon erzählt. Sechs Jahre war er Missionar gewesen, bis er dann als Pastor in die evangelische Kirchengemeinde St. Stephanus berufen worden war. Auch von der Gefahr hatte er erzählt, die mit dem Missionieren verbunden war. Nicht wegen der Indianer, sondern wegen der Goldsucher, die die Indianer vertreiben wollten. Nicht selten hatte es Morddrohungen gegeben, weil die
Missionare auf Seiten der Indianer standen. Und einige Male hatte der Vater erlebt, dass ganze Dörfer vernichtet wurden. Dann stürmte eine Bande der Goldsucher in das Dorf, plünderte, brandschatzte, erschoss jeden, der nicht rechtzeitig geflohen war. ‚Affengrillen‘ nannten sie das. Dahinter stand natürlich der Betreiber der Goldmine, der sein Terrain erweitern wollte und zum Beispiel eine neue Landebahn für die Flugzeuge brauchte.
„Ja, ja, mein Junge“, hatte er geschlossen, „ich habe in dieser Zeit viel gesehen und erlebt. Und ich dachte, das Beste hätte ich gerettet. Deine Mutter. Deine gewesene und von uns geflohene Mutter.“
„Wo ist sie?“ hatte Severin unmittelbar nach ihrem Verschwinden gefragt. „Wann kommt sie zurück?“
Der Vater hatte mit den Schultern gezuckt. „Ich weiß es nicht. Sie hat ihren Reisepass mitgenommen und von unserem gemeinsamen Konto die Hälfte des Geldes abgehoben. Sie wird nach Brasilien geflogen sein. Aber wohin? Ich kann es dir nicht sagen. Brasilien ist fast so groß wie Europa.“
Eine Woche nach ihrem Verschwinden hatte er an einem Nachmittag ein Blatt aus einem Schulheft gerissen, um ihr einen Brief zu schreiben.
„Liebe Mutter, du fehlst mir. Bitte komm zurück!“
Da der Vater gerade auf einer Versammlung des Presbyteriums war, hatte er seinen Schreibtisch nach einem Umschlag durchsucht, fand auch rasch einen, begann ihn zu beschriften. ‚An Iraçema Souza Buurmeester, Brasilien‘. Hier hielt er inne. Da erst wurde ihm bewusst, dass der Brief im Nichts landen würde, als unzustellbar zurückkäme.
Nach einem Jahr hatte Severin das Fragen eingestellt. Der Vater hatte ihn darum gebeten. „Frage mich nicht mehr. Es belastet mich.“
Nur einmal noch war die Rede von ihr. Severin wollte wissen, was ihr Name bedeutet. Iraçema. Buurmeester hob missbilligend die Augenbrauen, antwortete dann aber doch.
„Doce com mel. Süß wie Honig. Aber du hast ja gesehen. Sie ist eher ‚Perigoso como uma abelha‘. Gefährlich wie eine Biene.“
Iraçema meldete sich nicht mehr. Kein Brief kam, keine Karte, kein Telefonanruf. Noch nicht einmal zum Geburtstag ihres Sohnes.
Zurückgeblieben war da der Schmerz über den Verlust. Die Noten in der Schule wurden schlechter und Severin verweigerte für Jahre die Klavierstunden, die er hätte nehmen sollen.
Mit den Jahren schien dieser Schmerz nachzulassen, als habe sich Severin damit abgefunden und sei zur Normalität zurückgekehrt. Die Noten in der Schule wurden wieder besser. Er nahm auch das Klavierspielen wieder auf und fasste sogar den Entschluss, Pianist zu werden. Doch die zärtliche Erinnerung an die Mutter hatte sich nur tiefer in das Unterbewusste zurückgezogen. Dem Vater war er dankbar, dass er keine Stiefmutter ins Haus holte. Für die Orgel hatte Martin Buurmeester bald Ersatz gefunden, eine strenge Calvinistin, wie man sich erzählte, von 50 Jahren. Sie hatte ein nicht unhübsches Gesicht, eine ansprechende Figur und üppige Brüste. Manchmal kam sie zu einer Besprechung ins Pfarrhaus. Ob da sonst noch etwas lief, wusste Severin nicht. Es war ihm auch egal.
Kapitel 3
Während die ‚Amazonia‘ weiter durch die Nacht stampfte, angetrieben von ihrem Dieselmotor und von der Fließgeschwindigkeit des Amazonas, dachte Severin darüber nach, warum Iraçema verschwunden war. Er erinnerte sich an einen Eklat, den es kurz davor gegeben hatte. Martin Buurmeester, der Pastor, hatte sie, die sehr musikalisch war und ausgezeichnet Klavier spielen konnte, schon seit Jahren als Organistin in der Kirche St. Stephanus eingesetzt. An jenem Karfreitag, also dem Todestag Christi, saß sie während der Andacht wieder an der Orgel. Sie sollte eine Fuge Bachs spielen, wählte stattdessen aber einen flotten brasilianischen Bolero. ‚Tenho um Coração‘– Ich habe ein Herz. Das erste Erstaunen der Kirchenbesucher schlug rasch um in Empörung. Nur bei wenigen zeigte sich ein Lächeln.
„Wie kannst du mir das nur antun!“ machte ihr Buurmeester zu Hause heftige Vorwürfe. „Wenn der Bischof das erfährt! Bei einer Andacht an Karfreitag einen Bolero spielen! Statt eine Fuge von Bach,
wie es sich an einem solchen Tag gehört. Bist du von allen Sinnen verlassen!?“
Iraçema hatte zunächst nichts geantwortet, ihn nur ruhig angesehen, mit einem Blick, der schon in eine weite Ferne zu gehen schien. Dann hatte sie auf Portugiesisch gesagt: „Lass das! Wir streiten uns nicht vor dem Jungen.“
Buurmeester hatte daraufhin das Wohnzimmer verlassen und die Türe zugeknallt. Severin hatte die Szene mitbekommen und auch alles verstanden. Da seine Mutter kaum Deutsch sprach und es offensichtlich auch nicht richtig lernen wollte, hatte sie ihrem Sohn das brasilianische Portugiesisch beigebracht, was dieser mit jugendlicher Leichtigkeit rasch lernte. Einen Tag nach Ostern war sie verschwunden, ohne sich zu verabschieden. Severin war bei einem Freund, ihr Mann auf einer Beerdigung. Sie musste ihre Reisetasche gepackt haben, war zur Bank gegangen, dann mit dem Zug nach Amsterdam oder Frankfurt gefahren, hatte dort in einem Hotel übernachtet und einen Flug nach Rio oder São Paulo gebucht. So wird es gewesen sein. Und dann wahrscheinlich weiter über Brasilia nach Manaus in die Heimat am Amazonas. Sie wird damals den gleichen Weg genommen haben wie ich, überlegte Severin. Denn sie war wieder in Mocambo. Der Vater hatte ihm das verschwiegen. Im Nachlass des Vaters, hinter einer verschlossenen Tür des Schreibtischs, die er hatte aufbrechen müssen, war ein Karton mit einem Stapel von 40 Briefen. Briefe, die an ihn, Severin, adressiert und meist zu seinem Geburtstag eingetroffen waren, ein paar Tage früher, ein paar Tage später. Der Vater hatte sie an sich genommen, versteckt, ihn nicht darüber informiert. Warum hatte er sie aufbewahrt? Er hätte sie auch zerreißen und wegwerfen können. Gegenüber dem Schreibtisch, an der Wand, hing ein umrahmter Spruch von Albert Schweitzer.
‚Wahrhaftigkeit ist das Fundament des geistigen Lebens.‘ Hatte ihn das an der Vernichtung der Briefe gehindert? Eine verspätete Wahrhaftigkeit?
Der letzte Brief war vom Februar 2024. Einer der wenigen außerplanmäßigen, also nicht zu seinem Geburtstag.
„Gib doch bitte endlich ein Lebenszeichen von Dir!“ hatte sie geschrieben. „Nach vierzig Jahren muss man doch vergessen und verzeihen können.“
Die Adresse der Absenderin stand bei jedem Brief hinten unterhalb der Falz. Parintins, Mocambo, Avenida São João 12, Brasil. Im August war der Vater, über neunzig geworden, gestorben. Im September hatte Severin die Briefe gefunden. Und auch das Foto. Iraçema am Klavier in Mocambo. 1970.
Kapitel 4
Die Briefe waren noch verschlossen gewesen. Der Vater hatte sie nicht geöffnet. Hastig und voll fiebriger Ungeduld hatte Severin sie geöffnet, sie bei einem ersten Lesen überflogen und bei einem zweiten Satz für Satz. Im ersten stand: ‚Lieber Severin, es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders handeln. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich es dir erklären. Ich weiß, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis du mich in Brasilien besuchen kannst. Ich denke immer an dich und werde immer an dich denken. Du kannst nichts dafür, dass ich gehen musste. Deine Mutter.‘
In den nachfolgenden Briefen, die kurz waren, tauchte immer wieder die Frage auf: ‚Warum meldest du dich nicht? Bist du mir etwa böse?‘
Aber beharrlich hatte sie weiter Jahr für Jahr zu seinem Geburtstag einen Brief geschickt. Die Frage ‚Warum meldest du dich nicht?‘ tauchte nicht mehr auf. Dafür teilte sie ihm mit, wie sie lebte. ‚Mocambo ist größer geworden. 5000 Einwohner. An der Escola Municipal Santa Maria arbeite ich als Klavierlehrerin. Spielst du noch Klavier?‘
Der Brief, der 1998 kam, enthielt eine Überraschung. ‚Lieber Severin, du hast jetzt eine Schwester, Márcia.‘
Rasch überschlug er die Jahreszahlen, verwirrte sich in der ersten Aufregung, rechnete neu. Die Mutter musste da 44 gewesen sein. Márcia, seine Halbschwester, war jetzt, im Jahr 2024, 26 Jahre alt. In den nachfolgenden Briefen war davon nicht mehr die Rede. Sie enthielten nur eine kurz gefasste Gratulation zum Geburtstag, so als habe Iraçema die Hoffnung aufgegeben, ihn wiederzusehen. Es ist sehr verständlich, dachte Severin.
Denn wenn ich noch nicht einmal auf die Geburt einer Schwester reagiere, muss sie von einer völligen Gleichgültigkeit ausgehen. Aber trotzdem hat sie sich,
vielleicht mit einem letzten Funken Hoffnung, weiterhin gemeldet. Da im Februar 2024 ein Brief gekommen ist, mit ihrer Adresse wie immer, werde ich sie bei einer Reise nach Brasilien antreffen. Wie sie lebt, weiß ich nicht. Hat sie neu geheiratet? Kann sie das überhaupt? Der Vater hat nie von einer Scheidung geredet. Er hat sie einfach aus seinem Leben gelöscht, als wäre sie nie dagewesen. Dürfen sich evangelische Pastoren überhaupt scheiden lassen? Das weiß ich nicht. Wäre er bei einer Scheidung aus dem Kirchendienst entlassen worden? Hatte er sich an eine gewisse Vorbildfunktion halten müssen und war denWeg des Vergessens gegangen? Aber diese Fragen waren jetzt unwesentlich. Auch das Motiv, warum er mir die Briefe vorenthalten hat. Angst mich zu verlieren? Rache an Iraçema? Da du mich verlassen hast, wirst du deinen Sohn nie wiedersehen. Oder ist es einfach nur der Wunsch, nach einer schmerzhaften Enttäuschung nicht mehr in die Geschichte hineingezogen zu werden? Muss ich es ihm nicht hoch anrechnen, dass er die Briefe aufbewahrt hat? Er musste davon ausgehen, dass ich sie finde. Aber eben zu einem Zeitpunkt, wo er nicht mehr hineingezogen werden konnte. Und ich? Was mache ich jetzt? Erst den Nachlass ordnen. Einen Teil der persönlichen Dinge behalten, einen anderen weggeben? Um das Pfarrhaus muss ich mich nicht kümmern. Wieder Portugiesisch lernen in der Hoffnung, dass die zweite Sprache meiner Kindheit und Jugend rasch wieder auftaucht? Fliege ich nach Brasilien oder mache ich es wie der Vater? Einfach vergessen. Aber das wird nicht funktionieren. Wie soll ich das vergessen können!? Also werde ich im Oktober in Mocambo auftauchen.
Kapitel 5
Severin Buurmeester war in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen, was schon ein besonderer Umstand ist, der noch besonderer wird, wenn der Pastor Missionar war und mit einer AmazonasIndianerin verheiratet ist. Der Vater hatte den Namen ‚Severin‘ ausgesucht, des dritten Bischofs von Köln, eines Heiligen vom Anfang des fünften Jahrhunderts, also gut tausend Jahre vor der
Reformation. Welche Überlegungen Martin Buurmeester dabei hatte, wusste sein Sohn nicht. War es die Legende, dass der Heilige Severin Gesang hören konnte, wo andere nichts hörten? Oder jene Geschichte, dass die Kölner, als wegen einer großen Dürre eine Hungersnot drohte, die Gebeine Severins zu Hilfe nahmen und sofort begann es zu regnen? Die Vorfahren der Buurmeesters waren aus dem niederländischen Delft nach Deutschland gezogen. Sie waren Calvinisten, hatten also eine besondere Strenge, von der auch Martin Buurmeester noch etwas abbekommen hatte. Das betraf vor allem die Arbeitsethik. Fleiß war Lebensweisheit, Zeitvergeudung eine Sünde.Und so achtete Buurmeester sehr darauf, dass Severin stetig lernen und sich bilden musste. Er bekam private Bibelstunden, in denen ihm einzelne Kapitel vorgelesen wurden. Am lebhaftesten war ihm ‚Daniel in der Löwengrube‘ in der Erinnerung. Er hatte kindlich gestaunt, dass ein Engel gekommen war, um den Löwen das Maul zuzubinden. Später waren die Zweifel gekommen. War die Bibel ein Märchenbuch? Der Vater suchte auch
Lektüren aus, die der Sohn jedoch konterkarierte, indem er lieber Nabokovs
‚Lolita‘ las als irgendwelche frommen Geschichten. Und Henry Millers ‚Stille Tage in Clichy‘ schien ihm ebenfalls spannender als etwa Le Forts ‚Schweißtuch der Veronika‘. Wobei Severin nichts gegen die vom Vater vorgelegte Lektüre hatte. Er las auch das. Aber das andere eben lieber. Weil es sinnlicher, erotischer war. Mag sein, dass hier das indianische Blut der Mutter zum Vorschein kam. Denn immerhin konnte man Severin, auch wenn er Deutscher war, als ‚Caboclo‘ bezeichnen. Caboclo war im Brasilianischen eine Bezeichnung für die Kinder, die aus der Verbindung europäischer Eingewanderter mit Indigenenhervorgingen.Martin Buurmeester hielt nichts von Zerstreung. Und wenn sein Sohn lieber Fußball spielte, als sich zu einem hohen Bildungsniveau zu hangeln, so dachte er: „Der Junge soll lieber Goethes ‚Faust‘ lesen. Obgleich das wegen der Verführung Gretchens nicht unbedenklich ist.“ Spielte Severin auf dem Klavier einen flotten Walzer oder gar einen Reggae oder Bolero, so legte der Vater die Stirn in Falten, sagte aber nichts dazu.
Wobei er aber zu denken schien: „Kein Wunder bei der Mutter!“
So könnte man also davon ausgehen, ohne sogleich von Bipolarität zu sprechen, dass zwei Naturen in Severin wohnten. Auf der einen Seite die Disziplin des Vaters, auf der anderen die Sinnenfreude der Mutter. Was natürlich zu Konflikten führt. Nach dem Abitur besuchte Severin ein Konservatorium, übte sich im Klavierspielen, schaffte es jedoch nicht, ein Virtuose zu werden. Da der Mensch Geld und irgendeinen Job braucht, wurde er schließlich Musiklehrer an einem Gymnasium. Hier jedoch empfand er die Atmosphäre als zunehmend schlimmer werdend. Die Konferenzen wurden wegen irgendwelcher Nichtigkeiten zahlreicher, die Richtlinien enger und verrückter, die Schüler aufsässiger und uninteressierter. Stimmte er auf dem Klavier ‚Alle Vöglein sind schon da‘ an, sang keiner mehr mit. Sie fummelten unter der Bank lieber mit dem Smartphone rum. Schließlich kam es so weit, dass Severin in den Pausen im Musiksaal blieb, statt sich ins Lehrerzimmer zu begeben, wo man auch das ehedem so gemütliche Raucherzimmer abgeschafft hatte. Bei offenem Fenster stand er im Musiksaal, rauchte und trank Melissengeist. Als dann Corona kam, musste er die Klaviertasten desinfizieren. So ging es gewaltig bergab. Er hielt die Welt nur noch mit Wodka und Melissengeist aus. Als er einmal den Vater besuchte, der schon uralt war, aber noch gut sehen konnte, bemerkte Martin Buurmeester: „Warum verschüttest du den Kaffee? Du zitterst. Hast du in deinem Alter etwa schon Parkinson?“ Und dann gab der Pastor im Ruhestand selbst die Antwort: „Du hast eine Fahne, dass man allein davon schon besoffen werden kann. Mein Sohn ein Säufer? Das habe ich nicht verdient.“