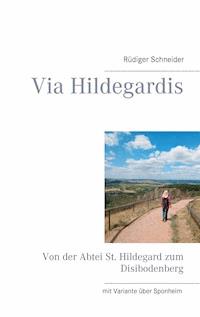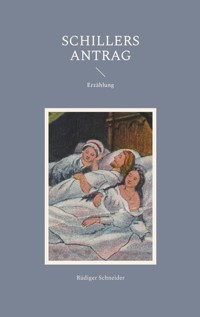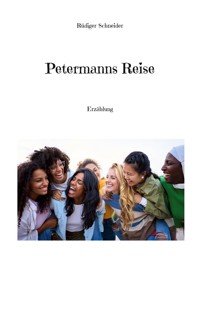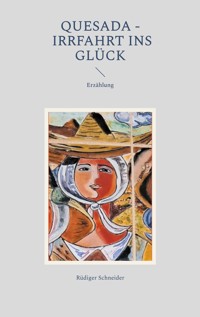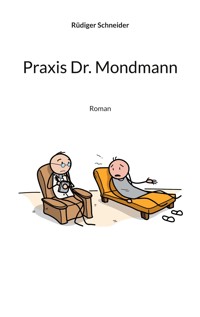Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Enttäuscht und gelangweilt von seiner Ehe fliegt der emeritierte Literaturprofessor Leonhard Wallberg nach Cartagena, Kolumbien, um nach seiner ehemaligen Studentin Myriam zu suchen. Er hat nichts. Keine Adresse, keine Telefonnummer, keine Email. Er sucht vergeblich, bis nach einem Traum und dem Besuch bei einem Schamanen die Geschichte am Rio Magdalena eine überraschende Wendung nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen und Handlung sind frei erfunden, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Namen rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
1
Leonhard Wallberg saß auf der Terrasse seines Einfamilienhauses. Der Wärmestrahler war eingeschaltet. Mit leisem Zischen verglühte das Gas in der Dunkelheit. Auf dem kleinen Gartentisch vor ihm stand eine fast leere Flasche Gin. Der Aschenbecher war randvoll mit Kippen. Wallberg sah auf die Uhr. Halb Neun. Gerda würde wie so oft in letzter Zeit spät kommen. Sie hatte ihm etwas erzählt von einer besonders wichtigen Sitzung des Vereins für emanzipatorische Sprachentwicklung. Dass die Frau Oberstudienrätin sich diesem Unsinn hingab, hatte bei ihm immer wieder das bekannte Vogelzeichen, das Tippen mit dem Zeigefinger an die Stirn, hervorgerufen. Der ehelichen Harmonie hatte es nicht besonders gutgetan. Wie auch einige andere Dinge.
Wallberg sah auf die fast leere Flasche. Die fünfte in drei Tagen. Nun ja, es gab eben keine nüchternen Schriftsteller. Schriftsteller war er zwar nicht, aber er gehörte auf der interpretierenden Seite dazu, war vor zwei Jahren als Professor für Germanistik emeritiert. An der Bonner Friedrich-Wilhelm-Universität hatte es eine kleine Abschiedsfeier gegeben. Dann war das Kapitel Berufsleben beendet. Seitdem langweilte er sich nur noch. Sogar die Leselust war ihm vergangen. Wie rasch man doch auf einmal 68 Jahre alt war! Die Tage fielen wie Blätter von einem herbstlichen Baum. Gerda hatte immerhin noch fünf Dienstjahre vor sich, bis es am Bonner Beethoven-Gymnasium auch für sie eine Abschiedsfeier geben würde. Gäbe es dann das übliche Rentner-Programm? Mallorca oder Radtouren den Rhein entlang. Oder Städtebesichtigungen. Er fürchtete sich vor dieser Öde.
Um Neun kam sie, betrat die Terrasse. „Guten Abend, Frau Wallberg-Richter!“ begrüßte er sie mit einem etwas spöttischen Unterton.
„Du kannst mir gratulieren“, sagte sie. „Der Verein hat mich zur Vorsitzenden gewählt.“
„Gratulieren? Kann man das? Du solltest lieber mehr ficken, statt dich diesem Schwachsinn hinzugeben.“
„Du bist vulgär geworden seit deiner Emeritierung“, bemerkte sie.
„Vulgär? Eher anschaulich. Ihr versaut und verhunzt einem ja die deutsche Sprache. Warum soll ich zum Beispiel nicht mehr ‚Weib‘ sagen dürfen? Es ist ein Elementarbegriff wie Sonne, Mond, Sterne, Wind, Meer, Natur überhaupt. Aber ihr sterilisiert alles, trocknet es aus, macht es blutleer, lasst es verschwinden.“
„Leo, das hatten wir doch schon“, sagte sie mit einem Blick zum Himmel und verdrehte die Augen. Der Begriff ‚Weib‘ wird oft herabsetzend eingesetzt. Deshalb hat er in der Sprache nichts mehr zu suchen.“
„Bei deinem Verein vielleicht. Bei mir nicht. Wenn ich zum Beispiel sage: Mein Weib spritzt vor Lust an die Tapete. Ist das herabsetzend? Passt da dieser kraftvolle Ausdruck nicht viel besser als das nüchterne ‚Frau‘?“
„Leo, du bist mal wieder betrunken. Was ist aus dir in den letzten beiden Jahren geworden? Hast du in deinen Vorlesungen oder Seminaren jemals so etwas gesagt, diese vulgären Ausdrücke benutzt? Aber bitte, wenn du dich ruinieren willst! Das ist die fünfte Flasche in drei Tagen. Und bei den Zigaretten zündest du eine an der anderen an.“
„Du hast also mitgezählt. Dann zähl auch weiter. Ich hole mir jetzt die sechste.“
Wallberg stand auf, schwankte, versuchte am Rand des Gartentisches Halt zu finden, fegte dabei Flasche und Glas auf den Fliesenboden und mit dem kippenden Tisch knallte er mit dem Gesicht in die Scherben. Das letzte, was er noch mitbekam, war die sich rasch ausbreitende Lache von Blut. Dann verlor er das Bewusstsein.
2
Auf dem OP-Tisch wurde Wallberg wieder wach, öffnete die Augen, bemerkte links und rechts neben sich zwei grün bekittelte Personen mit einer Maske vor dem Gesicht. Er spürte den feinen Einstich einer Injektionsnadel.
„Den Kopf nicht bewegen!“ sagte der Arzt zur rechten Seite. „Sie erinnern sich?“
Die Bilder tauchten bei Wallberg auf. Der Sturz, der Knall mit dem Kopf auf den Boden, die sich rasch ausbreitende Lache von Blut. Danach musste Gerda die Ambulanz gerufen haben, und jetzt lag er hier und man flickte ihm das Gesicht wieder zusammen.
„Ja“, antwortete er.
„Sie haben verdammt viel Glück gehabt“, sagte der Arzt. „Eine Scherbe ist nur ein paar Millimeter neben ihrem rechten Auge eingedrungen. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir noch ein CT machen, ob es innere Gehirnblutungen gibt. Ich frage Sie jetzt nach ein paar Informationen zur Überprüfung Ihres Zustandes. Sie heißen…?“
„Leo Wallberg.“
„Sie sind wie alt?“
„68“.
„Ihr Beruf?“
„Professor, Literaturwissenschaften.“
„Gut. Ein CT muss trotzdem sein. Wir werden die Wunden jetzt weiter vernähen. Sie bekommen auch noch einige Injektionen zur Betäubung.“
Wallberg ließ es still über sich ergehen. Das Eindringen der Nadel in die Haut, den Zug der Fäden, das Bedecken mit Mullbinden. Nach einer Stunde war alles erledigt. Er wollte sich vom OP-Tisch schwingen, aber der Arzt drückte ihn zurück.
„Sie können jetzt nicht gehen. Wir fahren Sie mit dem Rollstuhl zum CT.“
Es gab keine Schädigung des Gehirns. „Aber Sie müssen noch mit einem nachträglichen Trauma rechnen“, sagte der Arzt. „Sie sind mit ziemlicher Wucht auf den Boden geknallt.“
Gerda hatte gewartet, nahm den Arztbericht entgegen und die Anweisungen für die nächsten Tage. „Wechseln der Mullbinden nach drei Tagen, nach sieben Tagen kommen Sie mit Ihrem Mann wieder. Dann werden die Fäden gezogen. Ich gebe Ihnen auch noch ein Schmerzmittel mit. Die Betäubung wird nach etwa einer Stunde nachlassen. Er wird dieses Mittel brauchen.“
Sie bestellte ein Taxi. Vom Rollstuhl aus schob er sich auf den Rücksitz. Gerda schwieg. Er hörte weder Ermunterung noch Vorwurf. Mit unsicheren Beinen kletterte er aus dem Wagen, ging von ihr gestützt ins Haus, ins Bett, versank nicht nur von den Injektionen, sondern auch noch vom Gin betäubt in einen tiefen Schlaf.
Als er am Morgen aufwachte und aufstand, zitterten seine Beine, sein Gang war unsicher. Sich an der Wand abstützend schob er sich ins Bad, sah in den Spiegel und erschrak. Das Gesicht war blutverkrustet und mit Mull zugepflastert.
3
An einem Freitag, dem 13. Januar war er gestürzt. Am Samstag musste Gerda nicht in die Schule, sagte: „Komm runter in die Küche zu einer Tasse Kaffee.“
Er schüttelte den Kopf. „Geht nicht. Ich schaffe die Treppe nicht. Und bring mir bitte keinen Kaffee, sondern den Wodka. Da steht noch eine Flasche in der Bar. Vom Gin lass ich die Finger weg. Kann sein, dass ich die Wacholderbeeren, aus denen der hergestellt wird, nicht vertrage.“
„Ich bringe dir keinen Wodka. Hör mit dem Saufen auf.“
„Bitte! Ich muss den Alkohol ausschleichen. Der abrupte Entzug ist nicht möglich. Du kennst das Spiel. Die Wodkaflasche wird zwei Tage halten. Und bring auch die Cola zum Verdünnen mit!“
„Wie du meinst. Du musst wissen, wie du dich ruinierst. Du kannst ab jetzt auch hier rauchen. Ich werde unten in meinem Arbeitszimmer schlafen.“
In einer Ecke des Schlafzimmers war ein großer, bequemer Ohrensessel mit einem Beistelltisch. Wallberg ließ sich in den Sessel fallen, wartete, rief nach unten in die Küche: „Bring bitte auch einen Aschenbecher mit! Und die Zigaretten und ein Feuerzeug.“