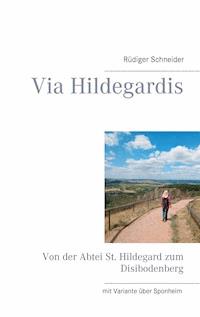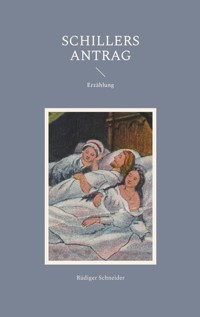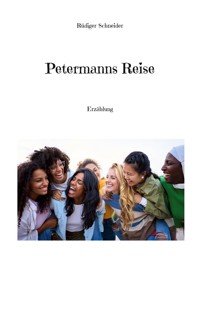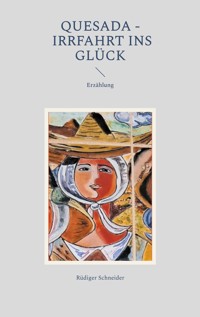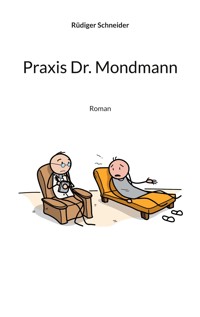Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mord oder ein seltsamer Unfall? Der Tod des Literaturagenten Arnold Achenbach, der den Rheinwasserfall bei Schaffhausen herunterstürzt, gibt Rätsel auf. Hat die Bestsellerautorin und Literaturpreisträgerin Martha Engelreich, die bei ihm unter Vertrag steht, damit zu tun? Welche Rolle spielt Alice Waigel, die attraktive Chefin des Penthesilea-Verlags, an den Achenbach Engelreichs Buch vermittelt hat? Vor der imposanten Kulisse des Bodensees gehen Kommissar Konrad Brandt und seine Kollegin Katharina Luca einem spektakulären Fall nach, in dessen Verlauf Brandt selbst in höchste Gefahr gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Personen und Handlung sind frei erfunden, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Namen rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
1
Der Tote, der die Kaskaden des Wasserfalls bei Schaffhausen hinunterstürzte, wurde dort, wo der Rhein mit etwas ruhigerem Gewässer an Laufen vorbeiströmt, von der Schweizer Polizei herausgefischt. Die Obduktion ergab, dass er etwa drei Tage im Wasser verbracht haben musste. Ungewiss war, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder einen Mord handelte. Zu zahlreich waren die Kopfverletzungen und ob die eine, besondere, von einer scharfen Felskante stammte oder mit stumpfer Gewalt herbeigeführt worden war, ließ sich nicht mehr feststellen. Dass er Wasser in der Lunge hatte, wies auf Ertrinken hin. Aber damit war noch lange nicht klar, ob er zuerst einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte oder unglücklich in den Rhein gestürzt war.
Seltsam war die Verweilzeit im Wasser. Drei Tage. Das war, bei starker Strömung, ungewöhnlich lange für die kurze Strecke vom Stauwehr in Schaffhausen bis zum Rheinfall. Vor dem Stauwehr des Wasserkraftwerks konnte die Tat oder das Unglück nach Überlegungen der Kantonspolizei nicht geschehen sein. Wäre er vom Bodensee her auf den Rheinfall zugetrieben, hätten ihn die Auffangrechen des Wehrs abgefangen. So begnügte man sich mit der These, dass er sich in einer Biegung des Stroms eine Zeitlang verfangen hätte und erst dann weitergetrieben sei.
Nichts hatte der Tote dabei. Keine Papiere, keine Brieftasche, kein Portemonnaie, keine Schlüssel, kein Handy oder Smartphone. Auffällig war nur der beige Sommeranzug und die teuren Markenschuhe aus Leder. Erst als man die Vermisstenanzeigen der näheren und weiteren Umgebung durchging, stieß man auf eine Spur. Die Vermieterin einer Ferienwohnung in Radolfzell am Bodensee hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Mann, der die Wohnung gemietet und noch nicht bezahlt hatte, war an einem Freitag angekommen, hatte übernachtet, die Wohnung am Samstagnachmittag verlassen und war nicht wiedergekommen.
Das Alter stimmte überein. Ebenso die Beschreibung der Kleidung. Jetzt ließen sich aufgrund des Meldezettels, den der Gast ausgefüllt hatte, die Personalien feststellen. Ein Arnold Achenbach aus Bonn. 55 Jahre, unverheiratet, ohne Familie, keine Geschwister, keine Eltern mehr. So viel hatte man herausbekommen und das schien genug.
Für die Schweizer war damit der Fall erledigt. Sie gaben ihn weiter an die deutschen Kollegen in Konstanz. Die wiederum leiteten ihn weiter an das Bonner KK 11, das für Todesermittlungen zuständig war. Die Bonner waren nach ihrer Auffassung eher dazu berufen, im Umfeld des Toten zu recherchieren und herauszufinden, warum Achenbach nach Radolfzell gekommen war und was er dort unternommen hatte.
2
„Erst hast du kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu.“ An diesen Spruch musste Hauptkommissar Konrad Brandt denken, als er am Montagmorgen die Sportseite im Bonner General-Anzeiger las. Er hatte am Samstag das Endspiel der Champions League im Fernsehen verfolgt, Liverpool die Daumen gedrückt, aber am Ende hatte wieder mal Real Madrid gewonnen. Der unglücklichste Mensch des Abends war der Torwart von Liverpool gewesen. Zwei fatale Fehler waren ihm unterlaufen und damit das Spiel für seine Mannschaft verloren. Nach dem Abpfiff hatte er minutenlang den Kopf in den Rasen des Stadions gedrückt, lag dann auf dem Rücken und war untröstlich.
Wie beim Fußball so konnte es auch im Leben laufen. Manchmal hatte man nicht nur kein Glück, sondern eine fatale Verkettung widriger Umstände gegen sich. Was war nur mit diesem Arnold Achenbach passiert? Brandt hatte die Akte der Konstanzer vor sich liegen, auch den Obduktionsbericht der Schweizer. Wie konnte man nur so viel Pech haben? In eleganter Kleidung in den Rhein stürzen und dann den größten Wasserfall Europas hinuntersausen? Betrunken jedenfalls, wie die Gamma-Werte der Leber ergaben, war er nicht gewesen. Ein Suizid war möglich. Aber wer wählte schon eine so qualvolle Methode? Die Eidgenossen allerdings neigten in ihren Überlegungen dazu. Die Konstanzer schlossen sich an und waren froh, den Fall nach Bonn abgegeben zu haben.
Eine gewisse Logik hatte das. Denn zunächst war das Umfeld, waren die Lebensumstände Achenbachs zu untersuchen. Die ergaben sich am besten vor Ort. Da, wo er gewohnt, gelebt hatte. Vielleicht ließ sich ein Motiv für einen Mord finden. Welche Verbindungen hatte der Tote nach Radolfzell und in die Schweiz gehabt? Brandt ärgerte sich über den lakonischen Rapport der Konstanzer. Die hatten Achenbachs Vermieterin in Radolfzell nur kurz befragt. Herumgekommen war dabei nichts. Die Wirtin, eine Frau Wöhler, hatte nur angegeben, dass ihr Gast am Samstagmittag ausgegangen sei. Er habe einen Bankautomaten aufsuchen wollen, um zu bezahlen. Aber dann sei er nicht wiedergekommen. Er habe sich unauffällig verhalten. Besuch hatte er auch nicht gehabt. Das wäre ihr nicht entgangen. Zurückgelassen habe er nur eine Tasche mit ein paar Textilien. Kein Notebook, kein Smartphone, keine Notizen, noch nicht einmal ein Buch. Er war mit dem Zug von Bonn nach Radolfzell gekommen. Aber wo war das Ticket für die Rückfahrt? Wollte er überhaupt zurückfahren? Konnte es sein, als er im Wasser trieb, dass all die Dinge, die man normalerweise bei sich trug, aus den Taschen des Jacketts und der Hose herausgefallen waren? Schlüssel, Papiere, Bankkarten, Handy oder Smartphone, Portemonnaie. Blank und leer waren die Taschen gewesen, so als habe sie jemand mit Absicht ausgeräumt. Damit man den Toten nicht identifizieren konnte.
Viele, sehr viele Fragen waren zu lösen und zunächst einmal musste er Achenbachs Wohnung aufsuchen und sich dort umsehen. Dann kamen die Routinearbeiten. Kontobewegungen erfragen, mit Hausbewohnern sprechen. Verheiratet war Achenbach nicht, aber vielleicht hatte er eine Freundin und Freunde, die Näheres wussten. Was machte er beruflich? Wieviel Geld verdiente er? Polizeilich war er noch nie aufgefallen, nicht vorbestraft. Das hatte eine erste Überprüfung ergeben. Achenbach hatte in einem Vorort Bonns gewohnt, in Endenich, in der Straße ‚Am Eichenkamp‘.
Brandt faltete die Zeitung zusammen, trank den letzten Schluck aus der Kaffeetasse, wollte gerade aufstehen, um nach Endenich zu fahren, als das Telefon klingelte. Der Polizeipräsident war am Apparat. „Conny“, sagte er, „bevor du in den letzten Monaten deines Dienstes mal wieder auf eigene Faust etwas unternimmst, komme doch bitte ein paar Minuten zu mir. Es geht nicht nur um den neuen Fall. Wir müssen auch über unser Turnier in reden.“
3
Mit dem Polizeipräsidenten oder auch PP, wie er abgekürzt intern genannt wurde, war Brandt per ‚Du‘. Zum förmlichen ‚Sie‘ gingen sie nur über bei dienstlichen Gesprächen unter mehr als vier Augen. Sie spielten zusammen Tennis, Doppel, und nahmen seit einigen Jahren an einem internationalen Seniorenturnier in Bad Breisig teil. Sie flogen zwar jedes Mal schon in der ersten Runde raus, hatten aber ihren Spaß an dem Spiel und besonderen Spaß an der ‚Blauen Runde‘, wo es für die Teilnehmer die besten Weine umsonst gab. Peter Kessenich, der Polizeipräsident, hatte dieses Jahr aber ein Problem, ein Handicap. Er war 61 Jahre alt, hatte vor drei Monaten eine neue Hüfte bekommen, seine Beweglichkeit war noch begrenzt. Und so empfing er Brandt in seinem Büro nicht wie sonst, indem er vom Schreibtisch aufstand. Er blieb sitzen, zeigte nur auf den Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand.
„Zunächst das Private, Conny“, eröffnete er das Gespräch. „Ich habe mich entschlossen, trotz der Hüfte wieder Tennis zu spielen und möchte im August auch wieder mit dir beim Seniorenturnier antreten. Was hältst du davon?“
„Nicht viel“, antwortete Brandt. „Wir blamieren uns. Du kannst dich nicht richtig bewegen. Wie soll das gehen?“
„Bis zum August ist noch Zeit. Tennis spielen ist die beste Reha. Mehr als wieder in der ersten Runde rauszufliegen kann uns nicht passieren. Wir müssen allerdings die Taktik ändern. Du darfst nicht mehr am Netz stehen. Wenn sie dich mit einem hohen Ball überspielen, komme ich hinten nicht mehr dran.“
„Dein Optimismus in Ehren. Meinetwegen. An mir soll es nicht liegen. Melde uns an.“
„Gut!“
Kessenich erhob sich umständlich, wobei er sich mit der rechten Hand am Schreibtisch abstützte. Er schlurfte langsam zur Kaffeemaschine, sah auf die Uhr, drehte sich um und bemerkte: „Es ist zwar erst halb elf und wir hatten den Grundsatz ‚nie vor elf!‘, aber irgendwo auf der Welt ist es immer elf Uhr. Möchtest du zum Kaffee auch einen Whisky? Ich habe einen schottischen Glenfiddich, fünfzehn Jahre alt, sehr mild, Honigaroma.“
Brandt nickte. „Meinetwegen. Wenn du mit der Hüfte Tennis spielen willst, kann ich auch im Dienst einen Whisky trinken.“
Kessenich warf die Kaffeemaschine an, kehrte zum Schreibtisch zurück, setzte sich, öffnete einen Unterschrank, kam mit zwei Gläsern zum Vorschein und einer Flasche Whisky. Er füllte die Gläser großzügig, schob Brandt ein Glas zu. „Also, trinken wir auf das Turnier.“
„Sollten wir auch auf dem Platz machen“, bemerkte der Kommissar lakonisch. „Was gibt es denn noch außer dieser Nachricht?“
„Ja, zu dem neuen Fall. Erst die gute Nachricht. Die Presse weiß nichts davon. Achenbach ist ein unbekanntes, unbeschriebenes Blatt. Niemand scheint ihn hier zu vermissen. Es gibt also keine Pressekonferenzen. Damit fehlt dieser Druck. Auch unser Staatsanwalt lässt dich in Ruhe. “
„Und die schlechte Nachricht?“
„Ist eigentlich keine. Ich möchte dir nur noch einmal mit Nachdruck ans Herz legen, keine Alleingänge zu machen. Bitte keine Vorprüfung mehr, wenn du einen Verdacht hast, den du erst einmal für dich allein abklopfen willst. Es ist keine Schande, Kollegen von Anfang an ins Vertrauen zu ziehen. Auch wenn sich hinterher dieser Verdacht als falsch erweist. Bitte keinen unangebrachten Stolz. Wahrscheinlich wirst du zuerst Achenbachs Wohnung aufsuchen. Denke bitte daran, dass sich auch andere dafür interessieren könnten und nicht erfreut sind, wenn du ihnen in die Quere kommst. Geh nicht allein dorthin. Wahrscheinlich wirst du auch eine Dienstreise an den Bodensee unternehmen. Mit wem? Bitte nicht mit Katharina Luca. Ich brauche sie hier als Profilerin.“
Brandt legte die Stirn in Falten, schwenkte den Rest Whisky im Glas.
„Warum nicht? Wozu brauchst du sie denn aktuell?“
„Aktuell nicht. Es könnte aber sein. Dir nützt sie als Fallanalytikerin gar nichts. Wir wissen nichts über den Toten und über den Täter oder die Täterin noch weniger. Auch ist noch nicht geklärt, ob es sich überhaupt um einen Mord handelt. Ich weiß zwar, dass ihr euch gut versteht. Aber eine gemeinsame Reise an den Bodensee mit einer attraktiven Kollegin ist nicht unkompliziert.“
„Da ist nichts. Sie ist 38, ich 65. Sie könnte meine Tochter sein. Außerdem ist sie in festen Händen.“
„War sie, mein Lieber. Sie ist vor zwei Wochen bei ihrem Freund ausgezogen, hat eine neue Adresse. Dir hat sie wohl noch nichts davon erzählt.“
„Nein, wusste ich nicht. Aber bitte, wir arbeiten gut zusammen, gehen auch mal privat ein Bier trinken. Mehr ist nicht, mehr wird nicht. Mit ihr kann ich den Fall rascher lösen. Dann haben wir auch Zeit für ein paar Trainingseinheiten, die du unbedingt vor dem Turnier brauchst.“
„Erpressung?“ Kessenich nahm einen weiteren Schluck, blickte in das jetzt leere Glas, dann auf die Flasche, überlegte anscheinend, ob er sich noch etwas nachfüllen sollte, ließ es aber.
„Meinetwegen“, sagte er schließlich. „Aber ich habe keine Lust auf interne Affären. Du erinnerst dich ja sicher noch an deine Geschichte mit der Praktikantin.“
„Schnee von gestern“, wandte Brandt achselzuckend ein. „Zwanzig Jahre her. Sie wollte es so. Ich habe mich nur nicht dagegen gewehrt.“
„Dann wehre dich bitte diesmal.“
„Nicht notwendig. Katharina ist emanzipierte Frau, die sich nicht auf einen Mann einlässt, der in drei Monaten auf dem Rentnerbänkchen sitzt, sich langweilt und nach einer Pflegeschwester Ausschau hält.“
„Du übertreibst. Du bist immer noch der ewige Junggeselle, der auch noch mit achtzig den Röcken hinterherschaut. Du weißt ja, das Auge bleibt jung. Hättest du jetzt wenigstens eine Freundin, wäre mir wohler. Aber bitte. Die letzten drei Monate mit dir überstehe ich auch noch.“
4
Viel lieber als mit dem hüftsteifen Präsidenten wäre Brandt mit seiner Kollegin bei dem Turnier angetreten. Aber Katharina Luca war erst 38. Für das Turnier musste man mindestens vierzig sein.
Die Kommissarin war vor zwei Jahren vom LKA Düsseldorf nach Bonn gekommen. Umzug und Versetzung der Liebe wegen. Eine schlanke, hochgewachsene, sportliche Frau, mit hellblondem Haar, das in wellenförmigen Kaskaden bis auf die Schultern fiel. Die Augen waren rehbraun. Beim Lächeln zeigten sich zwei lustige Grübchen auf den Wangen.
Ihre Eltern waren vor über vierzig Jahren aus Italien gekommen, hatten im Ruhrgebiet Arbeit gesucht, waren geblieben. Katharina war Deutsche, verleugnete aber ihre italienische Herkunft nicht. Sie sprach Deutsch und Italienisch. Es konnte passieren, dass sie auf Italienisch fluchte. Passte ihr zum Beispiel ein Ort nicht oder sie fühlte sich unbehaglich, kam „A casa del diavolo!“, was bedeuten konnte: Ich bin hier am Arsch der Welt oder in der Hütte des Teufels.
Vom Aussehen her erinnerte sie den Kommissar sehr an die junge Kate Winslet, von deren Filmen er keinen ausgelassen hatte. Den ‚Vorleser‘ hatte er sich sogar dreimal angeschaut. Nicht aus literarischem Interesse, sondern nur wegen der sympathischen Britin, die ihn wegen ihrer Natürlichkeit ansprach. Seit seiner Affäre mit der Praktikantin achtete der Kommissar streng auf die Trennung von Beruflichem und Privatem, wagte es nicht, sich irgendwelchen Träumen hinzugeben. Katharina selbst schien ihn mehr als väterliche Figur zu schätzen. Auf jeden Fall war die Zusammenarbeit angenehm und vor allem auch erfolgreich. Eine Reise mit ihr an den Bodensee? Na und? Was sollte schon passieren, außer dass man sich weiterhin kollegial schätzte? Zudem war es mit der Dienstreise noch lange nicht so weit. Zunächst war im Umfeld des Toten zu recherchieren. Vielleicht fand sich in seiner Wohnung ein Hinweis, dass er tatsächlich durch Suizid gefährdet war. Vielleicht war er in psychiatrischer Behandlung gewesen und die Schweizer hatten Recht mit ihrer Vermutung.
Acht Tage war es jetzt her, dass Achenbach den Rheinfall hinunter gesaust war. Die Spurensicherung mit in die Wohnung zu nehmen, schien überflüssig. Die Wohnung war nicht der Tat- oder Unglücksort. Außer seiner Kollegin würde jemand vom technischen Dienst mitkommen, um Zugang zur Wohnung zu bekommen. Vielleicht wohnte auch jemand im Haus, der den Schlüssel hatte. Brandt hatte sich vorab informiert. Drei Parteien wohnten dort. Im Grundbuch war Achenbach als Eigentümer eingetragen. Katharina und er würden sich erst einmal umsehen. Der Tote musste ein Profil bekommen. Eines aber hatte Brandt schon herausgefunden. Bei Google hatte er den Namen in der Suchleiste eingegeben und war auf die Website ‚Literarische Agentur Achenbach‘ gestoßen. Die Adresse im Impressum stimmte mit der Angabe des Einwohnermeldeamtes überein. Der Tote hatte nun für ihn auch ein Gesicht bekommen. Man sah auf der Startseite ein Foto. Mit Anzug und Krawatte stand Achenbach vor einem Bücherregal, wirkte kompetent, ernst und seriös. Wie jemand, der Manuskripte an wichtige Verlage vermitteln kann. Ein Honorar im Voraus wurde nicht verlangt. Nur im Fall einer erfolgreichen Vermittlung. Hier unterschied sich Achenbach von anderen Agenturen, die für die nur versuchte Vermittlung eines Manuskripts eine kräftige Gebühr vorab verlangten. „Erfolg spricht für sich!“ Mit diesem Spruch warb er und kassierte dann 20% des Autorenhonorars.
„Ist in Ordnung so“, meinte Katharina Luca, als sie zusammen mit Brandt die Website studierte. „Was mir aber auffällt: Hat er Mitarbeiter? Lektoren, Lektorinnen. Oder macht er alles allein? Davon steht hier nichts. Es gibt keine Seite ‚Unser Team‘. Wir haben es offensichtlich mit einem Alleingänger zu tun. Er wirbt auch nicht mit Autoren und Autorinnen, die er bereits erfolgreich vermittelt hat. Ungewöhnlich. Dass er sich Zeit lässt für eine Überprüfung, ist hingegen wieder normal. Er muss auch nicht auf unverlangt eingesandte Manuskripte antworten. Hier steht es ja: ‚Hören Sie innerhalb von sechs Monaten nichts von uns, dann gehen Sie bitte davon aus, dass wir kein Interesse haben.‘ Das ist die übliche Floskel von Verlagen und solchen Agenturen.“
„Woher weißt du das?“ wollte Brandt wissen.
Katharina hob die Schulter, lächelte. „Na ja, hab‘s mal in ganz jungen Jahren mit einem Gedichtband versucht. Verlief alles im Sand. Stereotype Absagen oder auch keine Antwort.“
„Eine Kommissarin, die Gedichte schreibt?“
„Schrieb. Eine romantische Jugendsünde.“
„Was hältst du von dem Foto? Wie wirkt Achenbach auf dich?“
„Seriös. Mit Anzug und Krawatte. Aber das heißt nichts. Das ist ein Foto, wie man es für so ein Geschäft braucht. Er kann auch noch ganz andere Seiten haben. Attraktiv ist er. Kann mir vorstellen, dass er bei den Damen Eindruck macht. Groß, schlank, wirkt sportlich. Die schwarzen Haare glatt und wohlfrisiert nach hinten gekämmt. Die Brille ist ihm etwas auf die Nase gerutscht. Das gibt einen belesenen, intellektuellen Anstrich. Man traut ihm zu, dass er Manuskripte beurteilen und vermitteln kann. Aber wir werden sehen. Wenn wir seine Wohnung durchsucht haben, wissen wir hoffentlich mehr. Mit welchem Wagen fahren wir?“
„Mit meinem“, antwortete Brandt. „Der ist mir für kurze Fahrten lieber als das Dienstauto.“
„Meinetwegen“, meinte Katharina. „Fahren wir antik.“ Mit einem leicht spöttischen Lächeln fügte sie hinzu: „Man könnte auch sagen ‚Die Post kommt‘.“
5
Den Kollegen vom technischen Dienst konnten sie rasch entlassen. Achenbachs Agentur lag Parterre. Auf einem Messingschild neben der Klingel stand ‚Literarische Agentur Achenbach‘. Über ihm im ersten Stock des Hauses wohnte ein Rentner, der ihnen öffnete und auch den Schlüssel zur Wohnung hatte.
„Ich kümmere mich um den Garten“, sagte er. „Wenn Herr Achenbach verreist ist, gehe ich einmal jeden Tag in die Wohnung, um die Pflanzen zu gießen und seine Fische zu füttern. Ich lege ihm auch die Post auf den Schreibtisch. Ich bin hier so eine Art Hausmeister. Dafür hat mir Herr Achenbach die Hälfte der Miete erlassen.“
Brandt hatte ihm den richterlichen Durchsuchungsbeschluss gezeigt und verwundert gefragt: „Herr Wagner, Sie wissen gar nicht, was passiert ist?“
„Nein. Warum wollen Sie denn in seine Wohnung?“
„Herr Achenbach wurde tot aufgefunden. Wir wissen noch nicht, ob es ein Unglücksfall war oder ob etwas anderes dahintersteckt. Hat er Ihnen gesagt, wie lange er wegbleiben und wohin er fahren wollte?“
„Wie lange? Er hat von ein paar Tagen gesprochen. Vielleicht würden es aber auch zwei Wochen. Wohin weiß ich nicht genau. Er hat nur gesagt ‚an den Bodensee‘.“
„Hat er Ihnen den Grund seiner Reise genannt?“
„Nein. Das hat er nicht.“
„Wie lange wohnen Sie schon hier?“
„Seit sieben Jahren.“
„Da hatte er schon die Agentur?“
„Nein. Das Schild hat er erst vor zwei Jahren angebracht. Davor hat er als Studienrat an einem Bonner Gymnasium gearbeitet. Aber dann ist er vorzeitig pensioniert worden. Warum, weiß ich nicht. Ich nehme an, aus gesundheitlichen Gründen. Er hat darüber nicht gesprochen.“
„Aus gesundheitlichen Gründen? Warum nehmen Sie das an?“
„Weil er zu dieser Zeit mit einer Krücke herumlief.“
„Er hatte auch psychische Probleme?“
„Damals? Das weiß ich nicht. Unser Kontakt beschränkte sich auf ein paar Gespräche über die Gartenarbeit. Eine Tasse Kaffee haben wir nie zusammen getrunken.“
„Sie sagten ‚damals‘. Sie meinen, als er vorzeitig pensioniert wurde?“
„Ja. Vor zwei Jahren.“
„Und jetzt?“
„Nein. Mir ist nichts aufgefallen. Die Krücke braucht er nicht mehr. Er hatte über die Bandscheibe geklagt.“
„Hatte Herr Achenbach oft Besuch? Eine Freundin zum Beispiel.“
„Na ja, weiß nicht so genau.“ Wagner sah den Kommissar verlegen an. Die Frage schien ihm unangenehm zu sein.
„Herr Wagner, Sie können uns ruhig alles erzählen. Herr Achenbach erfährt nichts davon.“
„Nun ja, da kamen immer zwei Frauen. Die eine mittwochs, die andere am Samstag.“
Der Rentner runzelte die Stirn, strich sich mit der Hand über das Kinn, schwieg, als hätte er jetzt genug gesagt.
„Herr Wagner, noch einmal“, ermunterte ihn der Kommissar. „Sie können alles, was Sie wissen, was Sie bemerkt haben, ohne Rücksicht erzählen. Ihnen entstehen keine Probleme daraus. Sie werden doch hier im Haus einiges mitbekommen haben. Es wird Sie doch interessiert haben. Sie haben Zeit, können viel beobachten. Was war mit den zwei Frauen? Wie alt etwa? Wie sahen sie aus? Wie lange sind sie geblieben? Eine Stunde, zwei, über Nacht vielleicht? Wie sind Sie gekommen? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit einem Auto? Mit welchem? Lassen Sie mich doch nicht umständlich nach jeder Einzelheit fragen!“
Der Kommissar holte tief Luft, sah den Rentner an, als müsse er einem hoffnungslosen Fall das Einmaleins beibringen. „Also bitte!“
„Ja“, räumte Wagner ein, „man interessiert sich schon für seinen Nachbarn. Aber es ist nicht so, dass ich dauernd am Fenster stehe oder auf dem Balkon. Mittwochs, immer am Nachmittag, kam eine Dame mit einem roten Porsche. Das Autokennzeichen habe ich mir nicht gemerkt, weiß nur, dass die ersten beiden Buchstaben AW waren. Sie blieb etwa zwei oder drei Stunden. Dann ist sie wieder gefahren. Sie dürfte so zwischen fünfzig und sechzig sein. Genau kann ich das nicht schätzen. Eine sehr elegante Dame, immer gut gekleidet, groß, schlank, lange rote Haare bis auf die Schulter. Ich habe auch gehört, wenn Herr Achenbach ihr die Tür öffnete und sie begrüßte. Er sagte dann immer: ‚Hallo, Martina!‘ Aber mehr weiß ich nicht.“
„Immerhin“, bemerkte Brandt. „Das ist doch schon was. Und die andere, die am Samstag kam?“
„Blieb länger. Manchmal ist sie über Nacht geblieben, erst am nächsten Tag wieder gefahren. Sie kam mit einem weißen Opel Corsa. Kennzeichen weiß ich nicht. Nur dass die ersten Buchstaben BN waren. Ich gucke manchmal bei den Autos, wo sie herkommen. Die Dame wirkte etwas jünger. Vierzig vielleicht, nicht so elegant gekleidet, einfach normal, wie man eben so rumläuft. Sie ist etwas kleiner als die Porschefrau, eher zierlich, hat kurze blonde Haare. Wenn Herr Achenbach ihr die Tür geöffnet hat, sagte er immer: ‚Komm rein, Franziska!‘ Es wirkte nicht so erfreut wie bei der anderen. So Unterschiede merkt man schon.“
Wagner trat nun von einem Bein auf das andere, als bereue er, so viel verraten zu haben. Er sah den Kommissar etwas ängstlich und eingeschüchtert an, als wolle er sagen: „Hören Sie jetzt bitte auf, mich zu fragen.“
„Alles gut, Herr Wagner“, übernahm nun Katharina Luca die Befragung. „Sie haben uns sehr geholfen. Haben Sie die Damen oder auch nur eine von ihnen seit Achenbachs Abreise hier gesehen? Wollten sie ihn besuchen?“
„Nein. Sie wussten wohl Bescheid, dass er verreist ist.“
„Haben Sie bei den letzten Besuchen einen Streit bemerkt? So etwas kann man ja vielleicht hören.“
„Streit? Weiß ich nicht. Am Mittwoch vor seiner Abreise wurde es etwas laut. Da ist die Dame mit dem Porsche auch nur eine halbe Stunde geblieben.“
„Worum ging es? Haben Sie etwas gehört?“
„Nein. So laut war es nicht. Das bekommt man hier oben nicht mit. Ich stelle mich ja nicht vor die Tür und lausche. Was denken Sie von mir!“