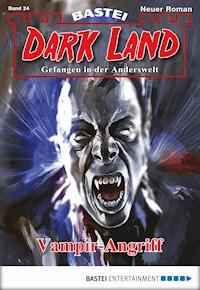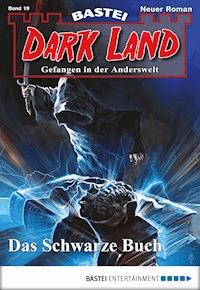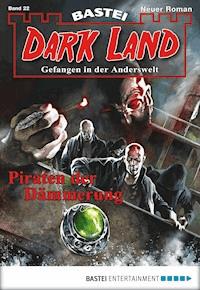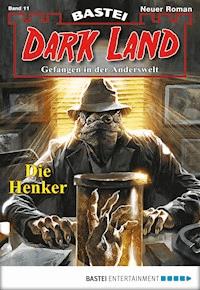2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux
- Sprache: Deutsch
Britannien, 45. n. Chr.
Commodus Naevus trug nur Lumpen am Leib. Die Rüstung, den Gladius und den Schild hatte man ihm abgenommen, als er in Gefangenschaft geraten war. Nur sein Stolz als römischer Legionär war ihm geblieben.
Der bärtige Befehlshaber der keltischen Krieger hatte ihm mitgeteilt, dass er gegen ein Lösegeld freikommen könnte. Seinem Centurio war er das Geld aber offenbar nicht wert. Und so blieb Commodus ein Gefangener und wurde bald darauf als Sklave verkauft.
Damit wollte er sich nicht abfinden. Er hatte seinen neuen Herrn niedergestochen, war aus dessen Haus geflohen und tief hinein in ein aus Hügeln und Wäldern bestehendes Niemandsland gelaufen. Wo genau dabei sein Ziel lag, wusste er selbst nicht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Im Bann des Spinnenkults
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE
Fußnoten
Impressum
Im Bann des Spinnenkults
von Rafael Marques
Britannien, 45. n. Chr.
Commodus Naevus trug nur Lumpen am Leib. Die Rüstung, den Gladius und den Schild hatte man ihm abgenommen, als er in Gefangenschaft geraten war. Nur sein Stolz als römischer Legionär war ihm geblieben.
Der bärtige Befehlshaber der keltischen Krieger hatte ihm mitgeteilt, dass er gegen ein Lösegeld freikommen könnte. Seinem Centurio war er das Geld aber offenbar nicht wert. Und so blieb Commodus ein Gefangener und wurde bald darauf als Sklave verkauft.
Damit wollte er sich nicht abfinden. Er hatte seinen neuen Herrn niedergestochen, war aus dessen Haus geflohen und tief hinein in ein aus Hügeln und Wäldern bestehendes Niemandsland gelaufen. Wo genau dabei sein Ziel lag, wusste er selbst nicht …
Im Bann des Spinnenkults
Es war eine unheimliche Nacht, die er sich für seine Flucht ausgesucht hatte. Commodus war nie ein ängstlicher Mann gewesen, denn schon dank seiner Eltern wusste er, dass die Götter ihn beschützten, wenn er sie nur in Ehren hielt. In der Armee war er mit seinem Mut und seiner Tatkraft schnell aufgestiegen, der Centurio wollte ihn sogar bald als Optio vorschlagen. Derselbe Mann, der ihn später fallenließ und ihm radikal vor Augen führte, dass er dem Römischen Reich nicht einen einzigen As wert war.
Nun musste er sehen, wie er zurechtkam. Dass es ihm jemals gelingen würde, in die Legion oder wenigstens nach Rom zurückzukehren, kam ihm illusorisch vor. Immerhin war er nicht nur ein Ausgestoßener, sondern auch ein Mörder. Die Helfer und Angehörigen seines neuen Herrn würden ihn gnadenlos jagen, wenn sie herausfanden, dass er ihm ein Messer ins Herz gerammt hatte.
Commodus hoffte nur, dass man die Leiche nicht allzu schnell fand.
Über ihm hallten Donnerschläge durch die Nacht und ließen ihn erzittern. Die Wolkenberge hielten den Regen noch zurück, dafür zuckten Blitze über die schwarze Wand hinweg, als würden die finsteren Götter der Britannier ihm vorführen wollen, welch ein Verbrechen er begangen hatte. Wenn die Menschen ihn schon nicht jagten, dann die Götzen der Kelten, die sich als grauenvolle Monster manifestieren und ihn in Stücke reißen würden.
Bald erreichte er einen dichten Tannenwald. Innerlich sträubte sich alles dagegen, ihn zu betreten, immerhin vernahm er auch das ferne Heulen der Wölfe. Zwischen den Bäumen würde es ihm noch weniger gelingen, sich zu orientieren, gleichzeitig wäre er aber auch vor seinen Häschern geschützt. Wenn es ihm gelang, sich einige Tage in einer Höhle oder einem verlassenen Haus zu verstecken, würde man die Suche nach ihm hoffentlich schnell wieder aufgeben.
Kaum dass er die ersten Bäume erreichte, fiel er auch schon zu Boden. In der Dunkelheit hatte er eine mächtige Wurzel übersehen, und als erneut ein Blitz über den Wald hinwegfuhr, glaubte er, die Klauen der Götzen bereits über seinen Körper streicheln zu spüren.
Mit einem Schrei fuhr er in die Höhe und fuchtelte mit dem blutverschmierten Dolch herum, ohne ein Ziel zu treffen. Natürlich nicht, immerhin war er völlig allein, und die Monster, von denen er sich umringt sah, existierten lediglich in seiner Fantasie.
Hechelnd rannte er weiter, ignorierte die Stiche in seiner Brust und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Wenn er jetzt die Nerven verlor, konnte er sich genauso gut auch sofort töten. Er musste sich auf etwas Reales konzentrieren, und wenn es auch nur sein Hass auf den Centurio war, der ihn schmählich im Stich gelassen hatte. Vielleicht gelang es ihm, aus diesem Zorn neue Kraft zu schöpfen, mit der er seine Ziele erreichen konnte. Dann müsste er sich nicht in Selbstmitleid ergeben.
Der nächste Blitz traf ihn dennoch völlig unvorbereitet. Wie der Arm eines Gottes schoss er über die Baumwipfel hinweg und traf eine uralte, mehr als fünfzig Schritt in den Himmel ragende Tanne, deren Stamm er in der Mitte spaltete. Feuer und Funken stoben in die Höhe, während das Holz mit einem infernalischen Krachen barst.
Commodus schrie sich die Seele aus dem Leib, während er im Stand herumwirbelte und in eine andere Richtung loslief. Schon bald verlor er in der Dunkelheit die Orientierung und stolperte mehr vorwärts, als dass er lief. Immer wieder stürzte er zu Boden, fluchte und kämpfte gegen die Schmerzen an, die seinen Körper malträtierten. Wenn das so weiterging, würde er nicht einmal diese Nacht überleben. Seine Verfolger würden lachend über ihm stehen und ihn verhöhnen, weil er vor Angst gestorben war.
Ein weiteres Mal stieß er mit dem Fuß gegen eine Wurzel, stürzte gegen einen Stamm und schlug mit dem Kopf gegen die Rinde, woraufhin er einige Augenblicke lang benommen auf dem Bett aus Nadeln liegenblieb. Sein Blick war verschwommen, als er in der Ferne ein Licht zu erkennen glaubte. Es handelte sich nur um einen schwachen, grauen Schimmer, doch seine Existenz allein ließ ihn neue Kraft schöpfen.
Er durfte nicht aufgeben, auf keinen Fall! Sein Centurio mochte ihn verraten haben, dennoch war er weiterhin ein Legionär, ein Diener Roms. Wenn er jetzt aufgab, verriet er damit nicht nur seinen Eid, sondern auch seine Eltern, die so stolz darauf gewesen waren, was er aus seinem Leben gemacht hatte. Er wollte sie unbedingt noch einmal in die Arme schließen und ihnen von dem inneren wie äußeren Kampf berichten, den er in diesen Stunden ausfocht.
Die nächsten Blitze, die über die Wolkenwand zuckten, leuchteten ihm den Weg. Jetzt zeigte sich, dass der graue Lichtschein aus einer mannshohen Höhle drang, die sich im zutage tretenden Felsgestein befand. Fast war es ihm, als hätten sich ihm die finsteren Götzen nun zugewandt, um ihn sicher an diesen schützenden Ort zu leiten. Eine absurde Vorstellung, das wusste er selbst, dennoch wollte ihm dieser Vergleich einfach nicht aus dem Kopf gehen.
Je näher er der Höhle kam, desto mehr fragte er sich, woher dieses Licht stammte. Es war nicht hell wie eine Kerze oder ein Lagerfeuer, eher matt wie der Schein des Mondes, wenn er durch eine dichte Nebelwand zu dringen versuchte. Was in aller Welt hätte ein derartiges Licht in einer Höhle erzeugen können?
Ein seltsamer Schauer rann über seinen Körper, als er den Eingang des düsteren Schlundes erreichte. Der graue Schein drang aus einer unbestimmbaren Tiefe hervor und brach sich mehrfach an den zerklüfteten Wänden. Unter ihm glaubte er, so etwas wie eine grob in das Gestein geschlagene Treppe zu erkennen, womöglich Spuren davon, dass die Höhle vor langer Zeit einmal Ziel von Besuchern gewesen war. Commodus dachte auch an einen Einsiedler oder einen Verstoßenen, der hier oben, fernab der Zivilisation, hauste.
Vielleicht ließ er ihn ja hier übernachten, und wenn nicht, würde er das mit seinem Leben bezahlen. Auf einen Mord mehr oder weniger kam es nun auch nicht mehr an, dachte er grimmig.
Eine unnatürliche, geradezu lähmende Kälte erfasste seinen Körper, während er eine Stufe nach der anderen nahm und dabei über die feuchten Wände strich. Manchmal glaubte er, dünne Finger oder Beine auf seinen Handrücken zu spüren, doch wenn er ihnen seinen Blick zuwandte, war dort nichts zu sehen. Etwas sagte ihm, dass es ein Fehler gewesen war, diesen unheimlichen Ort betreten zu haben, andererseits gab es nun kein Zurück mehr. Er musste herausfinden, wer oder was dieses graue Licht abgab, erst dann würde er sich in seinem neuen Versteck sicher fühlen.
Da und dort tropfte Wasser von der Decke. Hier unten zeigte das Gestein tiefe Risse, an einer Stelle war der Durchgang sogar so schmal, dass es ihn einige Mühe kostete, den Abstieg fortzusetzen. Unter Umständen hatte es in dieser Gegend einmal ein Erdbeben gegeben, woraufhin die Menschen diesen Ort aufgaben und sich selbst überließen. Nur das graue, lockende Licht war geblieben, als ein unheimliches Erbe vergangener Zeiten.
Endlich erreichte Commodus das Ende der Treppe. Auch hier war der Boden aufgeplatzt, als hätte sich das Gestein ineinandergeschoben. Es fiel ihm schwer, einen Fuß vor den anderen zu setzen, ohne erneut ins Stolpern zu geraten oder sich an den spitzen Felswänden die Haut aufzureißen.
Das graue Licht zeigte sich nun deutlich intensiver. Da er dessen Quelle immer noch nicht ausmachte, fragte er sich, wie es überhaupt möglich war, dass es bis zum Eingang der Höhle drang. Normalerweise hätte es sich spätestens auf der Treppe verlieren müssen. Das allein sagte ihm, dass er einer Kraft auf der Spur war, von der sich Menschen besser fernhalten sollten. Doch obwohl die Angst erneut nach seinen Gliedern griff und er zu zittern begann, kehrte er nicht um. Eine innere Stimme trieb ihn dazu an, hinter das Geheimnis dieser Höhle zu kommen.
Inzwischen bewegte er sich durch einen größeren unterirdischen Raum, dessen Decke weit über ihm in der Dunkelheit verschwamm. Dass sie überhaupt existierte, merkte er lediglich daran, dass weiterhin Wasser auf ihn herabtropfte. Manchmal glaubte er, ein leises Flattern zu hören, das sicher von den wahren Herren dieser Höhle, den Fledermäusen, stammte. Oder handelte es sich um Kreaturen einer finsteren Schattenwelt, die als Wächter des grauen Lichts fungierten? Commodus schalt sich einen Narren, dass erneut seine Fantasie mit ihm durchging.
Sein Herz übersprang einen Schlag, als er das Ende dieses riesigen Saals vor sich sah. Vor ihm erhoben sich zwei in das Gestein geschlagene Säulen, die eine rissige Altarplatte einrahmten. Genau dort stand eine Figur von der Größe eines Menschenkopfes, deren Anblick ihn erschaudern ließ.
Es war eine Spinne!
Commodus traute seinen Augen nicht. In was war er hier bloß hineingeraten? Auf der Flucht vor all jenen, die ihn für den Mord an seinem neuen Herrn bestrafen wollten, hatte ihn das Schicksal inmitten eines fürchterlichen Gewitters ausgerechnet an diesen Ort geführt.
Warum? Was wollten ihm die Götter damit sagen?
Vielleicht waren es ja wirklich nicht seine Götter, die ihm den Weg gewiesen hatten. Schon im Wald war ihm mehrmals der Gedanke gekommen, finstere Götzen der Kelten könnten hinter ihm her sein. Dieser Anblick zeigte ihm, dass er mit seiner Vermutung der Wahrheit wohl näher gekommen war, als ihm lieb war.
Auch jetzt noch hätte er die Möglichkeit gehabt, sich umzudrehen und all dies hinter sich zu lassen. Allein, wohin hätte er fliehen sollen? Hinaus in das Gewitter? Oder zurück zu seiner Legion, in der man ihn, einen billigen Sklaven, sicher schon vergessen hatte? Nein, für ihn existierte keine Zuflucht mehr, keine irdische jedenfalls. Sobald seine Angst verraucht war, stieg der Zorn über all die Ungerechtigkeiten erneut in ihm auf. Zur Not würde er seine Seele an einen Dämon verkaufen, wenn er dafür im Gegenzug die Gelegenheit bekam, Rache zu üben.
Genau diese geradezu niederschmetternde Erkenntnis war es auch, die ihn den Mut fassen ließ, sich dem Altar zu nähern. Über die Oberfläche der steinernen Figur huschten kaum wahrnehmbare Lichtreflexe, während in den winzigen Augen ebenfalls ein unheilvoller Schein glomm. Sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, dass er gerade einen verhängnisvollen Fehler beging, dennoch streckte er den linken Arm nach der Figur aus.
Als Commodus eines der Beine berührte, rann ein warmer Schauer über seinen gesamten Körper. Es war, als würde eine fremde Macht nach ihm und auch nach seiner Seele greifen. Andererseits verspürte er vor ihr keine Angst und musste sogar lächeln.
Du möchtest also Rache, ja?, vernahm er eine fremde, verzerrte Stimme, deren Echo durch seinen Kopf hallte. Oder ist es Gerechtigkeit, nach der sich dein Herz sehnt? Ich werde dir helfen, doch das hat seinen Preis. Eines Tages, in einer fernen Zukunft, wenn sich die Vorzeichen in dieser Welt verändert haben, wirst du ihn zahlen müssen, Commodus Naevus.
»Ich bin bereit.«
Dann soll es so sein …
Rom, im Sommer65n. Chr.
Amanus Peppus war trotz seines bescheidenen Einkommens mit seinem Leben zufrieden. Er ging einer Arbeit nach, die ihm Spaß machte, und wohnte zusammen mit der Frau, die er über alles liebte. Dass Daria ein wenig mit psychischen Problemen kämpfte und ihm niemals Kinder schenken würde, spielte für ihn keine Rolle.
Wäre da nur nicht dieser Dormus Kanibus …
Der monatliche Preis, den Amanus mit seinem alten Vermieter ausgehandelt hatte, spielte für diesen Halsabschneider keine Rolle. Im ganzen Viertel kaufte er Häuser auf und erhöhte die Mieten so stark, dass den Bewohnern nichts anderes übrig blieb, als ihre Sachen zu packen und auszuziehen. Angesichts dessen, dass dieser Kerl ihnen sogar mit Gewalt drohte, fiel den Vertriebenen die Entscheidung nicht schwer.
Er dagegen wollte sich das nicht bieten lassen. Seit fünfzehn Jahren lebte und arbeitete er in diesem Haus, war sogar mit seinem alten Vermieter befreundet gewesen und hatte immer pünktlich seine Schulden beglichen. Sollte das alles nun nichts mehr wert sein? Ein Auszug kam sowieso nicht infrage, da Daria mit einer derart tiefgreifenden Veränderung nicht klarkommen würde. Nur in ihrer gewohnten Umgebung fand sie sich einigermaßen zurecht. Wurde sie mit Unbekanntem, Hektik oder zu lauten Nachbarn konfrontiert, verlor sie schnell ihre Fassung und begann wie von Sinnen zu schreien.
Dabei war sie es, die sich auch um ihn kümmern musste, weil er sich gerne in seinen Gedanken verlor. So auch in dieser Nacht, die er eigentlich damit verbringen sollte, einen größeren Auftrag für den Wirt einer Taverne auszuführen. Bei einer wüsten Schlägerei waren zahlreiche Becher, Krüge und Teller zu Bruch gegangen. Dafür, dass er rasch Ersatz bekam, zahlte er Amanus eine stattliche Summe, die er gut gebrauchen konnte. Trotzdem würde sie niemals ausreichen, um die Miete an Dormus Kanibus zu bezahlen.
»Hier, Schatz«, hauchte Daria ihm zu, als sie neben seiner Arbeitsstätte in die Knie ging und ihm einen Becher voll Wasser auf den Tisch stellte. Erst jetzt bemerkte er, wie durstig er war, da er seit Stunden nichts mehr getrunken hatte.
»Vielen Dank.«
Daria war immer noch eine Schönheit, zumindest in seinen Augen. Seit zwanzig Jahren, genau genommen seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr, waren sie unzertrennlich. Der schweigsame, verträumte Arbeiter und die stets lächelnde Frau, der man nachsagte, nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein. Amanus nannte es eher ihre Phasen, denn die meiste Zeit des Tages verhielt sie sich wie jeder andere Mensch, wenn man einmal von ihrem flackernden Blick und einigen Zitteranfällen absah.
Mit seinen von feuchtem Lehm verschmierten Händen griff er nach dem Becher und trank ihn in einem Zug aus. Er blinzelte ein wenig benommen, als er bemerkte, dass die Dunkelheit längst über Rom hereingefallen war und die Sterne durch die Fenster glitzerten. Es war eine warme Nacht, in der er sich nicht vor kaltem Wind oder heftigen Regenfällen fürchten musste, die dem löchrigen Dach noch mehr Schaden zufügten. Auch für die Reparatur fehlte ihm das Geld, deshalb musste er sich umso mehr beeilen, den Auftrag des Wirts so schnell wie möglich zu erledigen.
»Ich habe die Becher in den Ofen geschoben«, erklärte Daria und strich ihm dabei über den Kopf. »Du solltest bald mal eine Pause machen.«
»Wenn ich das nur könnte …«
»Rom wurde auch nicht in einer Nacht erbaut, weißt du?«
Amanus musste lachen und blickte auf. Manchmal hatte Daria diese kindlichen Anwandlungen, bei denen man den Eindruck gewann, sie wäre immer noch ein kleines, lustiges Mädchen, das nichts als Unfug im Kopf hatte. Ihm gefiel diese Seite an seiner Frau, denn sie brachte stets ein wenig Farbe in sein ansonsten eher tristes und eintöniges Leben.
»Lass das nicht die Götter hören«, mahnte er, nicht ohne einen Hauch Ironie.
»Die Götter sind …«
Ihre Stimme erstarb, als laute Schritte von dem Pflaster vor dem Haus bis in die Töpferstube hallten. Hier, in diesem von einfachen Handwerkern bewohnten Viertel nahe der Subura, traute man sich nachts oft nicht auf die Straße, weil Räuber, Diebe und Einbrecher die Gegend unsicher machten.
Auch Amanus war in seinem Leben schon zweimal überfallen worden und scheute sich deshalb davor, im Dunkeln ins Freie zu treten. Sollte ihn das Schicksal nun ein drittes Mal heimsuchen? Wenn ja, war er bereit, sein Heim und seine Frau mit allem, was ihm zur Verfügung stand, zu verteidigen.
Schon bald hallten mehrere Donnerschläge durch das Haus, als jemand mit Gewalt gegen die Tür hämmerte.
Wer mochte um diese Uhrzeit noch etwas von ihm wollen? Der Wirt vielleicht, der dringend nach seiner Ware verlangte? Eigentlich müsste er wissen, dass er kein Hexer war und das Lehmgeschirr erst einmal aushärten und abkühlen musste.
»Ich gehe schon«, sagte Amanus, als das Hämmern nicht aufhören wollte. Er wischte sich die Hände notdürftig an einem Tuch ab, zog die Schürze aus und richtete sich auf. Durch die Werkstatt erreichte er schnell die Wohnstube und damit auch die Tür, die weiterhin unter den Schlägen erzitterte.
»Wer ist da?«, rief er misstrauisch, wobei er nach einem Knüppel griff, der neben der Tür auf einem Schrank ruhte.
»Freunde von Dormus Kanibus, die euch eine Nachricht überbringen sollen.«
»Mitten in der Nacht?«
»Mach schon auf, dann wirst du es erfahren!«
Was sollte er nur tun? Es fiel ihm schwer, dieser Aussage Glauben zu schenken. Andererseits, wenn er jetzt nicht öffnete und die Geschichte doch der Wahrheit entsprach, würde er seinem Vermieter noch einen weiteren Grund liefern, ihn aus dem Haus zu werfen. Außerdem bezweifelte er, dass die Tür den Fremden noch lange standhalten würde.
Deshalb öffnete er.
Nur Augenblicke später erkannte er seinen Fehler. Vor der Tür lauerten zwei muskulöse Gestalten mit kantigen, teils von Narben gezeichneten Gesichtern, die ebenfalls Knüppel sowie Messer mit sich führten. Amanus sah noch ihr gehässiges Grinsen, dann trafen ihn die ersten Schläge.