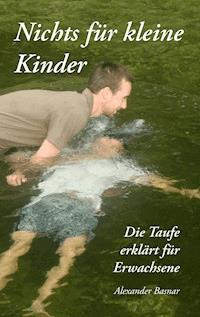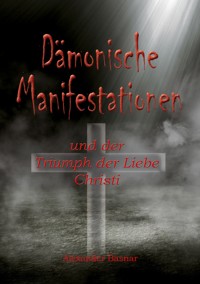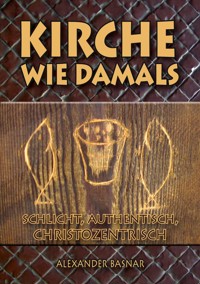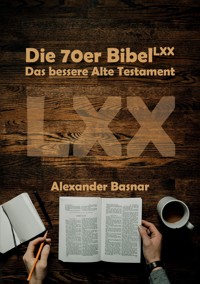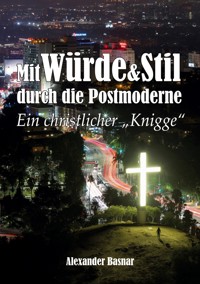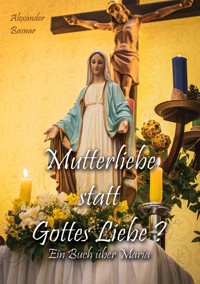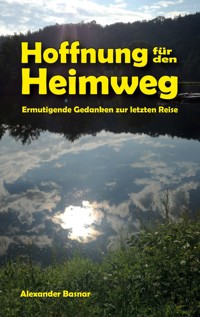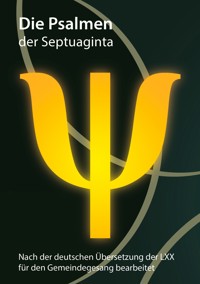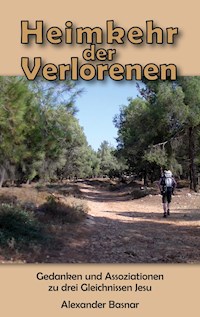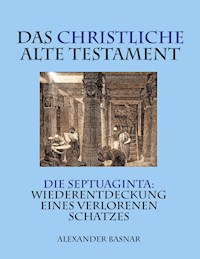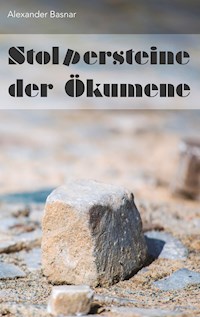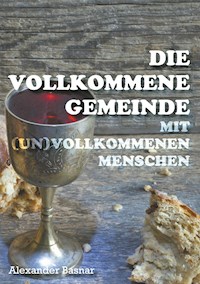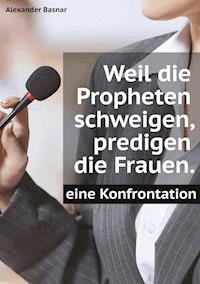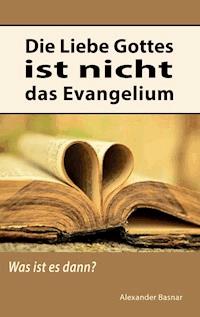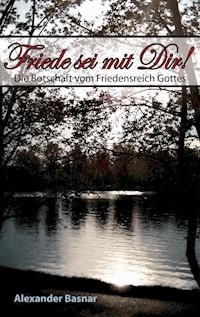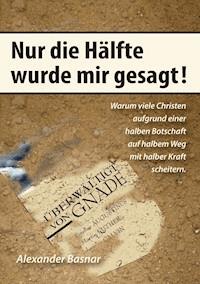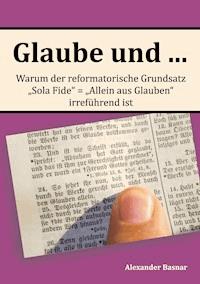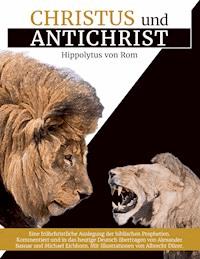
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hippolytus schrieb "De Christo et Antichristo" für seine Glaubensbrüder und Schüler, um ihnen Mut zu machen und sie vorzubereiten auf das erwartete Kommen des Antichrists, den er dem wahren Christus vergleichend gegenüberstellt anhand prophetischer Texte im Alten und Neuen Testament. Wir geben das Buch unter dem Titel "Christus und Antichrist" in heutigem Deutsch heraus, ergänzt durch erläuternde Kommentare und illustriert mit fünf Bildern aus Albrecht Dürers Apokalypse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Ermahnung an Theophilus, den Inhalt für sich und die Gläubigen nutzbar zu machen, nicht aber Ungläubigen mitzuteilen [Kap. 1]
Die vom Logos erleuchteten Propheten haben uns die Geheimnisse Gottes mitgeteilt. Eigenschaften des Propheten [Kap. 2]
Der Logos erleuchtete ehemals die Propheten, wie er ohne Ansehen der Person alle erleuchtet, welche zu ihm kommen wollen [Kap. 3]
Die Erlösungstätigkeit Christi verglichen mit Webstuhl und Gewebe [Kap. 4]
Inhaltsangabe der heiligen Schrift über den Antichrist [Kap. 5]
Der Antichrist ist in allem das Zerrbild von Christus [Kap. 6]
Jakobs Weissagung über den Erlöser [Kap. 7]
Erläuterungen des angeführten Textes [Kap. 8-13]
Wie Christus aus dem Stamm Juda kam, so kommt der Antichrist aus dem Stamm Dan [Kap. 14]
Weitere Beweise, dass der Antichrist aus Dan kommt [Kap. 15]
Jesaja über den Antichrist [Kap. 16-17]
Hesekiel über den Antichrist [Kap. 18]
Daniel über den Antichrist und das Weltende; das Gesicht Nebukadnezars [Kap. 19]
Die Vision Daniels von den vier großen Tieren [Kap. 20]
Der Alte an Tagen und das Gericht [Kap. 21]
Der Sohn Gottes [Kap. 22]
Erklärung, Daniel 7, 2-9: Nebukadnezar und sein Reich [Kap. 23]
Meder, Perser, Griechen [Kap. 24]
Das Reich der Römer. Der Antichrist [Kap. 25]
Sturz des Antichrists durch den Sohn Gottes [Kap. 26]
Zeit des Eintretens [Kap. 27]
Was die einzelnen Glieder der Statue Nebukadnezars bedeuten [Kap. 28]
Hippolytus fürchtet sich, es deutlich auszusprechen [Kap. 29]
Was Jesaja über Jerusalem vorhergesagt hat, ist eingetroffen [Kap. 30]
Lob der Propheten Jesaja, Jeremia, Daniel, Johannes [Kap. 31]
Was Daniel über die Bärin und den Panther vorhergesagt hat, ist bereits eingetroffen [Kap. 32]
Die Weissagung über das vierte Tier bestätigt sich [Kap. 33]
Jesajas Weissagung über den Sturz des alten Babylons, angewandt auf Rom [Kap. 34]
Der Herr hat es vernichtet wegen seines Hochmuts [Kap. 35]
Weissagung des Apostels Johannes über Babylon-Rom, den Sitz aller Laster [Kap. 36]
Das Tier mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern [Kap. 37]
Die sieben Köpfe sind die sieben Hügel, auf denen Rom gebaut, die zehn Hörner, zehn Könige [Kap. 38]
Babylons Herrschaft über alle Völker der Erde [Kap. 39]
Babylons Sturz wegen seiner Laster [Kap. 40]
Untergang seiner Herrlichkeit und aller Lastermittel [Kap. 41]
Freude der Gerechten über Gottes Gericht [Kap. 42]
Das Gericht wird eintreten in der letzten Jahrwoche, vorher erscheinen Henoch und Elia [Kap. 43]
Henoch und Elia sind Vorläufer des Herrn bei der zweiten herrlichen Ankunft, wie Johannes bei der ersten, leidvollen [Kap. 44]
Johannes ist auch Vorläufer in der Unterwelt [Kap. 45]
Henoch und Elia werden unter Wundern die zweite Ankunft Christi verkündigen, um die Menschen zu bekehren [Kap. 46]
Sie werden vom Antichrist getötet werden [Kap. 47]
Charakter des Antichrists, sein Zeichen und sein Name [Kap. 48]
Er wird das römische Reich und den Götzendienst wieder herstellen [Kap. 49]
Wie Antiochus wird er die Christen quälen: der Name der Zahl 666 ist ungewiss [Kap. 50]
Die Nachkommen Edoms und Moabs werden sich mit dem Antichrist verbinden [Kap. 51]
Eroberungen des Antichrists in Afrika und Kleinasien [Kap. 52]
Er macht sich zum Gott in seinem Übermut [Kap. 53]
Er wird die Juden versammeln und ihnen vorspiegeln, ihr Reich wieder herzustellen [Kap. 54]
Das trügerische Treiben des Antichrists [Kap. 55]
Verfolgung der Christen von den Anhängern des Antichrists [Kap. 56]
Der Antichrist ist der ungerechte Richter im Evangelium, die Witwe ist Jerusalem [Kap. 57]
Das jüdische Volk ist dem Antichrist überliefert, weil es Christus nicht anerkennen wollte, und der Hauptfeind der Christen [Kap. 58]
Vergleich der Kirche mit einem Schiffe auf dem Meere [Kap. 59]
Johannes hat die Verfolgung vorhergesagt unter dem Bild der Frau und des Drachen [Kap. 60]
Auslegung der Weissagung des Johannes [Kap. 61]
Das Weltende kommt plötzlich und unter großen Schrecknissen [Kap. 62]
Dem Weltende gehen der Glaubensabfall und die Herrschaft des Antichrists voraus [Kap. 63]
Nach dem Sturz des Antichrists folgen der Weltbrand und das Gericht [Kap. 64]
Belohnung der Guten und Bestrafung der Bösen folgt der Auferstehung [Kap. 65]
Die dann lebenden Frommen werden ohne Tod in die Herrlichkeit mit Christus eingehen [Kap. 66]
Zweck der Schrift ist, Theophilus zu einem gottgefälligen Leben anzuspornen [Kap. 67]
Epilog
Vorwort
Über den Autor
Hippolytus von Rom war ein Presbyter (Gemeindeleiter) und Märtyrer im frühen 3. Jahrhundert nach Christus.
Er genoss hohes Ansehen wegen seiner Gelehrsamkeit, seines Glaubens und seiner Standhaftigkeit bis zum Tod und verfasste weithin geschätzte frühchristliche Bücher, die uns bis heute erhalten geblieben sind, wie etwa „Refutatio omnium haeresium“ (Widerlegung aller Häresien), Canones (Kirchenordnungen) und „De Christo et Antichristo“ (Das Buch über Christus und den Antichrist), das die Grundlage dieses vorliegenden Werkes ist. So wurde Hippolytus einer der fruchtbarsten Schriftsteller des christlichen Altertums.
Besonders erwähnenswert erscheint uns, dass Hippolytus ein Schüler von Irenäus war, und der wiederum ein Schüler des Polykarp, welcher ein Schüler des Apostels Johannes war. Wegen dieser unterbrechungsfreien und kurzen Überlieferungskette zu jenem Apostel, der fünf biblische Bücher, darunter die Offenbarung, verfasste, ist Hippolytus daher ein unschätzbares Bindeglied zur Lehre und Auslegungspraxis der Heiligen Schriften wie sie die Apostel von Jesus lernten und an ihre Schüler weitergaben. Johannes (ca. 7-101) → Polykarp (ca. 69-156) → Irenäus (ca. 120-205) → Hippolytus (ca. 170-236): welcher andere bekannte Ausleger der Offenbarung, welcher moderne Bibelgelehrte, welcher Bibelkommentar kann auch nur ansatzweise so eine zuverlässige und lückenlose Überlieferungskette zu jenem Apostel vorweisen, der die Offenbarung persönlich von Jesus Christus empfing und diktiert bekam?
Und noch ein Vorzug von Hippolytus gegenüber allen späteren Bibelauslegern erscheint uns nennenswert: er war nicht nur mit der Sprache der frühen Christen (und damit der Autoren des Neuen Testamentes) bestens vertraut, er sprach sie und schrieb in dieser Sprache; er war nicht nur mit der Kultur der frühen Christen bestens vertraut, er war nicht nur ein Schüler von herausragenden Lehrern, die über jeden Zweifel erhaben waren, sondern er brillierte mit einer heutzutage schier unfassbaren Kenntnis der Heiligen Schriften (sowohl jüdische als auch christliche). Seine Auslegungen strotzen vor Zitaten aus den Heiligen Schriften (sowohl Altes Testament, wie auch Neues), die er seitenweise zum Großteil sogar auswendig wiedergab und legte dabei Zusammenhänge von Worten und Passagen dar, die mit modernen Methoden und Werkzeugen der Bibelauslegung kaum zustande gebracht werden können. Wir mussten Computer- und Datenbankwerkzeuge verschiedenster Art benützen, um das nachschlagen und erkennen zu können, was dieser Mann aus dem Gedächtnis niederschrieb, wobei er die Grundtexte sorgfältiger und besser las und interpretierte, als viele moderne Bibelübersetzer, wie wir leider feststellen mussten. Doch dazu später mehr in den Kommentaren, die wir in das Buch eingearbeitet haben und die nicht nur unseren tiefen Respekt vor Hippolytus ausdrücken, sondern eine Hilfe für die Leser des 21.Jahrhunderts sein sollen, um die Schriftauslegung der frühen Christen zu verstehen und darin einzutauchen.
Hippolytus setzte nämlich – wie viele frühchristliche Lehrer – eine Schriftkenntnis voraus, wie sie heute leider kaum noch vorhanden ist. So zitierte er nicht nur über einhundert Bibelstellen in diesem relativ kurzen Buch, sondern nennt dabei keine Angabe zu Buch, Kapitel oder Vers (so wie es heute üblich ist). Seine Leser und Schüler mussten wissen, wo das steht. Und wussten es wohl auch. Hier fällt eine Parallele zu Jesus Christus und seinen Aposteln auf. Auch Christus nannte nie die Stellenangabe, sondern höchstens den Autor („David sagte“, „Mose sagte“, etc.), wenn er seine vielen Zitate aus der Heiligen Schrift brachte. Seine Zuhörer mussten diese kennen, um seine Beweisführung zu verstehen. Kein einziges Mal lesen wir in einem Evangelium, dass ein Zuhörer Jesus fragte „Wo steht das? Woher hast du das?“ Sie kannten die Stellen. Ebenso predigten und schrieben auch die Aposteln und andere Autoren des Neuen Testamentes, die niemals exakte Quellenangaben machten, sondern sie zitierten wie selbstverständlich die Heiligen Schriften im Textfluss (zum Beispiel die Pfingstpredigt von Petrus, die eine Aneinanderreihung von Zitaten aus den Propheten und Psalmen sind). Erst die Bibelübersetzer und Kommentatoren späterer Epochen machten sich die Arbeit, feinsäuberlich die Zitate zu markieren und mit Stellenangaben und Parallelstellen zu versehen. So gut sie das eben konnten und soweit sie das verstanden. Hippolytus und andere frühchristliche Lehrer und Autoren waren da von einem ganz anderen Schlag, was sicherlich auch dem für uns ungewohnten Meister-Jünger-Ausbildungsprinzip geschuldet ist, das Jesus seinen Jüngern beibrachte und diese wiederum ihren. Das hielt sich bis ins 3.Jahrhundert nach Christus, bis zu Hippolytus. Ein Jahrhundert, das noch recht nahe an den Aposteln und frühen Christen war, aber noch keine Landeskirchen und deren Schriftauslegungen kannte, weder die Römisch Katholische Kirche noch die Lutherische und erst recht nicht die unzähligen Freikirchen. Daher ist Hippolytus frei von mittelalterlichem Gedankengut, ebenso wie von Dogmen des Papsttums, ebenso wie von reformatorischen Lehrsätzen und erst recht von modernen Interpretationen und Lehren zur Bibel.
Deswegen ist Hippolytus heute für uns eine kostbare Quelle der frühen apostolischen Lehre, da seine Ausführungen völlig frei von späteren Spaltungen und deren Irrlehren sind. Er lehrte und leitete eine Gemeinde zu einer Zeit, als das Christentum noch nicht in tausende Konfessionen zersplittert und zerstritten war, als die Kirche noch keine Staatsgewalt besaß, als Priester noch keine Beamten waren, als Theologie noch nicht auf weltlichen Universitäten gelehrt wurde, als das Christentum sich noch nicht mit dem Zeitgeist, der Wirtschaft und der Politik arrangierte. Hippolytus lebte zu einer Zeit, in der es lebensgefährlich war, Christ zu sein. In einer Zeit, wo Christen vom Staat verfolgt, gefoltert und hingerichtet wurden, wo Christen also sehr vorsichtig sein mussten und nur jene Menschen Christen wurden, die es ernst meinten und bereit waren, alles für ihren Glauben und ihren Herrn Jesus Christus aufzugeben. Auch ihr Leben. So erlitt auch Hippolytus den Märtyrertod.
Über die Illustrationen
Albrecht Dürer (1471-1528) war 27 Jahre alt, als er 1498 die „Die heimlich Offenbarung Iohannis“ im Eigenverlag herausbrachte. Es war ein gedrucktes Buch, das seine 15 Holzschnitte zur Apokalypse enthielt, samt vollständigem Text der 22 Kapitel umfassenden biblischen Offenbarung auf Deutsch. Dürers Buch war ein großer Erfolg, verbreitete sich rasch und wurde sogar in einer zweiten Auflage in lateinischer Sprache heraus gebracht. Noch heute zählt dieses frühe Werk Dürers zu seinen berühmtesten. Wenngleich Dürer rund 1300 Jahre nach Hippolytus lebte, so erscheinen uns seine Darstellungen der Apokalypse dennoch inspirierend und passend. Außerdem zeugt der erstaunliche Erfolg von Dürers Apokalypse davon, dass die Menschen in Europa schon Jahrzehnte vor Luthers Bibelübersetzung eine deutschsprachige Bibel kannten (Dürer übernahm den Text der deutschen Koberger-Bibel von 1483) und das Thema der Offenbarung, obwohl sie noch Ende des 15.Jahrhunderts als „heimlich“ galt, breitenwirksam im Volk ankam. Wir verwenden in diesem Büchlein nicht den gesamten Zyklus Dürers zur Apokalypse, sondern nur jene Holzschnitte, die einen inhaltlichen Bezug zu Hippolytus‘ Buch haben.
Über das Buch
Hippolytus verfasste das Buch „De Christo et Antichristo“ in Folge einer Unterredung mit seinem Freund Theophilus über die Hauptwahrheiten des Christentums. Er schrieb das Buch auf Griechisch und ausschließlich für Gläubige. Es durfte nicht für Ungläubige zugänglich gemacht werden, was er gleich im ersten Kapitel anordnet und begründet. Heute ist die Bibel allen zugänglich und ebenso die frühchristliche Literatur, auch längst digital im Internet, weswegen uns diese Einschränkung nicht mehr machbar erscheint.
Wir bringen daher Hippolytus‘ Buch in vollständiger Länge für alle Leser heraus, allerdings in heutigem Deutsch. Wir hielten uns dabei eng an die deutschsprachige Übersetzung der Bibliothek der Kirchenväter von Dr. Valentin Gröne aus dem Jahr 1872 mit folgenden Auflagen:
Die Zitate aus dem Alten Testament haben wir wortwörtlich aus der „Septuaginta Deutsch“ wiedergegeben, auch wenn Hippolytus in seinem Buch die LXX stellenweise nur aus dem Gedächtnis zitierte und daher nicht immer wortgetreu. Die kleinen Abweichungen, die sich daraus ergaben, hatten überhaupt keinen Einfluss auf die Argumentation von Hippolytus oder deren Schärfe. Wir wollten aber eine durchgehend konsequente Zitatqualität bieten.
Für die Zitate aus dem Neuen Testament wählten wir die Schlachter 2000, auf deren Schreibweise aller biblischen Namen wir uns ebenfalls einigten, zwecks durchgehender Kontinuität.
Und schließlich fügten wir an Stellen, die für den heutigen Leser wenig nachvollziehbar erscheinen müssen, Kommentare hinzu, um die Lehre und das Schriftverständnis des Hippolytus näher zu erklären.
Denn genau hier liegt aus unserer Sicht die größte Herausforderung: über die Jahrtausende haben sich Schriftverständnis, Lehre und Glaubenspraxis leider immer wieder verändert im Christentum, sodass viele Worte, Vergleiche aber auch biblische Zusammenhänge der frühen Christen heute fremd oder seltsam erscheinen und umgekehrt. Die frühen Christen wären verwundert, was aus der apostolischen Lehre und ihren Schriften, die sie teilweise mitverfassten, bewahrten und kanonisierten, heute herausgeholt und gelehrt wird.
Dieses Buch ist also nicht nur wegen des spannenden Themas interessant, das nie so aktuell war wie heute, sondern auch gerade deswegen, weil es gut geeignet ist, so manchen Irrtum, so manche Irrlehre aufzuzeigen, die sich im Laufe der Jahrtausende in die christliche Bibelauslegungspraxis eingeschlichen hat. Wir stellen an brisanten Stellen bewusst die vorherrschenden Lehren von damals bis heute gegenüber und versuchen auch die Hintergründe aufzuzeigen.
Auch wir waren beim ersten Lesen so mancher Passagen von Hippolytus leicht verwirrt, manches kam uns weit hergeholt oder nahezu aus der Luft gegriffen vor. Doch wir brachten ihm so viel Vorschussvertrauen entgegen, dass wir seine teilweise für uns befremdenden Auslegungen weder belächelten noch verwarfen und schon gar nicht durch unser Bibelverständnis zu ersetzen versuchten, sondern uns auf eine Forschungsreise begaben, wie Archäologen, die sorgsam in alten Schriften, Texten und Übersetzungen gruben und zu unserem großen Erstaunen mussten wir immer wieder feststellen, dass Hippolytus einen weitaus tieferen und fundierteren Einblick hatte als es auf den ersten Blick aussah. Wir entdeckten immer wieder Unschärfen bei unseren modernen Übersetzungen, während Hippolytus unfassbar tief und genau die Grundtexte las und so zu Auslegungen und Einsichten kam, die den heutigen auch mal konträr gegenüber stehen. Das stellt aus unserer Sicht immer wieder die Authentizität unserer heutigen Übersetzungen und Lehren in Frage und zeigt uns, wie wichtig es ist, nicht nur die alten Lehrer zu studieren, sondern auch gründlich die Grundtexte unserer Bibelübersetzungen anzusehen. Dazu mehr in den Kommentaren die, wie wir hoffen, in jedem Fall wertvolle Gedankenanstöße liefern, auch dann, wenn der Leser nicht unserer Meinung sein sollte. Apropos Meinung: wir versuchten, unsere persönliche Meinung so gut es ging heraus zu halten bei dieser Arbeit, sondern stattdessen die Sicht von Hippolytus und seiner Lehrer zu erkunden und dann mit damaligen und heutigen Grundtexten, Bibelübersetzungen und Lehren zu vergleichen und schließlich möglichst einfach verständlich gegenüber zu stellen.
Ein Wort zur Septuaginta
Die alttestamentlichen Zitate in der Schrift des Hippolytus (wie der allermeisten frühen Christen) folgen der im 3. Jahrhundert vor Christus begonnenen griechischen Übersetzung des AT, der Septuaginta. Unsere heutigen Bibeln beruhen auf dem hebräischen Masoretentext. Dass letzterer der Urtext sei, beziehungsweise diesem am besten entspräche, beruht auf einem Irrtum. Allein die Bezeichnung „Masoreten“ erinnert an die mittelalterlichen (!) Kopisten, welche den ursprünglich reinen Konsonantentext durch Vokalzeichen mit Selbstlauten lesbarer machten. Bis heute ist bisweilen allein die Vokalisierung umstritten, da unterschiedliche Vokale auch zu unterschiedlichen Wortbedeutungen führen. Die bekannteste Unsicherheit betrifft hier gerade den Gottesnamen JHWH, dessen korrekte Aussprache heute unbekannt ist.
Was aber noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass die Entscheidung für diesen Texttyp von den Pharisäern nach der Tempelzerstörung getroffen wurde (Synode von Jamnia – ab 90 n.Chr.), als diese begannen, die von den Christen in der Mission so erfolgreich eingesetzte Septuaginta (kurz LXX) zu verwerfen. Sie pochten auf den hebräischen Grundtext, und verwarfen dabei auch alle Bücher, von denen sie annahmen, dass es sie nur auf Griechisch gab (wie Weisheit Salomos, Jesus Sirach, Makkabäer und andere, die wir als Apokryphen oder deuterokanonische Bücher kennen).
Die Christen blieben jedoch aus gutem Grund bei der LXX: Der Herr Jesus und die Apostel gebrauchten sie bei ihren Lehren und Zitaten; selbst in den Synagogen Galiläas (stark griechisch geprägt) lag die LXX zur Lesung auf. Das blieb so, bis Hieronymus die Bibel auf Latein übersetzte (Vulgata) und dabei der jüdischen Argumentation folgte.
Heute wissen wir durch die Funde in Qumran, dass die LXX auf einem anderem hebräischen Grundtext basiert, und der sog. „protomasoretische“ Text nur eine von mehreren Varianten war. Dieses „Chaos“ mag aufs erste verunsichern: „Was, hat Gott sein Wort nicht bewahrt?“ Es gibt aber einen sehr plausiblen Grund für die chaotische Grundtextsituation um Christi Geburt (und davor): Ein Vorläufer des Antichrists (Antiochus IV. Epiphanes) ließ massenweise Bibeln vernichten. Diesen Verlust zu ersetzen, war es nötig rasch (und damit fehleranfälliger) neue Exemplare zu schreiben, wobei die damals aufkommenden drei Sekten (Pharisäer, Sadduzäer und Essener) da und dort der Versuchung erlegen sein mögen, die eine oder andere Textunsicherheit in ihrem Sinn zu „klären“ (wie das manche moderne Bibelübersetzer leider heute noch tun). Doch bereits vor dieser Bibelverbrennung wurde in Alexandria nach den Tempelrollen (also den besten Texten) die LXX ins Werk gesetzt.
Wir können also annehmen, dass die LXX auf einem älteren und besseren Text basiert als der Masoretentext einer ist.
Das letzte Wort in dieser Sache hat unsererseits aber dennoch der Heilige Geist, der durch den Gebrauch der LXX im NT diese bestätigt und geheiligt hat. Wie wir sehen werden, sind es oft die Lesarten der LXX, welche die Auslegungen Hippolytus‘ ermöglichen, während wir mit unseren Bibeln nie darauf kämen.
Michael Eichhorn und Alexander Basnar, Hermagor 2017
Zum Abschluss dieses Vorwortes wollen wir noch einen Auszug aus der Einleitung des Übersetzers Dr. Gröne von 1872 bringen, der schön zeigt, wie Hippolytus auch noch im 19.Jahrhundert von Gelehrten gesehen wurde: