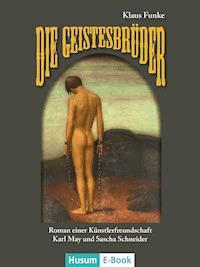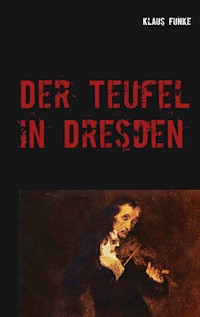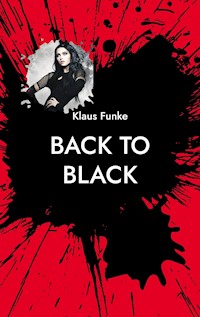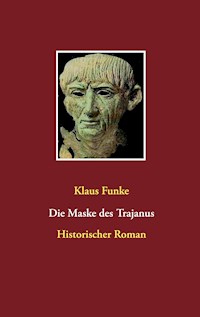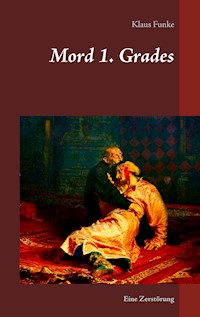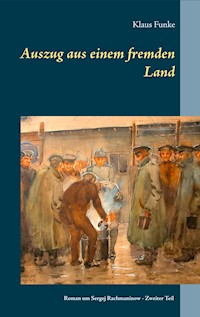7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zwei phantastische Erzählungen, beinahe Märchen, handeln von Wölfen und vom Teufel. Die erste berichtet von Wölfen im Oberlausitzer Revier und von einem Wildbiologen, den man sich aus Rumänien "ausgeborgt" hat. Mit unkonventionellen Methoden geht er zu Werke. Die Einheimischen finden ihn unheimlich. Kann er mit den Wölfen reden? Ist er eine Art Wehrwolf? Bald gibt es Konflikte mit den Behörden und der Jägerschaft. Als man die Wölfe vergrämen will, verschwinden sie ebenso wie der Rumäne. Die Region scheint noch nicht reif für wilde Wölfe... In der zweiten titelgebenden Erzählung erscheint kein Geringerer als der Teufel. Er mischt sich unter eine Urlaubsgesellschaft, es entstehen turbulente Szenen. Plötzlich glauben manche ihn auch schon woanders gesehen zu haben. Unerklärliches geschieht. Verwirrung bleibt zurück. Spannend und schaurig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Meinem lieben Freunde E.T.A. Hoffmann gewidmet
Zum Buch:
Zwei Fantasy - Erzählungen in der Tradition der deutschen Romantik. In der ersten wird von Wölfen erzählt, die in der Oberlausitz aufgetaucht sind. Man hat einen Wildbiologen aus Rumänien engagiert, dr den cdeutschen Kollegen zur Hand gehen soll. Doch der Mann ist ein Rätsel. Kann er mit Wölfen reden? Ist er gar ein Wehrwolf? Konflikte mit Behörden und Jägern eskalieren. Man will die Wölfe vertreiben. Der Rumäne hält zu den Wölfen. Wird er die Tiere retten können? In der zweiten Erzählung tritt der Teufel auf. Eine verwirrende und turbulente Geschichte wird erzählt. Schaurig und sehr spannend. Das Ende ist überraschend.
Zum Autor:
Klaus Funke, 1947 in Dresden geboren, ist dein bekannter Autor von Erzählungen, Novelllen und Romanen. Einige sind hier bei BoD erschienen. Darunter „Die Betrogenen“ – „Meine Verlage“ – Der Teufel in Dresden“
Inhaltsverzeichnis
Die Wölfe von Horkau
Das doppelte Ich
Die Wölfe von Horkau
Erzählung
Meine Aufzeichnungen sind undatiert, aber ich erinnere mich, sie begannen an einem heißen Junitag.
Der erste Satz lautet: Gerald D. hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis!
Heute rief er an und sagte mir genau das, und beinahe wörtlich, was er mir schon im April angekündigt hatte: Er möchte bis Ende August eine Reportage, einen Bericht, eine packende Story über das Wolfsprojekt im östlichen Deutschland herausbringen. Wenn die gut würde, könne er sich sogar eine Broschüre, ja ein Taschenbuch vorstellen. Nein, er wolle mich nicht ködern. Am Honorar würde das Vorhaben keinesfalls scheitern, fügte er generös an und bestellte mich für übermorgen in die Redaktion. Die schriftliche Vereinbarung wäre reine Formsache, lachte er, dann der Piepton, er hatte aufgelegt.
Zwei Tage später: Bin in die Redaktion gefahren. Gluthitze. Und bald ist der Siebenschläfertag. Das kann ein Sommer werden. Ich hasse Temperaturen über 28 Grad. Gerald D. residiert im fünften Stock. Riesige Glasfenster. Wunderbarer Ausblick von hier oben auf die Stadt und den Fluss. Bin beeindruckt. Auch vom Vertrag, den man mir anbot. Wirklich, das Honorar ist großzügig, überaus großzügig. Der Redakteur empfing mich mit einem geheimnisvollen Lächeln. Im Ministerium, sagte er wichtigtuerisch, wäre man an einem groß angelegten Artikel, einer Art Fortsetzungsgeschichte interessiert. Erfolge im Naturschutz wären politische Erfolge. Und dass diese Wölfe sich hier im Freistaat angesiedelt haben, käme einer Auszeichnung gleich. Auch international. Machen Sie was draus, rief Gerald D., breitete die Arme aus, es ist Ihre Chance. Und die Ihre, entgegnete ich. Wir lachten.
Am Nachmittag meldete ich mich dann in dieser Forschungsstation an. Keine Zeit, sagte man mir zunächst, wir telefonieren morgen wieder. Okay?
Nein, nicht auflegen. Ich bat, bettelte, erklärte. Schließlich hörte ich eine andere Stimme. Eine Frauenstimme. Ja, hier Elsa – Elsa Gluht. Wie die Glut nur mit „h“. Ich bin die Projektleiterin. Die Stimme klang angenehm. Irgendwie selbstbewusst, dennoch nett, freundlich, warm. Ja, am siebten Juli könne ich kommen.
Vier Wochen wollen Sie bleiben? Tatsächlich? Es ist eng bei uns. Und wir haben Besuch aus Rumänien. Ein Fachkollege. Ziemliche Kapazität. Radon Lupescu! Schon mal von ihm gehört? Nein? Also gut, dann bis zum siebten. Tschüß.
Wie befürchtet ist es tatsächlich furchtbar heiß heute, an diesem Siebenschläfertag. Habe den ganzen Tag Literatur gewälzt. Fachliteratur über Wölfe, überall liegen die Bücher und Zeitschriften. Renate hat den Kopf geschüttelt und ist zu ihrer Freundin gefahren. Wieder mal. Ich las und las, notierte. Habe mir eine Datei im Rechner angelegt. Wusste nicht, was es für Unmengen Geschriebenes zu diesem Thema gibt. Auch im Internet. Allerdings ist viel Phantasterei darunter, reiner Blödsinn und aufkeimender Kommerz. Wölfe scheinen eine Einnahmequelle zu werden. Habe mir allerhand Fragen notiert, fast fünfzig verschiedene, die man mir beantworten soll, dort in der Station, oder die ich selbst herausfinden will. Je nachdem.
Renate hat angerufen. Sie bleibt in Dohna bei ihrer Freundin. Ich wäre ja die nächsten Wochen sowieso zu nichts zu gebrauchen. Hätte das Wolfsfieber. Ja, stimmt. Sie hat Recht. Ein Fieber ist es, was mich zu packen beginnt.
In den Skizzen, die ich später zur einer Story zusammenfügen wollte, steht: Es ist jetzt elf Uhr am Vormittag. Ich habe beschlossen, jeden Tag, diese ganze Woche lang, etwas aufzuschreiben. Immer, wenn es geht, die Eindrücke des vergangenen Tages, auch Gehörtes, Erzähltes. Eine ganze zusammenhängende Geschichte. So, hoffe ich, geht nichts verloren und bleibt authentisch.
Bin also gestern am frühen Abend losgefahren. Würde gegen Mitternacht bei der Station ankommen. Unterwegs könnte ich ja noch eine Kleinigkeit essen. Irgendwo in einer Dorfkneipe. Ich soll nicht zu früh da sein, hat man mir gesagt. Auf dem Beifahrersitz habe ich den kleinen Voice-Rekorder bereit gelegt, um meine Eindrücke während der Fahrt festzuhalten. Einzelne Worte nur wollte ich draufsprechen, Stimmungen in Stichworten ...
Später, da war ich schon ein paar Tage in der Station und all die seltsamen Ereignisse hatten mich gefangen genommen, hörte ich das Band ab:
Meine Stimme klang fremd, die ersten Worte waren: Kleine Ortschaften, unter den deutschen Ortsnamen etwas kleiner ihre sorbische Entsprechung, niedrige Häuser, höchstens zweigeschossig. Dann beschrieb ich die Landschaft: Mischwald geht immer mehr in Kiefernwälder über, anfangs noch mit Laubbäumen. Birken, sogar Eichen sind darunter. Schließlich nur noch Kiefern, immer niedriger werdend. Sandhügel, dahinter stillgelegte Tagebaue. Am Horizont, jedoch nicht sehr weit, weiße, bauchige Wolken, dann sehe ich die Kühltürme des Kraftwerkes. Alles modern, die neusten Entstaubungsanlagen. Silberne Verkleidungen. Es blinkt in der untergehenden Sonne. Dann große Schneisen in den Kiefernwäldern, darüber schwingen Stromleitungen in die Ferne. Hier fließt er entlang, der östliche Strom, hin zur Hauptstadt, zu den Zentren, die nur wenige Hundert Kilometer entfernt liegen. Ich biege von der Bundesstraße ab und fahre weiter nach Osten. Im Rekorder höre ich meine Worte: Die Landschaft wird immer ursprünglicher, beinahe eine Heide, kleine Kiefern, vereinzelte Birken, niedrige Sträucher, trockenes Gras dazwischen. Ich durchfahre kleine Ortschaften...
Da ein Gasthof. Ich hielt an, schaltete den Recorder ab, stieg aus. Ein bemaltes Holzschild über der Tür, grellbunt, wie man es bei Schaustellern sehen kann. „Gasthof Zum letzten Wolf“ steht darauf, darunter ein von ungeübten Händen gemalter Wolfskopf. Zwei moderne Halogenleuchten links und rechts. Welch irrer Zufall, ausgerechnet dieser Gasthof auf meinem Weg zu den echten Wölfen, dachte ich belustigt, dann trat ich ein. Ich erinnere mich an die niedrige Gaststube: Gemütlich, Holztäfelung aus Fichtenimitat, an den Wänden Rehgehörne, Bilder von Jagden. Es roch nach Bier und kaltem Zigarrenrauch. In einer Ecke ein paar Einheimische. Misstrauisch schauten sie. Bei meinem Eintreten waren die Gespräche verstummt. Nur leises Radiogedudel kam von der Theke. Ein Ventilator summte. Dass man mir den Großstädter überall ansieht, war mir in diesem Moment peinlich. Vielleicht hätte ich doch nicht den modischen Blazer anziehen sollen. Ich nickte freundlich und setzte mich an den leeren Nachbartisch. Keine Reaktion, kein Gruß, man blickte schweigend zum Wirt. Der kam heran, legte die Speisekarte auf den Tisch, rückte das Kunstblumensträußchen zurecht. Ein Bier? Nein, einen Kaffee mit Milch und Sahne, wegen des Essens schaue ich in die Karte. In Ordnung. Er ging breitschultrig und schwer zur Theke. Ich schaute mich um. Auf einem der Fotografien eine Jägergruppe, vor ihnen, langgestreckt, die Zähne gefletscht, mit entblößten Zähnen – ein Wolf. Darunter in Kursivschrift, etwas ausgebleicht: Der letzte Wolf auf deutschem Boden! Ein unleserliches Datum. Wann ist denn das gewesen? fragte ich zum Nachbartisch und streckte den Arm nach dem Bild. Schweigen, feindselige Blicke. Das wees keener su genau, kam es vom Wirt hinter der Theke, aber mein Grußvater sagte, es wär im Sommer 1905 gewesen ...
Die Fahrt ging weiter. Es begann dunkel zu werden. Ich hörte meine Stimme vom Recorder: Geduckte Häuser wie man sie jenseits der Grenze auch in Polen findet. Manche im Backsteinbau, andere weiß angestrichen. Kleine Vorgärtchen, liebevoll gepflegt. Dann wieder verfallene Stallanlagen, eine zusammengestürzte Scheune, verkohlte Balken ragen wie Finger daraus empor. Seltsam, ich sehe nirgendwo Menschen. Ab und zu Gegenverkehr. Die Straße wird schmaler. Sie ist aus Betonplatten gefügt. Die Stöße erschüttern den Wagen. Der Wald rückt bis zum Straßenrand vor, einmündende Zufahrten mit rot-weißen Schranken, immer wieder Hinweisschilder: „Betreten und Befahren des Militärbezirkes verboten. Zuwiderhandlungen werden bestraft! Der Kommandant.“
Es wurde immer dunkler. Vom Horizont, den ich nur vor mir über der schnurgerade dahinführenden Straße sah, zog die Nacht herauf, verfärbte sich der Himmel vom Dunkelviolett zum Blauschwarz.
Das waren also die letzten Worte, die ich während der Hinfahrt aufgenommen hatte, doch der Recorder war eingeschalten geblieben, und so hörte ich vom Band in meinem Stübchen auf einmal wieder jenes andere Geräusch. Stark verrauscht und leise, aber dennoch gut zu verstehen.
Was für ein seltsamer Ton, hatte ich damals gedacht, während ich den eingeschalteten Recorder vollkommen vergessend ein Heulen gehört hatte, das wie eine Fabriksirene auf- und abschwoll, sich von tieferen Tönen bis zu ganz hohen steigerte, das einem Jodeln ähnlich war und plötzlich abbrach, um sofort, aus anderer Richtung kommend, wieder von vorn zu beginnen, etwas verändert zwar, aber doch deutlich dem ersten ähnlich.
Ich erinnerte mich, um ganz sicher zu sein, mich nicht verhört zu haben, dass es nicht etwa eine Sinnestäuschung gewesen wäre, hatte ich den Wagen angehalten, den Motor abgeschaltet. Vorsichtig kurbelte ich die Scheibe herunter und lauschte. Doch, da war nichts als die Stille der Nacht. Sollte es, dieses Heulen, dachte ich, tatsächlich nur in meiner Einbildung vorhanden gewesen sein, in meiner Vorstellung, die, seit ich meine Fahrt begonnen hatte immer intensiver geworden war, aber auch gestern und seit ein paar Tagen schon ganz von meiner neuen Arbeit bestimmt wurde, diesem Vorhaben, wie ich es nennen möchte, jener Reportage über das Wolfsprojekt im östlichen Deutschland. Ich löschte die Scheinwerfer, kletterte aus dem Auto, und stand nun am Rand des hell leuchtenden schnurgeraden Betonbandes inmitten des mit niedrigen Kiefern und Birken bestandenen weiten Waldgebietes, das sich schwarz und drohend zu beiden Seiten der Straße ins Unendliche dehnte. Ich schaute nach oben, sah den Sternen übersäten Himmel, sah das bleiche Gesicht des Mondes, das sich am Horizont eine Handbreit über die Wipfel der Bäume erhoben hatte. Es war ein und eine halbe Stunde vor Mitternacht, und wir schrieben den siebten Juli.
Was würde mich erwarten, dachte ich. Da vorn, irgendwo im Dunkel lag die Forschungsstation, zu der ich wollte. Etwas außerhalb des kleinen Dörfchens Horkau mitten im Walde, auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes fände ich sie, hatte man mir gesagt. Natürlich, in meinem Navigationsgerät könne ich vergeblich suchen. Eine wegwerfende Handbewegung folgte. Sowas hilft hier bei uns nischte, hier an der polnischen Grenze, wo das zivilisierte Europa trotz aller EU in Wahrheit zu Ende ist. Immer auf der Bundesstraße Richtung Boxberg müsse ich bleiben, dann, ungefähr zwei Kilometer vorm Ziel, an einer Weggabelung wäre ein Hinweisschild, scharf rechts führe die Straße weiter nach Boxberg, halb rechts ginge es nach Neudorf, dann links zum Bärwalder See, und geradeaus nach Horkau. Nicht zu übersehen. Im Ort könne ich dann fragen, vom Kind bis zum Greis, jeder wüsste wo die Wolfsstation wäre. Aus dem Dörfchen „naus“, würden sie sagen, dann auf den mit alten Betonplatten belegten Weg weiter in den Wald, „immer nei in de Kiefern“, irgendwann hören die Platten auf und es geht auf einem sandigen Weg weiter, keine Angst, breit genug für Ihr Auto, und, „wie nischte“ wäre ich da. Ich schaute auf das Leuchtzifferblatt meiner Uhr. In einer knappen Stunde also würde ich am Ziel sein.
Ich ging langsam auf den Wagen zu. Auf einmal hatte ich das Gefühl, nicht allein zu sein. Es beschlich mich diese Urangst, die in uns ist, seit fernen Jahrtausenden, diese Warnung vor unbestimmter Gefahr, die man nicht beschreiben kann, diese dumpfe Ahnung, nicht messbar, nicht greifbar und dennoch gegenwärtig. Ich fühlte, dass da neben mir im Unterholz des niedrigen Waldes etwas ist, dass da etwas lauert und mich beobachtet, mich im Blick hat, viel länger schon, als mir mein Unterbewusstsein die Warnung gegeben hat. Zu allem Unglück knackte es jetzt auch noch. Ja, da ist etwas, dachte ich, leise, kaum hörbar, aber doch nicht zu den Geräuschen der Nacht passend. Ein Zweiglein schien zerbrochen. Es barst und gab diesen Ton. Meine Nackenhaare standen aufrecht. Der Puls hämmerte in den Schläfen. Ich stand ganz still, lauschte und strengte die Augen an, versuchte das Dunkel zu durchdringen. Vor Anstrengung standen mir Tränen in den Augenwinkeln.
Und da sah ich es, dieses Etwas. Mir war, als schauten mich aus dem dichten Unterholz zwei glühende, metallisch leuchtende Pupillen an. Doch, nur für einen kurzen Augenblick, einen Lidschlag lang sah ich dieses Leuchten, dann verschwand die Erscheinung. Und im selben Moment hörte ich wieder diese auf- und abschwellenden Töne, wie eine klagende Melodie. Sie kamen von weit jenseits des Waldes. Aber sie waren deutlich und laut. Ein Winseln und Heulen, ein Jammern war darunter. Einem Stimmen von Instrumenten in einem großen Orchester glichen sie, diese Töne. Und dann einem großen Singen, Arien mit begleitendem Chor. Eine urzeitliche Musik, dachte ich. Vielleicht hat dieses Heulen, dieses Singen unsere Vorfahren zum Nachspiel auf ihren ersten knöchernen Instrumenten angeregt, ist dieser von tierischen Kehlen erzeugte vielstimmige Orchesterton der Widerklang einer frühgeschichtlichen Musik, ihr Anbeginn, dachte ich vor meinem Wagen stehend. Mich schauderte und ich war zugleich ergriffen, wollte fliehen, doch stand ich gebannt, vergaß für den Augenblick sogar die Erscheinung, die ich beobachtet hatte.
So also klingen sie, die Wölfe! dachte ich.
Seltsam, das Heulen war mit einem Mal verstummt, aber auch die Gefahr, dieses Etwas, das um mich gewesen war, schien verschwunden. Mit dem verklungenen Heulen schien die Angst besiegt. Es hatte mich irgendwie gestärkt, mir Kraft und Zuversicht gegeben. Ich fühlte mich wieder sicher. Tief sog ich die Nachtluft in die Lungen, schüttelte mich, wie ein Hund, der das Wasser aus seinem Fell vertreiben will, stieg in den Wagen und fuhr meinem Ziel entgegen ...
Ich war nach dieser seltsamen Begegnung noch eine dreiviertel Stunde gefahren, dann sah ich ein paar Lichter durch den Wald schimmern. Es waren die erleuchteten Fenster der Station, zu der ich wollte. Über eine kleine mit Schotter bedeckte Auffahrt fuhr ich in den Hof. An einem schiefen Tor, welches aus rostigem Maschendraht, notdürftig gehalten von einem Stahlrahmen, bestand, kam ich vorbei. Es stand weit offen, was mich wunderte. Ich parkte den Wagen vor dem Haus, über dessen Eingang ein kleines Lämpchen schaukelte. Nachdem ich ausgestiegen war, sah ich mich um. Aber es war so dunkel und die wenigen erleuchteten, auf den Hof reichenden Fensterchen reichten nicht aus, dass ich hätte etwas erkennen können. Gegenüber dem Haus schien eine Art Schuppen zu sein, vielleicht zum Unterstellen der Gerätschaften oder kleinerer Fahrzeuge. Neben dem Hauseingang eine verlassene Hundehütte. Eine in Windungen davor liegende Kette zeigte, dass der hier angebundene Hund frei umherlief oder vielleicht bei den Menschen im Haus war. Ich schlug die Wagentür zu, ein ziemlich lautes Geräusch um diese Zeit hier mitten im Wald, aber nichts rührte sich. Keiner kam aus dem Haus, um mich zu begrüßen. Ich schaute auf die Uhr, eine Viertelstunde über die vereinbarte Zeit war vergangen. Der Versuchung auf das Signalhorn zu drücken, widerstand ich. Sie mussten mich doch auch so gehört haben. Das ungute Gefühl, das ich auf der Fahrt hierher empfunden hatte, befiel mich wieder. Vielleicht wurde es auch dadurch ausgelöst, dass ich, als ich mich zur Seite, dem offenen Tor zuwandte, ein Knacken von Ästen jenseits dieses Tores zwischen den Bäumen vernahm, welches so klang, als sei jemand unachtsam auf trockenes Reisig getreten, und dieser Jemand musste von beachtlichem Körpergewicht sein, denn das Geräusch erklang mehrfach und verriet Unachtsamkeit oder Eile, ein kleineres Tier konnte es kaum sein, eher ein Wildschwein oder ein Mensch. Doch ich wandte mich dem Haus zu und ging hinein. Im Flur links und rechts große Bildtafeln über einheimische Wildtiere und die neu angesiedelten Wölfe, in einem Rahmen eine Auszeichnung des Ministeriums. Vor mir eine angelehnte Tür, dahinter hörte ich Stimmen, dazwischen Musik – eine Fernsehsendung oder eine Videovorführung vielleicht. Die Dielen knarrten als ich weiterlief, es roch nach trockenem Holz, irgendwie auch nach frischen Tannenzweigen und Zigaretten. Im Zimmer hinter der halb offenen Tür sah ich, als ich eintrat, zwei Menschen, ein Mann und eine Frau auf einfachen Stühlen, neben ihnen ein großer blaugrauer Weimaraner auf einer Decke. Er wandte mäßig interessiert den Kopf und beschaute mich aus seinen gelben Augen. Er gähnte, machte Anstalten aufzustehen. Der Mann und die Frau, beide rauchten hastig und nervös, starrten gebannt auf einen Bildschirm. Es lief ein Naturfilm. Irgendwie kamen mir die Landschaften vertraut vor, Heide, niedrige Kiefern, Sandwege, Ginsterbüsche, auf dem breiten Sandweg eine Wildspur, Trittsiegel von einem Wolf, die Kamera wanderte weiter, ein Menschenkopf erschien, es war der Kopf eben jener Frau, die jetzt gespannt vor dem Fernseher saß, ein Interview begann. Ich hüstelte. Der Hund stand endgültig auf, streckte sich und kam auf mich zu, er schnüffelte an meinem Hosenbein. Mit den Fingerspitzen kraulte ich ihm den Kopf. Ich räusperte mich lauter. Da wandte sich die Frau, eine hübsche, sportlich wirkende brünette Dreißigjährige, um, stutzte, lächelte, sprang von ihrem Stuhl auf.
Da, schau Frank, rief sie mit einem Lachen, unser Besuch ist angekommen.
Der Mann, Frank, ein blonder Hüne mit einem offenen Jungengesicht, war mit zwei Schritten bei mir. Er duzte mich. Sei willkommen, hier in unserer Einöde! Er klopfte mir kumpelhaft auf die Schultern. Ich stellte mich vor: Ich bin der Max! Und ich der Frank und das ist Elsa, unser Fernsehstar. Er zeigte auf den Bildschirm. Ich nickte, als ob ich Bescheid wüsste.
Komm setz dich. Er drückte die Zigarette aus. Willst du einen Happen essen? Oder ein Bier?
Ich setzte mich an den groben Tisch, auf dem eine Kamera, ein paar Landkarten und ein halb aufgezehrtes Abendbrot, bestehend aus zwei Bechern Joghurt, ein paar Äpfeln, weichem Bauernbrot und einem halben Brathähnchen stand.
Im Fernseher sagte der Sprecher, während wieder die Heidelandschaft und die breiten Sandwege gezeigt wurden: „Ein bisschen sieht es aus, als wäre hier kürzlich die Arche Noah beladen worden: Dutzende Spuren von Wildschweinen, Rehen, Hirschen und Hunden zeichnen sich auf dem Sandboden am Rande des Truppenübungsplatzes Oberlausitz ab. Und doch sticht für unsere Wildbiologen aus dem scheinbaren Wirrwarr eine Spur heraus: Ein junger Wolf ist vor kurzem in raschem Schritt über die Lichtung gelaufen. Eines von mittlerweile vermutlich 18 Tieren, die in der sächsischen Region an der Grenze zu Brandenburg und Polen, einzigartig in Deutschland, heimisch geworden sind. Eine Heimat gefunden haben hier mittlerweile auch Frank Schirmer und Elsa Gluht, inzwischen oft das «Wolfspärchen» genannt. Im Auftrag des Umweltministeriums beobachten die beiden seit Mitte vergangenen Jahres die ursprünglich aus Polen eingewanderten Wölfe und leisten Aufklärungsarbeit: Sie informieren die Öffentlichkeit über die Tiere und beraten Schäfer, wie sie ihre Herden vor den Räubern schützen können. So ganz nebenbei lenken sie mit ihrer Arbeit auch noch ein bisschen das Interesse auf die strukturschwache Region, wo die Wölfe den Tourismus ankurbeln könnten.“ Frank erklärte: Wir brauchen diese Filme. Du glaubst ja gar nicht, was für eine Agitation hier zu leisten ist. Manchmal sei es wie im Mittelalter, ergänzt er und zündet sich wieder eine Zigarette an, die unheimlichsten Geschichten würden erzählt, uralte Mythen und Legenden, dass einem das Blut in den Adern gefriere, und jedes neue tote Schaf, das sie hier mit aufgerissener Kehle fänden, gäbe neue Nahrung, selbst aufgeklärte Leute fielen immer wieder darauf herein. Sogar von Wehrwölfen und solchem Unsinn werde geredet, jawohl von Wehrwölfen, stell dir das vor, sie träten im Gefolge der Wölfe auf, sagt man, und geisterten als Gespenster durch unsere Wälder, fänden immer wieder neue Opfer, die sich dann ebenfalls in einen Wehrwolf verwandeln müssten. Frank schüttelt den blonden Lockenkopf. Erst gestern sei ein alter Schäfer ganz aufgeregt in die Station gekommen und hätte davon berichtet, wie ihm auf einem nächtlichen Kontrollgang ein solches Wesen begegnet sei. Rote Augen und furchterregende Zähne und einen halb aufrechten Gang, zottiges Fell. Zum Verrücktwerden, diese albernen Geschichten.
Erst nach dem dritten Schnaps, den ich ihm spendiert habe, lachte Frank, ist er wieder zu Verstand gekommen und abgezogen.
Nur gut, dass wir unseren Radon haben.
Wer denn dieser Radon wäre, fragte ich.
Radon? Radon Lupescu heißt er.
Ein lieber Gast aus Rumänien, antwortete Elsa, ein anerkannter Wolfsforscher, der uns hilft, die Station aufzubauen. Internationaler Wissenschaftleraustausch. Wir beide sind im vergangenen Jahr drei Monate in den Karpaten gewesen. Jetzt haben Sie uns Radon geschickt. Du wirst ihn noch kennen lernen. Zur Zeit macht er seinen abendlichen Kontrollgang. Doch, Du wirst Hunger haben, iss nur, sagt Elsa. Sie stand auf, tätschelte den Hund und ging zu einer Kochnische. Ich werd Dir einen Tee aufbrühen.
Während ich mir ein Stück von dem kalten Brathähnchen nehme, erzählte ich von der Reportage, die ich schreiben wollte, spreche von Organisatorischen, fragte nach Diesem und Jenem. Dann schauten wir alle drei noch ein Stück des Videos an. Elsa blickte auf die Uhr. Ich glaube, sagt sie, Radon kommt doch erst später. Vielleicht sogar erst, wenn der Tag graut. Frank nickt schweigend und gähnt. Elsa zu mir: Du wirst ihn morgen kennen lernen. Komm Max, ich will Dir Dein Zimmer zeigen, Du wirst müde sein. Und tatsächlich, ich war während der Filmvorführung ein paar Mal eingenickt.
Elsa führte mich über eine gewundene Holztreppe in den ersten Stock. Das Zimmer sah aus wie ein gemütliches Bauernstübchen. Holzgetäfelte Wände und eine Kassettendecke von heller Birke, ein schmuckes Schränkchen, ein Bett mit artigen blaukarierten Bezügen, dazu ein kleines dreibeiniges Tischchen mit einem dunkelblauen Deckchen, zwei Stühle, unter dem Fenster eine Kommode, links ein Wandregal, bestehend aus zwei Brettchen, die in einem Drahtgestell hingen, alle Holzteile in sandfarbener Birke - wie im Märchen dachte ich. Elsa zeigte mir, wo die Handtücher lagen und hinter einer Wandtür das winzige Bad.
Schlaf gut, sagte sie. Baldur (das war der Weimaraner Jagdhund) wird dich um sieben Uhr wecken. Dann war sie hinaus. Nicht einmal „Danke“ hatte ich gesagt, und „Gute Nacht“ auch nicht. Was wäre ich doch für ein ungehobelter Klotz, dachte ich.
Die Nacht war warm und ich hatte das Fenster, das zum Wald hinausschaute, geöffnet. Ich packte meine Tasche aus, brachte den Rasierapparat und die Waschutensilien ins Bad, legte den Schlafanzug wie ein ordentlicher Mensch aufs Bett. Dabei musste ich an Renate denken, ich stellte mir vor, wie sie lächeln würde, wenn sie mich so sähe. Plötzlich war ich nicht mehr müde. Also nahm ich den Labtop und wollte noch ein paar Seiten schreiben. Als ich vielleicht drei Seiten geschrieben hatte, ein Pensum, mit dem ich zufrieden war, klappte ich das Gerät zu. Aber jetzt hatte ich erst recht nicht die geringste Lust zum Schlafengehen. Ich schritt vor dem offenen Fenster hin und her und überdachte das soeben Geschriebene. Mitten in diesem Nachdenken, das mich gänzlich gefangen nahm, hörte ich ein Geräusch, das sich anhörte, als schleppe jemand unter großer Anstrengung einen schweren Gegenstand vom Waldrand zur Zaungrenze der Station. Dieser Jemand keuchte und zerrte, kleine Äste brachen, Laub raschelte. Es entstand eine Pause, doch kurze Zeit später war wieder das Keuchen und Zerren, das Schleppen und Rascheln zu hören. Der Weimaraner, der jetzt frei lief, war offenbar zum Zaun gestürmt. Von dort vernahm ich sein Knurren und dann wütendes Gebell. Ich trat ans Fenster. Doch, obwohl das Licht meines Zimmers ein wenig ins Dunkel vor dem Haus leuchtete, konnte ich nichts erkennen. Da dachte ich an meine Taschenlampe, die ich eingepackt hatte. Ich leuchtete hinunter und sah im Schein der Lampe zu meinem Entsetzen mitten im Laubwerk des dichten Unterholzes, wenige Meter vom Zaun entfernt, einen Menschenkopf. Die Erscheinung währte nur einen Augenblick, aber das eigenartige Aufblitzen der Augen, die meinem Blick begegneten, beeindruckten mich mehr, als ich sagen kann. Und, obwohl ich mir bewusst war, dies sei Unsinn, Phantasterei, ich sei nur übermüdet und es würde sich alles ganz sicher natürlich aufklären, fielen mir die Schauergeschichten wieder ein, die ich vor zwei Stunden unten von dem blonden Frank gehört, auch ähnliche Geschichten, Bücher, Filme, von denen ich wusste und von denen ich gelesen oder die ich vor langer Zeit gesehen hatte, ich dachte an Wehrwölfe und Lemuren, an Untote wie Graf Dracula, an aufgerissene Schafskehlen, verschwundene Kleinkinder, blutleere Jungfrauen und eine gewisse Unruhe befiel mich mit aller Macht. Ich fuhr unter hastigem Atmen zurück. Doch, als ich kurz darauf wieder ans Fenster trat, und ein paar wenige Worte, wie „He, Hallo“ oder „Wer ist da?“ oder „Zeigen Sie sich!“ hinab gerufen hatte, konnte ich nichts mehr entdecken. Die seltsame Erscheinung war verschwunden.
Die Tür wurde aufgerissen, Elsa kam herein. Was ist los? Ich habe unten noch gearbeitet, da hörte ich von hier oben deine Schreie.
Ich erzählte ihr, was vorgefallen war.
Du wirst dich getäuscht haben, sagte Elsa und lächelte, sie war mit schnellen Schritten zum Fenster gegangen, hatte sich hinausgebeugt, dann, rasch entschlossen, fast hastig, verriegelte sie es.
Nein, nein, antwortete ich, als sie mir wieder gegenüber stand, ganz unmöglich, ich habe ganz deutlich da unten im Unterholz vorm Zaun einen Menschen gesehen, einen Menschen, der sich ins Gebüsch duckte, als er sich entdeckt glaubte. Sie sind hier nahe der Grenze, passiert da nicht manchmal was? Asylanten, stammend von den wildesten Völkern, die durch Polen gezogen, die durch die Neiße gewatet sind, zu allem entschlossen, durstig, hungrig, ohne Geld, vielleicht auch Kriminelle, Gewaltverbrecher, Mörder, Diebe, Einbrecher, Betrüger ...
Ach Max, so reden sie an den Stammtischen. Was gibt´s denn hier zu holen? Nein, hier ist noch nichts vorgekommen, die ganze Zeit, die wir in der Station leben, nicht das Geringste. Fast zwei Jahre! Wir fühlen uns sicher, wir sind eine Forschungsstation. Wir sind harmlose Biologen. Wer sollte ...
Dann muss es jemand vom Hause sein, unterbrach ich sie. Vielleicht dieser Rumäne? Wie hieß er noch: Radon Lupescu!
Elsa starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ein flüchtiges Rot färbte ihr Wangen, sie senkte den Kopf, gab mir keine Antwort. Dann, im Hinausgehen, sagte sie leise, warum sollte sich Radon so verhalten. Nein, nein, Sie haben Gespenster gesehen, Max. Es war da nichts.
Aber ... aber der Hund? fragte ich, und es kam mir wie ein rettender Gedanke vor.
Baldur?? Der verbellt auch einen Igel, der durchs Laub raschelt. Nachts ist der Hund besonders nervös. Nein, nein, lieber Max, es war nichts. Leg dich nur hin und schlafe. Die erste Nacht im neuen Bett, solche Träume gehen in Erfüllung. Mit einem kleinen Seufzer ging sie hinaus.
Ich schlief wider Erwarten sehr gut und träumte weder von Wehrwölfen, noch von richtigen Wölfen, oder gar von Einbrechern.
Am Morgen, ich war tatsächlich von Baldurs kratzenden Hundepfoten geweckt worden, und jetzt, eine halbe Stunde später, als ich mit dem Rasieren gerade fertig, damit beschäftigt war, die richtige Kleidung auszuwählen, denn es war besprochen, ich sollte die Biologen auf einem Kontrollgang ins Revier begleiten, eben da klopfte es an der Tür. Ich öffnete und stand einem großgewachsenen, dunkelbärtigen, sehr schönem jungen Mann gegenüber. Er trug eine Art Kampfanzug mit braungrauem Tarnmuster, einen breiten ledernen Gürtel, umgehängt eine Kartentasche und an der Seite ein längeres Messer in kunstvoll gearbeiteter Scheide, in der Hand hielt er eine lange, gebogene Pfeife, wie sie in ländlichen Gegenden des Balkan und in den Bergdörfern der Karpaten unter den Dorfältesten üblich sind.
Ich komme, sagte er in gebrochenem Deutsch, um Sie persönlich zu begrüßen, und um Entschuldigung zu bitten, dass ich am gestrigen Abend so unhöflich gewesen bin, nicht da zu sein, als Sie hier ankamen. Meine Name ist Radon Lupescu. Ich stamme aus Rumänien und bin dort Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Reservat Sibiu. Ein Wolfsexperte! Er lachte.
Ich nickte freundlich, nannte meinen Namen und bat ihn einzutreten. Ich entgegnete, dass es im Gegenzug an mir wäre, mich zu bedanken, in den nächsten Tagen Gast der Station zu sein und dass ich schon jetzt dafür um Entschuldigung bitten müsse, infolge meiner Unerfahrenheit in Sachen Wildbiologie, allen eher eine Last, als tatkräftige Hilfe zu sein.
Er lächelte, verzog dann aber sein Gesicht, als ob er Schmerzen hätte, griff sich an die Schläfe, er bitte um Verzeihung, sagte er leise, aber ein immer wiederkehrendes Leiden plage ihn heute wieder seit den Morgenstunden. Eine Art Migräne. Nichts hülfe, nicht das stärkste Medikament. Manchmal dächte er, ihm zerspringe der Kopf, dann wieder könne er in einer Aufwallung von Hellsichtigkeit Dinge riechen und hören, die kein Mensch vermöchte und die er selber, sei der Anfall vorüber, ohne Gedächtnis wie einen flüchtigen Traum vergäße. Ach, verzeihen Sie mir, ich erzähle Ihnen langweilige Sachen. Wieder lächelte er. Dann, als ob er sich straffte und, indem er sich im Zimmer umsah, sagte er: Ich hoffe, Sie sind hier gut untergebracht. Unser bestes Zimmer. Elsa sorgt wie eine liebende Hausfrau für alles. Er räusperte sich und schwieg. Bitte vergessen Sie nie, fügte er nach kurzer Pause an, dass Sie hier beinahe in der Wildnis leben und unter Biologen geraten sind. Wir sind Barbaren, wir sehen alles nur durch die Brille unserer Wissenschaft.
Ich klopfte ihm jovial auf die Schulter und versicherte, ich hätte mich vom ersten Augenblick an höchst behaglich gefühlt. Eine kleine Portion Abenteuer und Romantik vertrüge ich als Stadtmensch gut. Im Gegenteil, sie sei sogar willkommen und wer sehne sich nicht danach. Die kleine Episode der Nacht hatte ich vollkommen vergessen. Und, während ich so mit jenem Radon Lupescu sprach, konnte ich mich nicht enthalten, ihn mit einer forschenden Neugier zu betrachten, die mir selber aufdringlich vorkam. Sein Blick, und dies war das Auffälligste an ihm, sein Blick hatte etwas Bannendes und zugleich jenes Flackern, so dass ich dadurch nun doch wieder an den Menschenblick denken musste, den ich in der Nacht vor dem Zaun im Unterholz gesehen hatte. Aber im selben Augenblick verwarf ich diesen Gedanken wieder, als ich bedachte, was dieser rumänische Wissenschaftler im Dunkeln und offenbar in geheimer Mission nächtens vor der Station zu schaffen haben könnte. Es war kaum annehmbar. Unmöglich. Eine optische Täuschung. Radon Lupescu hatte eine hohe, schön gewölbte, wenn auch etwas enge Stirn. Wie auch seine Augen, die von hellem faszinierendem Gelbgrün waren, sehr eng beieinander standen. Und ich konnte den Blick nicht abwenden von diesen schönen, wilden Augen, die mich, während wir so standen, immer wieder gemustert hatten. Doch jedes Mal, wenn sich unsere Blicke auf diese Weise trafen, und dies geschah, wie ich dachte, rein zufällig, jedes Mal mussten wir uns befangen abwenden. Plötzlich brach der Rumäne in ein Lachen aus, ein verlegenes, künstliches Lachen.
Sie haben mich wiedererkannt! sagte er.
Wiedererkannt? Wieso?
Nun, als ich heute Nacht von meinem Kontrollgang zurückkam, bin ich einer Wolfsspur, die direkt bis zur Grundstücksgrenze der Station, unmittelbar unter Ihr Fenster, führte, gefolgt. Sie war gewissermaßen noch warm, aber dann sah ich Sie am Fenster. Sie riefen und waren erschrocken. Freilich hätte ich mich zu erkennen geben sollen, hätte meinen Namen nennen oder ein Zeichen machen können, aber mir kam das Ganze so lächerlich und absurd vor, und, wie ich sagte, der Wolf war noch nicht weit, sodass ich mich versteckte und schwieg. Ich bin dann der Spur noch ein Stück nachgegangen, aber es war vergeblich. Der Wolf hatte das Weite gesucht. Und, als ich zum Haus zurückkam, war alles dunkel. Sie, wie auch die anderen, schliefen schon. Da bin ich still in mein Zimmer gegangen. So ist es gekommen, dass ich Sie erst jetzt begrüßen kann. Verzeihen Sie mir.
Alles dies hatte er in seinem gebrochenen Deutsch mit einem scherzhaften Lächeln vorgetragen; aber zugleich war er dabei über und über rot geworden und unverkennbar in ziemlicher Verlegenheit. Ich ließ mir nichts anmerken, woraus er hätte schließen können, dass ich an seinen Worten zweifle, ihn nicht ernst nähme, und brachte die Rede schnell auf ein anderes Thema.
Wann brechen wir auf? fragte ich, denn es sollte am heutigen Morgen ja hinaus in die Heidewildnis gegen. Ich würde ihn und Elsa auf einen Forschungsgang begleiten. Was soll ich mitnehmen? Fotoapparat? Den Voice-Recorder? Stiefel oder leichte Schuhe? Was empfehlen Sie?
Radon Lupescu lachte. Er schien erleichtert. Ja, Stiefel sind richtig. Den Rest haben wir. Wir treffen uns in einer halben Stunde auf dem Hof. Haben Sie schon gefrühstückt? Auf dem Weg ins Revier können wir dann auch ein wenig über Wissenschaftliches reden ...
Und über Ihre Heimat? Über Rumänien und die rumänischen Wölfe.
Natürlich, sagte er, gern gebe ich Auskunft.
Mit einem freudigen Lachen, das wie das übermütige Winseln eines Hundes klang, verließ er mich, schloss die Tür.
Als ich wieder allein war, verharrte ich unbeweglich in der Mitte des Zimmers. Ich fing an, ganz abwesend auf einen bestimmten Punkt an der Wand zu starren, und abgesehen, dass ich spürte wie meine Hände zu zittern begannen, bewegte ich mich nicht. Dies hielt bestimmt ein paar Minuten an.
Ich wandte mich um und sah in den Wandspiegel. Da stand ich nun und mir war, als sähe ich mich zum ersten Mal. Die untersetzte Gestalt, die bräunliche Gesichtsfarbe, den feinen, fast femininen Mund. Ich hob die linke Hand und sah den Ring, den mir Renate im letzten Winter geschenkt hatte. Unser Verlobungsring, hatte sie gesagt und den gleichen an ihre Hand gesteckt. Ich erwachte aus meinen Gedanken mit einem heftigen Ruck, einem so kräftigen, dass es so wirkte und mir im selben Moment so vorkam, als hätte ich mir diesen Ruck, obwohl mich doch niemand beobachtete, lange zurecht gelegt. Dann holte ich aus meinem Gepäck und dem Kommodenschubfach Personalausweis, Geldbörse, ein paar Bilder von Renate und mir, meine Hausschlüssel, die ich mitgenommen hatte, und meinen Taschenkalender – legte dies alles unter mein Kopfkissen. Ich nahm meine Armbanduhr vom Nachttisch und betrachtete sie lange, so als hätte ich sie noch nie zuvor gesehen. Schließlich band ich sie um. Nachdem ich mich vollständig angekleidet hatte, zog ich, schon an der Tür, den Ring vom Finger und legte ihn zu den anderen Sachen unters Kopfkissen. Bis heute weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin, derartige Handlungen, noch dazu mit einer für mich ungewohnten Feierlichkeit, vorzunehmen. Ich kann mir das nicht erklären und doch sind sie mir wie unauslöschliche Einzelheiten im Gedächtnis geblieben.
Unten, im Gemeinschaftsraum, in den ich am gestrigen Abend gleich nach meiner Ankunft getreten war, empfingen mich Elsa, Frank und Radon, die beisammen saßen und die Reste des Frühstücks verzehrten. Baldur, den Weimaraner, sah ich nicht. Na, gut geschlafen? rief mir Elsa entgegen. Tee oder Kaffee? Kaffee, mit Milch und Zucker, bitte, sagte ich. Mit Zucker? Igitt.
Sachse! antwortete ich und ließ meinen Blick von einem zum anderen schweifen. Ich hatte Heiterkeit erwartet, aber ich bemerkte eine gewisse Spannung, die allerdings nichts mit mir zu tun hatte, sondern, die wie ein unsichtbares Gas schon im Raum gewesen sein musste, bevor ich herunter gekommen war. Die Drei machten so ernste Gesichter, als ob es Streit gegeben hätte. Und tatsächlich waren die sonst so friedfertigen Menschen heftig aneinander geraten. Folgendes hatte sich zugetragen: Baldur war, nachdem er, wie jeden Tag Elsa und Frank geweckt hatte, einfach nicht zur Ruhe zu bringen. Er jagte in einem fort auf dem Hof herum, preschte hinters Haus, lief am Zaun entlang, schnüffelte, jaulte. Das Grundstück konnte er nicht verlassen, denn Radon hatte, nachdem er zwei Stunden nach Mitternacht von seinem Erkundungsgang zurückgekommen war, das Tor geschlossen. Elsa fiel die Unruhe des Hundes als erste auf, sie versuchte, ihn zu beruhigen, gab ihm Futter, kraulte ihm die Brust, was ihm sonst wie nichts behagte und meistens in eine friedliche Stimmung versetzte. Doch diesmal war ihre Mühe vergebens. Das Tier wuselte ununterbrochen herum, jaulte kurz auf, gönnte sich keine Ruhe. Auch kam es ihr vor, als ob der Hund Anstalten machte zur Tür von Radons Zimmer zu laufen, was er sonst niemals getan hatte, denn er mied den Rumänen, schien eine unerklärliche Schau vor ihm zu haben, was dazu geführt hatte, dass er ihn als einzigen am Morgen auch niemals weckte. Heute jedoch lief er ein paar Schritte in den Seitenflur, hin zu Radons Tür, aber dann besann er sich, winselte und machte wieder kehrt. Schließlich holte Elsa ihren Kollegen Frank. Zu Radon ging sie nicht, denn sie wusste, er war spät heim gekommen und würde noch ein wenig schlafen wollen. Frank, rief sie, als sie vor der Tür den Weimaraner kaum halten konnte, komm doch mal, irgendetwas stimmt nicht mit dem Hund, ich glaube er hat hinter dem Haus etwas gefunden, wir sollten das Tor öffnen und ihn loslassen. Frank kam herbei, auch ihm fiel die Aufgeregtheit des Hundes sofort auf. Er nickte zu Elsas Vorschlag und öffnete das Tor. Dann gab Elsa das Tier frei. Mit einem Jaulen stürmte Baldur zum Tor hinaus und dann nach links, am Zaun entlang, hinters Haus. Die Beiden rannten hinterher.
Direkt vor der hinteren Front des Hauses, ein paar Meter vom Zaun ab unter einem Haselnussstrauch sahen sie den Hund in der typischen Vorsteherhaltung verharren. Er hatte etwas gefunden, gab ein kurzes Bellen ab, wartete, sein kupierter Schwanzstummel zitterte vor Aufregung. Als Elsa und Frank heran waren, sahen sie den Fund. Es war ein totes Schaf, die Kehle von einem typischen Wolfsbiss aufgerissen, auch die Brust war aufgebrochen, die Lunge und Teile der Leber hingen in blutigen Fetzen heraus, das Herz fehlte. Scheiße! sagte Frank. Er wusste, ein ortsansässiger Bauer, Hippel war sein Name, hatte hinter dem Waldstück, ungefähr dreihundert Meter von hier, eine Schafskoppel angelegt, ordnungsgemäß, wie es sich in der Wolfsgegend gehörte, mit einem Lappen - und einem Elektrozaun. Sogar zwei weiße Wolfshunde hatte er sich auf Anraten und mit Fördergeldern des Staatlichen Forstamtes unterstützt angeschafft. Und nun das! Der Wolf, es musste ein ungewöhnlich starkes Tier gewesen sein, wahrscheinlich der Alpha-Rüde des hier lebenden Rudels, hatte sich nicht beirren lassen, das Schaf trotzdem gerissen und es bis hierher an die Zaungrenze der Station geschleppt. Dreihundert Meter durch dichtes Buschwerk und Unterholz. Eine unglaubliche Leistung. Das Schaf, ein kräftiger kastrierter Bock, brachte bestimmt das Doppelte des Körpergewichts seines Feindes auf die Waage. Doch, warum hatte der Wolf seine Beute hier in die Nähe der Forschungsstation gebracht. Das war ja unfehlbar die falsche Richtung, weg von seinem Rudel, in dem es seit dem Frühjahr sechs Welpen zu versorgen galt. Man stand vor einem Rätsel. Frank ging ins Haus, um Radon zu wecken und ihn von dem Vorfall zu unterrichten. Der war indes schon aufgestanden und in der Zwischenzeit bei mir gewesen, um mich zu begrüßen, jetzt kam er gerade in fröhlicher Stimmung die Treppe herunter. Ich selber hatte natürlich, durch das Gespräch mit Radon abgelenkt, und danach völlig in meine Gedanken versunken, von den Vorgängen draußen vor und hinterm Haus nichts bemerkt.
Also, Frank, in ziemlicher Hast und Aufregung, berichtete Radon von dem sonderbaren Schafsfund, er packte ihn an der Schulter und wollte ihn mit hinaus ins Freie ziehen. Das muss du dir anschauen, rief er immer wieder, einfach unglaublich. Doch der Rumäne machte sich frei, blieb stehen und sagte mit ziemlichen Unwillen, dass er zuerst frühstücken wolle. Das mit dem toten Schaf habe er schon in der Nacht festgestellt, als er den Wolf nach seinem Riss gestellt und dann bis hier vors Haus verfolgt habe. Wenn der Pressemensch, er zeigte mit dem Daumen nach oben, nicht so einen Lärm geschlagen hätte, dann hätte er auch noch feststellen können, ob dieser Wolf tatsächlich der Alpha-Rüde unseres Rudels gewesen sei.
Frank war sprachlos. Dann wurde er wütend. Er, Radon, habe das alles gewusst und sei trotzdem seelenruhig schlafen gegangen? Warum er sie nicht geweckt habe? Ob er sich vorstellen könne, was dieser Schafsriss wieder anrichten werde in den Dörfern ringsum? Er sei ja ein Fremder hier und werde im nächsten Monat wieder nach Rumänien zurückgehen. Sie aber, Frank und Elsa, blieben hier, und müssten es ausbaden. Es sei sicher, der Alpha-Rüde und niemand anderes sei der Schafskiller und er werde schließlich zum Abschuss freigegeben, zumindest müssten sie ihn einfangen und wegbringen. Vielleicht in eines dieser Wolfsgatter nach Bayern. Das fünfte Schaf hintereinander. So eine Scheiße!
Radon lachte. Warum dieses Geschrei? Was man ändern könne? Er schlüge vor, das Schaf einzugraben. Wenn es keiner fände, sei immerhin nicht zu beweisen, dass es ein Wolf gerissen habe. Der Streit begann.
So macht ihr das in Rumänien, vielleicht. Hier bei uns geht das nicht so einfach. Die Bauern und die Jäger werden mit Hunden kommen und die Schweißspur finden, schließlich den Kadaver. Unüberlegter Blödsinn!
Radon winkte ab, wollte weggehen.
Elsa kam hinzu. Ihr Gesicht war vom schnellen Laufen und von der Aufregung gerötet. Sie sah bezaubernd aus. Frank berichtete ihr in schnellen Worten, was er wusste. Du? brachte sie nur hervor und stand vor Radon wie ein kleines, ratloses Mädchen, du, du bist dem Wolf gefolgt?? Der Rumäne nickte und warf ihr einen langen Blick aus seinen hellen Augen zu, die auf einmal so seltsam wild und räuberisch glänzten, wie sie mir später gestand, dass sie unwillkürlich erschrak und erblasste. Oh, mein Gott, sagte Elsa, atmete tief und senkte den Kopf ...
Und so war die Stimmung an diesem Morgen getrübt, als ich mich an den Tisch setzte. Kein richtiges Gespräch kam zustande. Nach und nach erfuhr ich, was passiert war. Radon ging als erster zur Tagesordnung über. Er wollte mit mir und Elsa ins Revier, den Hund würde man mitnehmen. Frank solle, schlug er vor, und mit keinem Wort war vom Eingraben der Schafsleiche die Rede, Frank solle inzwischen die Formalitäten wegen des toten Schafes erledigen, den Bauern informieren, die Staatliche Untersuchungsanstalt anrufen, damit sie den Kadaver abholten und sezierten. Mittag wollte man sich zusammensetzen und alles in Ruhe besprechen. Eine Presseerklärung vorbereiten. Diese Sachlichkeit trug rasch zur Beruhigung der aufgeheizten Stimmung bei, und als Radon, Elsa und ich mit Jeep hinausfuhren, war beinahe alles wie immer.
Wir waren noch keine Viertelstunde unterwegs, fuhren auf einem breiten sandigen Weg durch den Wald, links und rechts niedrige Kiefernbestände, ab und zu ragte eine Birke einsam, wie eine weiße Jungfrau auf, da hielt Radon plötzlich den Wagen an. Er schaltete den Motor ab, legte zwei Finger vor den Mund. Die Sonne stand schon hoch. Kaum ein Lüftchen bewegte die flirrende Sommerhitze. Es war ganz still! Nur ein vorwitziger Erlenzeisig ließ von irgendwo in der Nähe seinen gedehnten Lockruf „di eh – di äh“ hören, bald antwortete ein anderer in dem lustigen, für den Zeisig typischen, Geschwätz - „didldidldidldätsch“. Sonst kein Laut. Der Rumäne schaute sich nach Baldur um, doch der Weimaraner, es schien als füge ihm der Blick Radons körperliche Schmerzen zu, verkroch sich ängstlich winzelnd unter die alte, filzige Decke, die im Fonds des Wagens immer für ihn bereit lag, blinzelte wie ein ertappter Sünder unsicher und nervös aus seinen bernsteinfarbenen Augen darunter hervor.
Radon flüsterte: Wir sind nicht allein! Gleich bekommen wir Besuch. Haltet den Hund fest! Und tatsächlich, es verging ein kurzer Augenblick, da kam von links, der breite Sandweg kreuzte eine grasbewachsene schnurgerade Schneise, ein Mann in einem von einem hochbeinigen Pferd gezogenen leichten Tafelwagen gefahren. Der Mann, ein beleibter, rotgesichtiger Mensch mit grauem borstigen Haar, war in einen froschgrünen Jagdanzug gekleidet. Neben sich auf dem Bock, in Griffweite, mit einem Lappen abgedeckt, ein doppelläufiges Jagdgewehr. Er erschrak, denn offenbar hatte er nicht mit einer Begegnung gerechnet, er zog die Zügel mit einem lauten „Hoh!“ straff und beruhigte seinen weiß zottigen, riesigen Hütehund, der hinter ihm auf den Wagenbrettern gelegen hatte, und nun beim Anhalten herab und auf uns zu springen wollte. Auch Baldur war hochgeschnellt. Er knurrte gefährlich. Ich musste alle Kraft aufwenden, um ihn festzuhalten.
Ah, der Herr Kampmann, rief Elsa, zu dieser Stunde hier auf dem Militärgelände. Ihr Revier liegt doch ein paar Kilometer weiter südlich. Bei Neudorf, nicht wahr? Und Radon, der aus dem Jeep geklettert war, ergänzte: Was suchen Sie hier? Sie wissen, Unbefugten ist es nicht gestattet, und mit dem Pferdewagen. Ein grober Leichtsinn!
Ach, was, fuhr ihn der Dicke an, wo jetzt die Wölfe wieder die Schafe reißen, trotz eurer Lappenzäune und Spezialhunde, und es immer schlimmer wird, von Tag zu Tag.
Was wollen Sie damit sagen? Radon ging langsam auf den Wagen des Jägers Kampmann zu, ich sah, wie er die Fäuste ballte.
Tu doch nicht so scheinheilig! Bauer Hippel, den ich heute morgen traf, sagte mir, dass erst heute nacht wieder einer seiner Merinoböcke verschwunden sei. Er wollte zu Ihnen in die Station kommen. Zwei bei Hippel, eines bei Knauer, eines bei Kempitz und eines bei Guntermann - fünf tote Schafe in zehn Tagen! Da muss etwas getan werden. Noch heute Abend werd ich den Verein zusammenrufen. Wir werden schon eine Abschussgenehmigung bekommen, verlass dich drauf, Du Karpatenlümmel, und, wenn wir keine bekommen, werden wir auch so zu handeln wissen.
Radon war noch näher an den Wagen herangetreten. Der Hund knurrte, zog die Nase kraus, fletschte die Zähne. Ruhig, Wotan, ruhig! sagte Kampmann und feixte vom Wagen herunter. Mit einem höhnischen Lächeln sagte er: Wart´s nur ab, mit euren Wölfen werden wir hier noch eher fertig, als ihr es euch träumen lasst!
Radon hob die Faust, der Hund bellte, Kampmann griff nach der Peitsche.
Da springt Elsa aus dem Wagen.
Herr Kampmann, sagt sie, während Radon ganz dunkelrot im Gesicht angelaufen ist, Herr Kampmann, wenden Sie bitte Ihr Wägelchen, sonst müssen wir Sie wegen unbefugten Befahrens des Militärgeländes anzeigen. Bitte, seien Sie vernünftig, und zu Radon sagt sie leise, aber nachdrücklich: Komm Radon, komm bitte!
Zwischen diesem Jäger Kampmann und Radon hatte es vor ein paar Wochen, das erfuhr ich später, eine sonderbares Zusammentreffen gegeben, welche das Verhältnis der Beiden bestimmen sollte:
Radon hatte mit Frank Schirmer in Neudorf im „Kretzscham“ gesessen. Es war ein anstrengender Tag gewesen und man wollte ein paar kühle Bier trinken. Radon hatte sich gerade eine Zeitung geholt, er las gerne deutsche Zeitungen, hielt diese in der Hand, schlug sie auseinander, als Slawo hereinkam. Slawo, der eigentlich Boguslaw Kapinski hieß, aus Zielona Gora stammte, aber schon seit Menschengedenken im Nachbarort Horkau wohnte, Slawo war ein etwas einfältiger Bursche, wenn auch nicht mehr jung, sondern schon mit grauem Haar und groben, vom Wetter, den Zigaretten und dem Alkohol gegerbten Zügen. Slawo lebte von Gelegenheitsarbeiten, schlug sich irgendwie durch und er führte in den Kneipen, auch schon auf dem Jahrmarkt in Boxberg, kleine Kunststückchen auf, für die er meist ein kleines Trinkgeld erhielt. Also, als Slawo ins „Kretzscham“ kam, saßen um die Tische noch ein paar Gäste, Bauern, Leute aus dem Dorf, sogar ein Forstarbeiter aus Horkau, zwei Bauleute, die auf Montage waren, eine dicke Frau mit einem blauroten Tuch um die Schultern, ein Verkaufsfahrer mit einer auffälligen Brille. Slawo schien allgemein bekannt zu sein, er grüßte höflich, fast ein wenig schüchtern, nach links und rechts, als er hereinkam, wurde aber von den Einheimischen mit lautem Rufen und Gelächter empfangen. Die dicke Frau sprang auf und verneigte sich mit einem Knicks, dann setzte sie sich schnell wieder hin und begann zu kichern.
Heute nicht, Frau Kubitza, heut nicht, kein Kunststückchen, nein, nein, keinen Auftritt, sagt er ausweichend zu ihr und wendet sich an den Wirt, der hinterm Tresen Gläser spült. Dazu nimmt er seine speckige Ledermütze ab: Ich hab die Kisten hochgestapelt, es müsste so gehen. Dann brauchen Sie mich wohl heut nicht mehr?
Nein, es ist gut, Slawo, antwortet der Wirt, für heute ist´s genug. Was willst du heut auch noch arbeiten? Es ist doch schon Feierabend.
Die letzten Worte hat er laut gesprochen und sich dabei mit seinen blitzenden Augen unter den Gästen umgeschaut.
Na gut, also, sagt Slawo schüchtern, knetet die Mütze in der Hand und tritt von der Theke weg.
Jetzt im Kneipenlicht sah man wie hässlich Slawo war, seine Augen wässrig und mit hängenden Unterlidern sahen wie Hundeaugen aus, das Haar filzig und ums Kinn, das unrasiert war, hing ein blauschwarzer Flaum. Die Kleidung, er trug einen verschlissenen blauen Arbeitsanzug, voller Ölflecke und Risse, unterstrich das abgerissene Aussehen. Slawo lief ein wenig schlotternd, was daran lag, dass er nach einem Unfall ein versehrtes Bein hatte. Wenn er vor einem stand oder sich unterhielt, sah er beständig zu Boden, selten, dass er einem voll ins Gesicht gesehen hätte.
Man rief ihn von einem entfernten Tische, ein Dicker mit einem rotglänzenden Speckgesicht winkt ihm zu und zeigt auf eine Bierflasche. Dies war der Jäger Franz Josef Kampmann, ein in der Gegend seit einem knappen halben Jahr bekannter Mann, laut, jähzornig, bauernschlau. Er hatte in Neudorf ein Anwesen gekauft und es in ganz kurzer Zeit prachtvoll ausgebaut. Eine Art Luxusjagdhütte, alles holzverkleidet, mit drei Natursteinkaminen. Man munkelte, er stamme aus dem Westerwald, habe hier im Osten eine Erbschaft angetreten. Nach den ersten Wolfsmeldungen hatte er einen Verein „Deutscher Wald- und Heimatschutz-Verein“ gegründet. Mit aller Macht ging er gegen das Wiederansiedlungsprojekt vor, versammelte Gleichgesinnte und Wolfsgegner um sich, machte Stimmung, erzählte Schauergeschichten. Die Einheimischen fürchteten sich vor ihm.
Kommen Sie, sagt er zu Slawo, der zögernd herangekommen ist, kommen Sie und trinken Sie ein Glas Hopfentee, außerdem will ich sehen, wie es Ihnen steht, ohne Ihre verdreckten Hosen umherzugehen.
Ehrerbietig, die Augen niedergeschlagen, immer noch die Ledermütze in der Hand, steht Slawo vor dem dicken Jägersmann. Als Radon vorbeikam, weil der seine Zeitungen wieder in den Ständer tun wollte, grüßte er ihn mit einem stillen Kopfnicken und bewegte ein kleinwenig seine Lippen.
Er flüstert dem Dicken zu: Nicht so laut, Herr Vorsitzender Kampmann, ich bitte Sie. Sehen Sie nicht, es sind Fremde da.
Jesusmaria, poltert der Jäger, ich wollte Sie doch bloß zu einem Bier einladen. Und jetzt maßregeln Sie mich, hier in dieser Kaschemme zu laut zu sein, he, ho? Der Wirt blickt von der Theke herüber, er lacht nicht.
Um Gotteswillen, sagt Slawo, nein, Sie missverstehen mich, ich bitte um Entschuldigung. Doch, wenn Fremde da sind, möchte ich nicht gerne wieder mit den alten Kindereien anfangen, und Bier kann ich heute auch nicht trinken, nicht jetzt.
Ach so, Sie lehnen ab, vornehm wie Sie sind. Der Herr kann jetzt kein Bier trinken? Na, so etwas.
Nein wirklich, danke. Ich, ich danke Ihnen, aber jetzt nicht.
Ho, ho, dröhnt der Dicke, also jetzt danken Sie mir nicht, wann beliebt der Herr mir dann zu danken, he, he, ho? Sind Sie was Besseres? Sind Sie von altem, polnischen Adel? Achten Sie lieber, wie Sie sich in der Öffentlichkeit ausdrücken, wenn Sie schon so fein tun.
Oh, mein Herr, aber Sie missverstehen mich tatsächlich wieder falsch.
Ha, ha, so ein Unsinn. Wie könnte ich Sie falsch missverstehen? Also so etwas - dann verstünde ich Sie doch richtig, nicht wahr? Was ist los, mit Ihnen? Sind Sie heute verwirrt, Herr Slawo?
Kampmann packt den kleinen, schwachen Mann an der Schulter und zieht ihn auf einen Stuhl, und Slawo sitzt auch einen kurzen Moment, springt aber nach ein paar Sekunden sofort wieder auf.
Nein, bitte, lassen Sie mich in Ruhe, sagte er, ich vertrage das Trinken schlecht in letzter Zeit. Früher hab ich mehr vertragen. Weiß der Teufel, woher das kommt, dass ich jetzt kaum mehr was trinken kann. Ehe ich mich versehe, eins, zwei, drei, bin ich schon betrunken und find mich nicht mehr zurecht.
Der Jäger Kampmann erhebt sich, sieht Slawo fest ins Gesicht, drückt ihm das Glas in die Hand, sagt: