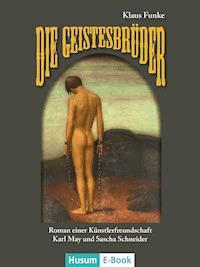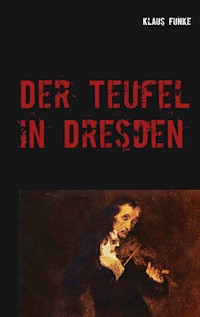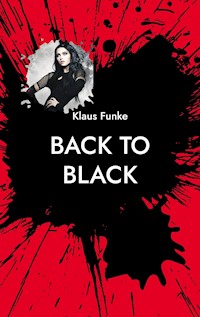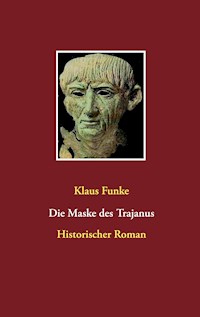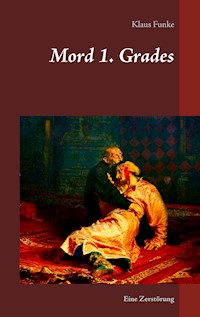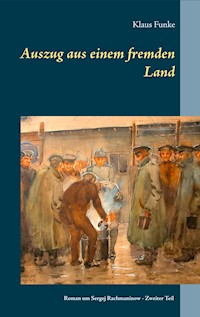7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman ist eine vielschichtige Suche nach Identität, mitten in aufregender Zeiten. Er ist die Suche nach sexueller Orientierung, nach dem Sinn politischer Einordnung und nach ganz persönlichem Glück. Brecht sagte: Doch die Verhältnisse, die waren nicht so. Da opfert einer seine Familie, sein kleines Glück, um anders zu sein, und scheitert daran. Ein anderer will dem nachspüren und das Warum herausfinden. Bei dieser Suche verändert er sich, wird beinahe zu dem, dessen Wesen er zu finden hofft. Das Buch ist ein politisches Buch, ein Krimi, ein Liebesroman. Alles in einem. Es ist schwer von diesem Buch fortzukommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Werde, der Du bist!
André Gide
Für Brita
und meine Töchter Cornelia und Corinna
Zum Buch:
Der Roman ist eine vielschichtige Suche nach Identität, mitten in aufregenden Zeiten. Er ist die Suche nach sexueller Orientierung, nach dem Sinn politischer Einordnung und nach ganz persönlichem Glück. Brecht sagte: Doch die Verhältnisse, die waren nicht so…
Da opfert einer seine Familie, sein kleines Glück, um anders zu sein – und scheitert daran. Ein anderer will dem nachspüren und das Warum herausfinden. Bei dieser Suche verändert er sich, wird beinahe zu dem, dessen Wesen er zu finden hofft.
Das Buch ist ein politisches Buch, ein Krimi, ein Liebesroman. Alles in einem. Es ist schwer von diesem Buch fortzukommen.
Der Autor:
„Wolfsuche“ ist Funkes allererster Roman. Bisher unveröffentlicht. Klaus Funke, inzwischen ein erfolgreicher Autor, ist 1947 in Dresden geboren.
Viele seiner Bücher sind wirkliche Bestseller geworden, darunter „Der Teufel in Dresden“, „Zeit für Unsterblichkeit“, „Am Ende war alles Musik“, „Die Geistesbrüder“, „Die Betrogenen“, „Franzi“, „Ich wollte König werden“ u.v.a.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
1
Zuerst war sie mir nicht aufgefallen, diese Frau in Schwarz.
Ein dunkler anonymer Fleck da draußen im bunten Strom der Passanten, der sich täglich an unserem kleinen Café vorbei schob.
Und natürlich hatte ich meine Augen und meine Aufmerksamkeit in erster Linie für meine Gäste. Ständig ging die Pendeltür. Gäste gingen, Gäste kamen: Guten Tag, meine Dame, erfreut Sie zu sehen, mein Herr, ich begrüße Sie, meine Herrschaften, wenn ich Sie hierher bitten darf. Hier die Karte von heute. Als Café Inhaber, Kellner, Büfettier, als Mädchen für alles, ist man immer beschäftigt, ständig in Bewegung. Die Augen eilen flink von Tisch zu Tisch. Nichts, nicht das Kleinste darf mir entgehen. Und doch gibt es Phasen der Ruhe. Meist im späten Vormittag. Es ist einfach nichts los. Wenig Gäste. Manchmal, für wenige Minuten oder mal eine halbe Stunde, ist das Café auch völlig leer. Ich lehnte dann am Büffé, las in irgendeiner Zeitung oder döste einfach so vor mich hin.
Mein Blick fiel in solchen Augenblicken auch durch die großen Fenster nach draußen auf die belebte Straße.
Und da habe ich sie gesehen, diese Frau.
Das Café, dem wir den einfachen Namen "Café petit" gegeben hatten, befand sich in der K...straße, gleich neben, oder besser: im Schatten der großen, altehrwürdigen Kirche gleichen Namens. Zusammen mit meinem Geschäftspartner und Freund Karl Gessner hatten wir, wenige Monate nach der neuen Einheit Deutschlands, die Idee, mitten in der City der sich rasch entwickelnden neuen Landeshauptstadt ein kleines Szene und Literatur Café einzurichten. Derartiges gab es zu diesen Zeiten noch nicht. Wir fanden ziemlich schnell die geeignete Lage, den Vermieter und eine Bank. Alles ging überraschend schnell und unkompliziert. Die Gäste kamen und mit Ihnen die Einnahmen und Umsätze. Wir stürzten uns in die Arbeit. Viel Streß, wenig Schlaf, nichts hielt uns auf, in diesen ersten Monaten und den folgenden zwei Jahren.
Erst dann kamen erste Kreditrückforderungen und die neuen Grundstückseigner und der schlimme Ärger, der uns schließlich zur Aufgabe zwang. Doch das ist eine andere Sache, die nicht hierher gehört.
Wenn ich heute dort, an unserem Café vorbei gehe, erinnern mich nur noch die zwei bunte Markisen, die den Gästen an vier kleinen Tischchen und den dazugehörigen Korbstühlen im Sommer Schatten und Erquickung spenden und die die Nachfolger von uns übernommen hatten, an unsere glückliche Zeit als Café Betreiber, an unser kleines Café „Petit" und an die merkwürdige Geschichte, die mich bis heute bewegt, und die mein Leben verändert hat.
Ja, durch sie bin ich ein anderer geworden, unmerklich am Anfang, doch in immer schnellerem Tempo zuletzt.
Es ist die Geschichte einer Suche. Der Suche nach der Identität eines Mannes, der sich in der Mitte seines Lebens selbst tötete und es ist die Suche nach mir, der ich ihm nachspürte und zuletzt mich in ihm selbst fand. So einfach und gleichzeitig so ungeheuer kompliziert ist sie, diese wahre Geschichte, die ich mit diesen Aufzeichnungen festhalten, dokumentieren und bewahren will.
Und sie begann in unserem Café mit dieser Frau in Schwarz.
Doch ich will versuchen, der Reihe nach zu erzählen.
Aber es fällt mir schwer, denn ich bin vollkommen ungeübt, eine solche Sache (diese merkwürdige und teilweise absurde Geschichte) aufzuschreiben, wie ich sie jetzt in Angriff nehmen will.
Schon seit längerer Zeit habe ich dies vor.
Tagelang sitze ich nun schon während der trübe dahin rinnenden Abendstunden in meiner kleinen Zweizimmerwohnung herum und quäle mich.
Wie fange ich es an? Wie schreibe ich das auf?
Wo beginnen, wo aufhören?
Und: Wer wird das jemals lesen? Wer noch außer mir? - denn in Wahrheit schreibe ich zuerst für mich.
Doch, genug dieser selbstquälerischen Gedanken!
Womit also beginnen?
Vielleicht mit der Beschreibung der näheren Umgebung des Cafés „Petit“. Das ist ein Einstieg, der mir leicht fällt und meine Gedanken sacht heran führt. Wie einen Wanderer zu seinem Ziel.
Wie ich weiter oben schon erwähnt habe, lag (das heißt: Es befindet sich bis zum heutigen Tag noch dort) unser kleines Café in der K...straße, unmittelbar neben der stadtbekannten Barockkirche gleichen Namens. Die K..straße ist nur sehr schmal; kaum zwei Autos kommen aneinander vorbei. Die Kirche dagegen aber ein gewaltiger Bau, so daß die Straße fast den ganzen Tag im Schatten liegt. Nur im Sommer und im späten Nachmittag erreichen die Sonnenstrahlen die grauen Granit Pflastersteine der Straße, die durch ihre Glimmer Einlagerungen silbern aufblitzen und vergolden dann auch die Straßenfront unseres Cafés und der Nachbarläden.
Jede Viertelstunde schlagen die Turmglocken der Kirche. Ihr Dröhnen und der lange Nachhall bestimmen den Rhythmus in ihrer Umgebung. Doch die Anwohner und auch wir kleinen Laden- und Cafébesitzer hören das schon nicht mehr. Ich glaube, wir wären über die Stille erschrocken, hätten diese Glocken einmal nicht mehr geschlagen.
Unser Café und der Laden nebenan bilden die Straßenfront und zugleich das halbe Erdgeschoß eines fünfstöckigen Gebäudes, das, in den Sechzigern erbaut, seit Anfang 1990 verschiedene Verwaltungseinheiten der evangelischen Landeskirche, kirchliche Vereine und ökumenische Einrichtungen beherbergt. Davor residierte in ihm seit seiner Erbauung die Stadtleitung der allmächtigen Einheitspartei. Aus dieser Zeit stammen auch die rot weißen Schranken, die Fahrzeuge aller Art an der freizügigen Einfahrt durch eine neben unserem Café gelegenen Hofeinfahrt hindern sollten. Auch am Eingangsportal des Hauses erinnern noch vier große Bohrlöcher, die man in den Sandstein getrieben hatte, um die rote Namenstafel der Einheitspartei für alle Ewigkeit zu befestigen, an diese früheren Zeiten. Damals gab es unser Café natürlich noch nicht. An seiner Stelle betrieb man ein Ledergeschäft, in dem man zwar kaum Leder, dafür aber jede Menge sogenanntes Kunstleder in allen Farben und Designs kaufen konnte.
Geht man an den großen in Jahrhunderten geschwärzten Sandsteinblöcken der Kirche entlang, kommt man auf den alten Markt der Stadt. Einem imposanten Platz, der von Wohnblöcken und Kaufhäusern im Stil der fünfziger Jahre umrahmt wird. Immer wieder fühlt man sich dabei an die ehemalige Berliner Stalinallee erinnert. Die gleiche pompöse Architektur, nur irgendwie stadttypischer und provinzieller. Auf der anderen Seite der Kirche hat der wuchtige Klotz des Rathauses mit seinem achtzig Meter hohem Turm und dem vergoldeten Mann darauf, der seinen rechten Arm gen Osten hebt, die Zeiten und den schlimmen Krieg überdauert.
An der Seite der Kirche, die der K...straße zugewandt ist, besteht das Trottoir nur aus schmalen Granitplatten, die zur Kirchenmauer hin stufenförmig angeordnet und erhöht sind. Die meisten Passanten benutzen daher die andere Seite des Fußweges, diejenige, auf der sich auch unser Café „Petit“ befand.
Eines Tages, es war einer jener schwülheißen Tage wie wir sie oft gegen Ende Juni hier im Elbtal erleben, kurz vor Mittag, stand ich am Büffet und blätterte in einer Boulevardzeitung. Im Café waren nur zwei Tische mit insgesamt drei Gästen besetzt. Nichts los, also. Die berühmte Saure Gurken Zeit im späten Vormittag. Außerdem war Vorsaison. Der Sturm der Touristen auf die Innenstadt hatte noch nicht eingesetzt. Wohl las ich die fettgedruckten Schlagzeilen in der Zeitung, aber, wie immer, hatte ich mit einem Auge den Gastraum im Blick.
Ich erinnere mich noch genau: Ich blätterte gerade eine Seite um, erfaßte aber den Inhalt nicht, denn mein Blick ging über den Zeitungsrand hinaus, zum Fenster und über die K...straße bis zum Mauersockel der Kirche. Die grau schwarzen Sandsteinquader der Außenmauer, hier und da ein heller Stein eingesetzt. Dies alles sah ich, und sah es auch wieder nicht, denn meine Gedanken umkreisten geschäftliche Probleme, eine Rechnung, die noch offen war und die Kassenabrechnung vom gestrigen Tag, die ein Minus von neununddreißig Mark aufwies. Besonders dieser Umstand beschäftigte mich intensiv, weil ich ihn mir nicht erklären konnte.
Im ersten Moment sah ich also nichts, doch dann signalisierte es in meinem Hirn. Dort, an der Mauer, gerade gegenüber von meinem Café, steht eine Frau in Schwarz und schaute unverwandt und starr nach einem der Stockwerke über uns. Der Passantenstrom, der in diesem Minuten wieder einsetzte, wälzte sich an ihr vorbei. Sie aber stand und starrte nach oben, unbeweglich, schwarz gekleidet, wie in einer griechischen Tragödie.
In diesem Augenblick kamen mehrere Gäste aus dem Strom der Passanten in das Café. Gin tonic, Mineralwasser, Cola, Eistee wurden bestellt. Ich hatte zu tun. Auch draußen unter den Markisen hatten sich einige Gäste in den Korbstühlen erschöpft nieder gelassen. Immer mehr drängten heran. Ich hätte zwei Arme und Beine mehr gebraucht, um alle Wünsche rasch zu befriedigen. Unter meiner Kellnerweste wurde mir heiß. Die Frau in Schwarz hatte ich wieder vollkommen vergessen. Bis zum Abend riss dann der Gästestrom nicht ab. Ein erfreulich hoher Umsatz für einen Vorsaison Tag. Spät noch rief ich meinen Partner Karl Gessner an. Heute hat die Kasse geklingelt. Wenn´s nur immer so wär. Dann gingen wir Bestellungen durch, verglichen Preise undsoweiter. Gegen halb zwölf sank ich müde und geschafft ins Bett.
Der nächste Tag, ein Donnerstag, brachte früh schon Schwüle, Gewitter und Regen.
Vormittags - wir öffneten um halb zehn Uhr - kaum Gäste. Wieder stand ich am Ausschank, den linken Ellenbogen auf das glänzende Metall der Anrichte gelegt, den Rücken bequem angelehnt, ein Bein lässig um das andere geschlagen, den Bleistift keck hinters rechte Ohr geklemmt und die bekannte Boulevardzeitung aufgeschlagen in den Händen. Wieder schaute ich über den Zeitungsrand. Doch im selben Moment, als ich dies tat, fiel mir die Frau in Schwarz von gestern ein. Ob sie wohl vielleicht auch wieder da stünde? Mein Blick fiel auf die Außenmauer der Kirche. Und richtig. Da stand sie wieder. Sie stand und starrte unbewegt auf eines der Fenster über unserem Café. Heute trug sie ein Kopftuch, ebenfalls in Schwarz, denn der Regen hatte noch nicht wieder aufgehört. Ich schaute nach links auf die Uhr des Rathausturmes. Sie zeigte dreiviertel elf. Die Pendeltür knarrte, zwei Frauen kamen ins Café. Sie setzten sich gleich neben Tür an einen der runden Marmortische und versperrten mir die Sicht. Außerdem beschäftigten sie mich: Sachertorte, Sahne, Kaffee, danach Eisbecher wieder mit Schlagsahne, schließlich zwei Kirch Whisky und dann noch zum Abschluß zwei Schoppen Rotwein, französischen, lieblich, wenn´s geht. Unwillkürlich fiel mir der Udo Jürgens Song ein. Dann klingelte das Telefon. Karl war dran. Er fragte nach irgendeinem Schreiben der Stadtverwaltung. Als ich wieder auf die Uhr schaute war es halb zwölf. Die Frau in Schwarz stand immer noch an der gleichen Stelle. Ich weiß nicht wieso, aber jetzt erfasste mich irgendein unbekanntes Grauen. Das jemand ein Haus anstarrt und dabei vielleicht die Zeit vergisst, soll ja vorkommen, dachte ich. Aber das dieser Jemand-oder in diesem Fall diese jemand-dies über eine dreiviertel Stunde tut, ohne sich von der Stelle zu bewegen, und dies schon mehrere Tage hintereinander (Denn es war ja gut möglich, dass ich diese Frau in den Tagen vorher nur nicht bemerkt hatte. Sie aber immer da war.), das schien mir nicht nur ungewöhnlich, sondern geheimnisvoll. Doch dann verwarf ich diese Gedanken wieder. Schließlich kann es auch etwas ganz Normales sein und ich überspannter Neurotiker sehe Seltsames und Grausiges, wo gar nichts zu entdecken ist. Das kommt davon, wenn man zuviel liest oder die Phantasie mit einem durchgeht. Ich wandte mich ab und meinen Gästen zu, denn inzwischen füllte sich der Gastraum wieder und ich wurde voll in Anspruch genommen.
Zwei Tage später, am Sonnabend, wir öffneten samstags erst um Zehn, hatte es sich eingeregnet. Es war der siebenundzwanzigste Juni, der Siebenschläfertag. Sieben Wochen Regen, dachte ich, dem alten Aberglauben anhängend. Das kann ja eine Saison werden. Umsatz adé. Im Café keine Menschenseele. Ich musste mich irgendwie beschäftigen. Also räumte ich um, begann die Tische noch mal gründlich zu reinigen, wischte in den Gläserregalen, schaltete die Radiosender durch. Überall die gleiche Dudelei. Schließlich fiel mir ein, dass ich die Grünpflanzen im Fenster etwas auszupfen und beschneiden könnte. Alte verdorrte Blätter entfernen, die Töpfe besser ins Licht drehen, etwas Wasser erneuern. Was man alles so tut, wenn keine Gäste kommen. Zufällig fiel mein Blick auf die Rathausuhr. Es war halb elf. Und gerade als ich diese Uhrzeit registrierte und den vergoldeten großen Zeiger länger als man das sonst tut, anstarrte, blitzte es mir durch´s Hirn. Ob sie wohl auch heute kommt, die geheimnisvolle Frau in Schwarz?
Das geht mit dem Teufel zu, dachte ich, denn just in diesem Moment stand diese Frau wieder an ihrem Platz. Es regnete stark. Sie hatte einen schwarzen Schirm aufgespannt. Ihre Augen aber starrten unbeweglich zu den oberen Fenstern. Deutlich sah ich die weißen Augäpfel und den halb offenen, verpressten Mund. Wie jemand, der stumm in sich hinein schluchzt.
Heute, mit dem Abstand von fast zwei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, wie diese Frau zu mir ins Café herein gekommen ist. Obwohl ich mich an alles, bis ins Kleinste erinnere, was danach geschah, an jedes ihrer Worte, jede Geste, ihr Gesicht, ihre Kleidung, ihr Haar, ihre Augen. All das kann ich bis heute haarklein rekonstruieren. Aber gerade diese Szene, wie sie in mein Café geriet, ist mir vollkommen entfallen.
So weiß ich beim besten Willen nicht mehr: Bin ich aus dem Café heraus und über die Straße gelaufen und habe die Frau wegen des starken Regens herein gebeten, oder war sie herüber gekommen und ich hielt nur die Pendeltür auf, um sie herein zu lassen? Irgendwie war ich an diesem Vorgang beteiligt.
Jedenfalls, sie trat ein, warf einen flüchtigen Prüfblick um sich und setzte sich nahe der Tür an einen Zweiertisch. Vorher hatte ich ihr aus dem vor Nässe glänzenden Mantel geholfen und den tropfenden Schirm weggestellt.
Ich stand neben ihr, beugte mich herab und gab Hinweise zum Angebot auf der Karte. Einen Obstkuchen vielleicht, oder ein leichtes Dessert, dazu Kaffee und einen Kirch vielleicht, zum Aufwärmen?, sagte ich mit betont sanfter Stimme und ließ einen besorgten Unterton mitklingen.
Natürlich, man kennt ältere Damen und ihre Wünsche. Man weiß wie man ihnen begegnen muß, was sie bestellen, welche Reihenfolge sie bei den verschiedensten Gerichten und Getränken bevorzugen und kennt ihre Café Haus Vorlieben. Schließlich gehörten sie zu meinen häufigsten Kunden. Soweit war das Routine von mir. Doch ich spürte vom ersten Augenblick an eine merkwürdige Sympathie und Wärme für diese Frau in Schwarz und eine kribblige Neugier, die ich mir bis zum heutigen Tag nicht erklären kann.
Sie mochte ungefähr sechzig Jahre oder etwas darüber sein. Ihr dunkles Haar, das von breiten silbrigen Streifen durchzogen war, hatte sie im Nacken zu einem Knoten gebunden. Darin steckte ein bräunlich marmorierter Schildpattkamm. Am unteren Haaransatz im Nacken hatten sich ein paar Strähnen gelöst. Sie kringelten sich in zierlichen Löckchen zum Hals hin, auf dem ich im zarten Faltennetz der Haut zwei oder drei dunkle Pigmentflecke bemerkte.
Ich hatte das Gefühl, dass sie sehr stark erregt war, dies sich aber unter keinen Umständen anmerken lassen wollte. Ihr ganzer Körper, die Haltung des Kopfes, die Arme und Hände, alles schien sie mit Aufbietung ihrer ganzen Willenskraft unter Kontrolle halten zu wollen. Ein unmerkliches, für einen oberflächlichen Betrachter kaum wahrnehmbares Zittern schien sie zu durchrieseln. Selbst ihren Atem ließ sie nur in kleinen, gepressten Stößen, wie von einem Ventil reguliert, aus Nase und dem halb geöffneten Mund.
Meine Worte hatte sie wohl wahrgenommen, wie man Laute und Stimmen im halb bewussten Zustand eben so hört, aber ich konnte nicht erkennen, dass sie sie auch verstanden hätte.
Immer noch stand ich deshalb leicht gebeugt neben ihr und unsere Körper waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Da wandte sie mir ihren Kopf mit einem plötzlichen Ruck zu. Ich zuckte zurück und mußte in diesem Moment wahrscheinlich einen ausgesprochen überraschten, um nicht zu sagen blöden, Gesichtsausdruck gezeigt haben, denn ihre eisgrauen Augen weiteten sich erstaunt für eine winzige Sekunde. Dann sagte sie, wie aus tiefen Gedanken auftauchend mit brüchiger und unsicherer Stimme:
Nein, bringen Sie mir bitte einen Tee und Biskuit. Keinen Alkohol.
Während sie dies sagte, starrte sie mich wie gebannt an und mir kam es vor als ob sie in meinem Antlitz irgendetwas gefunden hätte, was ihre Erinnerung sehr stark berührte. Ihr Blick hatte sich vom ersten Erstaunen über ein jähes Erkennen in einen maßlosen Schrecken verwandelt. Sie wurde noch bleicher als sie ohnehin schon war, öffnete den Mund und ihr Kopf, ihr Hals und die Hände begannen zu zittern. Doch das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, dann gewann sie ihre Beherrschung wieder. Ich zögerte einen Moment und antwortete betont ruhig und vertrauenswürdig mit dunkler, gesenkter Stimme:
Selbstverständlich, wie Sie wünschen, meine Dame.
Und ich trat ab.
Als ich das Gewünschte wenige Minuten später an ihren Tisch brachte, war eine junge Frau im Kelly Family Look mit zwei Kindern, einem Buben von vielleicht fünf Jahren und einem Mädchen im Alter von etwa sieben herein gekommen. Sie hatte sich zwei Tische weiter platziert und mir sofort zugerufen:
Einen Schoppen Rotwein, blaufränkischen, zwei große Cola und drei Fruchteisbecher!
Dann holte sie ein zerlesenes Taschenbuch aus ihrem kleinen Stadtrucksack und begann darin zu lesen. Das Mädchen, blondlockig und pausbäckig, hatte sich ebenfalls an den Tisch gesetzt, baumelte mit den Beinen und begann mit einer Barbie Puppe zu spielen. Der Bube inzwischen, wieselte im Café herum und postierte sich vor einem an der hinteren Wand befindlichen Spielautomaten. Dort stand er mit verschränkten Armen, die Beine gespreizt und rief seiner Mutter zu:
Ich will hier mal spielen, Mama.
Komm her, Du kriegst gleich eine Cola.
Will aber jetzt spielen.
Herkommen sollst Du, Arne.
Nein, spielen.
Da ich im selben Moment das von der jungen Frau Bestellte auf ihren Tisch absetzte, stand diese mit einem Ruck auf, lief mit schnellen Schritten zum Spielautomaten und zerrte ihren widerstrebenden Arne an den Tisch zurück.
Scheißcola, maulte der Kleine, bekam dafür eine Kopfnuß und kletterte auf seinen Stuhl, während seine Schwester schon mit einem Plasteröhrchen, die in einem Becher auf jedem Tisch bereit standen, aus ihrem dunkelsüßen Getränk laut hörbar schlürfte.
Die Frau in Schwarz, die diese Szene beobachtet hatte, zeigte ein winziges Lächeln, das sich durch kleine Fältchen in ihren Augenwinkeln verriet. Mir schien es, als ob sie sich mit einem fast krankhaften Bemühen gespannter Aufmerksamkeit, gerade auf diesen trotzigen Buben konzentrierte. All seine Bewegungen, seinen Widerspruch gegen die Mutter, jede Einzelheit war für sie offenbar von höchstem Interesse. Mit geweiteten Augen und einem manisch wirkenden, seltsam verzerrten Ausdruck im gelblichen, müden Gesicht. Aber ich bemerkte auch, dass sie ihren Blick ab und zu verstohlen auf mich richtete und mich, wenn sie sich unbeobachtet meinte, mit geradezu fotografischer Akribie musterte. Dabei glaubte ich in ihren Augen, ein eigentümliches Grauen glimmen zu sehen.
Arne, sitz doch mal gerade. Bekleckere dich nicht, sagte gerade die junge Mutter zu ihrem Buben. Dieser hatte mit der Kindern eignen Gabe, besonders herum zu kaspern und sich albern und auffällig zu benehmen, wenn sie Aufmerksamkeit verspüren, sehr wohl das Interesse der schwarzen Frau mitbekommen. Jetzt rutschte er erst recht auf dem Stuhl hin und her, sog mit gurgelndem Geräusch die braune Brühe in sich hinein, machte dabei ein Faxengesicht, schielte. Schließlich stampfte er seine Schwester unterm Tisch mit seiner hellbraunen Sandale, dass diese aufschrie und sich bei ihrer Mutter beklagte.
Arne, wenn Du jetzt nicht gleich ruhig sitzt, gehen wir und Du bekommst kein Eis, war die pädagogische Antwort.
Wenn ich doch aber an dem Automat spielen will.
Das geht doch nicht. Du bist zu klein, kommst gar nicht an die Hebel und Knöpfe.
Bin ich nicht.
Bist Du doch, echote die Schwester. Bums, wurde sie wieder gestoßen.
Aua, Mutti, der Arne.
Diese kleinen Familienturbulenzen gingen noch eine Weile, dann brachte ich das Eis und es wurde friedlicher. Schließlich bezahlte die Junge Frau und alle drei gingen nach draußen.
Noch einen Tee, die Dame?, fragte ich höflich, aber doch mit meinem freundlichsten Lächeln, obwohl ich wusste, dass sie nichts mehr nehmen würde.
Die eisgrauen Augen fixierten mich in einer Weise, dass ich mich unsicher und wie irritiert fühlte:
Haben Sie auch Kinder, einen Jungen, vielleicht, Herr
Ober?
Ich hob die Achseln, schüttelte den Kopf, verneinte.
Kinder sind das, was unserem Leben erst Sinn gibt, nicht wahr? Das einzig Wichtige. Oder? Sagen Sie, fügte sie nach einem tiefen Atemzug, die Worte ungewöhnlich dehnend hinzu: wie ist Ihr Name, Herr Ober? Verzeihen Sie, aber ich glaube, Sie...,
Hier brach Sie plötzlich ab.
Sie hatte dies alles mit einem so unendlich traurigen in sich gewandten Blick und ihrer brüchigen, kratzigen Stimme gesagt. Und nach einer mir endlos scheinenden Pause, die ich benutzte, um meine Fassung nicht zu verlieren und ein wenigstens einigermaßen verständiges Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern, kam von ihr in entschlossenem Ton: Was bin ich Ihnen schuldig?
Sieben fünfundsechzig. Und, ich heiße Fabio D. ich bin der Teilhaber in diesem Café und wie Sie sehen zugleich Kellner, Büffetier, Empfangschef, einfach Mädchen für alles. Mit diesen scherzenden Worten versuchte ich, wieder ganz Caféhaus Routinier, die etwas verkrampfte und peinliche Situation zu entspannen.
Die Dame lächelte müde. Ich half ihr in den Mantel, reichte ihr den Schirm mit einer leichten Verbeugung. Ein letzter prüfender Blick aus ihren eisgrauen Augen traf mich, dann knarrte die Pendeltür. Hinaus war sie. Einen Augenblick noch blieb ich unentschlossen stehen, grübelte.
Diese Sätze über Kinder und die Frage nach meinem Namen waren das Einzige, was ich an diesem Tag über sie erfahren hatte.
Nun sitze ich zu Hause, an meinem alten PC und versuche, aufzuschreiben, was mich damals bewegte, was ich dachte, was ich empfand, nach diesem ersten Kontakt mit der Frau in Schwarz, mit der Passantin von der K...kirche.
Der Cursor blinkt und es vergeht viel Zeit bis ich die richtigen Worte, Sätze finde, die das wiedergeben, was ich wirklich ausdrücken will. Alles verwischt sich, Vergangenes, Heutiges. Es ist schwer, sich zu konzentrieren.
Ich lege eine CD in den Player, Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 1, lehne mich zurück, schließe die Augen, Bilder tauchen auf, verschwinden wieder, aber sie kommen zurück. Ich sehe Vater und Mutter, besonders die Mutter. Jetzt: Nur noch die Mutter. Eine energische Frau mit eisgrauen Augen, dem markanten Gesicht und der langen, gebogenen Nase. Eisgraue Augen! War es das, was mich so unsicher machte?
Bilder malen, in alle Hefte, aber der Aufsatz, den ihr morgen abgeben müsst, den hast Du vergessen. Du Träumer, nichts wird aus Dir werden, rein gar nichts. Weiß Du denn nicht, was wichtig ist, im Leben. Das Wichtigste? Tränen, Geheul, weitere Schimpfworte, eine Waschschüssel mit kaltem Wasser. Ich bin bis aufs Hemd durchnäßt. Ihr Jähzorn, bis ins hohe Alter, ein schlimmer Fluch.
Was ist das Wichtigste im Leben? Wie ist Ihr Name,
Herr Ober?
Ich stehe auf, presse die Stirn an die kalte Fensterscheibe und schaue in das Dunkel da draußen. Gelbe, rötliche, blaue Vierecke, größere, kleinere leuchten durch die Nacht. Überall dahinter sind Menschen und gehen ihren abendlichen Verrichtungen nach. In ihren Menschenwaben, Termitenbauten aus Stein, Glas und Beton. Was für Gedanken, schwirrenden, winzigen Insekten gleich, mögen in diesem Augenblick in den Menschenköpfen geboren, wieder vergessen, gespeichert und wieder gelöscht werden? Was für Glück, was für Unglück wird aus ihnen hervor gehen?
Ein blinkender leuchtender Punkt schwebt am nächtlichen Himmel von Nord nach Süd. Irgendein Flugzeug. Wo mag es ankommen? Wird es erwartet? Freut man sich dort auf die Menschen, die es durch die Lüfte trägt? Wer sitzt da oben, im Bauch aus Aluminium und Stahl?
Eisgraue Augen, dunkles, grau gesträhntes, hinten geknotetes Haar. Sich kringelnde silberne Löckchen im Nacken. Eine Stimme brüchig und rau. Ohne einen erkennbaren Dialekt. Sechzig Jahre oder mehr. Wer ist diese Frau in Schwarz? Kinder sind das wichtigste, sind der eigentliche Sinn unseres Lebens? Eine trauernde Großmutter, die ihren Enkel, einen Buben von fünf Jahren, plötzlich verloren hat? Oder eine zu Tode betrübte Mutter, die hinauf schaut zu den Fenstern des Hauses, gerade über dem Café. Ich durchwühle mein Gedächtnis nach Einzelheiten, nach kleinen Bruchstücken, die mir womöglich entgangen sein könnten, die mir Rat geben, wer ist, was ist mit dieser Frau. Wieso hat sie mich so angestarrt? Durchbohrt mit einem Blick als ob sie in mir jemanden erkannt zu haben glaubt? Mein Name?
Wieder habe ich mit dem Schreiben aufgehört.
Die Uhr zeigt viertel nach Elf.
Ich gehe zu meinem Fischglas. Die vielen bunten Fischlein paddeln scheinbar planlos und ohne Sorgen darin herum. Manche jagen sich. Dann lassen sie wieder davon ab und schießen in eine andere Richtung weiter. Mein großer Gelber, ein prächtiger Malawi Barsch, steht ruhig in der Mitte des Beckens. Seine Kiemendeckel klappen gleichmäßig langsam auf und zu. Mit den Brustflossen rudert er, um seinen Standplatz zu halten. Manchmal rede ich mit ihm. Ob er das wahrnimmt? Natürlich erkenne ich keine Reaktion. Ab und zu bewegt er die schwarzen Fischaugen unabhängig voneinander nach oben und hinten. Alles geschieht ruhig und ohne Hast, ohne Aufregung und Hektik, die uns Menschen so zu schaffen macht. Was meinst Du, sage ich zu ihm, was hat es mit dieser Frau auf sich? Soll ich mich darüber aufregen, versuchen dahinter zu kommen und dabei selbst keine Ruhe finden? Der große gelbe Barsch, klappt sein Maul auf, als ob er gähne und gleitet dann ganz sacht und elegant in seine steinerne Wohnhöhle.
Ich will sie fragen. Ich muß es wissen. Mich plagt nicht nur Neugier, sondern auch eine unbestimmte Vorahnung von etwas, das für mich ganz wichtig und bedeutend zu sein scheint. Vielleicht sehe ich sie ja auch nicht wieder? Vielleicht war es nur eine Touristin? Nein, unmöglich.
Ich lege mich schlafen. Doch, ich wache in dieser Nacht drei vier Mal auf, grübele über gerade Geträumtes. Traum und Wirklichkeit vermischen sich. Mir ist als ob ich schliefe, doch dann glaube ich mich wach. Die Augen weit offen, blicken ins Dunkel des Zimmers.
2
Habe die letzten Eintragungen korrigiert und ergänzt.
Vier Tage hatte ich nichts mehr geschrieben.
Vorgestern bekam ich plötzlich einen Aushilfsshop im Hotel Maritim über einen alten Bekannten angeboten. Zwei Schichten in sechsunddreißig Stunden. Bin jetzt noch ziemlich müde und abgearbeitet. Fast ein Jahr geht das nun schon so: Mal einen Hilfsshop, dann ein paar Wochen zur Probe, am Ende wieder nichts.
Aber irgendwie muß ich doch leben, essen, mich kleiden, die Miete zahlen. Die kleine Unterstützung vom Staat reicht hinten und vorn nicht.
Heute war der Karl bei mir. Hat wieder tolle Ideen, der Junge. Erlebnisgastronomie, irgendwo auf dem Lande. Trotzdem wirkte er schlaff, Tränensäcke, gelbliche welke Haut. Die Haare noch mehr gelichtet und grauer. Ich werd´s mir überlegen, hab ich gesagt. Doch ich wusste sofort. Das wird nichts. Und ich fühle mich auch nicht frei für so was. Erst muß ich meine Geschichte zu Ende bringen, muß mir von der Seele schreiben, was ich wie eine Zentnerlast mit mir herumtrage. Zu nichts anderem habe ich Lust als zu dieser nervenaufreibenden, und vielleicht nutzlosen Schreiberei. Ich kann nicht anders, so lange ich bedrängt werde wie noch nie in meinem Leben.
Aber stimmt denn das, denkt ein anderes ich in mir.
Oder ist es nicht vielmehr die Furcht vor neuen Niederlagen, Anstrengungen und Plagen? Mach ich mir nur etwas vor? Rede ich mir das nur ein, nur um nicht das tun zu müssen, worauf es ankommt? Denn ich bin jetzt seit unserem vorzeitigen Aus schon fast zwei Jahre ohne feste Aufgabe, richtigen Job.
Mir fällt ein wie antriebslos und träge ich während der Studienzeit und auch in den ersten Wochen der Wende war.
Stundenlang kann ich meinen Fischen im Aquarium zuschauen, mich freuen an ihrer Wendigkeit und ihrer Gleichgültigkeit allen Aufregungen gegenüber. Oft habe ich in warmen Sommertagen an der Elbe gelegen und minutenlang einen Käfer bestaunt, der sich mühte, einen Grashalm hinauf zu klettern, oder auf dem Rücken liegend, die Veränderungen und phantastischen Wandlungen der Wolken betrachtet. Manchmal habe ich dann auch die Lider halb geschlossen und das Sonnenlicht durch die Tränenflüssigkeit der Augen wie einen Regenbogen schillern lassen.
Was wird nur aus Dir Du Träumer. Diese Frage habe ich in meiner Jugend allzu oft gehört.
Eine Woche war vergangen, seit jenem Sonnabend. Ich hatte keine Ruhe gefunden, mich zergrübelt, nachgedacht und war zu keinem vernünftigen Schluß gekommen. Wer ist diese Frau in Schwarz, was wollte sie, warum, ja warum hatte sie mich nach meinem Namen gefragt?
Wieder samstags Vormittag, wieder wenig oder über Viertelstunden keine Gäste.
Dabei hatte ich an diesem Tag eine Aushilfe. Eine Pauschalkraft, Studentin, viertes Semester, Psychologie. Ganz nettes Mädchen. Flink, freundlich, aber eben ohne das Feeling, was man als Bedienung in so einem Laden wie dem unseren braucht. Na, vielleicht bekommt sie´s noch mit. Karl hatte sie ausgegraben. Er meinte: Letztes Wochenende vor dem Ferienstart. Da geht die Saison los. Da wirst´e jemanden brauchen.
Das Wetter zeigte sich freundlich. Die süße, laue Luft des Spätfrühlingstages war selbst hier mitten in der Stadt zu spüren, zu riechen. Ich hatte die Pendeltür geöffnet, ihre Flügel festgehakt. Der Frühling strömte mit seiner ganzen Macht herein. Von fern tirillierte durch den beginnenden Großstadtlärm eine Amsel, die sich einen Platz hoch oben auf den Zinnen der Kirche gesucht hatte. Man fühlte sich von einer Freundlichkeit und einer unbestimmten Sehnsucht erfüllt. Am liebsten hätte ich das Café zugesperrt und wäre hinaus vor die Stadt ins üppig sprießende Grün und den betörenden Duft blühender Apfelhaine gefahren. Meine Seele durchwanderte die saftigen Elbwiesen, freute sich am zarten Grün der sanften, baumbewachsenen Hänge. Hoch oben die erste Lerche. Auf dem Flusses ein weißer Ausflugsdampfer. Fröhliche Stimmen, Lachen weht herüber.
Da plötzlich war sie wieder, die schwarze Fee. An ihrem alten Stammplatz, mit dem Rücken zur Außenmauer der Kirche, den traurigen Blick nach oben zu den Fenstern über dem Café gerichtet, stand sie, die unbekannte Frau in Schwarz.
Ein Schauer durchlief mich. Doch wie von einer magischen Kraft getrieben, stürzte ich auf die Straße, blieb vor ihr ein wenig außer Atem stehen und rief:
Wenn Sie Lust haben, darf ich Sie zu einer Tasse Tee und einem Likör einladen?
Für eine Sekunde erschrak sie, dann trat wieder der musternde, vergleichende Blick in ihre Augen. Doch sie nickte eine Spur verlegen und antwortete:
Ja, vielen Dank. Ich komme.
Wir gingen über die Straße und es kam mir vor als ginge ich mit einer alten Bekannten. Wie von einer Welle warmer Vertrautheit eingehüllt, fühlte ich diese alte Frau neben mir.
Sie setzte sich an den bekannten Tisch gleich neben der Tür und wartete, dass ich mit dem Angekündigten käme. Heute trug sie ein schwarzes Kostüm älteren Zuschnitts, was ihr jedoch vorteilhaft stand und die volle frauliche Figur angenehm zur Geltung brachte. Eine weiße Rüschenbluse, geschmückt mit einer fast modernen Brosche gab ihr ein elegantes Aussehen, das von einer zierlichen schwarzen Kappe, die sie mit mehreren Nadeln im Haar befestigt hatte, ergänzt und noch hervor gehoben wurde.
Als ich an ihren Tisch trat, hatte ich sofort den Eindruck, dass sie heute gelöster, befreiter und nicht mehr so abgesperrt wirkte wie vor einer Woche. Ihre Züge waren weicher, die Haut weniger blaß. Die eisgrauen Augen nicht so starr und stählern. Ich wagte einen Vorstoß, während ich den Tee eingoss:
Der Frühling ist selbst hier in der Stadt nicht zu unterdrücken. Man kann machen, was man will, aber es gelingt einem einfach nicht, bei so einem Wetter schlechte Laune zu kriegen. Sie gefallen mir heute viel besser als noch vor einer Woche, wenn es erlaubt ist, das zu sagen, meine Dame.
Sie schaute etwas verwundert zu mir auf, runzelte für einen Augenblick die Stirn.
Ich begann mich schon über mich zu ärgern; so ein geschraubter Quatsch!, und glaubte, sie könnte meinen, ich mache mich über sie lustig, da antwortete sie:
Sie haben recht. Daran könnte es liegen, doch ich glaube nicht.
Sie rührte mit dem Löffel im Tee, ihre hellen Augen suchten die meinen und unvermittelt sagte sie:
Ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Haben Sie einen Moment Zeit? Könnten Sie sich zu mir setzen?
Wieder stand ich, wie am letzten Samstag ein wenig verdattert und hilflos da. Und ohne zunächst weiter nachzudenken, rief ich, mechanisch fast, die Aushilfe: Yvonne, übernimm mal den Laden für eine Weile. Ich bin nur im Notfall da, wenn´s zu voll wird. Aber das glaube ich für die nächste Stunde nicht. Ich muß hier mal mit dieser Dame etwas... Den Rest murmelte ich unverständlich in mich hinein, zeigte aber dem Mädchen mit dem Daumen, dass ich jetzt dort bei der Dame in Schwarz zu finden sei. (Ich weiß, das mit dem Daumen, war eine Unhöflichkeit, aber auch ich bin eben nicht immer perfekt.) Dann rief ich noch: Bring mir bitte einen Kaffee!
Ich wartete stehend bis der Kaffee kam, setzte mich der Frau gegenüber und blickte sie erwartungsvoll an. Im Geist rekapitulierte ich ähnliche Situationen in meinem Leben. Wie verhält man sich jetzt? Muß ich betont natürlich, oder mehr herablassend wirken. Wie halte ich die Hände, den Kopf, wie setze ich mich? Wo blieb die Routine, auf die ich mir immer so viel einbildete. Ich fand keine vergleichbare Situation und wusste selbstverständlich nicht mit meinen Händen wohin. Mal drehte ich sie ineinander, mal fasste ich die Kaffeetasse an, dann strich ich über die Tischplatte. Schließlich fiel mit irgendetwas von Körpersprache ein. Ich hatte da vor kurzem etwas gelesen.
Ich lehnte mich also langsam zurück, nicht zu sehr, damit ich nicht überheblich wirkte, legte die linke Hand an den Henkel der Tasse, die rechte steckte ich in die Hosentasche, wo ich sofort nach dem Taschentuch griff, denn ich spürte, dass die Handfläche naß wurden. So mit mir beschäftigt, übersah ich, dass die Frau sehr wohl meine Unsicherheit bemerkt hatte und wartete bis ich so weit war, dass sie mich ansprechen konnte. Als ich nun aufblickte, fühlte ich mich ertappt, errötete und ein kalter Schauer Peinlichkeit fuhr mir den Rücken hinab.
Die Frau lächelte mich an wie einen Sohn, der sich zum ersten Mal den Schlips gebunden hat. Dann sagte sie, und ihre Stimme klang nicht mehr so brüchig und gepresst wie das letzte Mal:
Wissen Sie, ich bin eine alte Frau, und als ich abwehrend die Hände hob (hätte ich auch das nur unterlassen, denn ich fühlte, dass sie mich wie eine Mutter vollkommen durchschaute), schüttelte sie den Kopf: Doch, doch ich werde in diesem Herbst vierundsechzig. Wieder wollte ich eine höfliche Floskel, wie "das sieht man Ihnen ja gar nicht an" oder "ich hätte sie höchstens auf...geschätzt", einflechten, doch ich beherrschte mich im letzten Moment, biß mir auf die Lippen und schwieg unter einem leichten, mir angebracht scheinenden, Kopfnicken.
Da ist man nicht mehr so eitel, setzte sie fort und als ob sie erriete, was ich hatte sagen wollen; da ist man nicht mehr so sehr auf Komplimente aus, auch, wenn sie einem immer noch gut tun.
Wieder schwieg ich, diesmal mit einem zustimmenden Augenzwinkern.
Ich muß am vergangenen Samstag einen ziemlich verheerenden Eindruck auf Sie gemacht haben. Aber ich will es Ihnen erklären, obwohl mich nichts auf der Welt dazu zwingen könnte. Dennoch will ich es tun. Und zwar zunächst aus diesem Grund...
Und sie langte sich ihre Handtasche auf die Knie, knipste sie auf, holte eine zierliche Brieftasche daraus hervor, ergriff ein kleines Bild von der Größe einer halben Postkarte und schob es mir über den Tisch.
Deswegen!, sagte sie mit Entschlossenheit.
Ich nahm die Fotografie und erschrak. Ich musste förmlich zusammengezuckt sein, so dass mein Gegenüber triumphierend ausrief: Sehen Sie! Erstaunlich, nicht wahr?
Auf dem Bild lächelte mir ein Mann entgegen. Doch dieser Mann war ich. Etwa um die Mitte Dreißig, dunkles gewelltes Haar, das an den Schläfen schon die berühmten ausgefallenen Ecken zeigte. Dieselben starken geschwungenen Augenbrauen, der gleiche sinnliche Mund, die stark gewölbten Nasenflügel. Selbst die Augen, die gleiche Farbe, der gleiche blitzende Glanz darin. Auch die kleine Narbe an der linken Stirn fehlte nicht, nur war sie etwas länger und deutlicher als bei mir. Nur das Kinn hatte nicht diese Eckigkeit und Entschlossenheit, die ein Zeichen meiner Sturheit, aber auch ein Erbmerkmal meines Großvaters ist. Es war bei diesem Mann weicher, fraulicher fast.
Aber er lächelte wie ich, verzog den Mund wie ich es von meinen Passbildern her kenne.
Ich gab der Frau das Bild zurück, rückte ihr auf meinem Stuhl entgegen, vergaß Körpersprache und Verstellung und konnte nur noch ausrufen:
Phaah, das gibt´s doch gar nicht!
Ich habe es bis vor einer Woche auch nicht geglaubt. Nur deshalb, bin ich heute wieder gekommen. Ich wollte Sie noch mal sehen und kennenlernen, einen Mann, der meinem Sohn zum Verwechseln ähnlich sieht. Denn dieser da ist mein Sohn, und sie zeigte mit einem Finger auf die Fotografie. ...war mein Sohn, verbesserte sie nach einer kleinen Pause, in der sich ihr Gesicht wieder verdüstert hatte und die graue Blässe der vergangenen Woche zeigte.
Habe ich es mir doch gedacht, überlegte ich, nicht ohne einen Anflug von Altklugheit, und war erneut versucht eine Floskel wie "Oh, das tut mir aber leid. Mein herzlichstes Beileid!" los zu werden. Aber wieder beherrschte ich mich und schwieg.
Sie werden sich denken können, fuhr sie fort, dass ich mich das Ganze sehr durcheinander gebracht hat. Denn mein Sohn ist in diesem Haus, und sie zeigte mit dem Daumen nach oben, in diesem Haus ist er gestorben. Vor genau fünf Jahren. Jedes Jahr komme ich in dieser Zeit mehrmals hierher, um an ihn zu denken. Seit fünf Jahren immer im Juni. An die Stätte seines Todes. Und nie habe ich dieses Café betreten, außer in der letzten Woche. Und da sehe ich Sie. Sie, Herr Fabio D., an diesem Ort. Als ich Sie, als ich ihn, da wieder sah, glaubte ich für einen Moment an ein Wunder, ein Zeichen, ja, glaubte ich wieder an Gott. Wenn Sie sich vorstellen können, was ich damit meine. Nicht das ich besonders gläubig bin. Ich zahle nicht einmal mehr Kirchensteuer. Habe mit denen da, diesmal zeigte sie mit dem Daumen nach draußen, zur Kirche, nichts am Hut, wie es jetzt modern heißt. Aber im Herzen, wissen Sie, tief drin, da ist noch was von der Erziehung, dem lieben Gott, ein Rest von Halt, den man einfach braucht, in diesen Zeiten.
Wieder nickte ich stumm.
Er war mein Junge, mein Kind, immer mein Kind, trotz der Sorgen, der Nöte und der schlimmen Scham und Schande, die er uns, die er mir, bereitet hat. Der Älteste von dreien, die anderen sind im Abstand von zwei Jahren jünger. Sind Mädchen, seine Schwestern. Wolf, so hieß er, mein Junge, ein Achtmonatskind, war schwächlich und viel krank in den ersten Jahren. Was gab es auch schon in dieser Zeit nach dem Krieg. Nichts Richtiges zu essen, kein Obst, wenig Gemüse. Nicht wie heute, wo überall die Läden überquellen, fast platzen vom Überangebot. Andauernd mussten wir ihn umsorgen, den Wolf. Abwechselnd am Bett sitzen, mein Mann und ich. Auf jedes Hüsteln hörten wir danach, bei jedem Halsschmerz bekamen wir einen Schreck, dass es wieder eine Lungenentzündung werden könnte wie die, die er mit vier Jahren gerade so überlebt hatte. Wo es auf Messers Schneide stand, damals, ob er durchkommt oder nicht. Vielleicht ist er durch diese ewigen Zustand, immer umhegt, ständig umsorgt, immer scheinbar ein wenig mehr geliebt zu werden als seine Geschwister, so geworden, der er zum Schluß war: Ein weicher, schwacher Mensch mit dieser fatalen Neigung. Ich weiß es nicht.
Sie hatte nach diesen Worten ihren Kopf in die Hände gestützt und schwieg, schwer atmend eine kleine Weile. In meinem Kopf schwirrten die Gedanken, längst Vergessenes quoll an die Oberfläche. Das soeben Gehörte mischte sich mit Erinnerungen. Dein Großvater hat Dich verzogen. Es gab nur Dich für ihn. Die anderen zwei zählten gar nicht. Die blonden Locken und die dunklen Augen, ein Bild von einem Jungen. Ach, Du mein Gott. Einen Spiegelaffen hat er aus Dir gemacht. Jawohl. Einen selbst verliebten Narziß. Kein Wunder, dass Du Dich so entwickelt hast. Nur Dich gibt es als Maßstab, nichts sonst. Niemanden kannst Du je lieben außer Dich selbst. Ein weicher Schwächling, das ist aus Dir geworden. Ich sehe das markante Gesicht der Mutter, ihre lange, gebogene Nase. Die leidenschaftlichen, zornigen, eisgrauen Augen.
In meinem Kopf war es wie Watte. Wie von Ferne hörte ich die schwarze Frau mir gegenüber:
Am liebsten zog er Puppen an und aus. Was der für eine Menge Autos und Spielzeugindianer hatte. Aber nur ganz selten beschäftigte er sich mit ihnen. Einmal habe ich ihn erwischt, da stolzierte er in meinen Unterrock vor dem Spiegel hin und her. Ich glaube da war er elf oder zwölf. Mutti, warum bin ich kein Mädchen, hat er mich ganz unschuldig gefragt.....
Wieder machte sie eine Sprechpause. Ihr Blick schien nach innen gewandt. Die Haut blaß, sehr blaß.
Und als er dann kam, vollkommen zerstört, eine Woche vor seinem Tod war das. Seine Frau hatte sich von ihm getrennt, ihn davon gejagt, die Kindern zu ihren Eltern geschafft. Und was der Wolf für süße Kinder hat. Ich war so stolz. In der Firma, ach, was sage ich, in dieser furchtbaren Partei, denn in einer Firma war er ja nicht, da wollten sie ihn.......Er wusste nicht mehr wohin. Wie auf der Flucht fühle er sich...
Sie machte eine wegwerfende Geste.
....Er war hilflos, wusste wirklich nicht wohin. Sein Freund, dieser...., hatte sich schon einige Zeit vorher aus dem Staube gemacht. Da stand er nun vor mir, wie ein armer kleiner nasser Vogel, der sich verflogen hat. Mutti, hilf mir, hat er gesagt. Und ich? Wir haben nicht geholfen-damals lebte mein Mann noch-wir haben ihn fortgeschickt. Mit Dir, so hat mein Mann gebrüllt, obwohl er zu dieser Zeit auch schon fast am Ende war (Darmkrebs), mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Haben wir Dich nicht ordentlich erzogen? Haben wir Dich nicht verwöhnt? Mehr als die anderen. Nein, Wolf, das ist keine Veranlagung, wie Du uns weißmachen willst, das ist einfach nur Sauerei, Perversität, weiter nichts. Weil es euch zu gut geht, darum treibt ihr solche Dinge. Da musst Du schon allein durch. Nein, da helf ich Dir nicht...und Mutter auch nicht. Basta.
Und ich stand daneben, brachte kein Wort heraus. Ich, seine Mutter, half ihm nicht, stand ihm nicht bei.
Und eine Woche später.... da war er tot. Fast genau vor fünf Jahren. Hat sich umgebracht, da oben. Und sie zeigte mit dem Daumen in die Höhe. Sie schaute mir direkt in die Augen und ich sah wie sich bei ihr eine Träne löste und die blasse, welke Wange herab rollte. Doch dann setzte sie zornig und mit einem Ton der Rechtfertigung hinzu:
Die da oben, diese Einheitspartei, bei denen er "arbeitete" (sie dehnte das Wort arbeiten eigentümlich in die Länge und gab ihm einen zynischen Unterton), die haben ihm den Rest besorgt: Was hätten mein Mann und ich denn schon gekonnt. Er war ja aus dem Haus. Achtunddreißig Jahre alt. Was können alte Leute wie wir da noch tun oder ausrichten? Nein, die da oben waren es. Die haben meinen Wolf in den Tod getrieben. Glauben Sie das? He?
Und wieder schaute sie mich geradewegs an. Herausfordernd und nicht mehr so niedergeschlagen. Ich antwortete unbestimmt, unschlüssig:
Möglich, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich kannte die da oben (jetzt zeigte ich mit dem Daumen nach oben) nicht so gut.
Aber ich weiß es, sagte die alte Frau in eiferndem Ton, ganz genau sogar. Und ich könnte vielleicht einen Skandal herbeiführen... Aber, ach, das ist nun zu spät. Die da oben gibt es nicht mehr und mein Wolf wird davon auch nicht wieder lebendig.
Wieso, fragte ich
Weil er das letzte halbe Jahr eine Art Tagebuch geführt hat. Meine Schwiegertochter, die Gabriela, hat es mir kurz nach seinem Tod gebracht. Hat es auf den Küchentisch geworfen und ausgerufen: Da steht, was Dein Herr Sohn, so gedacht, gemacht und gelitten hat, dieser.....Kannst es behalten. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dieser Lump, mein Leben hat er zerstört. Und sie brach in Tränen aus. Wenn die Kinder später mal fragen: Was war mein Vater für ein Mensch. Oder deren Kinder: Was war der Opa für einer? Was, um Gottes Willen sag ich, sagt man, da? Er war ein Schwuler, hat seine Familie wegen eines Kerls verlassen? Hat sich am Ende umgebracht deswegen? Sagt man das? Oder ist es besser: Na ja, er war ein kranker Mann. Wir haben ihn sehr lieb gehabt. Trotzdem. Dann ist sie davon gerannt. Wir sehen uns nur noch ganz selten. Zu den Geburtstagen ab und zu. Ja, so ist das.
Aber ich habe diese Tagebuch gelesen. Wollte es lesen, verbesserte sie sich. Ich hab es nicht fertig gebracht. Habe es nicht vollständig durchgelesen. Da stehen Dinge drin, kann ich Ihnen sagen. Das ist nichts für mich alte Frau. Aber es beweißt eines: Die da oben haben einen gehörigen Anteil an seinem Tod. Die hätten es verhindern können, nicht ich, die arme, geplagte Mutter...oder mein Mann, der jetzt seine Ruhe hat.
Wissen Sie was, sagte die Frau mir gegenüber mit plötzlicher Entschlossenheit, ich werde Ihnen das Tagebuch bringen. Dann lesen Sie und stellen fest, die Alte hatte recht. Wollen Sie?
Ich weiß nicht. Das ist doch eine sehr private Sache, entgegnete ich vorsichtig.
Lesen Sie es. Ich sehe es Ihnen an, dass sie mir nicht so recht glauben wollen. Sie werden sehen, es ist genauso wie ich Ihnen sagte: Die da oben.....
Am Dienstag bringe ich es Ihnen. Einverstanden?
Ich nickte. Die alte Frau verabschiedete sich und ging hinaus.
Wie benommen saß ich eine Weile noch da. Den Kopf in die Hände gestützt.
Inzwischen hatte sich das Café erfreulich mit Gästen gefüllt. Die Studentin Yvonne lief mit schnellen Schritten hin und her und hatte alle Hände voll zu tun. Das schöne Frühlingswetter schien nicht alle Stadtbewohner in die reizvolle Umgebung zu verführen, sondern auch eine große Anzahl zu einem Stadtbummel zu verleiten, was uns zu Gute kam. Ich stand auf, band mir die rote Halbschürze um, das Dienstmerkmal unseres Hauses, und trat vom Büffet an den nächsten Tisch.
Einen wunderschönen guten Tag. Was wünschen die Herrschaften?
3
Wieder habe ich eine Schreibpause im Fall der Frau in Schwarz eingelegt.
Das zuletzt Geschriebene gefällt mir gar nicht. Am liebsten würde ich es löschen und neu formulieren. Doch, da ich ja beschlossen habe, nur für mich allein dieses alles nieder zu schreiben, lasse ich es stehen. Trotzdem bin ich unzufrieden.
Es wirkt so gedrängt, so kurzatmig und einseitig. Auch der Stil ist zu aggressiv.
Liest es ein Fremder, bekäme er sicher ein falsches Bild.
Die Frau in Schwarz, die mich noch immer beschäftigt, war eine vom Gram und Schmerz gebeugte, ja überwältigte Frau, die sich schuldig fühlte, im entscheidenden Moment für ihren unglücklichen Sohn nicht alles, in ihren Kräften Stehende getan zu haben. Das Bewusstsein dieser, ihrer Schuld traf sie härter als der eigentliche Tod ihres Wolf.
Dies glaube ich bis heute und tat es auch damals.
Nur, als ich dieses Gespräch niederschrieb, lebte alles mit plastischer Lebendigkeit wieder auf. Und ich fühlte wie sich diese Frau daran klammerte, dass sie diese, ihre Schuld mit jemandem teilen müsse, dass sie nicht allein diese Last zu tragen hätte. Ich hatte Verständnis für dieses Urbedürfnis der Verdrängung.
Doch dann habe ich dieses Tagebuch tatsächlich gelesen.
Und ein unbekanntes Gefühl des Grauens erfasste mich.
Er hatte unter uns gelebt, dieser unglückselige Mensch, namens Wolf Kirchner, mitten unter uns. Und sich gequält, selbst gequält. Und nicht gewusst wohin, zum Schluß, als sein Weg klar war und sich deutlich abzeichnete. Als er sich erkannt hatte, selbst, und seine unumkehrbare Veranlagung. Als ihn die anderen erkannten und ihn abstießen wie einen Aussätzigen, selbst seine nächsten Verwandten sich ihm kalt zeigten, ihn wie einem kranken, hilflosen schutzbedürftigen Tier die Hilfe verweigerten.
Deshalb habe ich eine Schreibpause eingelegt, ja, einlegen müssen.
Und ich habe diese Bekenntnisse nicht in einem Zug lesen können. Immer wieder legte ich Pausen ein, manchmal monatelang.
Und da ich meine Aufzeichnungen nicht datiert habe (ein unverzeihlicher Mangel, der meiner Unerfahrenheit zu schulden ist) und auch sonst keine Eintragungen, etwa in Kalendern oder sonstwo, geblieben sind, kann ich jetzt nicht genau sagen wie lange ich dazu eigentlich gebraucht habe. Das mag seltsam klingen, aber es ist die reine Wahrheit.
Viel hat sich ereignet, seit ich die ersten Eintragungen aufschlug. Unser Café ging Pleite, kaum daß es richtig lief (ich schrieb am Anfang darüber) und ich habe seither keinen richtigen Job mehr gehabt. Und ich habe nachgedacht, über mich, mein bisheriges Leben, habe mit mir selbst abgerechnet. Plus und minus, immer wieder. Es ist ein negativer Saldo geblieben bis jetzt.
Am letzten Sonntag fand ich vor meiner Tür ein junges Kätzchen, grau getigert mit weißem Brustlatz. Es miaute kläglich, war in einem erbärmlichen Zustand, verdreckt, naß und mit eingefallenen Flanken. Wahrscheinlich hatte es sich verlaufen und tagelang nichts mehr zu fressen bekommen. Um selbst, etwa Mäuse zu fangen, war es noch zu klein und daher unerfahren.
Ohne eigentlich zunächst recht zu wissen, was ich tun sollte, schloß ich auf. Wenn ich eine rechte Vorstellung davon gehabt hätte, was mich erwarten sollte, vielleicht hätte ich nicht so leichtfertig den Schlüssel im Schloß gedreht und den Weg in mein Reich, das ich bisher nur mit den stummen Fischen teilte, frei gemacht.
Doch kaum war die Tür einen wenige Zentimeter breiten Spalt auf, sprang sie auf, wand sich geschmeidig hindurch, den gestreiften Schwanz mit der weißen Spitze steil nach oben, und war in der Wohnung verschwunden.
Das ist nun fast eine Woche her und seit dieser Zeit lebt dieses Kätzchen, das ich Cleo genannt habe, bei mir.
Ich ging in meine kleine Küche, nahm einen Teller, goß Milch aus dem Kühlschrank hinein und rief: Kätzchen (ich hatte sie noch nicht Cleo getauft), Kätzchen, komm her. Es gibt Milch. Sie kam nicht. Auf ihren leisen Sametpfoten strich sie im Wohnzimmer umher, schnupperte mit ihrem rosa Näschen hier, guckte mit den Bernsteinaugen da hin und schmiegte sich im Vorbeigehen an Sessel, Stühle, Couch, Schrank, Commode, Tapete, an einfach alles. Sie liebt mich, sie will mir zeigen, dass sie meine Wohnung angenehm findet, dass es ihr bei mir gefällt, dachte ich begeistert. Erst später habe ich irgendwo gelesen, dieses Anschmiegen dient nur dem einen Zweck, ihre Duftmarken überall zu hinterlassen. Das Revier wird markiert.
Das ging so eine ziemliche Weile. Dann kam sie, vorsichtig und Schritt für Schritt in die Küche. Ich machte mich ganz klein. Hoffentlich trinkt sie die Milch, war meine größte Sorge. Erst blickte sie sich um, dann schnupperte sie am Teller, dann an der Milch, stippte ihre Barthaare versehentlich hinein. Prustete, schniefte und lief weg. Trinkt keine Milch, kennt sie nicht, dachte ich entsetzt. Wie, wenn sie auch nichts frisst. Dann muß sie wieder weg. Ins Tierheim.
Doch es renkte sich alles ein. Nach wenigen Tagen begannen wir uns zu verstehen, Cleo und ich. Man muß ihr nur Zeit lassen und sie muß von allein wollen.
Wie bei einer Frau.
Und mir fiel die Zeit ein, als ich noch mit einer Frau, mit meiner Frau zusammen lebte. Mit Luisa. Auch da war es so. Sagte man ihr etwas, oder forderte gar, tat sie das Gegenteil.
Dabei hatte es mit alles verstehender Liebe und Schwüren begonnen. Ich bin immer für Dich da. Wie man sich nur streiten kann, wenn man liebt. Du liebst mich doch, oder?
Über alles.
Ich kann nicht verstehen, dass man nicht ewig füreinander da sein kann und alles tut, was dem anderen Freude macht.
Ach, diese Blindheit am Anfang; man sieht sie nicht, die Realität. Es geht einfach nicht. Obwohl man anatomisch mit allem ausgerüstet ist, kann man nichts entdecken, nichts sehen, nichts hören, nichts verstehen, was einem später immer mehr stört, quält, verärgert und ergrimmt am einstmals geliebten Partner. Doch alles war von Anfang an da: Der Trotz, die Eitelkeit, die Verstellung, die Lüge und auch das Schniefen beim Essen, das Liegenlassen der Schlüpfer im Bad, der Drang nach Amüsement, der Flirt mit jedem Postboten, jedem Kollegen, all das, war schon da und häufte sich zu einem riesigen Vulkankrater von Konflikten, der erst rauchte, dann gelegentlich und später immer häufiger ausbrach. Bis man die Flucht ergreifen mußte.
Cleo sitzt auf dem Fensterbrett und schaut stur auf die Straße.
Ich weiß, jetzt brauche ich sie nicht zu rufen. Vor einer Weile kam sie zu mir und wollte gestreichelt werden, wollte schmusen, nach Katzenart. Da hatte ich keine Zeit und keine Lust. Beleidigt zog sie ab. Nun muß ich warten bis sie mich wieder ihrer Aufmerksamkeit würdigt. Das kann dauern.
Es liegt vor mir, dieses Tagebuch. Ein offenes Buch. Doch wie gehe ich damit um? Zwar fühle ich es in mir, doch ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, das alles zu verarbeiten, darzustellen, wieder zu geben, offen zu legen, auch, wenn es nur für mich sein sollte.
Und ich habe Angst. Angst vor mir selbst.
Vor Reflexionen, die dies auslösen wird, unweigerlich.
Sie werden aufsteigen in meinem Innern, Erinnerungen, dunkle und verdrängte, Unbewußtes, aufgespeichert seit Jahren. Ich werde nicht mehr derselbe sein, der ich vorher war.
Deshalb zögere ich, meine Niederschrift fortzusetzen. Es ist eine Folter dieses Schreiben. Man lebt mit dem, was man schreibt. Und die Wahrheit, die man sonst bequem im Alltag verdrängen kann, drängt sich ans Licht. Man häutet sich unter Schmerzen wie eine Schlange, gebiert qualvoll sein eigenes anderes Ich. Und kann doch nicht davon lassen. Es wird zur Sucht. Aber es ist die Hölle.
Am Einfachsten ist es, man hält sich an Fakten, an das, was war oder von dem man meinte, dass es so gewesen war. Gewesen sein mußte, denn das Gedächtnis hat es bewahrt. Man braucht nichts zu erfinden, erzählt einfach der Reihe nach. Ob mir dieses gelingt?
Wie war das also damals?
Pünktlich am Dienstag gegen Elf erschien die Frau in Schwarz, von der ich erst später durch die Aufzeichnungen ihres verstorbenen Sohnes Wolf erfahren sollte, dass sie Kirchner hieß, Melanie Kirchner, seit vier Jahren verwitwet war und in der Südvorstadt wohnte. Sie übergab mir die Tagebücher. Es waren insgesamt drei dicke grüne Schulhefte.
Lesen Sie das, und Sie werden mich, Sie werden alles, verstehen, sprach sie etwas atemlos zu mir, jetzt muß ich gleich weiter. Meine Adresse steht in einem der Hefte. Sie können sie mir ja zurückbringen, wenn Sie fertig sind. Auch, wenn es länger dauern sollte, würde ich mich freuen, Sie irgendwann wiederzusehen. Leben Sie wohl!
Fort war sie. Ein Rätsel, diese Frau. Ich blickte ihr nach, sah sie aber nur noch von weitem mit schnellen energischen Schritten um die Ecke der Kirche gehen.
(Und es sollte eine lange, lange Zeit vergehen ehe ich sie wieder sah, zu ihr ging, das Tagebuch zurück zu bringen. Nicht Wochen, nicht Monate, sondern mehrere Jahre.)
Bis zum Nachmittag habe ich es ausgehalten. Aber als gegen halb sechs (wir schließen in der Woche um einundzwanzig Uhr) gerade wieder kaum Gäste im Café saßen, griff ich in meine Aktenmappe (ein altes gutes Stück von echtem Leder, das ich noch von meinem Vater habe), suchte nach einer Nummerierung der Hefte, fand eines, auf dessen Außenhülle mit dickem Filzstift geschrieben war "Privataufzeichnungen Nr. 1" und begann darin hastig zu lesen. Immer mit einem halben Auge noch den Gastraum des Cafés im Blick.
Ich las also:
Ein Vorwort
(am 29.03.87 eingefügt)
Ab heute werde ich Buch führen, ja richtig wie ein Buchhalter, der alles einträgt in das Hauptbuch, plus und minus, Soll und Haben, den Saldo meines Lebens. Seit ich weiß, sicher weiß, dass sich in mir eine unumkehrbare Wandlung vollzogen hat, dass ich anders bin, nein, anders geworden bin als ich das noch vor kurzer Zeit je geglaubt hätte, will ich davon berichten wie ich Schritt für Schritt in diese Richtung gegangen bin, halb bewusst, halb unbewusst, und wie mein Leben jetzt so radikal verändert ist, dass ich nicht sagen kann, ob ich das alles durchstehe. Aber ich werde es aufschreiben, um der Wahrhaftigkeit willen.
Als ich diese Aufzeichnungen begann, was ich zunächst aus Neugier auf mich selbst tat, konnte ich noch nicht ahnen wie dramatisch, wie schrecklich kompliziert sich alles entwickeln würde.
Weiter kam ich nicht, denn das Café hatte sich in der Zwischenzeit so gefüllt, dass ich nicht mehr weiter lesen konnte. Auch verfügte ich an diesem Tag nicht über die fleißige Aushilfe vom Wochenende.
Doch während ich die Gäste bediente und dann abends kurz vor Schluß noch mit Karl die Bestellung und die Einnahmen am Telefon durchging, eigentlich todmüde und abgespannt war, konnte ich nur an eines denken, was stand in diesen Tagebüchern. Ich war bespannt wie früher als Oberschüler, als ich von einem Kumpel ein zerlesenes Exemplar von Edgar Wallace "Der Grüne Bogenschütze" geborgt bekam und nur noch fieberte, dieses Büchlein zu Ende zu lesen.
Ich eilte nach Hause, warf Jacke, Tasche, Mütze und Schuhe achtlos von mir, vergrub mich in mein altes, knarrendes Ledersofa und las:
3. Januar 1987
Der erste Arbeitstag nach diesen hässlichen Feiertagen und dem verkorksten Sylvester. Ich kann diese Familienseeligkeit nicht mehr ertragen. Die Eltern waren da, wir sind zu den Schwiegereltern gefahren, Bruder, Schwester, Schwager und die Kinder. Alles bunt durcheinander gewürfelt. Warum tut man sich das an? Warum fährt man nicht mit Frau und Kindern irgendwohin, in den Winter, in die Berge oder an die Ostsee? Oder auch ganz allein zu sein, könnte ich mir an solchen Tagen vorstellen. Auch ohne Gabriela, jawohl, ganz ohne sie. Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, sie kann mit mir nur friedlich zusammen sein, wenn andere drum herum sind. Kaum sind wir allein miteinander, gibt es Krach. Auch gestern wieder als der ganze Festtagstrubel vorbei war. Und die Anlässe dafür werden immer kleiner, immer winziger. Ich glaube, wir streiten uns eines Tages, weil es ein bestimmter Wochentag ist oder, weil der Wetterdienst ein Hochdruckgebiet und kein Tief angekündigt hat. Gestern war es ein zerbrochenes Bierglas. Was wird es heute sein, dachte ich noch gestern? Warum verstehen wir uns nicht mehr? Seit zehn Jahren sind wir verheiratet. Seit acht Jahren sind wir zu dritt, da ist der Junge, der Conrad, dazu gekommen. Und seit fünf Jahren eine vierköpfige Familie, weil das Mädel, die Constanze, geboren wurde. Eine statistische Musterfamilie. Vierpersonenhaushalt.
Wir sollten eigentlich glücklich sein. Denn wir haben alles: Eine Neubau-Plattenbau-Wohnung mit allem Komfort, einen Trabant-Kombi, einen Garten. Ich habe meine Bierdeckel und Briefmarkensammlung. Gabriela strickt wie eine Besessene. Mützen und Schals für die Kinder, Pullover für mich, reizende Sachen für sich, für ihre Mutter, die Schwiegermutter, für alle. Und wir waren auch glücklich. Bis vor einem Jahr, etwa. Dann ging irgendetwas in die Brüche. Aber was? Bin auch ich daran schuld? Was ist mein Anteil? Seit heute abend weiß ich, was es sein könnte, was es ist.
Doch, ich will mich nicht verplaudern, sondern versuchen, im Zusammenhang zu berichten.