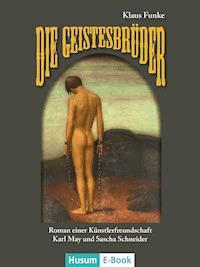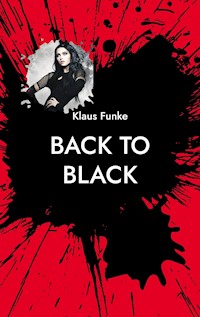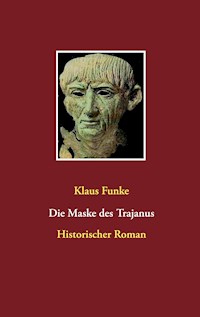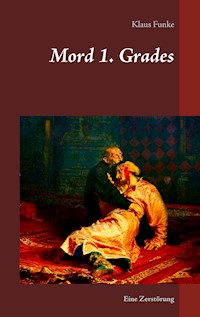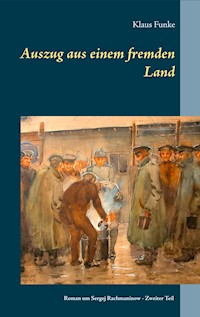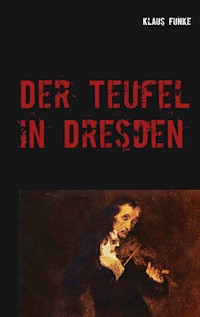
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Tage im Leben des genialen Geigers und Komponisten Niccolo Paganini und doch wird ein ganzes Künstlerleben vor dem Leser ausgebreitet. Paganini, ein von Gott Berührter, ein Jahrtausendgenie, der mit seinem virtuosen Spiel eine ganze Musikepoche angestoßen hat, geht im Jahre 1829 auf Deutschlandtournee und zwingt sich mit seiner Geige die Residenzstadt des Königreichs Sachsen zu Füßen. Seine Introvertiertheit beschäftigen Adel und Bürgertum, Dienstmädchen und Pferdekutscher und umhüllen ihn mit Schauergeschichten. Der Teufel in Dresden ist ein von atemloser Spannung geprägtes, farbig grotesk erzähltes Stück Musikgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor: Klaus Funke, geboren in Dresden, Autor erfolgreicher Romane und Erzählungen (Am Ende war alles Musik – Zeit für Unsterblichkeit – Der Abschied oder Parsifals Ende – Die Geistesbrüder – Heimgang – u.a.). Mit „Der Teufel in Dresden“ legte Funke einen Paganini-Roman vor, der im deutschsprachigen Raum große Beachtung fand.
Inhaltsverzeichnis
Introduzione
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Introduzione
Seeluft, frisch, verwegen und verlockend weht vom Hafen in die engen Gassen der Stadt, doch schwingt darin auch wie immer jener bekannte Geruch mit, der von gefangenen und feilgebotenen Fischen kündet, jene salzige Fäule, die Armut, Rohheit und Laster verströmt.
Der junge Mann atmet tief, er kennt diese Luft, seit er denken kann, doch heute schickt sie ihm Mut, dass es in den Adern prickelt. Er lehnt, mager, hoch aufgeschossen, mit blasser Haut, bescheiden gekleidet, in gebrauchtem dunklen Überrock, fast noch ein Kind, an einer der grauschwarzen, feuchten Hauswände in der Vico delle Fosse del Colle, dem Katzengang, wie die Gasse wegen ihrer Enge und Düsternis genannt wird. Dies ist eine jener elenden dunklen, sonnenarmen Häuserschluchten der Stadt Genua, von denen es hier nur allzu viele gibt und die in großen Teilen seit Jahren leer stehend der Verrottung und dem Verfall preisgegeben sind.
Der Junge zittert vor Erregung, seine dunklen Augen glänzen wie im Fieber, sie brennen sich in ein Blatt schäbigen Papiers, das er in den Händen hält. Er liest die Proklamation des Napoleon Bonaparte, der zwei Tage vorher in glänzendstem Triumph in Milano eingezogen ist: „Soldaten, ihr ernährt euch schlecht und geht fast unbekleidet. Die Regierung der Republik schuldet euch viel, aber sie kann nichts in eurem Interesse tun...darum beschloss ich, euch aus den Bergen in das fruchtbarste Tal der Erde hinunterzuführen. Weite Straßen, große Städte stehen offen vor euch, ihr werdet herrliche Gegenden sehen, ein neues Land, wo euch Ehre, Ruhm und Reichtum erwarten...“
Es ist mitten im Frühling, am 17. März 1796. Der Junge an der kalten, grauschwarzen Mauer in jener Gasse Genuas ist gerade 14 Jahre alt.
Er ballt die Fäuste seiner übergroßen, langfingrigen Hände, er ballt sie entschlossen und mit aller Kraft, obwohl ihn ein Hustenanfall zu schütteln beginnt. Grimmig sagt er zu sich: Eine neue, gänzlich andere Welt bringt er uns, dieser Franzosengeneral. Er zeigt uns, wie man es vermag, dass man mit dem rechten Willen alles im Leben erreichen kann. Bin nicht auch ich schlecht gekleidet, leide nicht auch ich, schuldet man nicht auch mir viel, ja alles im Leben? Ist es nicht Zeit, dass mich meine Musik aus der erträumten in die wirkliche Welt führt, welche Städte werde ich sehen, wie viele Menschen, erwartet nicht auch mich Reichtum, könnte ich nicht bald diesen Gassen, dieser Enge entfliehen? Ja, denkt der Junge in überschwänglichem Glücksgefühl, das ihn so plötzlich angefallen hat, denkt und spürt nicht die Kühle des Mauerwerks im Rücken, die Zeit der Freiheit, der Befreiung ist gekommen. Oh, Madonna! Also will, also muss ich mich nun befreien aus väterlichem Joch. Es muss und es wird gelingen, ich werde dem Tyrannen, dem verfluchten Mentor entkommen ...
Und es atmet der Junge begierig die frische, landeinwärts wehende Seeluft. Ihm ist, als käme mit ihr jene Freiheit, nach der er sich schon so lange gesehnt. Zu gern hätte er sich schon früher von diesem harten Mentor frei gemacht, denkt er, das napoleonische Flugblatt in der entschlossenen Faust, aber er wich nicht von meiner Seite, dieser höllische Wachhund von Vater. Nun aber will ich´ s wagen, bei erster Gelegenheit, um fortan auf eigenen Füßen zu stehen. Denn mit meiner Kunst, meiner Violine stehe ich schon lang allein. Was ich darauf vermag, brachte ich mir selber bei. Er, der Alte, war mir nur immer der Kerkermeister. Nun soll die Geige meine Waffe sein, mit der ich, diesem französischen General gleich, die Welt erobern will... Doch gerade, als er dies denkt, schrickt er zusammen, der schwarzhaarige, magere Knabe, denn er hört mit seinem überfeinen Ohr eilige sich nähernde Schritte, hört sie heraus aus den Geräuschen der nahen Gassen und des Hafens, hört das asthmatische Keuchen, das er so fürchtet. Der Vater kommt, er sucht ihn. Wieder wird es Züchtigungen geben. Rasch birgt der Junge das Blatt unter dem Hemd. Noch rechtzeitig, denn da taucht der Gefürchtete schon auf, packt den Jungen am Kragen und zerrt ihn mit sich fort. Üben sollst Du, brüllt er, nicht Maulaffen feil halten, so komm, ich will dich lehren. Und er schüttelt den Widerstrebenden, ihn roh bei den Haaren packend, kräftig durch...
1. Kapitel
Mit hochrotem Kopf stürmt die Bettenmamsell Johanna Kleditzsch am Kellner Knöfel vorbei die Treppe hinab. Fassungslos starrt er ihr nach.
Was für Launen! Was für ein Gelächter! so ruft sie voller Empörung vom unteren Treppenabsatz nach oben. Sie zittert am ganzen Leib.
Sogar zur nachtschlafenden Zeit dieses abscheulich irre Gelächter!
So könne nur der Teufel lachen! hört der erschrockene Kellner, und er macht stumm eine abwehrende Handbewegung, legt den Finger vor den Mund. Doch die Bettenmamsell schweigt nicht: Und dann dieses Violinspiel! Als ob eine ganze Schar von Geigern, ja ein ganzes Orchester im Zimmer wäre und alle auf dieser armen einzigen Violine spielten. Ein Heulen und Jammern, ein Flöten und Fiepen, ein Krächzen und Winseln. Alle Töne der Hölle wären zu hören. Die Haare stünden einer anständigen Frau zu Berge. Keine zehn Pferde brächten sie noch einmal hinauf in die Etage, wo dieser Teufel abgestiegen sei.
Weiter, doch leiser schimpfend, steigt sie die Treppe hinab.
Der Kellner Knöfel macht eine hastige Bewegung, und es scheint, als wolle er auf der Stelle umkehren und der Mamsell hinterher, doch dann winkt er resigniert ab. Wenn sie nur nicht, dieses unvernünftige Weibsbild, denkt er noch, hinaus auf die Straße läuft, vor das Hotel, wo in diesem Moment Dutzende Gaffer und Neugierige vielleicht noch immer stünden, oder zurückgekehrt seien, obwohl er sie auseinander getrieben habe.
Seit Stunden hatten sie so gestanden. Die Nachricht, dass im „Hotel de Pologne“ ein geheimnisvoller, hochberühmter Fremder aus Italien abgestiegen sei, hat sich in der Stadt, der Knöfel weiß nicht wie, herumgesprochen. Und Knöfel denkt daran, wie er eben noch unten bei diesen Menschen gewesen ist und ihnen erklärt hat, sie möchten nach Hause gehen, er verweigere jede Auskunft, dazu sei er verpflichtet, jeder Gast sei heilig und beanspruche die Unversehrtheit seiner Person. Wohin wir denn kämen, hat er deutlich gesagt, wenn man eindringe in die Privatsphäre von Gästen und Künstlern allzumal, die in seinem Hause als Gäste weilten. Er gäbe keine Auskunft, „Basta“, und er verwehre jedem, außer man weise sich als Mann der Presse aus und habe ein berechtigtes, nachvollziehbares Interesse, also verwehre jedem den Zutritt ...
Und dann habe er sich in die Tür gestellt und kein Wort mehr gesagt, nur die Arme über der Brust gekreuzt, und er habe ein entschlossenes, vielleicht sogar ein böses Gesicht gemacht, denkt er jetzt. Er ist mit sich zufrieden. So steht der Kellner sinnend und kopfschüttelnd noch immer auf der Treppe.
Es ist ruhig im Haus, auch aus der oberen Etage hört er nichts.
Nein, und nun auch noch die Johanna, Knöfel ist verwirrt, vielleicht habe sie von den Gerüchten gehört, und sei deshalb besonders erregt und nervös. Was für einen Lärm sie gemacht habe, wie aufgeregt sie sei, diese Johanna. So kenne er sie gar nicht, denkt er. Man werde sie ermahnen müssen. So benimmt man sich nicht im „Pologne“! Ja, sie habe sich anstecken lassen, denkt der Kellner Knöfel noch einmal, alle seien sie aufgeregt und angesteckt, die ganze Stadt sei in Aufruhr wegen diesem Gast auf Zimmer 45.
Heinrich August Knöfel, Kellner im „Hotel de Pologne“, einem bekannten, wenn nicht gar dem besten Haus am Platze, das unübersehbar in der Schlossgasse, Ecke Badergasse unweit der Residenz gelegen, hat beste Manieren und eine Bildung, die ihn beinahe für die Stelle eines Kammerherrn am Hofe geeignet erscheinen lässt. Er kennt sich aus in Kunstsachen und Musik, wie kaum ein anderer. Oft, wenn bekannte Künstler hier absteigen, wird nur er beauftragt, die Berühmtheiten zu bedienen, ihnen die Wünsche von den genialischen Stirnen abzulesen. Die Frau Effenberg, Besitzerin des Hotels, kann sich auf ihn verlassen, ohnehin ist er ihr beinahe wie die rechte Hand geworden, in all den Jahren. Er kennt die Marotten und Launen dieser Herrschaften, er versteht sich aufs Englische, Spanische und Französische und, wenn er sich Mühe gibt, sogar aufs Italienische. In all diesen Sprachen kennt er Redewendungen, auch Flüche, er weiß über neueste Opern ebenso zu plaudern wie über angesehene Konzertsolisten, selbst Dichter kennt er beim Namen und selten weiß er nicht mehr weiter. Doch diesmal, mit diesem geheimnisvollen, dunkelhaarigen Italiener, diesem Violinvirtuosen aus Genua, Paganini geheißen, ist Knöfel in ziemlicher Verwirrung.
Vor dem Haus die Gaffer und Neugierigen, die kaum zu beruhigen waren. Nicht allein, dass ihm, wie nun soeben die Mamsell Johanna, auch schon die Etagenkellner, ja das gesamte Personal jeden Dienst an diesem seltsamen Gast verweigert, nein er, der kunstsinnige gebildete Herr Knöfel ist mit all seinen Erfahrungen, seiner Noblesse, seinem Latein am Ende, schließlich habe er, so denkt er, auch nur Nerven und die brauche er für seinen Dienst hier im Hause.
Sogar einen großen Enzian habe er, als er eben von unten heraufgekommen ist, trinken müssen, zur Beruhigung nach all der Aufregung und dem Lärm; einen Enzian, den er um diese Zeit sonst noch niemals habe trinken müssen, denkt er.
Gestern am Abend, es dunkelte schon, ist dieser Herr Paganini mit einem eigens gemieteten privaten Reisewagen aus Prag angekommen.
Er wird erwartet in der Residenzstadt, sogar Seine allergnädigste Majestät, der greise König Anton, soll hinter der Einladung stecken, sagt man. Schon in den späten Nachmittagsstunden hatten sich erste Schaulustige und Neugierige vor dem Hotel gesammelt. Flugzettel sind verteilt worden mit dem Auftrittsprogramm, das er aufführt, einer Akademie, wie es genannt wird. Man tuschelt. Gerüchte schweben heran und unter die Leute der Stadt. Tolles wird erzählt, die wirrsten Geschichten. Knöfel hat einige aufgeschnappt. Sie flattern ihm noch jetzt im Kopf herum, da er auf der Hoteltreppe steht. Die e-Seite von Paganinis Guaneri del Gesu soll aus dem Gedärm einer toten Geliebten gesponnen sein, er trinke Schafsblut vor jedem Auftritt.
Wie ein Wachsoldat hat er, der aufgeklärte und gebildete Kellner Knöfel, zuletzt vor dem Hotel gestanden. Nein, er könne niemanden hereinlassen, hat er immer wieder sagen und sogar mit der Polizei drohen müssen. Und wieder und wieder forderte er die Leute zum Gehen auf. Man werde den Künstler in der Oper sehen, hat er beruhigend unzählige Male wiederholen müssen, ja er sei ein Virtuose von europäischem Rang, dieser Paganini; wohin er auch führe, überall gäbe es dieselbe Begeisterung und die Damen bekämen Ohnmachtsanfälle. Was sei daran außergewöhnlich, habe er gesagt, die Damen fielen leicht in Ohnmacht heutzutage, das läge an ihren eng geschnürten Kleidern und sicherlich auch an ihrem hysterischen Naturell, aber mit dem Teufel stünde der Paganini nicht im Bunde, wenn auch kein Mensch so auf der Violine zu spielen verstünde wie er. Von Beethoven dächte man ja auch nicht, er sei des Teufels, und doch sei der ein Musiker, dessen Begabung unerklärlich sei. Schriebe ganze Sinfonien und Quartette und höre dennoch nicht eine einzige Note.
Also beruhigen Sie sich, bitte sehr, meine Herrschaften. Und nun gehen Sie auseinander, meine Herrschaften! hat er wieder und wieder sagen müssen. Ja, Herrschaften habe er gesagt, habe er sagen müssen, denkt der Kellner Knöfel, aber es sei nur niederer Pöbel gewesen und ein paar Studenten, die vor ihm gestanden haben. Oh, er sieht auf den ersten Blick, mit wem er es zu tun hat. Lange Jahre Berufserfahrung, da kennt man sich aus mit den Menschen. Oh ja, und er sei beherrscht und höflich geblieben, er sei würdig aufgetreten, denkt der Kellner jetzt. Aber sie haben sich nicht zerstreut, diese aufdringlichen Gaffer, Banausen allesamt. Erst als Knöfel einem heranschreitenden Schutzmann zugerufen habe, er könne seinen Posten nicht verlassen, man stürme das Hotel, da endlich seien die Leute zögernd, zuerst einzeln, dann paarweise, davongegangen.
Überall in der Stadt diese Hysterie, überlegt Knöfel auf dem Treppenabsatz, einen Tag vor dem Konzert in der Opera1 seien alle Karten ausverkauft und es habe schon Prügeleien an den Kartenschaltern in der Stadt gegeben. Sein Neffe, Baldur, den Knöfel ausgeschickt hat, ist unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Nix zu machen, Oheim, habe dieser gewitzte Bube gesagt, keine Karte sei mehr zu bekommen. Im Gegenteil, Püffe und Faustschläge habe er einstecken müssen.
Aber er wird trotzdem hingehen. Morgen. Er muss diesen Teufel spielen hören und sehen. Unbedingt. Das sei er sich und seinem Kunstsinn schuldig. Spiele er doch selbst ein wenig auf der Geige in seiner karg bemessenen Freizeit. Und er werde Friederike mitnehmen, die Tochter. Im vorigen Monat hat sie eine Sonate von Kreutzer auf der Violine öffentlich gespielt. Ja, so wolle er es machen, beschließt der brave Knöfel. Er werde schon hineingelangen ins Opernhaus, er werde Mittel und Wege finden. Schließlich sei er nicht unbekannt, hier in der Stadt. Den Knöfel kennt man.
Und tatsächlich! Ein geheimnisvoller Mensch, dieser Paganini. Er selbst habe ja diesen seltsamen und berühmten Gast gestern, als er ankam, denkt der Kellner Knöfel, der immer noch auf der Hoteltreppe steht, nur ganz kurz zu Gesicht bekommen, wie ein Verbrecher, das Gesicht fast vollkommen bedeckt, nur ein leichenblasser mit hochgeschlagenem Mantelkragen, den Zylinder tief in die Stirn Streifen Haut und ein paar schwarze, geringelte Haarlöckchen seien zu sehen gewesen, so sei er wortlos mit hochgezogenen Schultern, ein zuckendes, zappelndes Bündel in wärmendes Tuch gehüllt vor der Brust tragend an ihm vorbei geschlichen. Hatte vorher in der Kutsche gesessen, dieser seltsame Mensch, und ein kleines Wesen sei bei ihm gewesen, ein Kind oder Kobold, wie gesagt werde. Und ihm sei das Gerücht vorausgeeilt, denkt der Kellner Knöfel, dass Paganini seinen kleinen Sohn Achille nach der Trennung von der hysterischen, gewalttätigen Mutter mit sich herumschleppe bei allen Konzerten, sich nicht trennen könne von dem Kleinen. Aber wer weiß, denkt Knöfel, ob dies ein rechtes Kind ist oder nicht doch vielleicht ein Kobold oder ein auf Handmaß geschrumpfter Teufel. Und sie haben gescherzt und gelacht, der Paganini und dieses kleine Wesen, so viel konnte Knöfel hören, solange haben sie in der Kutsche gesessen, aus der Kichern und fremde lustige Worte drangen, bis dann der Assistent des Künstlers, dieser widerliche kleine Kerl, der ein hannoverscher Stückeschreiber sei, alle Formalitäten erledigt hatte. Und mit diesem Assistenten, dem Herrn Reisesekretär Georg Harrys, wie er sich offiziell nennen lässt, hat er, Knöfel, dann auch einige Worte gewechselt.
Ja, hat dieser dicke kleine Mensch mit dem roten Gesicht und der auffälligen Weste gesagt, er sei extra aus Hannover hier herunter nach Dresden gekommen, in der Pirna´schen Vorstadt hätten sie sich getroffen, der Maestro und er. Ja, Paganini brauche einen Mann wie ihn, hat er unverschämt grinsend hinzugefügt und an den Metallknöpfen seiner ordinären Weste gedreht, ohne ihn käme er mit den deutschen Verhältnissen nicht zurecht, vor allem fürchte er die deutschen Künstler und Kritiker, was ja oft dasselbe sei, denn die deutschen Künstler, namentlich die Musizi, seien allesamt Kritiker im Nebenberuf und hätten über alles außerdeutsche sofort die eigenste, speziellste Meinung: nur Scharlatanerie sei die welsche Kunst, schrieben sie oder kreischten auf ihren Instrumenten den Kommentar. Doch sein Niccolo Paganini, hat Harrys gesagt, dieser göttliche Künstler, der sei wie ein Kind und habe nur seine Musik und sonst nichts im Sinn...
Und so steht der Kellner Knöfel da, sinnt, erinnert sich. Doch mit einem Mal hebt er die Augenbrauen, und sogleich mit ihnen die spitzen Schultern in die Höhe, so dass der breite Kragen seines Fracks die Ohren berührt. Er hat einen Entschluss gefasst. Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, mit spitzem Schritt steigt er die steilen Stufen zum Obergeschoss hinauf. Vielleicht, so denkt er, könne er hören, was die Bettenmamsell Johanna hörte. Nein, nicht aus Neugier, sagt er sich, sondern aus Fachinteresse (denn wir wissen, er spielt die Violine auch) und weil er von Amtswegen verpflichtet ist, wie er sich selber versichert. Die Frau Effenberg muss er unterrichten, er ist ihr Hofmeister, denkt er nicht ohne Stolz. Also steigt er nach oben, zu Nummero 45, und mit jedem Schritt, den er geht auf seinem Ohrenpfad, spitzt er seine Ohren, die vor Aufregung rosig gestrafft scheinen und ein wenig abstehen, schärft er sein Gehör mehr und mehr, wie eine Katze auf der Mäusejagd. Aber außer seinem Herz, dass er klopfen hört, ist es still im Haus. Er zählt die Stufen, er weiß, von Treppenabsatz zu Treppenabsatz, wo bei einem jeden eine dorische Säule aus feinstem Marmor, blumendekoriert, aufgestellt ist, sind es zehn Stufen. Noch zwei Absätze muss er überwinden in seinem Lauf, bei dem ihn die Ohren leiten, dann kommt eine halbe Treppe, also fünf Stufen, und wieder ein Absatz mit einer Säule, auf der ihn die Apollofigur mit der Lyra, beleuchtet von einem Seitenfensterchen, erwartet. Schließlich der halbdunkle Gang mit der Nr. 45, geschmückt von dem roten Läufer, der seine Schritte unhörbar machen wird.
Knöfel vernimmt noch immer nichts, nur seine leisen Schritte und das eigene erregte Herz, das inzwischen so laut klopft, dass der ehrenwerte Kellner denkt, es müsse außer ihm von allen im Haus gehört werden. Vielleicht auch von diesem Herrn Paganini.
Halt, da ist der Apoll!
Jetzt noch fünf Stufen und ein paar Schritte in den dunklen Gang hinein. Den braven Kellner Knöfel beschleicht plötzlich das Gefühl, etwas Unrechtes, Unmoralisches zu tun. Man hört nicht an den Türen der Gäste. Das hat er dem Personal Hunderte Male verboten, und einige Male hat er jüngere Kollegen und Lehrjungen an den Ohren von den Zimmertüren weggezogen. Nun will er selber tun, was er ansonsten streng untersagt. Doch er muss, denkt er, er sei verantwortlich, er sei eine Amtsperson, ein deutscher Kellner von Ehre und Gewissen, dem Gemeinwohl verpflichtet. Und er strafft sich.
Im selben Moment, er ist gerade vor der Tür mit der Nummer 45 angekommen, bricht dahinter ein Höllengelächter los. Knöfel schrickt zusammen, springt einen Schritt beiseite. Laute Worte hört er, italienische Worte: Li porta il diavolo, questi suoni! Santo cielo! Knöfel kramt sein mageres Italienisch zusammen, doch ihm fällt nichts ein. Himmel und Hölle glaubt er verstanden zu haben.
Oh, großer Gott, denkt Knöfel, tatsächlich eine Beschwörung!
Im selben Moment jedoch erklingt eine Violine. Einsam, singend schwillt der Ton. Und was er nun hört, ist von so unglaublicher Schönheit, von solcher Kraft, Reinheit und Innigkeit, dass Knöfel vor der Tür in die Knie sinkt. Nichts kann er jetzt denken, nur hören, immerzu hören. Weil er selber ein Musiker sei, entschuldigt er sich bei sich selbst, nur deshalb sei er in die Knie gesunken, was ihm sonst noch niemals vorgekommen.
Knöfel hält den Atem an.
Denn Unglaubliches dringt von drinnen, hinter der Tür mit der Nummer 45 hervor, an seine Ohren, die sich jetzt bedenklich röten, er hört Arpeggios, Flageoletts, Terztriller, Läufe den Steg hinauf und herunter, dass es ihm eiskalt den Rücken hinabläuft. Plötzlich schweigt die Musik und wieder hört der arme Kellner italienische Worte und ein irres Lachen:
Eccellente! Mamma mia! Efficace! Giusto diavolo mio!
Dann ein Trommelfeuer wildester Töne, es klingt, als spielten mindestens zwei oder drei Violinen, und Knöfel spürt, wie ihm die Gedanken entgleiten. Er ist nicht mehr Herr seines Willens. Er sieht sich auf einer Waldlichtung, umtanzt von Elfen und Feen, halb bekleidet mit wildem Lachen ziehen sie ihre Kreise um ihn, der nackend, sich die Blöße bedeckt. Doch von ihm weicht die Furcht und alle Hemmung. Es zuckt, es zerrt in ihm, seine Glieder beginnen ein Eigenleben, und auf einmal schämt er sich seiner Nacktheit nicht mehr. Er will tanzen, sich im Kreise drehen und die selige Musik in sich aufnehmen, sich in ihr baden. Er schnalzt mit der Zunge, hebt die Arme und schnippt im Takt mit den Fingern. Und immer näher tanzen die spärlich bekleideten Mädchen, ihre Brüste wippen, rosa Fleisch glänzt, sanft geringelte Löckchen zeigen sich. Und in dem tanzenden Knöfel steht eine wahnsinnige Gier auf, er ist sich seiner Sinne nicht mehr bewusst, es schwebt, es treibt, es girrt und lacht, und die Musik streift einer antreibenden Peitsche gleich über seinen Körper, dringt ihm in Herz und Hirn. Wilde Wollust hat ihn angefallen. Er will nichts, er weiß nichts, außer dem Tanz und den verführerischen Mädchen um ihn her ...tanzen, lachen, lüstern sein...
Alles hat er vergessen, der brave Herr Knöfel, Sitte und Anstand, Form und Moral, und als die Musik endlich, nach endloser, ewiger, nicht gemessener Zeit schweigt, sieht er sich vor dem Zimmer 45 in der oberen Etage seines vornehmen Hotels sitzen, den Rock abgeworfen, den Kragen geöffnet, sich seiner Beinkleider entledigt, in Strümpfen und den langen, wollenen Unterhosen ...
Er hat nicht Zeit, wieder zu sich zu kommen, sich anzukleiden und in die rechte Fasson zu bringen, denn plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, steht der kleine Georg Harrys vor ihm. Der Herr Reisesekretär. Breitbeinig, die kurzen Arme verschränkt, steht er vor dem am Boden hockenden Knöfel und feixt. Er dreht an den Metallknöpfen seiner Weste und wartet. Er wendet sich nicht ab, nein, er starrt den Kellner Knöfel herausfordernd an. Und was für Knöfel das Schlimmste ist, dieser Mensch blickt auf ihn nieder und schweigt, sagt kein Wörtchen, schweigt nur und lächelt in ordinärster Weise. Dann wendet er sich so plötzlich ab, wie er aufgetaucht ist, Knöfel sitzt noch immer am selben Fleck, und der Kleine klopft an der Tür von Nummero 45.
Maestro? hört Knöfel ihn leise fragen, ehe er ein zweites Mal klopft. Von drinnen ist ein Wiehern zu hören, wie von einem Pferd, dann ein Miau, allerlei andere Tierstimmen noch, ein helles kindliches Lachen und schließlich eine Akkordfolge auf der Violine, die wie ein „Herein, herein!“ klingt. Rasch verschwindet der kleine Harrys in der sich öffnenden Tür.
Nur eine weiße, schrecklich blasse Hand hat Knöfel gesehen, der brave Kellner, der am Boden sitzt, eine leichenblasse Hand ist es gewesen, mit langen, überlangen Fingern, die im Türspalt eine Geste vollführten, als ob sie dem Hereintretenden winke. Dann ist wieder Stille auf dem halbdunklen Gang.
Langsam erhebt sich Knöfel, nimmt seine am Boden verstreuten Kleidungsstücke auf, und geht, nachdem er sich angezogen hat, mit gesenktem Kopf den Gang entlang, steigt müde und schwer die fünf Stufen hinab, läuft am Apoll vorbei, und weiter die Treppe hinab, bis er in seinem Arbeitskabinett angekommen, sich einschließt, an den Schreibtisch setzt und den Kopf auf die kühle Holzplatte fallen lässt. Ihm schwindelt und ein wenig übel ist ihm auch, dem Kellner Heinrich August Knöfel, an diesem kalten Wintermorgen...
Und schon einen Tag später, keiner weiß woher, ob der lächelnde Reisesekretär Harrys, oder ob der Kellner Knöfel selbst über seine Verwirrung gesprochen hat, oder ob er nicht doch von irgendeinem anderen beobachtet worden war, als er auf dem Flur vor der Tür des unheimlichen Italieners so verrückt tanzte und sich seiner Kleider entledigte, einen Tag danach schwebt ein neues Gerücht durch die Gassen, durch die Kneipen und Salons der Residenzstadt. Der Kellner Knöfel, den man kennt, ansonsten würdig und von besten Manieren, habe sich von diesem Teufelsgeiger behexen lassen und im „Hotel de Pologne“, wo er angestellt, einen wilden Tanz aufgeführt und sei dann nackend die Treppe hinabgerannt. Kein Zweifel, wird gesagt, dieser Italiener müsse mit dem Satan im Bunde sein.
Natürlich hört die Hotelbesitzerin Effenberg, eine energische Dame mittleren Alters, von diesem Gerücht. Sie bestellt ihren Knöfel zum Bericht. Da steht er nun, eine Jammergestalt, mit Augenrändern von fehlendem Schlaf, und er flüstert beschämt von seiner Entgleisung.