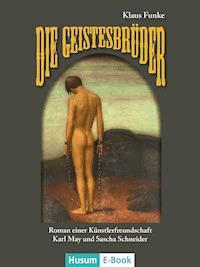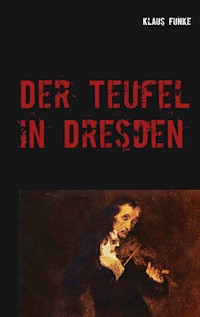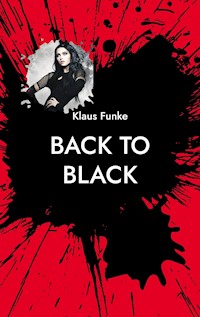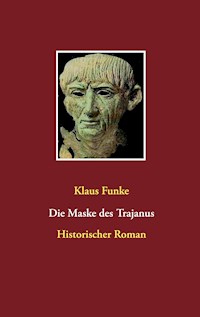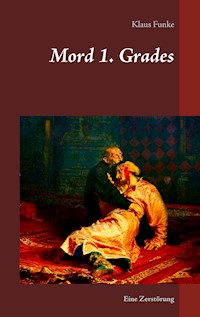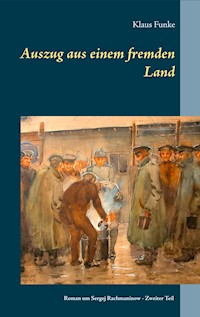Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Vater liegt in einem Hospiz im Sterben. Er ruft seinen Sohn zu sich und will vor ihm eine Art letzter Beichte ablegen. Er erzählt ihm, was er zuvor nie getan, von seinen Kriegserlebnissen. Und die sind wahrhaftig erschreckend, wirr und bunt. Von den Sowjets gefangen genommen, gelingt ihm die Flucht. Fast ohne jedes Hilfsmittel flieht er zu Fuß durch das winterliche Nordrussland. Mannigfaltig und gefährlich gestaltet sich diese Flucht. Verletzt erreicht er die deutschen Linien und wird in einem Lazarettzug in die Heimat gebracht. Dort heiratet er, inzwischen genesen, eine Krankenschwester, die er im Lazarettzug kennengelernt hat. Dennoch meldet er sich an die Westfront, nimmt an der Ardennenoffensive teil, wird von den Briten gefangen genommen, wird Freund eines britischen Offiziers, flieht erneut, kommt nach Hause. Viele Jahre später erkennt er einen Nazi-Kriegsverbrecher, der ihm einst übel mitgespielt hat. Er bittet, inzwischen todkrank, seinen Sohn um die späte Rache und die Enttarnung dieses Mannes. Dieser erfährt davon und bringt seinen Rächer mit einer Giftkapsel um, kann aber unerkannt entfliehen. Wird der Sohn seinen Vater rächen? Ein bis zur letzten Zeile packendes Buch und zugleich ein stimmiges Zeitdokument.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Vater Friedrich Paul Reinhard Funke (1921 – 2007)
Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. William Faulkners
Zum Buch
Ein Vater liegt in einem Hospiz im Sterben. Er ruft seinen Sohn zu sich und will vor ihm eine Art letzter Beichte ablegen. Er erzählt ihm, was er zuvor nie getan, von seinen Kriegserlebnissen. Und die sind wahrhaftig erschreckend, wirr und bunt. Von den Sowjets gefangen genommen, gelingt ihm die Flucht. Fast ohne jedes Hilfsmittel flieht er zu Fuß durch das winterliche Nordrussland. Mannigfaltig und gefährlich gestaltet sich diese Flucht. Verletzt erreicht er die deutschen Linien und wird in einem Lazarettzug in die Heimat gebracht. Dort heiratet er, inzwischen genesen, eine Krankenschwester, die er im Lazarettzug kennengelernt hat. Dennoch meldet er sich an die Westfront, nimmt an der Ardennenoffensive teil, wird von den Briten gefangen genommen, wird Freund eines britischen Offiziers, flieht erneut, kommt nach Hause. Viele Jahre später erkennt er einen Nazi-Kriegsverbrecher, der ihm einst übel mitgespielt hat. Er bittet, inzwischen todkrank, seinen Sohn um die späte Rache und die Enttarnung dieses Mannes. Dieser erfährt davon und bringt seinen Rächer mit einer Giftkapsel um, kann aber unerkannt entfliehen. Wird der Sohn seinen Vater rächen?
Ein bis zur letzten Zeile packendes Buch und zugleich ein stimmiges Zeitdokument.
Der Autor
Klaus Funke, in Dresden geboren, ist Autor zahlreicher bekannter und erfolgreicher Romane, Novellen und Erzählungen. Die meisten davon sind bei bekannten Verlagen erschienen.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Zweiter Teil
Erster Teil
Der Mann saß nicht am Tisch, nein, er lag mit dem Kopf und dem halben Oberkörper darauf.
Der Tisch stand gleich neben der Theke. Er trug eine rotkarierte, unsaubere Leinendecke. Auf der anderen Seite vom Tisch ging es zu den Toiletten. Ab und zu ging die Tür auf. Jemand kam heraus, andere gingen hinein. Ein kalter Schwall Toilettenluft wehte in die Gaststube.
Der Mann schlief nicht. Er beobachtete mit einem Auge zwei Finger seiner rechten Hand. Den Zeigefinger und den Mittelfinger. Mit denen spielte er, wie es die Kinder tun, Exerzieren. Die Finger waren die Soldaten. Dazu summte der Mann ein Marschlied. Die Finger spazierten an einer Front von fünf Wermutgläsern entlang. Drei Gläser waren leer, das vierte war noch zu einem Drittel gefüllt, das fünfte stand unberührt und voll in der Reihe. Der Wermut schimmerte wie dünnes rotes Blut. Das Licht des Kneipenkronleuchters spiegelte sich darin.
Die Finger des Mannes machten vor dem fünften Glas halt. Der Mann schmetterte einen Tusch. Das Ganze Halt. Lallend sagte er: Und jetzt bist du dran! Ich verurteile dich zum Tod durch Entleerung!
Er ergriff das Glas, setzte sich gerade hin und kippte den Inhalt hinter.
Brrr! Brrr! machte er, das Zeug schmeckt auch beim fünften Glas nicht besser.
Er stützte den Kopf in die Hände und schaute sich mit gläsernem Blick im Gastraum um.
Nichts Neues, murmelte er, kein neuer Gast, sie wird nicht kommen…
Dann legte er seinen Kopf wieder auf die Tischplatte. Er öffnete die Lippen einen Spalt und lallte:
Güstrow war ein Reinfall, ein totaler Reinfall. Und ich bin ein Idiot. Ja, ein kompletter Idiot.
Wir kennen den Mann. Er ist Anfang der Vierzig, mit Stirnglatze und einem Oberlippenbärtchen, nein, schlank ist er nicht, er neigt zu Fülle. Er heißt Franz Malef und er ist aus Sachsen nach Güstrow gekommen, gewissermaßen im Parteiauftrag. Unterwegs begleitete ihn eine junge Frau, Franzi Schönlebe. Zufällig waren sie sich auf dem Dresdner Hauptbahnhof begegnet. Auch sie stammte aus Sachsen, und zwar aus dem kleinen Dörfchen Reinhardtsdorf in der schönen Sächsischen Schweiz, sie war aber schon vor der Wende in den Westen gegangen, nicht ganz freiwillig wie wir wissen. Sie hatte nach der Wende in Marburg Psychologie studiert und im letzten Jahr in Leipzig eine Praxis für Psychotherapie eröffnet. Dabei wurde sie von einem Freund, dem Rechtsanwalt Jean Frederic de Bourienne, finanziell großzügig unterstützt. Plötzlich aber hatte sie hingeschmissen. Nun reiste sie umher und war auf der Suche. Wonach wusste sie offenbar selber nicht. Malef hatte während der Zugfahrt seine liebe Not mit ihr und ihrer verfluchten Spontanität, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hatte er sich in sie verliebt. Die beiden hatten sich am Bahnhof in Güstrow getrennt. Sie wollte zu einer Tante, die angeblich hier wohnte – freilich einer sehr entfernt verwandten Tante, und Malef hatte sich mit dem ehemaligen Mitglied der Güstrower Kreisleitung Hagen Grünzig sowie mit noch zwei weiteren „guten, alten Genossen“ getroffen. Diese hatten einen gemeinnützigen Verein gegründet, der sich die Unterstützung ehemaliger Funktionsträger und Genossen der SED zum Ziel gesetzt hatte, und zwar solcher, die nicht in die Nachfolgeorganisation PDS gewechselt oder übernommen worden waren. Sie hatten bis eine Stunde vor Mitternacht heftig debattiert und dabei ein paar Flaschen vom Güstrower „Kniesenack-Bier“ geleert, einem deftigen regionalen Starkbier, das einem seltsamerweise erst an der frischen Luft in die Beine fuhr. Ohne eine Einigung und „temlich besapen“, auf hochdeutsch „ziemlich besoffen“, hatte man sich schließlich getrennt. Und wie es aussah, noch nicht einmal im Einvernehmen. Nun saß Malef, angeschlagen und einigermaßen angetrunken, in der heruntergekommenen Gastwirtschaft am Stadtrand von Güstrow. Diese Gastwirtschaft, welche zugleich fünf Fremdenzimmer pro Nacht für nur 80 DM anbot, trug den schönen norddeutschen Namen „To dat Gröön Huus“ auf hochdeutsch „Zum grünen Haus“.
Plötzlich, allerdings zuerst undeutlich und wie im Nebel, sah Malef einen Mann am Nachbartisch. Er musste noch nicht lange da gesessen haben, denn als Malef vor einer Stunde hier hereinkam und die vier Gläser Wermut bestellt und getrunken hatte, war der Nachbartisch leer. Indes, Malef, je mehr sich der Schleier seiner Trunkenheit lüftete, erkannte er diesen Mann. Das ist doch nicht möglich, dachte er, das ist doch? Und in der Tat, auch wir kennen diesen Herrn am Nachbartisch, dunkelhaarig, mittelgroß, mit einer Stirnlocke, um die Sechzig. Ja, es ist niemand anderes als Lutz Lautenschläger. Auch ein Ehemaliger, allerdings in Dresden. Der frühere Abteilungsleiter der Stadtleitung der SED. Und dazu einer, der derzeit eine gutbezahlte Nebentätigkeit ausübt, im Solde des innerdeutschen Verfassungsschutzes. Wir lasen im vorhergehenden Band davon.
Malef, trotzdem er keine gute Erinnerung an diesen Menschen hat und trotzdem seine Gedanken am heutigen Abend nur schwer in Gang kommen, wird neugierig. Der ist sicher nicht zufällig hier. Solche Zufälle gibt es nicht. Was er wohl will?
Malef erhebt sich, er muss sich auf der Tischplatte abstützen, geht schwerfällig tappend auf den Mann zu. Der tut als sei er überrascht, aber das nimmt ihm Malef nicht ab, und so fragt er:
Willst´n du hier? Mich nochmal anmachen? Da hatte ich dir doch schon bei unserem letzten Zusammentreffen ´ne klare Ansage gemacht, oder?
Der Angesprochene behält seine Überraschung bei. Er sagt: Pardon, mein Herr, kennen wir uns?
Malef: Na hör´ mal. Bitte nicht diese Tour. Spiel jetzt nicht den überraschten Fremdling, Lutz.
Aber nun der Andere empört: Aber mein Herr, ich heiße nicht Lutz. Sie verwechseln mich. Wahrscheinlich – er zeigt auf Malefs Tisch – haben Sie einen Wermut zu viel getrunken? Soll vorkommen. Aber bitte, wenn Sie gestatten, ich heiße Holm Hansen…
Ach, wie der aus der „Olsenbande“?
Malef verkneift sich ein Lachen.
Bitte, mein Herr, wollen Sie mich beleidigen? sagte der vorgebliche Herr Hansen, ich nannte Ihnen meinen Namen, ich bin aus Kiel und hier in Güstrow geschäftlich unterwegs. Wenn Sie wollen, setzen Sie sich doch zu mir, bitte schön…
Er macht eine einladende Geste.
Malef dankt durch Kopfnicken, schiebt einen störenden Stuhl beiseite und setzt sich.
Schön, sagt der, welcher sich Holm Hansen nannte, nun können wir reden wie zivilisierte Leute. Sie sind nicht aus Güstrow stimmt´s? Wohl eher etwas südlicher, aus Thüringen vielleicht?
Nein, nicht aus Thüringen, sondern aus Sachsen. Aber für Leute von hier oben klingen unsere Sprachen verwandt. Das gebe ich zu.
Aus Sachen? So, so. Wo die hübschen Mädels wachsen? Ein Sprichwort, Sie kennen es bestimmt.
Ja, ich kenne diese Redewendung und wenn wir einen Moment warten, so kann ich Ihnen vielleicht eine dieser Mädels aus Sachsen vorführen. Wir haben uns nämlich für heute Abend hier verabredet, aber die Dame ist noch nicht erschienen. Sicher kommt sie noch…
Oh, das wird ja spannend, entgegnet Herr Hansen, der Geschäftsreisende aus Kiel.
Ja, sagt Malef, das könnte spannend werden…
Er hat kaum die letzten Worte ausgesprochen, als die Tür des Gastraumes aufging und diejenige hereinkam, die Malef gemeint hatte – Franzi.
Sie kam mit ihren zwei riesigen, silbernen Rollkoffern und ihrem kompletten Handgepäck, das aus einer Umhängetasche und zwei kleineren über die Schulter gezogenen Taschen bzw. Beuteln bestand.
Mit zwei Koffern? sagt sich Malef, und ihrem ganzen Krimskrams? Sie hat all ihr Gepäck dabei? Also war die entfernte Tante entweder eine Erfindung oder sie hat sie gar nicht angetroffen.
Und er hebt den Arm, um ihr zuzuwinken.
Franzi hat ihn erkannt, auch sie hebt den Arm, ruft: Hallo, da bin ich! sie lacht laut und ein wenig geziert. Mit ein paar Schritten ist sie am Tisch, dabei stört es sie nicht, dass sie mit ihren Koffern die Kellnerin und ein paar Gäste behindert. Sie walzt durch, wie man sagt.
Oho, ruft der Kieler Hansen aus, Sie sind aber stürmisch.
Franzi antwortet nichts, mustert den Kieler mit einem Blick, stellt ihre Koffer ab, und zwar so, dass der Tisch blockiert ist, dann streckt sie Malef die Hand hin
Meine Tante war nicht da. Sie ist, wie mir ihre Nachbarin sagte, ein paar Tage nach Holland gefahren. Wenn ich sie treffen will, muss ich mindestens 3 Tage hier bleiben. Sie zuckt die Achseln, sagt bedauernd: Leider hab ich kein Quartier und auch kein Geld für ein Drei-Sterne-Hotel.
Hansen, der Franzi gemustert hat, sagt: da könnte ich helfen. Wenn Kiel kein Problem für Sie ist? Ich hätte da ´ne kleine Pension am Kieler Hafen, sehr preiswert und für Sie – er machte eine galante Handbewegung – dann könnte ich Sie mit dem Wagen mitnehmen…
Malef hat auf der Zunge: „Und was wird aus mir?“, aber er lässt es, macht nur ein missmutiges Gesicht. Indes, Franzi hat ihn beobachtet, kühn fragt sie: Und mein Freund? Der Herr hier links, Herr Malef, was wird aus dem?
Ein kleiner Schatten huscht über Hansens Gesicht, aber er will sich nichts anmerken lassen, sagt: O.k. Herr Malef kann selbstverständlich mitkommen. Wir haben auch Doppelzimmer.
Franzi hat sich einen Stuhl heranzogen, sie setzt sich, lächelt: Na, dann wär ja alles klar!
Der Kellner kam.
Ja, ich nehm´ auch ´nen Wermut, sagt Franzi, aber schön kalt und mit viel Eis.
Das Getränk kommt, sie nippt daran, leckt sich die Lippen. Hm! Einfach himmlisch.
Sie kann nichts dafür: Franzi ist sofort der Mittelpunkt. Sie plaudert und schnattert, sie lacht und setzt sich in Szene, dass es eine Freude ist, ihr zuzuhören und zuzusehen.
Holm Hansen aus Kiel ist begeistert, er macht schmachtende Augen. Ja, es stimmt die Mädels aus Sachsen sind unwiderstehlich. Er ist ein typischer Westdeutscher, er versucht es mit Spendieren. Sekt kommt, ein paar kleine Appetithäppchen. Die Runde wird lockerer und fröhlich. Hansen selber hält sich mit dem Trinken zurück, er muss ja noch fahren.
Man hat beschlossen, auf seinen Vorschlag einzugehen und mit ihm nach Kiel zu kommen.
Da brauch ich ja gar nichts auszupacken, lacht Franzi, der Tante werde ich eine Nachricht schreiben.
Als es ans Bezahlen geht, zeigt sich Hansen wieder sehr spendierfreudig, er übernimmt alles, auch Malefs Rechnung, wiewohl die nicht allzu hoch war. Dann gehen sie zu Hansens Wagen. Er steht draußen im Laternenschein vor der Kneipe. Es ist ein alter Mercedes E-240 der Baureihe W 124, Farbe silbergrau, sehr geräumig, da passt alles rein, sogar Franzis ganzes Gepäck und die Koffer.
Sie fahren los. Franzi plaudert immer noch. Von allem möglichen redet sie, sogar von Preisen für Schuhe und den letzten Wahlen. Malef ist in den weichen Polstern des großen Wagens eingeschlummert. Auch der Cinzano hat da mitgeholfen, er fängt sogar an zu schnarchen, Franzi stößt ihn in die Seite. Sein Schnarchen stottert und hört auf. Hansen reagiert auf Franzis Wortschwall nur ab und zu und meist nur mit einem einzelnen Wort. Er muss auf die Straße achten, er fährt routiniert, aber nicht zu schnell. Von Güstrow nach Kiel sind es reichlich 200 Kilometer. In spätestens 3 Stunden wird man da sein, wahrscheinlich schon eher. Die Straßen sind jetzt um Mitternacht frei und es ist trockenes Wetter.
Plötzlich summt Malefs Mobiltelefon in seiner Jackentasche. Dem Summen nach, mit diesen rhythmischen Unterbrechungen, wird es eine Email sein. Er wird munter, tastet nach dem Telefon, aber er schaltet es aus, ohne sich zu melden. Wird nichts weiter sein, denkt er. Scheiße, um diese Zeit, was soll das? Morgen komm ich auch noch zurecht, danach zu sehen, wer da Lust hatte, mir mitten in der Nacht eine Nachricht zu schreiben. Er sackt weg, schläft weiter. Franzi ist inzwischen auch still geworden. Sie versucht einzuschlafen, aber die Sitzhaltung ist zu unbequem, sie schafft es nicht.
Gegen 2 Uhr kommen sie in Kiel an. Hansen fährt Richtung Hafenviertel. Er will zum Düsternbrooker Weg, biegt dann nach zwei Kilometern links in den Schwanenweg ein. Dort in der Nummer 26 hat er seine Pension, weiß leuchtet der attraktive Außenanstrich des modernen Baues sogar in der Nacht, sie besitzt eine Tiefgarage. Das geschmiedete Tor öffnet sich geräuschlos auf Knopfdruck. Sie fahren abwärts. Das Rolltor rumpelt hoch, ein Licht geht an.
So, meine Herrschaften, sagt Hansen, da wären wir. Sie müssen nur noch aussteigen.
Malef schaut sich verschlafen um. Wo sind wir? Was ist los?
Wir sind da! ruft ihm Franzi ins Ohr, aussteigen! Wenn du mir ein bisschen Gepäck abnehmen würdest, wäre das sehr nett. Malef greift sich eine von den Umhängetaschen und den größeren der silbernen Koffer. Verdammt schwer, das Ding, was sie nur mit sich herumschleppt?
Hier entlang! ruft Hansen, der schon an der Tür zum Aufzug steht, in einer Minute haben wir es geschafft.
Sie sind kaum an der Tür zum Inneren der Pension, als es in Malefs linker Jackentasche erneut summt. Wieder drückt er den Anrufer weg. Er ist wütend. Was soll das bloß? Ist jemand gestorben?
Franzi fragt: Wer war das? Schau doch mal drauf, vielleicht ist es tatsächlich wichtig.
Nein. Jaaa, wartet´s ab. Lass uns doch wenigstens erst mal eintreten. Außerdem ist es mein Mobiltelefon. Also wird es mich betreffen, nicht dich. Ich entscheide, ob ich die Nachricht annehme oder nicht… oh verdammt, denkt Malef, unser erster Streit. Ich muss mich zurücknehmen…
Dann aber hält er es doch nicht aus, er greift sich das Telefon und schaut nach, wer ihm da eine Nachricht geschickt hat.
Ooch, bloß meine Olle, die Eva! stöhnt er, vielleicht hat eines der Kinder Fieber oder sie ist bei einer ihrer Lehrgangsprüfungen durchgefallen oder der Wellensittich ist gestorben. Mein Gott, die Weiber! Für die muss immer alles sofort und superwichtig sein!
Franzi zieht ein Gesicht. Was bist du nur für ein Charmebolzen.
Malef steht verdattert rum. Irgendwie ist er aus dem Konzept
Der Unternehmer Hansen, abwartend und diskret beiseite gehend, winkt ab mit der Hand. Machen Sie nur. Vielleicht ist es doch was Wichtiges! Ich warte einstweilen…
Und so greift Malef schließlich noch nach seinem Handy. Er tippt darauf herum. Das Display leuchtet auf. Ja, es sind zwei Nachrichten von Eva. Das Handy meldet, Sie haben zwei Nachrichten:
Erste Nachricht – „Franz, Deinem Vater geht es schlecht. Besuche ihn schnellstens, sonst könnte es zu spät sein. Eva.“
Zweite Nachricht – „Franz, ich hoffe, Du hast meine Nachricht gelesen. Dein Vater wünscht Dich unbedingt noch einmal zu sehen. Er liegt im Altenpflegeheim „Friedensruh“ in der Nähe von Forst, die Adresse hänge ich Dir an. Bitte. Überwinde Dich und fahre hin. Das muss jetzt oberste Priorität haben. Gruß und Kuss. Eva“
Franzi ist an Malef herangetreten.
Was Schlimmes?
Wie man´s nimmt. Mein Vater liegt im Sterben. Er will mich nochmal sehen.
Na, dann fahr´ doch hin, Franz. Man hat nur einen Vater…
Holm Hansen hat einen Teil des Gesprächs aufgeschnappt, er mischt sich ein, fragt:
Wie alt ist Ihr Herr Vater?
Fünfundsiebzig.
Und er liegt im Sterben?
Offensichtlich.
Woran leidet er denn?
Darmkrebs, wahrscheinlich im Endstadium.
Na dann machen Sie sich schnellstens auf den Weg, Herr Malef, sagt Hansen. Meinen Vater hab´ ich nicht mehr lebend angetroffen. Ich war in einer ähnlichen Situation. Ich erfuhr, dass mein Vater am Ende sei, ich war damals auf Geschäftsreise im Ausland. Habe alles sofort abgebrochen und bin trotzdem zu spät gekommen. Glauben Sie mir, das ist eine verteufelte Sache, man macht sich ein Leben lang Vorwürfe… fahren Sie, ich werde derweil auf Ihre Frau Schönlebe aufpassen, dann, wenn Sie alles erledigt haben, kommen Sie wieder hierher…
Es war ihm anzusehen, was er unter dem „Aufpassen auf Franzi“ verstand, er konnte seine Vorfreude kaum unterdrücken. Und auch Franzi schien sich mit Holm Hansen gut zu verstehen, sie lächelte ihm zu. Malef biss sich auf die Unterlippe. Aber er schwieg.
Malef hatte seinen Vater mindestens ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen, er wusste es nicht einmal mehr so genau, es könnte auch länger her sein. Sie hatten nie ein besonders herzliches Verhältnis gehabt, sein Vater und er, und Malef quälte immer das Gefühl, dass sein Vater ihm einiges aus seinem Leben verschweige, aber jetzt war eine andere Situation. Jetzt lag der Alte im Sterben. Nein, er musste unbedingt hin nach Forst, hin zu seinem kranken Vater, er fühlte, es war irgendwie seine verdammte Pflicht, mochte da zwischen ihnen gewesen sein, was da wolle, er war der Sohn – er würde hinfahren. Punkt. Gleich morgen früh würde er sich auf den Weg machen. Franzi würde er hier zurücklassen. Nein, wegen eines Holm Hansens, dachte er, brauchte er sich keine Sorgen machen. Der war sicher nicht Franzis Typ, so ein geleckter Wessi… außerdem, so hätten sie, Franz und Franzi, gleich eine erste Probe… eine Art Treuetest.
An nächsten Morgen war es nebelig und kalt. Malef fröstelte, als er ins Freie trat. Er zog sich die Jacke fester um die Schultern. Vom nahen Meer wehte es kühl. Möwen kreisten und schrien, es roch nach Hafenwasser und Tang. Auch im Auto würde es kalt sein, die Scheiben waren beschlagen. Ehe er die Wagentür öffnete, wandte er sich noch einmal um, winkte Franzi und dem Holm Hansen, die auf der Vortreppe standen. Oh ja, sie standen ziemlich einträchtig beieinander, die beiden. Hielten sie sich schon an den Händen?
Malef trat aufs Gaspedal, er fuhr zügig los.
Er hatte ausgerechnet, bis nach Forst, wo sich des Vaters Pflegeheim befand, waren es über vierhundert Kilometer. Er würde mindestens fünf Stunden brauchen, denn er wollte sozusagen über Land fahren, auf Schleichwegen also, die Autobahn umgehen. Das war ein wenig kürzer und abwechslungsreicher, die Autobahn schlauchte ihn immer so. Allerdings würde er da mehr Zeit brauchen. Aber er könnte ja irgendwo an einem Dorfgasthof haltmachen und ein Frühstück zu sich nehmen. So richtig deftig, ländlich. Darauf freute er sich. Wie er so fuhr, wurde das Wetter immer freundlicher. Die Sonne kam heraus und beschien das Land in goldenen Streifen. Die Landschaft war sanft und hügelig, auch bewaldet. Komisch, dachte Malef, Deutschland ist immer noch ein waldreiches Land, hier in der östlichen Mitte mit Linden und Buchen, mit Eichen und auch mal Birken, aber kaum mit Nadelwald bestanden. Über die abgeernteten Felder stolzierten die Störche auf der Suche nach Mäusen, denen jetzt die Deckung abhanden gekommen war, man sah Rehe und Damwild in kleinen Gruppen, an manchen Stellen zogen die Bauern schon wieder ihre Furchen für die bevorstehende Herbstsaat. In einem Dörfchen in der Mark Brandenburg – der Teufel weiß wie es hieß - machte Malef Rast. Die Kneipe war früher zu LPG-Zeiten ein Kulturhaus gewesen. In einigen Ecken klebten noch die alten, roten Plakate, jetzt überstrichen und überklebt von anderen, neueren, wo die halbierten Köpfe der Kandidaten der Sozialdemokraten und der Grünen mit denen von CDU und PDS hervorschauten und miteinander wetteiferten. Die Kneipe hieß noch immer Kulturhaus und trug den Namen eines einstmals Großen der DDR „Bruno Apitz“. Aber das Angebot an Speisen und Getränken war neu und vielfältig. Malef trat ein. Der Gastraum ähnelte einem Saal, mit Galerie und bunten Fähnchen, mit vielen Luftschlangen und Konfetti auf dem abgeschabten Parkettfußboden, mit abgeblättertem Putz und Zigaretten-Werbung an der Theke - vielleicht hatte hier am letzten Wochenende ein großer Dorfschwof stattgefunden.
Eine Kellnerin in karierter Schürze und mit ein paar Lockenwicklern im Haar machte vor Malef einen Knicks, was komisch aussah. Sie zeigte ringsum und sagte mit einem Lächeln, sie hätten am letzten Sonnabend ein großes Dorffest gefeiert, das dreißigjährige Bestehen des Kulturhauses, sogar der Bürgermeister und der Landrat wären da gewesen.
Malef gratulierte seinerseits und setzte sich an einen der Tische. Er schien der einzige Gast von außerhalb zu sein, die meisten Tische waren frei, nur in einer Ecke saßen ein paar Bauern und prosteten sich zu.
Die sind wohl vom Fest übrig geblieben? fragte Malef.
Nee, nee, ein holländischer Viehhändler ist angekommen und der will einen großen Posten Schlachtrinder aufkaufen. Der Dicke dort ist es, die Kellnerin zeigte mit der Hand auf einen Mann im hellen Trachtenjanker, der eben seinen Humpen hob. Ja, der dort ist es. Das ist Mijnheer van Klaaßen aus Andernacht. Vielleicht haben Sie den tollen Wagen vor der Tür gesehen. Ein amerikanischer Mordsschlitten, „Oldsmobile“ Baujahr 65. Der Mann hält hier die ganze Brigade frei, bezahlt gleich alles in bar, hat die Brieftasche voller Scheine, auch Dollars und Pfund Sterling…
Die Kellnerin fragt: Und? Was wünschen Sie zum Frühstück?
Malef hat Appetit, er bestellt ein doppeltes Bauernfrühstück und ein großes Clausthaler.
Der Holländer hat herüber gesehen, er hob die Hand und rief:
Du! Hallo, Mennecken mit der Glatze! Du bist auch mit eingeladen. Ik betaal je ontbijt! Zum Wohl! Proost, mijn liefste!
Danke! brüllt Malef quer durch den Saal. Ik geniet ervan – ich werd´s genießen.
Das war pure Angeberei. Malef konnte nur ein paar Brocken holländisch. Trotzdem, die Kellnerin, die daneben stand, staunte…
Erst ein paar Wochen später erfuhr Malef, als er im Fernsehen die Sendung XYZ gesehen hatte, dass dieser fröhliche Holländer ein bekannter Betrüger war, der die Bauern abzockte und bei Nacht und Nebel dann heimlich mit ein paar Spießgesellen alles Vieh abtransportierte. Ganze Herden soll er auf diese Weise geklaut haben. Tja, zu dieser Zeit glich der Osten Deutschlands einem Freiluftwarenhaus, jeder gemeine Verbrecher konnte hier mit seinen alten Tricks ein Schnäppchen machen…
Malef fuhr weiter, noch beschwingt von der fröhlichen Gesellschaft und dem lustigen Holländer. Er ahnte ja nicht, was der für ein Kaliber war. Es war früher Nachmittag als er am Pflegeheim, wo sein Vater lag, dem Haus „Friedensruh“, am Rande des Städtchens Forst, ankam...
Es war ein alter Bau, zur Jahrhundertwende um 1900 erbaut, rote Klinker mit Sandstein verziert, eingebettet in eine weite Parkanlage. Vögel zwischerten, Eichhörnchen huschten über die Wege und an den alten Buchen empor. Auf den Parkbänken saßen Leute, auf den ersten Blick konnte man nicht unterscheiden, was Besucher und was Insassen waren. Vereinzelt wurden Patienten im Rollstuhl umhergefahren. Personal, kenntlich an den weißen Kitteln, lief auf den Wegen, meist im schnelleren Schritt als die Insassen. Malef ging zum Haupthaus, um sich anzumelden und sich den Weg nach der Unterkunft seines Vaters beschreiben zu lassen. Es war ein langer Tresen, das Möbel schon älter, dahinter wie in einem Hotel die Dame der Rezeption. Als Malef sich vorgestellt, sein Anliegen erklärt hatte, wurde er aufgefordert zu warten. Eine Ärztin werde gleich erschienen. Die werde ihn über den Krankenzustand seines Vaters aufklären. Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis die Ärztin erschien. Es war eine Dame um die Vierzig, sie wirkte streng, ganz und gar sachlich, kalt. Sie bat Malef in eine Sitzecke. Tja, begann sie, es wäre schön, dass er sich als der Sohn hierher bemüht habe. Der Zustand seines Vaters sei im Augenblick zwar, nach der Operation vor einem Vierteljahr und dank verschiedener, onkocider Medikamente, stabil, zugleich aber auch bedenklich. Immerhin, er sei über die Mitte Siebzig hinweg, außerdem gäbe es noch verschiedene Nebenerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, da könne es manchmal recht schnell aus dem Ruder laufen. Sein geistiger Zustand sei bestens, keine Anzeichen von Demenz oder Ähnlichem. Trotzdem bitte sie ihn, seinen Vater, Herrn Reinhard Malef, nicht allzu sehr zu belasten. Ess- und Trinkverbote gäbe es nicht. Natürlich, Alkohol, das verbiete sich von selbst, ebenso Nikotin. Freilich, schwer Verdauliches, Blähendes oder Süßes sollte ihm nicht gegeben werden… ach und eines noch – die Ärztin wirkte verlegen – falls Sie noch einen Tag länger bleiben wollten, Herr Malef, man hätte hier die Möglichkeit, ein Zimmer zu den ortsüblichen Preisen zu mieten, es genüge, wenn man sich bis siebzehn Uhr bei der Rezeption diesbezüglich anmelde…
Malef wollte noch ein paar Einzelheiten zur Krankheit seines Vaters erfahren – Folgendes war ihm bekannt: Der Alte hatte ein Dickdarmkarzinom im Endstadium, die Operation konnte nichts Grundsätzliches ändern. Damit hätte man die Letalität nur um Einiges hinausgezögert. Der Krebs werde wiederkommen und weiterwachsen und schließlich zum Tode führen. Aber am Ende ließ er es, er fragte nichts weiter. Die medizinischen Tatsachen würden ihn nur verwirren. Und was änderte es, wenn er es wüsste?
Malef bedankte sich bei der Ärztin. Sie verabschiedeten sich. Er schaute ihr nach wie sie mit festem, sportlichem Schritt davonging. Noch im Laufen nahm sie den Piepser aus der Kitteltasche, blieb stehen, hielt den Kopf schräg, sprach mit dem Anrufer und lief dann noch eiliger als vorher, wie ein Pferd mit dem Kopf nickend, davon.
Malef stand auf, er wollte jetzt zur Unterkunft seines Vaters. Die Rezeption hatte den Alten angerufen. Malef würde also erwartet. Überraschungen liebte man hier nicht, es könne unangenehme Folgen haben.
Malefs Vater war im Haus D, Erdgeschoss, Zimmer 27 untergebracht.
Man musste durch den halben Park laufen. Malef ging betont langsam, er wollte die herrliche Natur und die Ruhe genießen und nicht außer Atem oder gar verschwitzt ankommen.
Jenes Haus D war wie die anderen der Anlage ein Bau aus der Zeit des Jugendstils. Allerdings hatte der Zahn der Zeit schon ein wenig an ihm genagt, am Wandputz, an den Säulen des Eingangsportals, am Dachfirst, der Schieferdeckung und auch an der Außenfarbe der Fenster. Es war ein Gebäude mit drei Etagen, das Erdgeschoss mitgerechnet, umstanden von üppig blühenden Rhododendronbüschen, davor eine sattgrüne Rasenfläche, geschmückt mit mehreren Sandsteinfigurinen und drei oder vier Sandsteinputten, kleinen halbmannshohen dicklichen, pausbäckigen Knaben, auf dem Kiesweg, der herumführte, standen mehrere dreisitzige Holzbänke. Die waren mit moosgrüner Farbe frisch gestrichen.
Malef trat durch das säulengeschmückte Portal ins Innere. Stille, gebohnertes Parkett und Kühle empfingen ihn. Es roch nach den üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Rechts der Mitte führte eine Treppe in Windungen nach oben, in der Mitte hatte man einen Fahrstuhl eingebaut. Ein altertümliches Modell mit einem bronzierten Gitterkorb. Links eine Tür mit Milchglasscheiben, darauf stand in alter, schwarzer Fraktur-Schrift: Erdgeschoss Zimmer 3 bis 29. Etwas kleiner darunter: Es wird um Ruhe gebeten. An den Zimmern ist anzuklopfen.
Malef ging an den grau gestrichenen Türen entlang. Das Zimmer 27 lag am Ende der linken Seite, kurz vor dem tiefgezogenen Gangfenster. Malef stand vor der Zimmertür und er spürte wie das Herz zum Halse schlug. Ein Täfelchen an der Seite verriet den Zimmerinsassen: Friedrich Paul Reinhard Malef.
Dann, kurz entschlossen klopfte Malef.
Eine dünne Stimme rief: Herein!
Franz Malef hatte seinen Vater über ein Jahr nicht mehr gesehen. Als er nun vor ihm stand, musste er sein Erschrecken hinter einem Lächeln verbergen. Sein Vater war jetzt etwas über fünfundsiebzig, aber er sah zehn Jahre älter aus. Die wächsern weißgelbe Haut glänzte und sah aus wie gegerbtes Leder, das man über hervorstehenden Knochen gespannt und glatt gezogen hatte. Sie wirkte wie gummiert oder als sei sie unter Vakuum auf den Körper gepresst.
Der Alte im Bett versuchte sich aufzurichten. Es gelang ihm nur halb, es fehlte die Kraft. Er streckte seinem Sohn die dürren, mit mehreren Pflastern beklebten Arme entgegen, seine Augen – haselnussbraune, die Farbe hatte sich nicht geändert – glänzten fiebrig.
Komm, mein Junge, du bist gekommen. Das freut mich. Komm küsse deinen Vater!
Malef musste sich überwinden, der Vater roch auch anders, als er es in der Erinnerung hatte. Da war irgendein erdiger, muffiger Geruch, den er nicht kannte. Er küsste den Vater auf die Stirn. Diese fühlte sich kalt und trocken an. Der Alte wiederum küsste Malef auf die Wange. Der empfand etwas Fremdes, Hölzernes. Wie doch Krankheit einen Menschen verändert.
Der Alte sank zurück in die Kissen. Er keuchte dabei, wiewohl er es zu unterdrücken versuchte, wie ein alter Kessel, der undicht geworden ist.
Stell mir doch das Kopfteil steiler, bitte. Dann kann ich dich besser sehen.
Es entstand eine Pause, in der Malef dem Vater zu einer besseren Sitzposition verhalf. Malef wollte sich nicht auf das Bett des Vaters setzen, irgendeine Furcht war in ihm, er zog sich einen weißgestrichenen Anstaltsstuhl heran und setzte sich.
Ich wollte dir Blumen mitbringen, Vater, sagte Malef, doch ich wusste nicht, ob das erlaubt ist. Mit Naschereien ist es ebenso. Entschuldige!
Der Vater machte eine wegwischende Handbewegung.
Schon gut. Darauf kommt es gar nicht an. Hauptsache, Du bist da. Wie war die Fahrt?
Man spürte, dass zwischen beiden noch die unsichtbare Mauer einer langen Trennung stand. Im Grunde fühlten sie sich einander fremd, erinnerten sich der gemeinsamen Zeit, Franz seiner Kindheit und der Alte seiner Zeit als Familienvater, nur unvollständig und dunkel. Langsam begann das Eis ihrer vergessenen Erinnerungen aufzutauen, zu schmelzen. Am besten, dachte der Vater, man redete zunächst über die Schülerstreiche des Sohnes, und Franz sagte sich, es werde das Beste sein, man spräche von seinen Verfehlungen aus der Schulzeit. Da hätte sich der Alte zwangsläufig am meisten mit ihm beschäftigen müssen… denn es ist ja so, dass den Eltern diejenigen Kinder, welche ihnen am meisten Sorgen machen, zugleich am nächsten sind. Und so geschah es, dass beide, der Vater wie der Sohn, für die Gesprächseröffnung dasselbe überlegt hatten. Es wirkte deshalb wie eine Befreiung als Franz fragte:
Weißt du noch, Vater, wie ich damals den Brief des Klassenlehrers versucht habe vor dir zu verstecken? Und wie Herr Bürgel sich dann bei uns zu Hause anmeldete, weil von dir keine Reaktion auf seinen Brief gekommen war?
Und ob ich mich erinnere, du Lausebengel, entgegnete der Vater, und ob. Und dabei lachte er. Fast schien es, als wäre er froh und erleichtert, Worte wie „Lausebengel“ auszusprechen…
Und weißt du noch, setzte Franz nach, wie ich eines Tages aus dem Landheim in Königstein vorzeitig nach Hause musste?
Und ob ich das weiß, konterte der Vater, und ob. Ich sah´ dich noch als armen Sünder in der Tür stehen, den Blick, ganz gegen deine Art, zu Boden gerichtet, blass und auch ein wenig ungewaschen…
Ja, ich hatte einer Klassenkameradin, der Paula Simmel, unter der Elbbrücke, als wir von einer Wanderung zurückkamen und zu Fähre gingen, eine tüchtige Ohrfeige, und zwar von hinten, verabreicht. Den Grund weiß ich heute nicht mehr. Natürlich heulte die Paula gleich los und ihre Freundinnen kreischten. Herr Bürgel, der Klassenlehrer, war empört. Und abends dann beim gemeinsamen Abendbrot im Landheim, im Speisesaal, in dem es immer wie nach Schulessen roch, da verkündete Herr Bürgel gegen mich, den Übeltäter, ich sollte am nächsten Vormittag in Begleitung einer Erzieherin nach Hause fahren, für mich wäre der Landheimaufenthalt zu Ende. Die halbe Nacht habe ich aus purer Verzweiflung in die Kissen geheult. Meine Kameraden, die Mitschüler, lästerten, manche freuten sich sogar. Das waren meine Widersacher. Jedenfalls ein großer Ärger. Es hatte auch nichts genützt, dass ich mich bei der Paula und bei Herrn Bürgel entschuldigt hatte. Strafe musste sein…
Ja, sagte der Vater, das war eine gerechte Strafe und ich habe später deinem Herrn Bürgel dafür gedankt. Es wäre eine große Erziehungshilfe gewesen. Hoffentlich helfe es, hatte der geantwortet. Und dann lächelte er und zitierte Mao Zedong „Bestrafe einen – erziehe Tausende“…
Gut, antwortete Malef, aber richtig geholfen hat es dennoch nicht. Viele Dinge derselben Art, wie du weißt, sind später noch passiert.
Und so redeten beide noch eine ganze Weile über „diese Dinge“ aus der alten Zeit, sie lachten darüber, wo sie früher in Zorn geraten oder Tränen vergossen hatten, ja, und es geschah tatsächlich, das Eis taute fast vollständig auf…
Auf einmal wurde der Alte ernst und er sprach, sich ein paar Mal unterbrechend, hüstelnd, heiser werdend, wegen dieser alten Nichtigkeiten und Bagatellen habe er ihn, seinen Franz, nicht hierher gebeten, nein, nein, es ginge um Größeres, welches mehr ihn, den Vater, betreffe.
Und er müsse voranschicken, dass das, was er, Franz, jetzt zu hören bekäme, noch kein anderes Ohr aufgenommen habe, nicht einmal das seiner Mutter, Gott habe sie selig. Es wäre, wenn man es so ausdrücken wolle, seine, des Vaters, Generalbeichte. Schlimme Dinge, ja sogar Verbrechen, lägen ihm auf der Seele und er müsse sie loswerden, derartig belastet wolle er nicht von der Welt abtreten.
Freilich klinge das jetzt für fremde Ohren falsch und pathetisch, vielleicht empfinde er, der Sohn, dies heute auch als überzogen, wo inzwischen viel Schlimmeres passiert sei und wo die Menschen tagtäglich haarsträubende Gräuel zu hören und zu sehen bekämen. Trotzdem wolle er, Friedrich Paul Reinhard Malef, jetzt endlich sein Gewissen erleichtern, diese Last müsse er abwerfen und was wäre natürlicher, wenn er dies seinem leiblichen Sohn erzählte…
Der Alte machte eine Pause. Es war ganz still im Krankenzimmer, nicht einmal eine Uhr tickte, nur ganz leise und gedämpft, hörte man von draußen den Gesang der Vögel im Park, Vögel, von denen in der Schrift gesagt worden ist, dass sie nicht säen und nicht ernten und dass sie der Herrgott dennoch ernähre, womit gleichsam gemeint sei, dass sie aus der Zeit gefallen seien, als lebende Nachfahren einstiger Saurier von vor Millionen Jahren, und dass sie gewissermaßen wie nichts sonst den Fortbestand alles Lebenden symbolisieren…
Malef wusste von seinem Vater wenig, aber am allerwenigstens wusste er über seine Zeit während des Weltkrieges. Nie hatte der Vater etwas erzählt, immer nur ausweichend geantwortet. Diejenigen, so sagte er beispielsweise, die viel vom Krieg redeten, hätten nicht wirklich etwas erlebt, die wollten sich nur wichtigmachen. Wer aber wirklich etwas erlebt hätte, und damit meine er etwas wirklich Schlimmes und Unerträgliches, der müsse schweigt…
Nun also wollte er, der sein Ende herannahen fühlte, dieses Schweigen brechen. Dazu hatte er sich durchgerungen. Deshalb hatte er ihn, seinen Sohn, herbestellt.
Malef also saß auf seinem weißen Anstaltsstuhl, er hatte die Hände zwischen die Knie genommen, er saß still und kerzengerade wie in der Schule. Leise sprach er: Vater! Sprich! Sprich ohne Scheu, ich bin nicht dein Richter. Ich verspreche dir, alles für mich zu behalten und keinem etwas davon zu erzählen…
Halt! Nein, das will ich gar nicht, Mein Junge, rief der Vater. Wenn es ausgesprochen ist, was in mir viele Jahrzehnte ruhte, was zwar ruhte aber nicht tot war, sondern gärte und wühlte, dann gehört es nicht mehr mir selbst, dann soll es der Welt gehören. Denn du und andere Nachfolgende sollen ihre Lehren daraus ziehen. Wenn dies nicht so wäre, hätte ich umsonst gelebt. Dann wäre mein Schweigen auch ein Verbrechen. Ich meine damit nicht, dass du es überall und öffentlich heraus posaunen sollst, aber deine Kinder, meine Enkel, Personen, die du liebst und verehrst, denen du vertraust, die sollen es erfahren. Sie wenigstens sollen gewarnt sein…
Wie du dir denken kannst, Franz, geht es um meine Zeit als Soldat der Deutschen Wehrmacht während des Krieges.
Malef, die Hände zwischen den Knien, schwieg. Seine Hände schwitzten. Er zitterte sogar ein wenig.
Ich bin mit 19 Jahren im Jahre 1940 eingezogen worden. Ich weiß noch wie mich der Einzugsbefehl erreichte. Ich war als Vermessungstechniker des Vermessungsbüros Ferdinand Überall & Söhne, was zugleich mein Lehrbetrieb war, im Einsatz. Die Sonne lachte vom Himmel. Es war ein schöner Maien Tag. Kein Mensch dachte an einem solchen Tag an Krieg. Es galt eine Straße in Cotta (das ist ein Stadtteil von Dresden), zu vermessen. Ein motorisierter Bote mit einer schwarzen Lederkappe kam, er wäre vorher am Sitz der Firma gewesen, wo man ihm sagte, wo ich zu finden wäre. Er fragte ohne die Maschine aufzubocken beim Chef nach mir. Der zeigte auf mich. Der Bote fuhr die paar Meter auf mich zu, den Motor stellte er gar nicht erst ab, mit den Beinen hielt er die Maschine fest, das Krad tuckerte vor sich hin – ich weiß noch, es war eine Ardi - er zog aus seiner Brusttasche einen Brief, ließ mich quittieren, gab mir den Brief und knatterte davon. Ich öffnete den Brief. Natürlich, ich wusste, es war der Einberufungsbefehl. Ich rief meinen Chef, zeigte ihm den Befehl. Der schlug mir auf die Schulter:
„Gratuliere mein Junge! Nun kannst du zeigen, was in dir steckt. Führer, Volk und Vaterland sind stolz auf dich.“
Zu Hause war große Aufregung. Meine Muttel, deine „Großi“, war ganz aus dem Häuschen.
Mein Junge, nun wirst auch du Soldat, rief sie in einem fort, sie weinte gleich aus zwei Gründen, einmal aus Angst um ihren Ältesten – mein Bruder, dein Onkel Wolfgang, der in Rostow am Don gefallen ist, den hatten sie schon im Oktober 39 geholt, er diente in Polen und hatte bis dato Glück gehabt, er war Schreiber im Stab bei Oberst Grünwald, seinem Regimentskommandeur, geworden, seiner schönen Schrift und seiner umgänglichen Art wegen und weil er traumhaft Trompete blies und daher im Musikkorps eingesetzt werden konnte – zum Zweiten aber vor Freude, dass jetzt auch ihr zweiter Sohn dem Führer mit der Waffe dienen konnte. Meine Mutter, eure Großi, war ja ein strammes Parteimitglied. Ich hab´ noch ein paar alte Fotos von ihr, wo das runde NSDAP-Abzeichen an ihrem Kleiderkragen prangt. Ich erinnere mich, immer am 20. April, zu Führers Geburtstag, gab es Kaffee und Kuchen. Meistens Obstkuchen, weil den der Führer angeblich so gerne aß.
Ja, ja so war sie…
Plötzlich klingelte es und es kamen weitere Verwandte und Bekannte, die mir alle gratulieren wollten. Manche brachten Geschenke mit, darunter auch sogenannte Fressalien, weil sie meinten, ein Soldat brauche vor allem Verpflegung, und so häuften sich auf unserem Küchentisch Würste geräuchert oder in Büchsen, eingekochtes Obst, Schokolade und was weiß ich noch alles. Zum Hauptbahnhof, wo die Dresdner sich in der großen Halle vor Gleis 17 sammeln sollten, begleiteten mich die Großi, mein Vater und vier oder fünf Verwandte. Manche hatten Blumen mit, andere machten Fotos. Rote Hakenkreuzfähnchen, auch Deutschlandfähnchen, alle aus Papier und irgendwelche bunten Wimpel wurden geschwenkt. Ein besonders Vorwitziger, mein Onkel Alfred, der Bruder meines Vaters, verstreute Konfetti. Tante Marianne, eine Freundin meiner Mutter, hatte Sekt mitgebracht. Aus Zahnputzbechern tranken wir, Onkel Alfred sogar aus einer Henkeltasse. Sektkelche waren zu schade. Es herrschte eine tolle Stimmung. Fünf Jahre später sollte es ganz anders aussehen… Meine Muttel küsste mich, auch mein Vater. Komm gesund heim, Junge, sagte er und strich mir über den Kopf… Ich weiß noch, wie mir bei all dem durch den Kopf schoss: Wie können die eigenen Eltern, die Verwandten, Onkel Alfred, Tante Marianne, wie können sie so fröhlich und außer sich vor Freude sein, wenn ich, ihr Junge, ihr Söhnchen, dem sicheren Tod entgegengehe, denn dass ich diesen Krieg überlebe, erschien mir ausgeschlossen, ich würde sterben, mit 19 oder 20 Jahren, das wäre gewiss, alles andere wäre ein Wunder. Dabei war mir durchaus nicht traurig zumute, im Gegenteil, auch ich war aufgekratzt, fröhlich und siegesgewiss. Ich war ein Teil jener ganzen trunkenen Menschenmeute in Deutschland zu dieser Zeit. Mit solchen und ähnlichen Gedanken verabschiedete ich mich und stieg in den wartenden Zug…
Ich war, warum weiß der Teufel, zur 6. Panzerdivision und dort zum 2. Panzerregiment als Panzergrenadier eingezogen worden. Das sind die, weißt du, die mit den Panzern mitlaufen, die hinten aufsitzen, die das Umfeld aufklären und das Gelände für die Panzer frei machen sollen. Und die im Siegesfalle vom fahrenden Panzer aus den Kindern an den Straßenrändern Schokolade und Bonbons zuwerfen. In jedem Falle - ein Kanonenfutterjob. Die Sterblichkeit dieser Truppe liegt, das hab ich irgendwo gelesen, bei über 60%.
Unser Chef war damals und zwar bis zum 6. Januar 1941 der Generalleutnant Werner Kempf. Danach ist er in die sogenannte Führerreserve versetzt worden und hatte dann bis zu seiner Gefangennahme durch die Amerikaner im April 45 verschiedene Kommandos inne. Er ist, wenn ich mich richtig besinne, in Ruhe und Frieden, mit einem Rosenkranz auf der Brust, im Alter von 78 Jahren in Bad Harzburg gestorben.
Unsere Division jedenfalls lag von Juli bis August 1940 mit ihren Truppenteilen auf zwei Wehrkreise verteilt, nämlich im Wehrkreis IX Hessen, Westthüringen und im Wehrkreis IV Sachsen, Ostthüringen, in den Städten Kassel und in Dresden, also in der Heimat in den Kasernen. Warum man mich ausgerechnet nach Kassel rief und ich nicht in Dresden bleiben konnte, liegt in der Bürokratie und dem Durcheinander des Ersatzheeres begründet. Der Chef dieses Monstrums und Wirrwarrs war bis zum 20. Juli 1944 der bekannte Generaloberst Friedrich Fromm. Du weißt, wie der nach dem Stauffenberg-Attentat endete.
Im September 1940 dann wurden wir komplett nach Ostpreußen zur 18. Armee verlegt. Diese stand bis zum 16. Januar 1942 unter dem Oberbefehl von Generaloberst Georg von Küchler. Ich habe ihn nie persönlich nahe zu Gesicht bekommen, nur einmal zu einem Appell, ritt er auf einem weißen Wallach an der Front der Soldaten entlang und grüßte mit dem Hitlergruß. Das Pferd – er konnte sich nur mit Mühe im Sattel halten, denn er war korpulent und steif, ließ er nur zu Paraden aufsatteln, sonst stand es im Stall oder galoppierte auf irgendwelchen Weiden herum. Er hatte dem Tier einen besonderen germanischen Namen gegeben. Wotan. Vielleicht hat er dabei an Julius Caesar gedacht, der die Front seiner Soldaten ebenfalls stets zu Pferd abritt, oder an Alexander den Großen mit seinem Hengst Bucephalos . Im Ganzen war er, unser Chef, ein stockkonservativer, alter Militär von hessischem Adel und er war von der Rassenideologie der Nationalsozialisten ganz und gar durchdrungen. Die Polen und die Balkanvölker hielt er für minderwertig, Juden sowieso. Solange er in Polen war, benahm er sich wie der Herr im Hause, rücksichtslos und brutal. Aber immerhin, er hatte dem Führer Anfang Januar 42 mehrfach widersprochen und wurde deshalb vom Oberkommando für die Achtzehnte abgelöst. Er wurde ersetzt durch Generaloberst Georg Lindemann, der die Truppe bis März 44 befehligte. Ein farbloser, kauziger Typ mit einem verkniffenen Gesicht und einem Schmiss auf der linken Wange. Auch er schied aus seiner Funktion wegen eines Dissens mit dem Führer…
In den ersten beiden Monaten bis zu unserem Abmarsch, also im Juni und Juli 40, war Drill, Ausbildung und endloses Waffenputzen angesagt. Und zwar jeden verdammten Tag, den Gott werden ließ. Zehn Stunden lang Drill. Ich war ja nichts gewöhnt, war ein Jüngelchen, ein Bürohengst wie man über mich sagte, fix und fertig haben sie mich in den 8 Wochen gemacht. Fast zehn Kilo hab´ ich abgenommen. Hab mir Blasen gelaufen, groß wie Weintrauben. Einmal hab ich sogar in die Hosen geschissen, weil ich es nicht bis zum Abtritt schaffte. Eine Demütigung ohne Beispiel stand mir bevor. Ich musste vor der Kaserne im feuchten, kalten Dreck liegen, drei Stunden lang. Im wahrsten Sinne des Wortes mit der Schnauze in einer Pfütze. Der Spieß, der sich großsprecherisch die Mutter der Kompanie nannte, war ein sogenannter Altgedienter, der schon bei der Reichswehr und beim Kaiser Soldaten geschunden hatte, er war ein strunzdummes und perverses Schwein. Er soll sogar einmal eine Strafkompanie unter sich gehabt haben. Dort haben sie ihn wegen Sadismus abgelöst. Ich erspare mir hier die Einzelheiten mein Junge, aber selbst wenn ihr bei der DDR-NVA auch ein bisschen „geschliffen“ worden seid, so ist das gar nichts gewesen im Vergleich zu uns. Wir hatten manchmal eine wahnsinnige Wut im Bauch, ein paar von uns wollten den Spieß sogar nachts im Bett ersticken, aber am Ende geschah diesem Schwein nichts. Ein Glück bloß, es ging einem ja nicht allein so und das wenigstens konnte man als Trost nehmen.
Unser erster Einsatz fand im neuen Regierungsbezirk Zichenau statt. Im Grunde war es eine Art Polizeiaktion, die Säuberung von Juden und anderen ostischen Nichtariern, auch nach Kommunisten, Sozialdemokraten und ehemaligen Angehörigen der polnischen Armee wurde gefahndet, sogar Lehrer und Angehörige der Intelligenz wurden gesucht und aussortiert. Wir hatten hier zunächst lediglich die Aktionen der SS abzusichern. Eine einfache Sache. Aber es zeigte sich, was sich später immer wieder bestätigte, dass Gewalt und Rohheit, häufig angewendet, gewissermaßen zur Gewohnheit werden. Die Soldaten bekommen ziemlich schnell, um es bildlich auszudrücken, eine Art Hornhaut auf der Seele. Eh man selber draufgeht, muss, wenn man die Chance hat, der andere dranglauben. Das kommt wie von selbst. Fast ein Automatismus. Ohne dass die Offiziere viel sagen müssen. Freilich trug die wöchentliche Politschulung auch ein wenig dazu bei. Aber das war für uns eher eine Art Freizeit oder Pausenstunde, langweilig und hundertmal gehört. Viele nutzten sie zum Briefeschreiben. Andererseits, ich muss es so sagen, fanden manche von uns regelrecht Spaß daran, Weiber, Kinder und alte Leute zu hetzen und in Angst und Schrecken zu versetzen, sie anzubrüllen so wie man das aus der Kindheit kennt, wo viele Gefallen daran fanden, den Leuten im Haus oder in der Nachbarschaft einen Schabernack zu spielen, sie in Angst zu versetzen oder in der Schule als Primaner denen von der Unterterzia so richtig einen zu versetzen. Wer kennte das nicht?
Dort sah ich auch meine ersten Toten. Aber ich war erstaunt, sie sahen gar nicht aus wie Menschen, eher wie alte, morsche Baumstämme, grau, schwärzlich, rissig, ohne Farbe, wild durcheinander geworfen
Am 22. Juni 41 begann dann mit dem Überfall auf die Sowjetunion der eigentliche Krieg im Osten, jener Krieg, in dem die deutschen Armeen schließlich so krachend zugrundegingen. Doch zunächst sah es nicht so aus. Es fing wie immer klein an: Wir erfuhren, dass wir einen Überfall der Bolschewisten abzuwehren hätten. Und dass der Kampf an allen Fronten beinahe gleichzeitig beginnen müsse, der Norden aber von besonderer Wichtigkeit wäre. Unsere achtzehnte Armee wurde mit der sechzehnten Armee und mit mehreren Panzerarmeen, der vierten und der sechsten, zusammengelegt. Diese geballte Schlagkraft bildete die neu formierte Heeresgruppe Nord, deren Hauptstoß sich sehr bald auf Leningrad (heute St. Petersburg) richtete. Die oberste Heeresleitung und der Führer samt seinem Propagandatross glaubten, dass dieser Angriff symbolträchtig genug wäre, denn wenn Leningrad fiel, das den Namen des geheiligten Revolutionsführers Wladimir Iljitsch Lenin trug und dass außerdem Jahrhunderte lang der Sitz des Zaren gewesen wäre, dann wäre der Sowjetunion das Rückgrat gebrochen. Leningrad sei den Sowjets noch wichtiger als ihr Regierungssitz in Moskau. So die Propagandamühlen tagaus, tagein. Und wir, mein Junge, ja wir glaubten daran, so wie wir heute wieder das meiste glauben, was uns die Politiker auftischen. Es ist ewig das Gleiche, seit dem Altertum wird den Menschen von ihren Führern eingeredet, was für sie gut sei und was sie zu tun hätten. Und in Kriegen ist die Leichtgläubigkeit am höchsten. Also wurde eine riesige, geballte, militärische Kraft geformt, mehr als eine Million Mann, unvorstellbare, nie dagewesene Militärtechnik, Flugzeuge, Panzer, Artillerie, das Beste und Neueste, worüber das deutsche Heer und die deutsche Luftwaffe damals verfügten.
Der Feldzug gegen Leningrad begann. Er wurde geführt von Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb. Die Erstürmung war das Ziel. Doch, dazu kam es nicht. Alles verlief erstens nicht so schnell und am Ende ganz anders, als unsere Strategen geplant hatten. Und wieder kam es zu Fehlentscheidungen des Führers. Statt die ganze Chose abzubrechen, nachdem klar war, dass es zu nichts führen und nur sehr verlustreich werden würde, befahl Hitler die Belagerung, das „Aushungern“, wie er sich ausdrückte. Dies dauerte bis zur Winteroffensive der Roten Armee 1943/44 und kostete über eine Million Einwohnern Leningrads aber auch vielen unserer Soldaten das Leben. Doch das weißt Du ja alles, mein Junge. Der Unterschied ist nur: Bei Dir ist es Schulwissen, aber bei mir, Deinem Vater, ist es gelebtes Leben und leidvoll gesammelte Erfahrung, ein gewaltiger Unterschied… Malef nickte stumm, er sagte nichts. Was hätte er auch gegen solche Axiome sagen sollen.
Freilich kriegten wir von den unendlichen Leiden der Einwohner nicht viel mit, redete der Vater weiter, nur manchmal, wenn sie ihre Leichen verbrannten, zog der Gestank bis zu unseren Vorposten, aber der russische Winter setzte auch uns zu. Minus vierzig Grad! Ich sage dir, das zwackt… Zwei Zehen habe ich mir am Ladogasee abgefroren. Hier schau!
Und der Alte streckte dem Sohn den linken Fuß entgegen. Tatsächlich sah man nur drei normale Zehen, zwei waren bis auf kümmerliche Knubbel nicht mehr vorhanden. Warum war Malef Junior das früher nie aufgefallen, beim Baden im Freibad zum Beispiel oder wenn der Alte in der Wohnung barfuß über den Steinholzfußboden ging?
Aber, fuhr Malefs Vater fort, hin und wieder schnappten wir Zivilisten oder auch russische Militärs, die im Winter über den zugefrorenen See kamen, um Nahrungsmittel und andere Zivilgüter in die belagerte Stadt zu schmuggeln. Diesen Weg über den zugefrorene See, sie nannten ihn дорога жизни – die Straße des Lebens, war beinahe die einzige Möglichkeit die Stadt notdürftig zu versorgen oder auch sie zu verlassen.
In diesem Zusammenhang hat sich mir eine Begebenheit eingeprägt, die mich sehr verstört hat und seit der ich den Krieg mit anderen Augen zu sehen gelernt habe, es war eine schauderhafte Sache, die in ihrer Grausamkeit nur von den Geschehnissen übertroffen wurde, die ich später im Westen im Rahmen der Ardennen offensive erlebte…
Es war im zweiten Winter vor Leningrad, 1942 zu 43. Es war bitterkalt. Temperaturen von minus 30 Grad Celsius waren keine Seltenheit. Dabei schneite es nicht sehr häufig. Allerdings wehte ein schneidender, eisiger Wind. Unser Regiment (im Soldatenjargon sagten wir „R´ment“) lag am nordöstlichen Ufer des Ladogasees, und zwar zu beiden Seiten des Städtchens Vidlitza über fast 40 km entlang des Sees. Meine Einheit lag in dem Dorf Tschernewskoje, das war einen Gewehrschuss von Vidlitza entfernt. Wir hausten in alten, halb verfallenen Bauernhäusern, die mit inzwischen morschen, blaubemalten Brettern verschalt waren. Manche der Häuschen waren mit Stroh gedeckt, eines mit echten Schieferschindeln. Dort hatte der Dorfsowjet seinen Stammsitz gehabt. Ein paar der Dächer waren auch mit roten, halb verrosteten Blechtafeln versehen. Das Dorf war mit unserem Eintreffen von seinen Einwohnern verlassen worden, nur in zwei baufälligen, alten Häusern am Dorfende, nach Norden hin, hausten noch ein paar alte Leute. Wovon die lebten wussten wir nicht, sie hielten sich kein Vieh, nur ein paar Ziegen und Hühner. Sie wurde von uns regelmäßig kontrolliert. Natürlich wurde gelegentlich auch mal ein Huhn oder ein junges Zickel requiriert. Sonst ließen wir die Leute aber in Ruhe. Als später, Ende 43, die SS kam, war es allerdings damit vorbei… ich weiß nicht, was aus den Leuten geworden ist, nehme aber an, das man sie deportiert oder umgebracht hat. Ich selber bin nach meiner schweren Verwundung nicht mehr dorthin zurückgekommen. Doch dazu später. In den Häusern hatten wir kleine gusseiserne Kanonenöfchen vorgefunden, sogar zwei oder drei gekachelte Öfen. Wir feuerten fast nur mit Holz, auch mit getrocknetem Torf, Kohle gab es nicht. Die Öfchen bullerten und glühten um die Herdplatte rot an, so sehr strapazierten wir sie. Eines Tages, es war Ende Dezember/ Anfang Januar, die Russen feierten ihr Weihnachtsfest. Wir sahen das daran, dass im nicht sehr fernen Leningrad ein paar bunte Raketen hochgingen und dass unsere gefangenen Russen – wir hatten ungefähr zwei Dutzend davon, für Hilfsarbeiten und zum Dolmetschen – ihre schwermütigen Lieder sangen…
Wir hatten mit unserem Zug Wachdienst. Alle Züge des Regiments waren nach dem Rotationsprinzip in den Wachdienst eingebunden. Diejenigen, die sich ausruhten und der Unteroffizier vom Dienst, wir hockten im ehemaligen Haus des Dorfsowjets. Du erinnerst dich, das war das Haus mit dem Schieferdach. Wir rauchten, quatschten, tranken unsere Tagesration Schnaps, ein paar spielten Karten, andere schliefen. Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen, ein Schwall kalter Luft drang herein. Der lange Monz erschien - der war Oberfeldwebel und vertrat bei uns den Zugführer. Er stieß einen russischen Zivilisten ins Zimmer, langte in seine Feldtasche und holte zwei tote Ratten hervor. Diese warf er auf den Tisch.
Eh, du spinnst wohl, Monz? rief einer.
Nimm die Ratten weg!
Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, Oberfeld? protestierte ein anderer, diesmal einer der Kartenspieler.
Was soll der Quatsch? meldete sich ein dritter
Schließlich wischte einer die Ratten mit dem Ellenbogen vom Tisch, schleuderte sie dem Oberfeldwebel vor die Füße.
Da rief der Oberfeldwebel: Ich hab´ euch Ungeziefer mitgebracht, zwei tote Ratten und einen zerlumpten Russen, alle drei hab ich bei der Regimentsküche geschnappt. Die Ratten hab´ ich mit dem Seitengewehr gleich erledigt, den Russen hab ich euch zum Spielen mitgebracht. Ehe ich ihn zum Stab schaffe, wo sie ihn ausquetschen und vielleicht erschießen werden, könnten wir mit ihm noch unseren Spaß haben.
Was sollen wir mit ´n Russen?
Mensch, Monz, du hast´ n Knall.
Ich hab´ mir gedacht, antwortet der Oberfeldwebel, die Kerle sind doch ausgehungert. Der hat Knast ohne Ende, nicht umsonst ist er bei der Regimentsküche rumgeschlichen. Wir wär´s, wenn wir ihm die Ratten zu fressen gäben. Er soll sie häuten, dann hauen wir sie in kochendes Wasser. Der Hygiene wegen, ha, ha, ha. Und dann muss er sie fressen. Komplett, mit Schwanz. Na? Wär das was, Jungs?
Ein paar johlten, zwei, drei klatschten in die Hände. Aber es gab auch einige, die den Monz für verrückt hielten und sowas nicht zulassen wollten. Doch, die wurden niedergebrüllt. Ja, das wär mal ein Gaudi in dem Scheiß-Landser-Einerlei. Hinterher könnte der Russe dann satt und zufrieden zum Stab gebracht werden, wo sie ihm die Eier rausreißen.
Gut gemacht, Monz!
Es wurde sogar abgestimmt. Die klare Mehrheit war für Monz´ Vorschlag.
Man stellte den Russen auf die Beine. Es war ein Mann von ungefähr vierzig Jahren. Er sah ziemlich heruntergekommen aus, mit zerrissenen Klamotten, ohne Stiefel oder Schuhe, mit dicken Leinenbinden um die Füße, unrasiert, hohlwangig, mit fiebrig glänzenden Augen. Er stand da und blickte sich wie irr um. Heiser stieß er immer wieder die Worte „Голод! Я голоден!“ – Hunger! Ich habe Hunger! Dazu machte er Bewegungen mit den Händen zum Mund.
Mensch, der hat Hunger Leute, rief ein Witzbold, Hunger ist bekanntlich der beste Koch. Dem werden die beiden Ratten wie junge Kaninchen schmecken. Los gebt ihm ein Messer und erklärt ihm, was er machen soll.
Ein Messer? Ihm, dem Feind ein Messer geben? Der wird es gegen uns richten. Nein.
Ach, was soll der einzelne Russe ausrichten. Wir stehen doch wie ´ne Mauer um ihn herum. Los, fangen wir an.
Einer holte die Ratten, ein anderer gab dem Russen ein Seitengewehr. Ein Dritter, mein Freund, der Gefreite Dietrich, er konnte ein paar Brocken Russisch, erklärte, was zu tun wäre.
Der Russe war erschrocken, vielleicht dachte er an einen makabren Scherz, dann sah er uns im Kreis mit gezogenen Maschinenpistolen herumstehen, er stieß einen russischen Fluch aus.
Schließlich aber machte er sich ans Werk. Wir schauten zu. Ein paar von uns mussten sich übergeben, auch mir wurde kotzübel. Als er fertig war, er hatte das sehr geschickt gemacht, die Rümpfe der kleinen Tiere waren kaum eingerissen, kam Monz mit einem Eimer. Mit dem Benzinbrenner wurde das Wasser erwärmt und zum Kochen gebracht. Es stank zum Umfallen. Monz hatte noch eine Handvoll Salz in den Eimer getan. Nach zwanzig Minuten waren die Ratten gar, sie begannen sogar schon zu zerfallen. Einer holte eine Zinkschüssel. Die Ratten wurden hineingelegt.
Einer rief: Iwan, es ist angerichtet!
Der Russe musste sich setzen, ihm wurde ein Handtuch als Lätzchen umgebunden.
Man sah ihm an, wie er sich kaum überwinden konnte, ein paar Mal würgte es ihn.
Mir tat er leid, anderen auch. Wir wollten die makabre Show beenden.
Mensch Monz, hör doch auf. Du hast deinen Willen gehabt. Erlass dem armen Kerl diese Tortur.
Nein, schrie der Oberfeldwebel, was auf den Tisch kommt, wird gegessen! Das hat meine Oma schon immer gesagt. Los jetzt, Iwan, friss!
Und Monz hielt ihm seine Luger an die Schläfe. Los! kommandierte er, friss, Iwan!
Der Russe setzte das Messer zu einem Schnitt an, er zerteilte die Ratte. Das Gedärm quoll hervor und verbreitete einen fürchterlichen Gestank. Mit der Messerspitze spießte er die halbe Ratte auf, öffnete den Mund, immer wieder von Würgereizen geschüttelt…
Plötzlich schrie einer an der Tür: Achtung!
Alle standen wir wie vom Blitz gerührt sofort stramm. Herein kam der Regimentskommandeur Major Moritz von Sanftleben, begleitet von seinem Adjutanten und dem Zugführer des ersten Zuges, Leutnant Schumacher. Er machte seinen Routinerundgang. Wie immer hielt Sanftleben seine lederne Reitgerte (er besaß weder Pferd noch Reitausrüstung) hinter dem Rücken und wippte damit. Er machte ein strenges Gesicht, und er schrie – und Sanftleben konnte, wenn es darauf ankam, brüllen wie ein Löwe:
Was ´n hier los, verdammt?
Der Oberfeld machte Meldung: Wachlokal der dritten und der vierten Kompanie, besetzt mit zwölf Mann… als er jedoch bei dem gefangenen Russen angekommen war, kam er ins Stottern. Er wusste nicht mehr weiter. Der Russe – wir kannten seinen Namen nicht – war vor lauter Schreck mit aufgesprungen. Er trug noch das Lätzchen vor der Brust.
Soll´ n der Russe hier?
Melde gehorsamst, Herr Major, das ist eine Gefangennahme. Ich wollte ihn gerade zum Stab bringen…
Und da sitzt der hier gemütlich am Tisch und frisst…
Der Kommandeur trat an den Tisch. Er schaute auf den Teller, erkannte die tote, gesottene Ratte…
Ratten!!! Was´ n das für eine verdammte Sauerei!
Zu Befehl, Herr Major, wir haben dem Russen… weil wir dachten, er hätte Hunger und er hat auch andauernd „Hunger“ geschrien, da haben wir ihm…
Mann, wollen Sie mich verarschen?
Zu Befehl, nein, Herr Major…
Dann räumen Sie das hier weg, verdammte Schweinerei. Schumacher?!
Zu Befehl, Herr Major?
Schnappen Sie sich den Russen und ab zum Stab damit.
Also, Oberfeldwebel Monz, das gibt ´ne saftige Meldung, verstanden? Mensch, was denken Sie sich eigentlich? Wir sind hier nicht im Alten Rom, wo man mit Sklaven solche Spielchen veranstaltet hat…
Zu Befehl, nein, nicht im Alten Rom, Herr Major.
Also dann, weitermachen…
Und der Major, samt seiner Begleitung und dem Russen stapften hinaus.
Wie wir später erfuhren, sollen sie den Russen erschossen haben. Wir erfuhren nicht, was mit ihm los war, wie er hieß, ob er ein Überläufer, ein Spion oder ein Deserteur gewesen war. Es wird wohl ein armes Schwein gewesen sein, den weiter nichts als der Hunger aus der Stadt getrieben und der gedacht hat, bei den Deutschen da kriegt er vielleicht was zu fressen. Dabei hatten wir zu dieser Zeit tatsächlich noch reichlich davon. Die Generalität speiste beinahe täglich Wild, Elch und Ren, Hirsch und Bärenschinken, Lachs und Hausen, aus den umliegenden Wäldern und den Seen Kareliens. Unsere Offiziere lebten auch nicht schlecht. Nein, nicht mal einen Kanten Brot hat er bekommen, der halb verhungerte Russe, oder einen Löffel Suppe - nur zwei tote Ratten. Und die musste er noch selber abhäuten. Monz musste einen Bericht schreiben. Und er bekam eine Strafe: Wegen Störung des militärischen Ablaufes und wegen Beköstigung eines Kriegsgefangenen - sein Urlaub samt Beförderung zum Stabsfeldwebel, die dran gewesen wäre, wurde ihm gestrichen. Eine harte Bestrafung? Keine Spur. Was für ein Hohn. Waren damit die Ehre und die Gerechtigkeit wiederhergestellt? Natürlich nicht.
Mich hat der Vorfall noch Tage danach und dann mein ganzes Leben beschäftigt. Das Gesicht des verzweifelten Russen erschien mir nachts im Traum. Und unsere Truppe, da wurde mir klar, das waren alles andere als gute Kerle und treue Kameraden. Das war die Kavallerie des Teufels. Mit einigen wenigen anderen steckten wir die Köpfe zusammen und schimpften auf Monz und Konsorten. Aber was nützte das? Nichts. Es sollte indes noch schlimmer kommen.
Am nächsten Tag wurde ein Kommando zusammengestellt. Insgesamt acht Mann. Wer sich freiwillig meldete, bekam 5 Tage Sonderurlaub (natürlich nicht per sofort. Der wurde nur angerechnet und irgendwann gewährt) und drei Extrarationen Schnaps und Schokolade. Ich meldete mich. Ich war so dumm…
Es ging um einen Erkundungsinspektion nach Osten, mitten durch die Wälder Kareliens, den Russen entgegen. Wir sollten herausfinden, wie weit oder wie nahe sie uns waren, die Russen. Im Grunde ein Himmelfahrtskommando. Denn wenn sie uns fingen, die Sowjets, war unser Leben nichts mehr wert.
Ausgerechnet Oberfeldwebel Monz war zum Führer bestimmt worden. Auch er hatte sich freiwillig gemeldet. Und natürlich sofort das Kommando bekommen. Er wollte die Scharte mit der Rattenmahlzeit für den gefangenen Russen ausmerzen. Und er war geil auf die Nahkampfspange und das Eiserne Kreuz Erster Klasse. Er hatte zwar schon die halbe Brust voller bronzenes Geklimper, aber das reichte ihm nicht. Monz war für sein Draufgängertum, für seine Rücksichtslosigkeit, aber auch für seine Kumpelhaftigkeit bekannt. Im Grunde war er ein dummer Hund, ohne jede Bildung, dem Materielles, alles, was er anfassen und fressen konnte, über alles ging. Er stammte aus der Eiffel. Seine Eltern und seine Schwester betrieben fort eine Bauernwirtschaft.