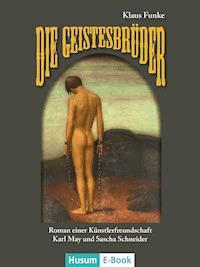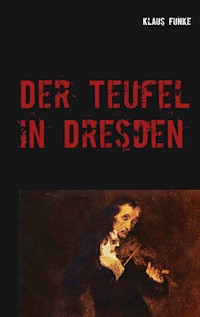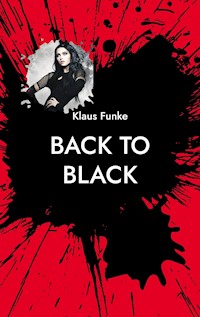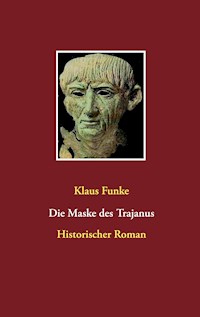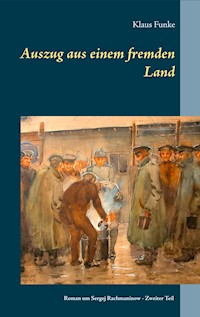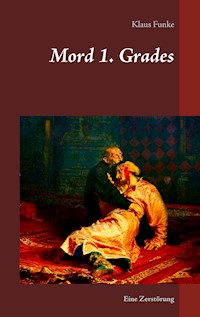
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann ermordet seine Mutter. Vorausgegangen sind jahrelange Demütigung, Erniedrigungen und Beleidigungen. Ein gebrochenes Verhältnis seit er seiner Kindheit. Er hat fast alles verpfuscht, Karriere und Liebesbeziehungen. Die Schuld gibt er der Mutter. Diese ist ein zähes, rachsüchtiges Weib, verwirrt von den Umwälzungen im neuen Deutschland, wo sie einst im Schatten der allmächtigen Partei Macht und Einfluss besaß. Das Buch fällt durch genaue Beobachtungen und psychologisches Raffinement auf. Es entsteht ein Sog, dem sich der Leser kaum zu entziehen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
„Triff mich in den Bauch!“
Letzte Worte von Agrippina, der Jüngeren, der Mutter Kaiser Neros, zu ihrem von ihrem Sohn geschickten Mörder (59 n.Chr.)
Zum Buch:
Ein Mann ermordet seine Mutter. Vorausgegangen sind jahrelange Demütigung, Erniedrigungen und Beleidigungen. Ein gebrochenes Verhältnis seit er seiner Kindheit. Er hat fast alles verpfuscht, Karriere und Liebesbeziehungen. Die Schuld gibt er der Mutter. Diese ist ein zähes, rachsüchtiges Weib, verwirrt von den Umwälzungen im neuen Deutschland, wo sie einst im Schatten der allmächtigen Partei Macht und Einfluss besaß. Das Buch fällt durch genaue Beobachtungen und psychologisches Raffinement auf. Es entsteht ein Sog, dem sich der Leser kaum zu entziehen vermag.
Der Autor:
Klaus Funke, 1947 in Dresden geboren, ist Autor zahlreicher Romane, Novellen und Erzählungen. Einige davon sind seit 2018 bei BoD erschienen, darunter „Die Betrogenen“ – „Der Teufel in Dresden“ – „Das doppelte Ich“ u.v.a.
Keiner hat gesehen, wann und woher dieser Mann gekommen ist. Es ist niemandem aufgefallen. Nicht dem Wirt, nicht dem Personal und nicht den Gästen. Plötzlich hat der Fremde dagesessen auf einem der Holzstühle. Stumm, unauffällig und wie verloren mitten unter ihnen.
Die neue Bedienung, eine junge Frau von kaum Dreißig, stammend aus einem der nahe liegenden Dörfer, beschäftigt in diesem Ausflugslokal erst seit wenigen Wochen, beginnt draußen auf der Terrasse abzuräumen. Rotes Haar, blasser Teint mit vielen Sommersprossen auf der Nase und den Wangen, Sommersprossen, die sie frisch und gewitzt aussehen lassen. Sie reckt sich über die Tische und stellt die Teller zusammen. Das weiße Schürzenband pendelt über dem straffen schwarzen Rock, der viel zu kurz ist. Makellose Beine in dunkelgrünen Nahtstrümpfen. Der rotbraune Zopf, geflochten und von einem ebenfalls grünen Band gehalten, rutscht ihr von der Schulter nach vorn. Sie setzt das gerade ergriffene Geschirr ab, richtet sich auf, um den Zopf wieder nach hinten zu schieben.
Da sieht sie den Mann.
An einem Tisch in der dunkleren Ecke der Terrasse, dicht an der begrenzenden Hecke, sitzt er - grauhaarig, Stirnglatze, Mitte Vierzig. Den Kopf gebeugt, die ganze Gestalt in sich gesunken, apathisch, abwesend starrt er auf einen Punkt der bergigen, waldreichen Landschaft, die durch die stark gelichtete Buchenhecke der Terrasse schimmert. Die Bedienung - sie heißt Gerti Schubert - stutzt. Sie überlegt.
Hat der vorhin schon hier gesessen, als die Reisegesellschaft noch da war? Gehört er gar zu ihnen? Hat man ihn vergessen?
Sie geht über den knirschenden Kies auf ihn zu.
Der Mann hebt langsam den Kopf. Blickt sie an und durch sie hindurch. In seinen Augen, grauen, eisgrauen Augen mit unnatürlich weiten Pupillen, Augen, die von roten entzündeten Rändern gerahmt werden, entdeckt die Bedienung Gerti Schubert etwas, dass ihr einen Schrecken den Nacken hinabjagt. Oh, da ist Kälte. Kalte, harte Entschlusskraft und Schmerz, da ist aber auch Endgültiges, Abschließendes wie von jemandem, der mit sich und allem Schluss gemacht hat.
Sie kennt das. Sie muss sofort an ihren Bruder Jan denken, der sich vor wenigen Monaten gleich hier in der Nähe vor den Zug geworfen hat. Der hat auch so geblickt, kurz vor seiner furchtbaren Tat. Diese Augen. Der gleiche Ausdruck. Nur wusste damals niemand, auch sie, die Gerti nicht, was er vorhatte, und dass er in dreißig Minuten von einer dahinschießenden Eisenmasse, vom Intercity Berlin-Prag zermalmt, zerrissen und gevierteilt werden würde. Aber dieser Blick, an den hat sie sofort gedacht und der hat sich ihr eingebrannt als sie die schreckliche Nachricht erhielt, so wie sie sich jetzt vor diesem Unbekannten mit Schauder erinnert - dieser Ausdruck, dieser Blick würde für immer in ihrem Kopf bleiben. Wie eine Fotografie. Bis an ihr Lebensende. Sie presst die Augen für einen Moment zusammen, will die Bilder, die in ihr aufgestiegen sind, los werden. Sagt – und ihre Stimme klingt heiser:
„Haben Sie noch einen Wunsch, mein Herr?“
Und sie ergänzt, weil sie spürt, noch etwas hinzufügen zu müssen, etwas, dass entspannen, mildern, nett klingen soll. Sie versucht ein Lächeln.
„Sie gehören nicht etwa zu der gerade abgefahrenen Reisegruppe?“
Der Mann schaut ihr jetzt ins Gesicht, nicht mehr durch sie hindurch. Doch es irritiert sie, denn sein Blick ist nicht auf ihre Augen, sondern auf ihre Stirn gerichtet. Auf einen Punkt über ihren Augen, zwischen der Mitte der Augenbrauen und dem Haaransatz.
Er starrt sie an, presst die Lippen aufeinander und sagt dann mit langsamer schleppender Stimme einen Satz, der sie, die Gerti Schubert noch einmal schaudern lässt, sodass die gerade verjagten Ängste rasch wieder hochkommen:
„Ich habe heute und für lange keinen Wunsch mehr!“
Und er fügt hinzu: „Nein, lassen sie mich nur ein Weilchen hier sitzen. Mehr will ich nicht.“
Gerti Schubert nickt und zuckt erleichtert die Achseln. Da fällt ihr Blick auf die Schuhe des Mannes und die hellen Hosen. Braune, elegante italienische Schuhe und beige Leinenhosen mit Umschlag. Doch an ihnen klebt noch feuchter Schmutz, richtige Erdklümpchen und weiter oben an den Hosenbeinen sieht sie dunkle Flecken.
Blut?!
Es sieht aus wie Blut. Die junge Frau zuckt zusammen. Ein Unfall, denkt sie, fragt:
„Hatten Sie einen Unfall?
Zeigt auf die beschmutzten Hosen und Schuhe, ruft:
„Können wir helfen?“
„Nein, nein, es ist nichts. Wirklich nichts. Ich bin nur vorhin als ich gekommen bin in eine schlammige Pfütze getreten. Hab nicht aufgepasst. Verzeihung.“
Er macht eine entschuldigende Geste, wendet sich ab und starrt wieder durch die Hecke hindurch hinaus auf die Landschaft, welche jetzt aber durch die sinkende Sonne seltsam grell erscheint.
„Und sie wollen wirklich nichts?“
„Nein. Ich sagte doch: Ich will nichts. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Oder darf ich hier nicht sitzen?“
Er blickt sie nicht mehr an, starrt, scheint sie vergessen zu haben.
Die Bedienung schüttelt den Kopf und geht über den knirschenden Kies zurück, beugt sich ein paar Tische weiter über Teller und Tassen, Gläser und Aschenbecher, stellt das Geschirr zusammen, baut es auf ihrem linken Unterarm zu einer Pyramide und balanciert zum Haus.
Drinnen fragt Hackenbiehl, der Wirt, der sie durch die offene Tür mit dem Gast sprechen gesehen hat:
„Will der noch was?“
„Nein, nur sitzen will er.“
Ob etwas mit dem sei, fragt er die Gerti.
Er hat mit seinem untrüglichen Kneiperinstinkt bemerkt, ja gerochen fast, dass mit diesem einsamen Mann da draußen auf der Terrasse etwas nicht stimmt.
Jetzt poliert er ein großes Weißbierglas und schaut dabei der Bedienung mit seinen wässrigen, hervorstehenden blauen Augen intensiv in ihre meergrünen, mit Wimperntusche umrandeten.
„Ich weiß nicht. Irgendwie bekomm ich mein Grauen, wenn ich ihn anschaue. Musste sofort an meinen Bruder denken. Ganz plötzlich.“
„Ach, Gerti, vergiss doch die alte Geschichte.“
„Nein wirklich, Chef. Und der hat auch ganz beschmierte Schuhe und Hosen. An den Knien... das sah aus wie... wie... Blut. Große Flecke. Als hätt´ er drin gekniet. Echt, Chef.“„
Mädel, du phantasierst. Vielleicht war es Wasser. Das sieht manchmal, wenn es frisch ist, auch so aus wie Blut. Er wird gestürzt sein oder ausgerutscht. Oder, was weiß ich.“
„Ja, er hat gesagt, er wäre in eine Pfütze getreten.“
„Na bitte… Deck doch jetzt bitte die fünf Tische da hinten ein."
Dann sagt er noch, der Hackenbiehl, und wieder ganz Chef, es sei sowieso gleich sechse. Die Reisegesellschaft komme jeden Moment und nichts sei fertig. Also, marsch, marsch…
Gerti Schubert nickt, macht sich an die Arbeit.
Und der Wirt werkelt hinter Theke weiter. Doch während er so dieses und jenes arbeitet, Gläser spült, ein Fass neu anzapft, den Kaffeeautomat füllt, denkt es hinter seinem breiten, kahlen Schädel:
Wann verflixt hab´ ich diesen Menschen da draußen heute das erste Mal gesehen? Wann wird er gekommen sein? Richtig, sagt er sich, es muss gegen drei gewesen sein. Ja, da waren die Wanderer und die Fahrradgruppe gerade eingetroffen. Und von denen hat dann der Hagere, der mit dem großen Bart, gleich im Stehen, noch den Rucksack in der Hand, ein großes Bier gekippt. Und dann haben sie ihre Wanderkarten ganz selbstverständlich auf zwei oder drei Nachbartischen ausgebreitet, sodass die Ausflugsgesellschaft aus dem silbernen Kleinbus, die eben ausgestiegen war und jetzt einen freien Tisch suchte, in ihrer Not hier herein in die Gaststube kommen musste.
Da, in diesem Moment wird der Kerl auf der Terrasse aufgetaucht sein, dieser komische Typ. Gleich neben der Hecke, zum kleinen hölzernen Pförtchen muss er hereingeschlüpft sein, denn als ich raus wollte, um den Wanderern zu sagen, dass sie die Tische nicht mit ihren Karten belegen könnten, da hab ich ihn plötzlich sitzen sehen.
Ja, dort, wo er jetzt hockt. Vorher nicht? Nein vorher saß da noch niemand. Also klebt der nun schon fast zwei Stunden an dieser Stelle fest.
Der Wirt schielt auf eine alte Standuhr, die gleich neben der Theke vor sich hin tickt und überlegt weiter: Aber bestellt…? Nee, bestellt hat der nix, oder fast nix: Zwei Wasser, einen Kaffee. Was ist das schon. Ja, hier ist noch der Bon auf dem Spießer.
Und Hackenbiehl greift danach und wendet den Schnipsel hin und her. Dann aber ergreift ihn die Neugier und sein Instinkt für die Abgründe dieses Lebens vollends und er schiebt, nein er rollt, er schwenkt seinen schweren Körper elastisch hinter der Theke hervor und geht hinaus auf die Terrasse.
Er geht direkt auf den Mann zu. Direkt und geradewegs. Im Laufen bindet er sich noch die graue, befleckte Halbschürze ab, behält sie zerknüllt in der linken Hand.
Ja, er will, er muss es jetzt wissen, was mit dem Kerl los ist. Ein Gefühl von Amtsperson, von Verantwortung, von Besorgtheit auch, ist plötzlich in ihm. Und wieder knirscht der Kies. Diesmal lauter, denn der Wirt bringt das Doppelte von der Gerti, seiner sommersprossigen Bedienung, auf die Waage.
Hackenbiehl baut sich vor dem Starrenden, Abwesenden, Zusammengesunkenen auf, wirkt wie ein Profiboxtrainer vor seinem mutlosen Schützling. Gleich wird er ihm das Handtuch zuwerfen und sagen, er soll aufgeben, es habe keinen Zweck mehr, er habe den Kampf verloren. Doch der Gastwirt ist kein Trainer und der Mann vor ihm kein Boxer.
Die kahle, bucklige und faltige Stirn Hackenbiehls glänzt von Schweiß und Fett. Die Unterlippe vorgeschoben, fragt er knapp, mit einem gefährlichen Drohen in der Stimme:
„Die Terrasse wird in fünfzehn Minuten geschlossen. Wünschen Sie noch etwas?“
Wieder hebt der Mann langsam den Kopf, wieder sagt er:
„Ich wünsche nichts mehr.“ Und „das habe ich doch ihrer Kollegin schon gesagt!“
Aber der lebenserfahrene Kneiper hat einen Blick für solche Typen. Er weiß, es stimmt, was seine Bedienung, die Gerti, vermutet hat. Dieser Mann hat ein Problem. Er sieht aus als hätte er einen Verkehrsunfall verschuldet, jemanden totgefahren, irgendetwas Schreckliches erlebt, dass er noch nicht verarbeitet hat. Aber da ist auch jene kalte Entschlossenheit, die schon der Bedienung aufgefallen ist. Da ist eine unsichtbare Schranke, die jenen Mann von allen anderen zu trennen scheint. Hackenbiehl muss an ein todwundes Raubtier denken, eines, dass gerade einen Kampf hinter sich hat, bei dem es nur knapp gesiegt hat, selbst aber bald seinen schweren Wunden erliegen wird.
Während dem Wirt solche Bilder durch den Kopf gehen, hat sich der Mann vor ihm plötzlich auf dem Gartenstuhl gestrafft. Er wirkt mit einem Mal größer, kräftiger und stattlich.
Mit einem Ruck steht er auf, stützt sich mit der rechten Faust auf die Tischplatte, zeigt mit der linken Hand in Richtung Lokal, murmelt leise, aber deutlicher Stimme:
„Haben Sie hier ein Telefon?“
„Ja. Gleich neben der Theke“
Der Wirt macht große Augen und wischt sich mit seiner zerknüllten Schürze die fettige Stirn. Er schaut dem Mann nach wie der kerzengrade und in fast unnatürlicher Steifheit dem Haus zustrebt. Dann schüttelt er seinen dicken Kopf und geht hinterher. Er hat ihn noch fragen wollen, nach dem wie und warum und dem ob.
Und nun läuft der einfach davon. Aber da ist noch dieses unbestimmte Gefühl, das ihm gerade so furchtbare Gedanken ins Hirn geschickt hat. Hackenbiehl geht schneller, er beeilt sich, er will nichts verpassen, was der Mann da drinnen tut und sagt.
Dieser hat gerade seine Frage nach dem Telefon wiederholt, den Oberkellner, einen drahtigen Vierziger mit dunklem Bürstenschnitt, am Ärmel festgehalten und steht jetzt neben der Theke an dem nussbaumfarbenen Tischchen, hält den Hörer in der Hand.
Dann besinnt er sich plötzlich einen Moment, wartet, bis der Wirt heran ist:
„Wie ist die Vorwahl nach D.?“
„Brauchen Sie nicht. Wir gehören noch zum Amt der Stadt.“ –
Der Wirt, der sich wieder hinter seine Theke gezwängt hat, will sich gerade wieder die Schürze umbinden, als er seinen Ohren nicht zu trauen glaubt. Denn er hört wie der Mann, keine zwei Meter von ihm entfernt, in das Telefon sagt:
„Hallo, ist dort das Polizeirevier Mitte? Ja? Also, meine Name ist Johannes Wendrich. Ich befinde mich hier im Landgasthof `Drei Buchen´ in K. Ich bitte, mich hier abzuholen. Ich habe heute meine Mutter getötet. Wie bitte? Ja, heute am Morgen, vor ungefähr 10 Stunden. Ja. Wie bitte? Nein, ich warte bis Sie mich hier abholen. Ja. Einen Moment...“
Der Mann wendet sich um, legt den Hörer auf das Tischchen, blickt den Wirt an, sagt:
„Sie möchten bitte ans Telefon kommen. Sie...Sie sind doch der Besitzer hier?“
„Dddder Pppächter. Nnnur der Ppächter.“
Der Kneiper stottert auf einmal. Er ist fassungslos, wie gelähmt. Nein, bei allem, was ihm heilig ist, einen solchen Gast, einen Mörder, hat er hier noch nicht gehabt. Noch nie, nein niemals hat er einen derartigen Menschen leibhaftig gesehen. Aus solcher Nähe gar. Einen Mörder! Einen, der seine eigene Mutter....
Und er kramt in seinem Gedächtnis nach Vergleichbarem. Aber ihm will nichts einfallen. Wie benebelt fühlt er sich, als hätte er Watte im Kopf. Das ist der Schock, sagt er sich, holt dann tief Luft und zwängt sich aufs neue hinter seiner Theke hervor.
Nein, er blickt den Mann, diesen Mörder, der sich Johannes Wendrich nennt, nicht an, nicht ins Gesicht, nur nicht ins Gesicht. Das kann er jetzt nicht. Am liebsten hätte er einen zwei-Meter-Arm gehabt, damit er nur ja nicht nahe heran muss an diesen gefährlichen Menschen.
Vorsichtig, mit spitzen Fingern, fasst er den Hörer, denkt für eine Sekunde irgendetwas von Fingerabdrücken, flüstert dann mit belegter Stimme in die Sprechmuschel:
„Hallo? Ja? Hier ist der Landgasthof ´Drei Buchen´ in K. Ja, ich bin es selbst. Ja, nur der Pächter, leider nur der Pächter. Wie bitte? Ach so. Mein Name ist Hackenbiehl. Friedhelm Hackenbiehl. Was? Ich soll? Hier? Jetzt? Mann oh Mann...“
Er bricht ab, wirft einen Seitenblick auf den Fremden, namens Wendrich, der sich etwas abseits, vielleicht zwei Meter neben ihm, aufgestellt hat und verwirrt und verstört wirkt. Der nervös an seinen Hemdknöpfen dreht und mit der rechten Schuhspitze auf dem Holzdielenfußboden scharrt.
Unentwegt dreht er, scharrt er und sein Blick ist weit weg.
„Nein“, spricht der Wirt Hackenbiehl, jetzt eine Spur sicherer, weiter ins Telefon „nein, so wirkt er nicht. Eher das Gegenteil. Vollkommen nüchtern. Ich wette, der hat keinen Tropfen getrunken. Ja, das kann ich beurteilen. Nein, verstört, verwirrt, ja, aber normal... Ja, gut, mach ich. Ja, Herr Kommissar. Sie können sich darauf verlassen.“
Hackenbiehl hat den Hörer aufgelegt, er wartet und ihm kommt es wie eine Ewigkeit vor bis er sich an dem Mann Wendrich zuwendet.
Verlegen, mit einer unbestimmten Scheu, sagt er zu ihm:
„Der Herr Kommissar von der Polizei hat gesagt, dass ich Sie nicht aus den Augen lassen soll, bis er da ist. Es wird eine Weile dauern, hat er gesagt, eine dreiviertel Stunde vielleicht. Kommen Sie, wir gehen in den Vereinsraum. Da warten wir. Sie und ich.“
Wendrich nickt. Hackenbiehl winkt das Personal heran. Es sind nur der Oberkellner und die Gerti im Gastraum. Keine Gäste. Gott sei Dank sind im Augenblick noch keine Gäste da. Eine glückliche Fügung. Ein Zufall. Natürlich haben sie alles mitbekommen, diese beiden und auch das Küchenpersonal scheint inzwischen Bescheid zu wissen. Böhnke, der rotgesichtige Koch, steht in der Schwingtür zur Küche und stiert auf die beisammen Stehenden. Er macht irgendwelche Zeichen, auf die keiner achtet. Der Geruch der halbgaren Speisen schwebt in den Gastraum. Es riecht nach Basilikum, Knoblauch, nach angebranntem Fett, nach frischem Kuchen, einfach nach allem. Ein Speisekartencocktail der besonderen Art. Während der Telefonate sind die Gerti und der Oberkellner langsam und unmerklich immer näher gekommen, Schritt um Schritt. Eine Ahnung, ein Gefühl, eine Urangst hat sie getrieben. Atemlos, Fußlänge für Fußlänge. Ihre Ohren haben die Worte eingesaugt, ihre Augen jede Einzelheit festgehalten. Jetzt stehen sie abwartend und voller innerer Spannung vor dem Wirt Hackenbiehl. Und wie von einer unsichtbaren Bannmeile abgetrennt, daneben der unheimliche Gast, der Mörder Johannes Wendrich. Es sind nur zwei Meter Grenzstreifen zwischen ihnen. Dunkler kahler Holzfußboden, der matt glänzt. Und doch ist ihnen, dem Personal des Gasthofes mit dem dicken Hackenbiehl auf der einen Seite und dem allein dastehenden Wendrich auf der anderen, als wäre zwischen ihnen das ganze Universum. Als wäre hier die eine und dort die andere Welt. Mit einem Mal, von jetzt an, plötzlich ist sie aus dem Boden gewachsen, diese unsichtbare Mauer. Und mit ihr eine nicht zu beschreibende Scheu, ein Misstrauen, eine Mischung aus Vorsicht, Abwarten, Grauen und Scham. Die einen sehen in dem Mann, diesem Mörder Wendrich, ein Wesen, das nicht mehr zu ihnen gehört, das ein unsichtbares Mahl trägt, vor dem man sich graut, fürchtet, das plötzlich, von einem Augenblick zum anderen, kein Mensch mehr wie Du und Ich zu sein scheint. Sie ist mit Händen zu greifen, die Urangst, das Verfehmte, das Fremde, das immer Gleiche seit Kain und Abel. Und ihnen steht er gegenüber. Der Mörder. Und er weiß plötzlich, er spürt und fühlt, er gehört nicht mehr zu ihnen. Er hat die Grenze überschritten, die kein Mensch überschreiten darf. Er fühlt sich, ganz plötzlich und jäh, ausgestoßen. Es ist ihm bewusst geworden in dem Augenblick, als er am Telefon seine Tat bekannte. In diesen Minuten hat er begriffen: Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin kein Mitglied der Gesellschaft mehr. Er weiß nicht, ist es Scham und Reue, ist es die Urschuld, die hervorbricht, wenn man diese Grenze übertreten hat, wenn man einen Menschen getötet hat. Er, der Mann Wendrich weiß es nicht. Er fühlt nur, kann es nicht beschreiben: Ich bin ab jetzt ein Ausgestoßener!
Am Morgen, nach der Tat, seiner verzweifelten Tat hat er das noch nicht gespürt. Da war er wie im Rausch. Da war nur Befreiung und Erlösung. Nicht dachte er an die Folgen, an Scham und Reue. Da hat er getan, was er tun musste. Und dann war dieses dumpfe Fühlen, dieses alles wie in Zeitlupe ablaufende Empfinden. Wie daneben, ja wie neben sich hat er gestanden und alles mit fremden Augen betrachtet, was er getan. Das verwüstete Zimmer, die blutüberströmte Leiche der alten Frau, die einmal seine Mutter gewesen ist. Und dann ist er fortgelaufen. Immer nur gelaufen. Nicht hat er gewusst, wo er hinwill, nicht, wo er sich befindet. Nichts. Wie ein seelenloser Automat ist er immer nur gelaufen. Atemlos, ohne Durst, ohne Hunger. Immer vorwärts. Zweimal ist er gestolpert und hingefallen. Doch er hat nichts gespürt, nichts gefühlt, keinen Schmerz. Laufen, Laufen, immer nur vorwärts. Bis er zu diesem Gasthof gekommen ist. Diesem Gasthof „Drei Buchen“.
Er hat sich erinnert, nicht genau, nur undeutlich und schemenhaft, dass er hier in frühester Jugend schon einmal gewesen sein muss. Denn alte Bilder sind aufgetaucht. Bilder, die er längst verschüttet geglaubt hat. Von Wanderungen mit der Mutter, dem Vater, den Schwestern. Bilder von leinernen Wanderbeuteln mit Wurstbroten und Waldmeisterlimonade, von Rapsfeldern und zwitschernden Lerchen, von Bauersleuten mit Pferdegespannen und tuckernden Traktoren. Und es hat so gerochen wie damals. Nach Kirschblüten, nach Raps und staubigen Feldwegen. Ja, deswegen muss es ihn hierher getrieben haben. An diesen Ort, wo er noch Kind gewesen ist. Damals. oh, damals ...
Der dicke Hackenbiehl inzwischen gibt seine Anweisungen, die Gerti und der Oberkellner nicken ernst und eifrig, der rotgesichtige Böhnke verschwindet hinter der Schwingtür. Dann sagt der Wirt im Tone eines Streifenpolizisten zu dem wartenden Wendrich:
„Na los, wir gehen da rein und warten bis Sie abgeholt werden.“
Die polierte Tür aus rotbraunem Nussbaum ziert ein ovales Messingschild. „Vereinszimmer“ ist darauf in Kursivschrift graviert und sie gibt einen leisen knarrenden Laut von sich, als sie von Hackenbiehl, dem Wirt, mit schwerer Hand geöffnet wird.
Sie treten in den holzgetäfelten, abgedunkelten Raum. Tische in U Form gestellt, darum Stühle mit hohen gepolsterten Lehnen, an den Wänden verschiedene Urkunden, vergilbt und kaum leserlich, zwischen den verhängten Fenstern Jagdtrophäen: zwei Hirschgeweihe und verschiedene Rehgehörne. Ein Geruch nach Leder, Bohnerwachs und Kneipe ist in der Luft, dieser typischen Mischung, nach der hierzulande alle Vereinszimmer riechen.
Der Mann Wendrich hat sich gesetzt auf einen der Polsterstühle.
So sitzt er nun, die Hände im Schoss ineinander gefaltet, wartet. Ein paar Meter, ihm gegenüber, Hackenbiehl, der Wirt. Beide schweigen. Was sollen sie auch reden, jetzt. Nachdem es bekannt ist. Wendrich hat seinem Bewacher nichts zu sagen. Warum ihm? denkt er. Der versteht sowieso nichts. Für den bin ich ein Abnormer, einer von der anderen Seite der Gesellschaft, einer, der die Grenze überschritten hat, hin zum Verbrechen, zum Abscheulichsten, was es auf Erden gibt, dem Mord an der eigenen Mutter.
Mit so einem redet man nicht, denkt in diesem Augenblick auch der dicke Hackenbiehl, und außerdem kommt gleich die Polizei. Freilich, die werden fragen, was ich mit ihm geredet habe, was er gesagt, was er gefragt hat, dieser Mörder. Da ist es am Besten, man weiß nichts. Wie die Bauern. Die wissen auch nie etwas. Gar nichts haben wir gesprochen als wir hier gewartet haben - das ist das Beste. Nein, ich weiß nichts, außer, was ich schon am Telefon gesagt habe. In so eine Sache, Mord, Muttermord sogar, da lass´ ich mich nicht hineinziehen. Und vielleicht ist der auch nur ein Verrückter. Soll es ja alles schon gegeben haben, dass da Leute Morde gestehen, die sie gar nicht begangen haben, nur in Gedanken sozusagen, im Suff oder unter Drogen. Drogen?? Ja, dieser Mensch könnte so einer sein. Ein Fixer, oder wie das heißt. Nimmt so einer am Morgen ein paar Pillen oder spritzt sich was, und dann fallen ihm die tollsten Sachen ein. Wie man seine Mutter umbringt zum Beispiel, nur so in den bunten wirren Träumen. Er liegt dann da, irgendwo im Park, neben sich eine Plastiktüte mit dem Notwendigsten, einer Spritze, einem kleinen Kocher, einem Löffel und dem kristallinen Zeug, diesem Teufelszeug. Er bindet sich den dürren, zernarbten, zerstochenen Arm ab und jagt sich die Nadel in die angeschwollene Vene. Und dann zerfließen die Gedanken, wird das alles, was im Kopf eingesperrt war, mit einem Mal frei, fliegt in irrem Flug davon. Alles wird möglich. Warum nicht auch ein Muttermord? Oh nein Hackenbiehl, denkt sich der Wirt, du hältst die Schnauze. Nichts sagst du. Klar? Keinen Mucks.
Und so sitzen sie und schweigen, diese beiden Männer. Von draußen, aus der Kneipe und aus der Küche nebenan hört man leises Geklapper, manchmal klingt es wie Stimmen, manchmal wie rasselnde Töpfe, dann wieder Schritte. Fernes Geräusch.
Wendrich hat den Kopf auf die Brust gesenkt, er betrachtet seine gefalteten Hände, die Knie, die Fußspitzen. Er hat das Gefühl als sei er gefesselt, ja ein Gefesselter ohne Stricke, ohne Fesseln. Und er kann sich dennoch nicht rühren...
Johannes Wendrich erinnert sich, besinnt sich auf Episoden aus der Kindheit…
… der Dachboden ist dunkel und es riecht nach trockenem Holz.
Irgendetwas raschelt ganz in der Nähe. Eine Maus? Oder eine Ratte gar? Ich habe gehört, dass Ratten lebende Menschen anfressen. Oder habe ich das gelesen, wo habe ich das gelesen? Bei Edgar Allan Poe? Wie lange sitze ich hier oben schon? Eine Stunde, zwei, drei – oder sind es nur Minuten? Ich weiß es nicht, habe keine Vorstellung, wie viel Zeit vergangen sein könnte, seit mich die Mutter hier eingesperrt hat, ergriffen mit ihren kalten knorrigen Händen, gepackt, gefesselt mit einer Wäscheleine, angezurrt an einen morschen Küchenstuhl und hier herauf geschleppt hat, das Schloss in der alten knarrenden Holztür herumgedreht, den Schlüssel abgezogen und davon gegangen ist. Ich höre noch immer ihre Schritte, ihre schlurfenden Schritte, mit dem linken Bein härter auftretend. Ihre Schritte, die sich entfernen, immer leiser werdend, bis ich sie gar nicht mehr wahrnehme und nur die Stille, diese knisternde, dunkle Stille und dieser Geruch von trockenem Holz um mich ist. Sie hat nichts gesprochen bei alledem. Nur ihr Atem pfiff neben mir, dieses asthmatische Keuchen an meinem Ohr, ist es, was ich von ihr gehört habe, vor den Schritten, ihren Schritten, als sie sich dann entfernte, das Keuchen als sie den Stuhl mit meinen Zwanzigkommafünf Kilo, einem Normalgewicht für einen Zwölfjährigen, die Treppe hinaufschleppte, dieses Keuchen hörte ich, aber kein Wort, nichts. Vorher in der Küche freilich schrie sie mit ihrer schrillen Stimme „Dir werde ich es diesmal lehren. Das wirst Du bereuen!“ Sie schrie, wie ich mir die Hexen vorgestellt habe, die Hexen aus den Märchenbüchern, die ich gelesen habe, wieder und immer wieder. Ein Brot sollte ich holen, doch ich holte kein Brot, sondern ein kleines buntes Heftchen „Die Liebe und der Kapitän“, das mir gefallen hat wegen der Bilder auf dem Titelblatt. Ein Kapitän, wie ihn man sich vorstellt mit blauer Mütze und goldenen Tressen, einem Bart und leuchtenden Augen hält ein Mädchen im Arm und will es gerade küssen. Ein Mädchen mit langen roten Locken und einem roten Samtkleid, vermutlich eine Prinzessin oder eine Fürstentochter, eine wie Rapunzel oder wie die Goldmarie. Das Heftchen hat auf einem Ständer gesteckt vor dem Backwarenladen. Ich habe es gekauft für zwei Mark und fünfzig, für das Brotgeld, das mir meine Mutter gegeben hat. „Wir haben kein Brot mehr“, hat sie gesagt, „komm geh zum Backwarenladen.“ Und als ich zurückkam, fragte sie, „wo ist das Brot?“ Das Heftchen habe ich mir unters Hemd gesteckt, damit sie´s nicht gleich findet. Doch sie hat es gefunden, meinen Kapitän mit seiner roten Prinzessin, diese Heftchen von vielleicht einhundert Seiten für zwei Mark fünfzig. Und sie kreischt los mit dieser Hexenstimme. Ob sie mich verwandeln wird? dachte ich eine Sekunde lang. Wenn sie eine Hexe ist, verwandelt sie mich vielleicht in ein Eichhörnchen. Das wär mir am liebsten, dann könnte ich von Ast zu Ast springen und ihr schnell entwischen, für lange Zeit, für immer. Für immer wollte ich aber kein Eichhörnchen sein, also verwandelte sie mich in ..., in den Kapitän auf meinem Heftchen? Doch, sie verwandelt mich nicht. Sie kreischt, sie schreit, sie fuchtelt und ihre Augen glühen vor Wut. Glühen wie bei einer Hexe, das dachte ich gerade wieder, da packte sie mich, presste mich auf den Stuhl, auf diesen Stuhl, auf dem sie sonst saß mit ihrer alten, abgewetzten Schürze, auf dem sie alle ihre Küchenarbeiten, bei denen sie sitzen konnte, verrichtete, hielt mich mit eiserner Hand fest in diesem Stuhl, zog eine Leine hervor, die bereit gelegen hat, eine Leine, auf der sonst Handtücher, Strümpfe und meine Hosen und Hemden gehangen sind und umwickelte mich wie ein Schnürpaket, Schlinge auf Schlinge, immer fester und fester, bis ich einem Rollschinken gleich, gefesselt bin, um mich dann als verschnürtes, lebendes Stuhlmännlein auf den Dachboden zu schleppen, keuchend, mit asthmatisch pfeifendem Atem „Da bleibst Du, bis ich Dich wieder hole und Du nachgedacht hast, was Du getan hast!“
Wieviel Zeit ist vergangen? Was soll ich bedenken? Was habe ich getan? Also sitze ich hier auf dem dunklen, stickigen Dachboden, auf dem es ganz still ist, wo es nur manchmal raschelt und knistert, dass mir Angst wird wegen der Ratten, von denen ich gelesen habe. Doch es ist wenigstens nicht nass hier und damit auch nicht kalt. Nässe und Kälte kann ich nicht vertragen. Mein ganzes Leben habe ich Angst vor dem Wasser und vor der Kälte gehabt. Und doch lebe ich in einem Land, in dem es die Hälfte des Jahres nass und kalt ist. Einmal war ich in Kroatien mitten im August vor vielleicht vier Jahren: Diese umhüllende Wärme, diese strahlende, grelle Sonne, der Duft nach Pinien, nach Rosmarin und Lavendel. Dieses unwirklich strahlende, klare Blau des Himmels und das blendende Weiß der Kalksteine, der Häuser, die wie mit hellem Pinsel von einem Maler in den Uferfels hineingetupft wirken. Und dann musste ich wieder zurück, hier in dieses grässliche Deutschland, wo alles grau und kalt, nass und hässlich ist. Zurück in dieses Land, zurück zu dieser Frau auch, meiner Mutter. Sie war es, die mir die Furcht vor dem Wasser eingepflanzt hat, vor kaltem, furchtbar kaltem Wasser. Eines Tages, ich war gerade zehn Jahre alt, war sie auf die Idee gekommen, dass ich das Schwimmen lernen müsse. Es zu lernen habe, bevor ich dazu in der Schule sozusagen amtlich Gelegenheit bekäme. Zu einem Junge wie mir, so hat sie gesagt, zu dem gehört Schwimmenkönnen dazu wie Laufen, wie – und dann fiel ihr nichts mehr ein oder ich habe es vergessen. An einem Morgen, einem Sonntagmorgen musste ich mit, in eine Badeanstalt. Zuerst hat sie mir, indem sie mit ihren Armen und Beinen eckige und kreisende Bewegungen ausgeführt hat, das Ganze auf dem Trockenen erklärt. Sie stand auf dem ausgebreiteten Handtuch mit einem Bein und mit dem anderen und ihren dürren Armen machte sie diese Bewegungen, als ob sie im Wasser wäre. Dabei schwankte sie, denn das Gleichgewicht war nicht leicht zu behalten auf diese Weise und mit dem Mund ahmte sie die stoßweise Atmung der Schwimmer nach. Nun sollte ich es probieren. Doch das Gezappel meiner Mutter hatte mich nicht nur verwirrt, sondern auch zum Lachen gereizt. Kein Wunder, dass ich vor Kichern und Lachen nicht richtig stehen konnte, noch dazu auf einem Bein. Da lief sie dunkel an vor Wut. Diese Wut überkam sie wie in einem plötzlichen Anfall immer dann, wenn ihre Geduld sich erschöpft hatte. Und Geduld war bei ihr immer nur sehr klein gewesen. Sie bekam also ihre Wut und warf mich kurzerhand in das Wasser. Dabei rief sie, nun könne ich ja weiter lachen, aber auch nicht vergessen zu schwimmen, sonst ginge ich unter und ersöffe augenblicklich. Die letzten Worte habe ich nicht mehr richtig gehört, denn ich ging tatsächlich unter. Ich fühlte nur, dass mich eine entsetzliche Kälte anfiel, wie alles seltsam leise um mich wurde und ich in ein sanftes Schaukeln und Gleiten geriet. Als ich erwachte, lag ich wieder auf dem Trockenen, neben mir kniete ein Mann und zerrte an meinen Armen, bewegte sie rhythmisch hin und her und meine Mutter stand armverschränkt mit unbewegter Miene ein paar Meter weiter ab. Ich erbrach etwas Wasser, bekam einen Hustenanfall und fühlte mich schwach und zerschlagen. Doch die Schwimmübungen gingen weiter und immer weiter. Ich wurde ins Wasser geworfen, ging zwar nicht mehr unter, aber das Schwimmen lernte ich nicht richtig. Als es in der Schule an der Reihe war, versuchte ich mich zu drücken und bin dem Schwimmunterricht die meiste Zeit fern geblieben. Noch heute wage ich mich höchstens bis zur Brust in das Wasser, mache dann ein paar schwimmähnliche Armbewegungen, tauche auch mal den Kopf mit zugekniffenen Augen ein paar Sekunden unter Wasser, um dann schnell und entschlossen an Land zu eilen ... - Ich versuche mich zu konzentrieren: Warum ging mir gerade eben mein Verhältnis zum Wasser durch den Kopf? Weil ich auf dem Dachboden hockte und mich gefreut hatte, dass es dort wenigstens nicht nass und kalt gewesen ist, denn es war kaum eine Woche her gewesen, da hatte mir meine Mutter eine volle 10 Liter Waschschüssel mit diesem kalten, grässlichen Wasser über den Kopf geschüttet. Von hinten als ich auf einem Stuhl saß und nur, weil ich einen Aufsatz für den Deutschunterricht nicht geschrieben hatte, obwohl er am nächsten Tag abgegeben werden sollte. Einen Aufsatz über ein fröhliches Ferienerlebnis, das ich nicht gehabt hatte und dass es nicht gegeben hatte, denn über Fröhliches wusste ich nichts. In den Ferien war ich nirgendwo, außer im Stadtpark und einmal an der Elbe gewesen. Was hätte ich also schreiben sollen? Stattdessen hatte ich mit einem Bleistift meiner zweiten Leidenschaft gefrönt, hatte Ritter und Pferde und Prinzessinnen skizziert, Kostüme und Waffen, Zaumzeug, Rüstungen und lange Kleider schraffiert und mir dabei Geschichten ausgedacht, so dass meine gezeichneten Figuren auf dem weißen Blatt anfingen, zu leben, sich zu bewegen. Ich war so aufgeregt und bei der Sache gewesen, dass ich nicht sah, spürte, nicht hörte wie meine Mutter hinter mir herumgeschlichen war, mein Aufgabenheft kontrolliert und nun mit bösen Augen eine Waschschüssel herantrug. Mit dieser Waschschüssel also, die sie mit kaltem, entsetzlich kaltem Wasser, solchem wie es aus der Leitung schoss, gefüllt hatte und dieses nun plötzlich über mir ausschüttete. Zehn Liter Wasser auf mich, der ich damals wahrscheinlich nicht mehr als einen Meter und zwanzig groß gewesen bin, über meinen Kopf, den gebeugten Rücken und bis zum Gürtel hinab. Alles war im Bruchteil einer Sekunde tropfend nass. Und meine Mutter, sie kreischte, sie fauchte, es sei eine typische Sache, wenn ich wieder nur meine Spielereien im Kopf hätte und nicht die Aufgaben für die Schule. Auf der Stelle, so schrie sie weiter, hätte ich diesen Aufsatz zu schreiben und dann verwies sie auf meine Schwestern Anna und Maria, dass es bei denen dergleichen noch nie gegeben hätte und dass nur ich... - die Ohren zuhaltend, heulend bin ich hinaus gestürzt, habe draußen weiter geheult, verzweifelt gejammert. Doch, wer sollte mich hören? Mein Großvater Albert, der Vater meiner Mutter, der bei uns ein Zimmer bewohnte, der einzige, den ich von Herzen geliebt habe und der mich geliebt hat, dem ich alles anvertraute, ausgerechnet der war nicht da, sondern in seiner Werkstatt, in der er, obwohl schon Rentner, häufig werkelte. Und meine Schwestern? Aus einem der Zimmer hörte ich das Spiel einer Violine, aus dem anderen das „Dadim, dadim, dadadimdim“ einer Clementi-Etüde. Künstlerinnen sollten aus ihnen werden, nach den Plänen meiner Mutter und der brummigen Zustimmung meines Vaters. Auch zu dem hätte ich nicht gehen können, selbst wenn er da gewesen wäre. Aber er war, wie immer nicht da, sondern irgendwo, auf einer Tagung, einem Kongress, in seinem Institut – ich wusste es nicht. Nein, auch ihm hätte ich mich nicht anvertrauen können, denn ein Leben lang hat mein Vater seiner Frau, meiner Mutter, immer nur zugestimmt. Nie habe ich von ihm irgendeine eigene Meinung gehört, oder einen eigenen Vorschlag, immer nur dieses „Du hast schon recht, mein Liebling!“, mit Liebling hat er sein Frau gemeint, dabei wäre man nur mit sehr viel Phantasie drauf gekommen, dass es zwischen den beiden so etwas wie Liebe gab oder jemals gegeben hätte, etwas, das die Anrede Liebling sachlich gerechtfertigt haben würde. Immer nur hat mein Vater, der auf die schönen Vornamen Friedrich August Maria hörte (oder doch auch nicht hörte, denn er wollte zeitlebens immer nur mit seinem Rufnamen Friedrich, welcher im Deutschen so prägnant auf „Fritz“ abgekürzt wird und dem wir Deutschen diesen wunderbaren Spitznamen verdanken, also auf Fritz wollte er angesprochen werden. Und er hatte auch dieses typisch „Deutsche“ an sich, dieses Gehorsame, dieses Unterordnen, dieses Pedantisch-Umständliche. Ein „Fritz“ eben, wie sie die Deutschen nannten - die Franzosen, die Italiener, die Engländer und wer weiß noch - das war er, mein Vater. Ein Fritz! ), also dieser Friedrich August Maria Wendrich hat meiner Mutter nach dem Munde geredet und dass auch uns gegenüber immer wieder betont, wenn er sagte: „Das wird Eure Mutter schon richtig machen“ oder „Wenn ihr auf Eure Mutter hört, dann stimmt alles ganz genau“ oder „Unsere schlaue Mutter hat es wieder genau gewusst“. „Genau“ war sein Lieblingswort, alles war bei ihm genau oder ganz genau oder haargenau. Denn auf das „Genaueste“ war er als studierter Mathematiker immer aus. Alles musste stimmen, alles an seinem Platz liegen. Ein „Genauigkeitsfanatiker“, mein Vater. Doch dass er meiner Mutter immer recht gab und ihr das Feld vollkommen überließ, hatte noch einen anderen Grund, auf den ich erst viel später gekommen bin. Mein Vater hasste es, Fehler zu machen oder bei solchen ertappt zu werden oder dass man ihm gar nachwies, er habe irgendetwas falsch gemacht. Also überließ er alles seiner Frau – und hatte immer den Rücken frei. Nichts konnte ihm passieren, wenn er ihr das Kommandieren, das Ersinnen und auch das Nachdenken überließ. Und noch etwas war es. Meine Mutter war von ihrer ständigen Rechthaberei, ihrer Bestimmerei und der Rolle als Familienoberhaupt so in Anspruch genommen, und er hatte sie so eingeschläfert durch sein ewiges „Du hast recht!“, dass es ihr entging, entgehen musste, weil sie nicht auch noch ihn kontrollieren und überwachen wollte, ihre gestrengen Augen nicht darauf richtete, was mein Vater mit seiner Freizeit und den Freiräumen anfing, die er sich durch sein Zurückweichen in die zweite Reihe erobert, die er sich so geschaffen hatte. Da waren seine Hobbys, wie das Sammeln und Katalogisieren von seltenen Mineralien. Stunden, Tage konnte er damit zubringen Quarze, Halbedelsteine, Lavagesteine, Glimmer, Achate, Feldspate zu sammeln, zu polieren und fein säuberlich in Kisten und Kästen einzupassen, zu beschriften und sich an der steinernen, manchmal auch glitzernden Pracht zu freuen. Aber da waren auch Besuche bei einem Freund, den er „meinen lieben Sander“ nannte. Ganze Sonntage, lange Abende verlebte er mit diesem Freund. Was sie trieben, ob sie irgendein gemeinsames Hobby hatten, ob sie lasen oder Karten spielten, ob sie Bier und Wein tranken, ob sie musizierten, denn mein Vater spielte Klavier und dieser „liebe Sander“ soll ganz gut gesungen haben, soll „einen wunderbar weichen Barriton“ gehabt haben, wie mein Vater gelegentlich gesagt hat, oder ob sie sich erotisch zugetan waren, wusste ich nicht und habe es nie erfahren. Ich habe diesen Sander, „meinen lieben Sander“, nur einmal gesehen. Das war zu meines Vaters Begräbnis vor zehn Jahren. Er hat auf mich den Eindruck eines sehr weibischen Mannes gemacht, große verträumte Augen, einen seltsam wiegenden Gang und samtene, weiche Hände, die einem festen Händedruck ausgewichen waren. - Doch zurück. Ich stand also im Flur mit nassem Kopf, Rücken und Hosen, fror und heulte und musste dem Klavier- und Violinenspiel meiner Schwestern Anna und Maria zuhören. Und während sie Akkorde griffen und Tonleitern auf und ab intonierten, während dieses ganzen entsetzlichen Gedudels und ich nass und frierend dastand, da, in diesem Augenblick, habe ich das erste Mal beschlossen, meine Mutter umzubringen. Ich spürte wie mir ein geradezu würgender Hass, der mich wie ein Krampf ergriff, von der Brust empor stieg. Da stellte ich mir vor, dass ich es tun würde – mit Gift zuerst. Sie hätte gerade eine Tasse Tee getrunken, in der ich vorher das Gift aufgelöst hatte, von dem ich nicht wusste welches, ob Arsenik, ob Strichnin, ob Barium, ob Zyankali, denn ich hatte selbstverständlich keine Ahnung von diesen Mittelchen, noch woher ich sie bekommen könnte, noch wie ich es bewerkstelligen sollte, diese heimlich in ihre Tasse zu tun. Ich stellte mir nur vor, dass ich es getan haben würde, und ich würde sie mit aufmerksamen Augen beobachten, wie sie die Tasse absetzte, mich merkwürdig anlächelte, um sich dann an den Hals, die Brust zu greifen, mit der anderen Hand sich klammernd an der Stuhllehne festzuhalten (derselbe Stuhl, an den sie mich eine Woche später fesseln würde!), wie sie röchelte, mit gurgelnder Stimme ausrufen würde „Junge! Was hast Du Deiner Mutter angetan!“ (in meiner Vorstellung sollte sie wissen, im Augenblick des Todes Gewissheit haben, dass ich, ihr eigener Sohn sie umgebracht, sie vergiftet hatte) und wie sie schließlich umsinken würde, die Augen verdreht, dass nur noch das Weiße zu sehen wäre... - Dann dachte ich, dass ich auf der Treppe zum Dachboden ein Brett lockern könnte. Ich wusste, sie stieg in der Woche mehrmals dorthinauf, um Wäsche aufzuhängen oder irgendetwas zu holen. Ich stellte mir vor wie sie, nachdem ich mein Werk heimlich vollendet haben würde und nun lauernd in der kleinen Kammer neben der Treppe hockte, wie sie mit schwerem Schritt, mit einem Bein härter auftretend, keuchend die Holztreppe hinanstieg. Ich wusste, denn ich hatte die Stufen gezählt und bei der dreizehnten, ja welche Ironie bei der dreizehnten Stufe musste das Brett, welches ich gelockert hatte, unter ihrem Fuß nachgeben. Neun, zehn, elf, zwölf – gleich, gleich würde es soweit sein, die dreizehnte Stufe. Ich würde einen Schrei hören und im gleichen Moment den Fall ihres Körpers. Da! Sie kreischte, ganz in ihrer Art, nein sie schrie nicht, sie kreischte, noch im Tode gab sie dieses hässliche, erschütternde Gekreisch von sich. Und das würde das letzte sein, was ich von ihr im Leben hören sollte, dann würde es still, ganz still werden. Totenstill. Das Violinenspiel und das Klaviergeklimper, das die ganze Zeit wie immer das Haus erfüllt hatte, würde mit einem Schlag aufhören. Die Schwestern Anna und Maria stürzten mit angsterfüllten Augen, die eine noch ihren Violinenbogen in der Hand, die andere mit den Noten von Diabelli, sie kämen aus ihren Zimmern gelaufen, auf mich zu, der ich arglos und mit gespielter Überraschung auftreten würde. Und sie würden mich fragen, ob ich DAS gehört hätte. Und ich würde fragen: Was denn? Und sie würden mit zitternden Stimmen weiter fragen: Diesen Schrei! Dieses Poltern! Und ich würde schweigend zur Bodentreppe zeigen. Und sie würden dorthin rennen, den Geigenbogen und das Notenheft in der Hand, atemlos und mit großen, angstvollen Augen. Und dann würde ich dasselbe Gekreisch hören, nur in anderer Tonlage, etwas höher und schwächer, von meinen Schwestern Anna und Maria. Und ich würde betont ruhig und beherrscht zu ihnen sagen: Ich rufe die Polizei, schafft sie bitte in das Schlafzimmer! Was sie auch ohne Umstände sofort tun würden. Indessen nagelte ich das Brett wieder fest, verwischte alle Spuren .... - jedoch, die Polizei ist nicht gekommen, meine Mutter ist nicht gestürzt, dieses Brett habe ich nicht gelockert, nichts ist passiert, denn ich habe im Flur gestanden, nass und frierend, aus den Zimmern klang gedämpfte Musik, gespielt von meinen Schwestern – alles hat nur in meinem Kopf stattgefunden. Doch ich würde mir den Tod meiner Mutter noch viele Male vorstellen, ihn mir wünschen, ihn vorbereiten und wieder verwerfen, es würde zu einer zwanghaften Vorstellung werden, über eine lange Zeit, über Jahre hinweg, bis ich ihn wirklich vollstreckte an ihr, ihn vollzöge wie ein Ritual – so geschehen am heutigen Tag, am heutigen Morgen ...
Meine Gedanken holen meine Schwestern Anna und Maria herbei – und sogleich möchte ich mir die Hände an die Schläfen pressen! Ich kann diese Namen nicht mehr hören. Anna und Maria! Auch, wenn es sich um ganz fremde Menschen handelt, kaum lese ich diese Namen, höre sie irgendwo, sofort denke ich an diese Schwestern. Sie stehen mir vor Augen wie Götzenbilder, wie eine ewige Mahnung, wie Spuk. Ihre Köpfe, diese eigensinnigen Münder, diese harten Augen - die Augen der Mutter - diese seltsam gereckten Hälse, als schraubten sie sich in die Höhe, diese auffälligen Frisuren, kunstvoll jeden Tag aufgerichtet. Dabei kann man sehen, dass sie mit ihren dünnen, kraftlosen Haaren - den Haaren der Mutter - sich vergeblich mühen so auszusehen wie andere Mädchen oder Frauen, welche mit Natürlichkeit und Frische ihnen immer voraus sind. Sie stehen mir vor Augen mit ihren Konzertkleidern, in denen sie sich knisternd und raschelnd bewegen, mit ihrem Rouge, das sie auftragen, weil ihnen das natürliche Rot der Wangen fehlt. Immerzu höre ich die Übungsstücke, die Sonaten, die Konzerte – mal von der Geige, mal vom Klavier. Und ich kann sie alle auswendig diese Konzerte, Etüden, Sonaten, auch Symphonien, Oratorien und Opern. Alles, was sie je geübt, in stundenlangem Mühen, die Töne rauf, die Töne runter, die Akkorde und Griffe, die Flagioletts und Glisanti, die Pizzecati, alle Fortissimo und Pianissimo, die Melodien und Tonpassagen - ich kann sie nachsingen. Es klingt mir in den Ohren. In kein Konzert kann ich unbefangen gehen, mich freuen an der Lieblichkeit der Musik, immer höre ich die eine der beiden, mal die Geige, mal das Piano, wie sie üben, zu Hause, wie es aus den Zimmern klingt und wie es bei uns niemals einen Tag gegeben hat, an dem keine Musik zu hören gewesen ist. Auf meinem Polsterstuhl im Parkett des Konzerthauses sitze ich, blättere im Programmheft, lese zum Beispiel Paganini Violinkonzert Nr. 2, Brahms Klavierkonzert Nr. 1 oder ich hocke daheim am CD-Player, wie auch früher am Plattenspieler und will mich auf die Musik freuen. Doch es ist immer dasselbe. Es kommen die ersten Takte und ich sehe Anna, meine Schwester, die Geigerin, sehe ihr angestrengtes Gesicht, sehe die steile Konzentrationsfalte auf ihrer Stirn oder ich sehe Maria, die Pianistin, mit vorgebeugtem Oberkörper, so als kröche sie hinein in ihren Konzertflügel, die Hände mit den überlangen Fingern wie wildes Durcheinander der über die Tasten wirbelnden Knöchel – und meine Stimmung ist dahin. Seit meine Schwestern Musikerinnen geworden, seit sie von meiner Mutter zu solchen gemacht, seit sie selbst der Ehrgeiz dazu getrieben hat, die Musik zu ihrem Beruf zu machen, seit den Tagen, da es begann und sie die ersten zaghaften Töne auf ihren Instrumenten zustande gebracht hatten, kann ich keine Musik mehr hören, ohne an sie, an zu Hause, an die Mutter und all das erinnert zu werden, was mich zeitlebens gequält hat. Und ich denke an meine eigenen verzweifelten Versuche mit der Blockflöte, der Gitarre und auch dem Klavier. Wie ich sie nicht treffen konnte, die richtigen Töne zur richtigen Zeit und wie mich meine Mutter wütend bei den Ohren packte, diese verdrehte, bis sie einem rötlichen Kringel ähnelten und