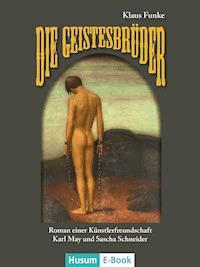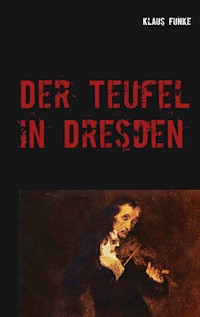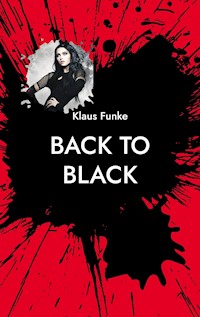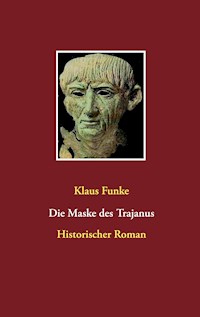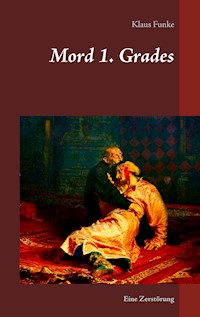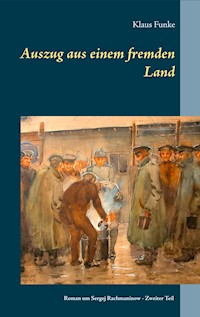Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Als mir meine Mutter sagte, ich sei ein Spätentwickler, war ich schon jenseits der Fünfzig. Meine erste Liebschaft hatte ich mit Siebzehn, meine erste Liebesnacht mit einem Mädchen aber erst mit Zwanzig. In den Stimmbruch kam ich als letzter meiner Klasse. Und in der Turnreihe, die der Größe nach aufgestellt wurde, stand ich an vorletzter Stelle. Und richtig rasiert habe ich mein Kinn erst mit Zweiundzwanzig. Ja, und tanzen habe ich nie gekonnt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ich tanzen gekonnt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen..." Der Autor schildert seine Kindheit aus der Sicht seines Alteregos Franz Malef. Es ist eine unbeschwerte Kindheit, aber sie zeigt auch die aufkommende Spaltung der Gesellschaft, die Trennung in arm und reich, in Staatskonformität und Gegnerschaft, in Ja-Sager und Widerständige. Und diese Bruchlinie reicht bis in die Familien - ein unterhaltsames und zugleich nachdenkliches Buch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1004
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch:
Das vorliegende Buch „Ich wollte König werden“ ist ein autobiografischer Roman. Es ist also im Goetheschen Sinne Dichtung und Wahrheit. Es umfasst die Kindheit und früher Jugend des Autors. Funke lässt sein Alterego Franz Malef agieren. Die realen Personen sind namentlich verändert, zahlreiche fiktive Personen hinzugefügt. Das Buch ist das Porträt einer Kindheit im getrennten, damals noch sozialistisch orientierten und von der Sowjetunion besetzten Ostteil Deutschlands. Es ist zugleich ein vielstimmiges und buntes Zeitporträt und ein Spiegel der ersten Nachkriegsjahrzehnte, es reicht bis kurz nach dem Mauerbau.
Zum Autor:
Klaus Funke, in Dresden wenige Jahre nach dem Krieg geboren, ist ein bekannter Autor erfolgreicher Romane wie „Zeit für Unsterblichkeit“, „Der Teufel in Dresden“, „Die Geistesbrüder“, „Heimgang“ u.v.a.
Dieses Buch ist ein Roman. Indes es ist zugleich Autobiografie. Ein
Mischwesen. Halb Dichtung, halb Wahrheit.
Man weiß, Romane sind erfundene Geschichten.
Deshalb sind die allermeisten Personen erfundene Personen,
wenn sie auch im vorliegenden Fall immer eine reale Entsprechung haben.
Indes, man möge sich nicht verleiten lassen, und das gilt für alle, die sich
wiederzuerkennen glauben, sie für tatsächlich existierende, für lebende
Menschen,
für sozusagen photografische Abbildungen wie aus einem Album, zu halten.
Ebenso die Handlungsorte, Straßennamen usw. – vieles ist erfunden.
Nicht erfunden hingegen ist die historische Zeit, in der sich alles abspielt.
Vielleicht trifft es das Ganze am besten, wenn ich sage:
Die vorliegende Geschichte ist die Poetisierung eines realen Lebens..
(Klaus Funke, 2015)
„Ich erhebe Anspruch auf die Freundschaft, die Achtung und die Dankbarkeit meiner Leser. Auf ihre Dankbarkeit: wenn des Lesen meiner
Erinnerungen sie belehrt und ihnen Vergnügen macht. Auf ihre Achtung;
wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren lassen und mich reicher an guten
Eigenschaften als an Fehlern finden. Auf ihre Freundschasft: wenn sie mich
dieser würdig finden wegen des Freimutes und des Vertrauens, womit ich
mich ohne Verkleidung, ganz wie ich bin, ihrem Urteil überliefere“
(Giacomo Casanova, Vorwort zu seinen Lebenserinnerungen)
„Ich aber erkenne gern stets in mir selber die Hauptursache des Guten und
Bösen, das mir zustößt. Daher sah ich mich stets mit Behagen imstande,
mein eigener Schüler zu sein, und machte es mir zur Pflicht, meinen Lehrer
zu lieben“
(Giacomo Casanova, Vorwort zu seinen Lebenserinnerungen)
Meine frühesten Erinnerungen zeigen mir einen kahlen, weißen Raum.
Große Milchglasfenster. Die Tür hat solche Milchglasscheiben. Ein gläsernes Zimmer. Man hat mich wie im Märchen von der Schneekönigin in einen Palast gebracht, der wie Eis erscheint und doch nur Fenster und Türen aus Glas besitzt. Das war mein erster Gedanke nach dem Erwachen. Denn ich war im Zustand tiefer Bewusstlosigkeit hier angekommen.
Jetzt sitze ich in einem Bett, dessen Kopfkissen, Matratze und Inlett nicht bezogen sind. Inmitten roten Stoffes sitze ich also und ab und zu zwängt sich eine winzige Feder aus dem Innern des Federbettes hervor, taucht empor als ob sie eben geboren wäre und schwebt dann tanzend und schwingend umher. Ich sitze mit angezogenen Beinen und starre zu dem kleinen, höchstens Heftblatt großen Fensterchen mit jener Milchglasscheibe, das in der Mitte der glänzend weißen Tür eingelassen ist. Diese Tür, das erfahre ich später, führt hinaus auf einen ebenfalls kahlen Gang mit einem grünen Ölsockel und schwarzweißen Bodenfließen. Von der Decke des Ganges hängen kugelige weiße Lampen herab. Auch mein Zimmer ist mit einem solchen Ölsockel versehen, nur ist er von hellerem Grün, als der auf dem Gang.
Überall riecht es scharf und beißend nach Desinfektionsmitteln. Und es ist seltsam still hier. Manchmal habe ich über lange Zeit keinen einzigen Laut gehört. Mein Weinen, und ich weine viel, ist dann das einzige Geräusch.
Ich sei in einem Krankenhaus, hat man mir nach dem Erwachen gesagt. In der sogenannten Isolierstation. Später werde ich erfahren, dass ich an einer schweren doppelseitigen Lungenentzündung erkrankt war und dass ich dem Tod gerade noch von der Schippe, wie gesagt wird, gesprungen wäre.
Ein Nachbar der Eltern, der emeritierte Medizinprofesser Dr. Leopold Grasser, hatte mich gerettet, nachdem er jene Lungenentzündung bei mir diagnostizierte. Kein anderer Arzt war erschienen, und er, der Dr. Grasser, hatte darauf bestanden, dass ich sofort in eine Klinik gehöre. Grasser war Mitglied der NSDAP und Militärarzt bei der Waffen-SS gewesen und durfte nach dem Krieg nicht mehr praktizieren. Berufsverbot. Nur ein paar Leute, die ihn kannten und als Arzt schätzten, besuchten ihn noch privat. Manchmal fertigte er bestellte Gutachten. Über einen Kollegen gab er machmal auch Rezepte aus.
Als ich ein Erwachsener bin und selber Familie habe, wohnt eine seiner Töchter eine Zeitlang neben uns im Plattenbau. Wie doch das Leben die Karten mischt. Bis heute bin ich freundschaftlich verbunden mit der Tochter meines Lebensretters. Sie ist eine liebenswerte alte Dame von fast Neunzig und sie liebt und liest meine Bücher.
Damals, im Krankenhaus, saß ich fiebernd und geschwächt in jenem roten Bett und weinte. Meine Eltern hatte ich schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Als sie mich hierher brachten, sie sind mit einem Taxi hinter dem Krankenauto hergefahren und haben lange gewartet, hofften sie, ich werde bald aus der Ohnmacht erwachen; und ich sah dann auch den Kopf meiner Mutter eine kleine Weile durch das Milchglasfensterchen. Sie stand da und redete mit der Krankenschwester, aber ich hörte nichts und es war nur der Schatten ihres Kopfes, den ich sah. Ein verschwommenes Bild. Dann klopfte es plötzlich an die Scheibe:
Mach´s gut, Franzl, hörte ich sie sagen, morgen kommen wir wieder. Werd gesund, wir denken an dich. Ihr Schattenbild verschwand und ich war wieder allein. An den Kopf des Vaters oder seine Stimme besinne ich mich nicht.
Ein anderes Bild: Die Mutter sitzt im Wohnzimmer, einem Zimmerchen, mehr lang als breit und nicht einmal zwölf Quadratmeter groß, sie hat ihre Brust entblößt, eine weiße, große Brust mit winzigen blauen Äderchen, und in ihren Armen liegt meine Schwester. Sie hat den bräunlichen Zipfel der Mutterbrust im Mund und saugt daran. Es scheint ihr zu schmecken, sie ist gierig, denn sie schmatzt und weiße Milch läuft ihr aus den Mundwinkeln. In ihren ersten Kinderjahren ist meine Schwester ein dickes, weinerliches Kind, das den Kopf zur Seite legt und bei jeder Gelegenheit zu heulen anfängt. Ich halte ein Foto aus dieser Zeit in meiner Hand, meine Schwester, sie heißt Birgit, aber alle nennen sie, auch heute noch, nur Gitty, sie hat darauf rote, verweinte Augen, ein Doppelkinn, und eine vorgewölbte Unterlippe, wie sie trotzige Kinder haben. Warum sie damals trotzig gewesen ist, weiß ich nicht mehr, vielleicht hat man ihrem Willen in diesem Moment nicht entsprochen oder sie wollte sich nicht fotografieren lassen, hatte Angst vor dem Blitzlicht. Ich liebte meine Schwester vom ersten Augenblick an, aber ich empfand ihr gegenüber gleichzeitig eine ständig wachsende Eifersucht. Und dies, oder etwas Ähnliches, eine Art Vorstufe von Eifersucht, fühlte ich auch, als ich damals, ich muss ungefähr fünf Jahre oder ein bisschen älter gewesen sein, im Wohnzimmer stand und ihr beim Trinken aus der mütterlichen Brust zusah. Meine Mutter musste meine Gedanken erraten haben; und dann tat sie etwas Überraschendes. Bis ans Ende meines Lebens werde ich nicht vergessen, wie plötzlich ihre bräunliche Brustwarze, die sie aus dem vorgewölbten Mündchen der Schwester gezogen hatte, auf mich zukam. Riesengroß mit Fältchen und einer schlitzförmigen Öffnung in der Mitte. Als einen Schlag empfand ich den warmen Milchstrahl, den sie mir aus dreißig Zentimeter Entfernung ins Gesicht spritzte. Die Flüssigkeit lief mir über Nase und Wange, sie schmeckte widerlich, süßlich und sie klebte. Tagelang spürte ich diese Nässe auf meinem Gesicht. Tagelang roch ich den Milchgeruch. Tagelang ekelte es mich.
Wie verworren sind doch die Pfade unserer Erinnerung, wie seltsam mischen sie sich, zuerst ähneln sie den Flicken auf einem Teppich, und dann, wenn man sich, um ihn im Ganzen zu betrachten, erhebt und einen Schritt nach rückwärts tritt, sieht man aus dem Abstand das vielgestaltige, bunte Bild. Nur aus der Distanz von vielen Jahren erhält man am Ende ein Bild, das aus den zahllosen Lebensflicken ein Gefüge erkennen lässt. Und manchmal kommt dann sogar ein bisher verborgener Sinn, ein facettenreiches Lebensbild oder ein geheimer Zusammenhang hinzu, den man vorher noch niemals entdeckt hat...
Es scheint demnach der Sinn all unseres Erinnerns zu sein, hinter den Sinn des eigenen Lebens zu kommen …
Als mir meine Mutter sagte, ich sei ein Spätentwickler, war ich schon jenseits der Fünfzig. Warum hat sie mir nicht früher davon gesprochen? Vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen. Indes, sie hat recht, wenn ich jetzt so zurück schaue auf Vergangenes, fällt mir auf, dass ich manche Einsichten oft zu spät gewann, dass einige Abschnitte meines Lebens eintraten, wenn meine Altersgenossen schon längst daran vorüber geeilt waren. Meine erste Liebschaft hatte ich mit Siebzehn, meine erste Liebesnacht mit einem Mädchen aber erst mit Zwanzig. In den Stimmbruch kam ich als letzter meiner Klasse. Und in der Turnreihe, die der Größe nach aufgestellt wurde, stand ich an vorletzter Stelle. Nur einer von den Jungen war noch kleiner als ich. Und richtig rasiert habe ich mein Kinn erst mit Zweiundzwanzig. Ja, und tanzen habe ich nie gekonnt. Meine Eltern hielten es nicht für nötig, mich, wie es die Eltern meiner Klassenkameraden mit ihren Sprösslingen taten, in eine Tanzschule zu geben. Wie ich später erfuhr, hat es dafür am Geld gemangelt. Obwohl, bei meiner Schwester, wie auch bei meinem Bruder schien es vorhanden zu sein: beide sind in die Tanzschule Graff gegangen. Das Tanzinstitut Willibald Graff war die renommierteste Tanzschule der ganzen Stadt. Am Schillerplatz und später auch an anderen Orten der Stadt unterhielten sie ihr Institut, in Sälen von stillgelegten Gaststätten zuerst und später in eigenen Tanzräumen wurde unterrichtet, und die Abschlussbälle fanden in den renommiertesten Restaurants statt, wie dem Luisenhof, dem Kurhaus Bühlau oder dem „Löwen“ in Pillnitz und in den Siebzigern sogar im Haus Altmarkt und im Kulturpalast. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ich tanzen gekonnt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen: zum Abitur-Ball hätte ich mit Irene Nägler getanzt, die ich heimlich verehrte, oder vielleicht sogar mit der Russischlehrerin, Fräulein Kowaltschik, einer schwarzhaarigen rassigen Schönheit; während des Berufslebens hätte ich mich bei den alljährlichen Betriebsfeiern den wichtigsten Damen der Firma beim Tanze nähern können und vielleicht manches erreicht, was auf dem einfachen Dienstweg nicht möglich gewesen wäre, zum Beispiel bei der Sekretärin des Chefs, seiner Gattin oder der attraktiven Frau des Parteisekretärs. Da ich aber das Tanzen nicht beherrschte und schon allein deshalb von Minderwertigkeitskomplexen geplagt wurde, graute es mir vor allen Feiern und Veranstaltungen, wo getanzt wurde. Auch meiner späteren Frau, einer leidenschaftlichen Tänzerin, konnte ich diese Freude nicht machen, was zu manchem Missmut geführt hat. Also grollte ich meinen Eltern, dass sie mich das Tanzen nicht hatten lernen lassen. Warum wird mancher fragen, warum ich denn später nicht nachgeholt, was ich in der Jugend versäumt hätte? Auch Erwachsene nehmen ja Tanzkurse. Und die entsprechenden Institute können sich, wie man hört, über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Nein, sage ich diesen Fragern und Ratgebern, dafür habe ich nie den Mut und deshalb auch nie die Zeit aufgebracht und redete mich mit Sprüchen wie „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ heraus. Heute, an der Schwelle des Alters, denke ich freilich anders darüber. Aber, welch Verhängnis, jetzt will der Körper nicht mehr. Die Kniee versagen den Dienst. Ein Spätentwickler eben. Meine Mutter hat schon recht.
Auch in anderen Dingen des Lebens erlangte ich erst spät die wichtigsten Einsichten. So fand ich mit Siebenundfünfzig endlich heraus, was sich jahrelang im Geheimen entwickelt hatte und was meine wahre Bestimmung war: Das Schreiben! Mit Siebenundfünfzig erschien mein erstes Buch und dann, bis heute, jedes Jahr ein weiteres. Erst im Alter erreichte ich also jene Befriedigung, die einen anfällt, wenn man weiß, dass das, was man tut, einen wirklich glücklich macht und dass es die wahre Berufung darstellt. All die Jahre vorher lief ich umher, arbeitete lustlos, ohne rechten Glauben an irgendeine Zukunft, war dauernd unzufrieden und suchte nach dem Lebensglück, nach meiner wirklichen Bestimmung, von der ich nicht wusste, was und wo sie sei ...
Ich bin am 17. Februar im zweiten Nachkriegsjahr geboren.
Dieser Februar wie der ganze Winter 46/47 war einer der erbarmungslosesten, kältesten, schneereichsten im hungernden, von den Folgen des Krieges gerüttelten, gedemütigten Deutschland. Ein Sack Kartoffeln bedeutete Reichtum, gelbe Rüben Ansehen und waren mehr wert als alle Bände Goethes oder Rilkes. Die Quellen für Milch, Butter und Honig schienen versiegt. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung waren überall, jede Woche fand man Erfrorene, Verhungerte, Leichen von Selbstmördern. Ich wurde acht Wochen vor dem berechneten Termin geboren. Ich weiß nicht, ob es der Hunger war, den meine Mutter litt oder irgendein anderes schreckliches Ereignis, Angst oder Furcht, vielleicht war es nur die Neugier des Ungeborenen in ihr, die verzehrende Ungeduld, die mich bis heute peinigt; jedenfalls drängte ich zwei Monate zu früh auf diese Welt. Als die Wehen einsetzten ging meine Mutter, begleitet von ihrem Vater, dem „Heinersch“, hinaus in den Schnee. Das Krankenhaus, ein christliches Hospiz namens „Nazaretheim“, lag nur zwei Kilometer entfernt. Der Großvater setzte die Mutter auf einen Schlitten und zog sie durch den meterhohen Schnee. Einen Arzt oder eine Hebamme hatte man nicht rufen können, nirgends gab es ein Telefon. Auch ein Taxi war unerreichbar. Es gab zu dieser Zeit vielleicht fünf Stück in der ganzen Stadt.
Man wird fragen: Wo war der Vater? Zu seiner Entschuldigung muss ich sagen – er konnte nicht dabei sein. Er war, wie es heute heißt, objektiv verhindert, denn er hatte eine Anstellung im Staatlichen Vermessungsamt bekommen und die hatten ihn zum Außendienst an die Ostgrenze nach Guben geschickt. Es galt die neue Demarkationslinie zu vermessen. Später hat meine Mutter immer spöttisch von Kazimir und Kazimiera gesprochen, polnischen Grenzvermessern, mit denen mein Vater zusammenarbeitete. Besonders jener Kazimiera, einer jungen hübschen Polin, muss mein Vater näher gestanden haben, zumindest nach den Spöttereien meiner Mutter. Ich habe leider niemals etwas Genaueres erfahren.
Etwas mehr als neun Monate vor meiner Geburt hatte meine Mutter von meinem Vater aus einem Kriegsgefangenenlager einen Brief erhalten. Darin lud er meine Mutter zu einem Besuch ein. Die Engländer, als Gentlemen bekannt, hatten nichts gegen Besuche von Verwandten der Gefangenen einzuwenden, vor allem dann nicht, wenn es sich um Gefangene wie meinen Vater handelte, der es durch seine Englischkenntnisse bis zum Lagerdolmetscher gebracht hatte und außerdem ein persönlicher Freund des Lagerkochs und Furiers geworden war; vielleicht wurde er das, weil dieser Koch das Klavierspielen und die Musik liebte und mein Vater auch hier zu Diensten stehen konnte, vielleicht aber auch, weil er meinen Vater sympathisch fand oder weil dieser Koch vor dem Krieg häufig in Deutschland und einmal auch in Dresden gewesen war. Ganz bestimmt ist die Summe dieser Gründe entscheidend für meines Vaters Glück gewesen. Wer kann das so genau wissen?
Ich habe mir den Namen dieses netten Engländers, der, wie wir gleich sehen werden, an meiner Entstehung begünstigend mitgewirkt hat, gemerkt und weiß ihn noch heute: Francis McCormyk, ein Schotte. Mein Vater und er haben sich noch lange Briefe geschrieben, bis ins Jahr Fünfzig hinein, doch dann wurden die Briten wieder unsere Feinde, das heißt Feinde des offiziellen Ostdeutschland, weil sie den Sozialismus in diesem Teil Deutschlands und die Sowjetunion nicht liebten, und weil den Ostdeutschen gesagt wurde, alles Westliche sei zu verabscheuen - und der Briefwechsel schlief ein. Auch war mein Vater inzwischen Genosse der Sozialistischen Einheitspartei geworden. Ihm waren solche Kontakte streng verboten. Und er gehorchte seiner Partei. Gehorchen war ihm anerzogen.
Doch zurück: Meine Mutter brach also im späten Frühling 46 auf, ihren Mann in jenem britischen Gefangenenlager zu besuchen. Sie hatten 1944 eine „Kriegerehe“ geschlossen. Vor mir das Hochzeitsbild: mein Vater steht in Uniform mit allen Orden und Abzeichen neben seiner Braut, die, wie es sich gehört, im langen weißen Kleid mit Spitze, Schleier und Blümchen auf dem Foto zu sehen ist. Für das Uniformbild hatte es Sonderurlaub gegeben.
Das heißt, natürlich nicht für das Bild, sondern für das Heiraten in Uniform. Die meisten Deutschen ließen sich damals auf diese Weise trauen. Man schaue einmal auf Hochzeitsbilder von Eltern und Großeltern in den Kommoden und Vertikos deutscher Wohnstuben. Oder in die allseits beliebten Fotoalben.
Meine Mutter trat also diese Reise an. Nun war das Reisen aber, wie alles Reisen in dieser Zeit, ein Abenteuer. Züge fahren unregelmäßig, viele Bahnstrecken sind unpassierbar, besonders im Ostdeutschland, denn die russischen Sieger brauchen die deutschen Schienen, sie demontieren sie und schicken sie nach Hause, nach Weißrussland, Moskau oder bis zum Ural, zurückbleibt das kahle Schotterbett, denn auch die hölzernen Schwellen sind begehrt; wenn die Züge auf den verbliebenen Strecken dann fahren, sind die Waggons, manchmal auch sogenannte Viehwaggons, die man notdürftig mit Stroh gepolstert hat, mit Reisenden der abenteuerlichsten Art „bis zum Sinken überladen“. Sogar auf den Dächern der Waggons sitzen sie. Seltsamerweise sieht man sie aber auf Fotografien aus jener Zeit immer mit lachenden Gesichtern, die Haare im Wind, die Arme zum Winken erhoben. Wenn es auch das Chaos ist, so ist es doch ein Chaos im Frieden. Wie soll man da nicht fröhlich sein. Man fährt in dieser Zeit kreuz und quer durch Deutschland, die Umgehungsstrecken sind groß, immer ist man auf der Suche nach versprengten Verwandten, immer auf der Suche nach Nahrung, nach Tauschgeschäften und Arbeit. Der Begriff vom „fahrenden Volk“ hatte eine völlig neue Bedeutung erhalten.
Auch meine Mutter, die vom zerbombten Dresdner Hauptbahnhof losgefahren war, hatte ein abenteuerliches Aussehen. Die braunen Haare hochgesteckt, weil man so am besten verbergen kann, dass man lange Zeit nicht beim Frisör gewesen ist. Ein kariertes Kopftuch, aus einem alten Kleid geschnitten, lässt sie dafür als verwegene, modebewusste junge Frau erscheinen. Eine umgearbeitete Militärjacke um die Schultern, ein kurzes, reichlich knielanges Kleid darunter, Kniestrümpfe und feste Männerschuhe, auf dem Rücken einen derben Gebirgsrucksack, darin Lebensmittel für die Reise sowie die wichtigen Papiere wie die Einladung ihre Mannes, gestempelt und unterschrieben von der englischen Kommandantur, und, sogar ihre Heiratsurkunde hat sie mitgenommen. Ein wenig klopfte ihr das Herz, als sie den Hakenkreuzadler auf der Urkunde sah, aber es ist ein amtliches Dokument, sie kann beweisen, wer sie ist. Sie ist die Ehefrau des Kriegsgefangenen Friedrich Paul Eberhard Malef, der im Internierungslager G/12/80 der Royal Army einsitzt. Was kann sie für den Adler und das Hakenkreuz. So steigt sie in den schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt völlig überfüllten Zug. In einem Abteil findet sie mit Mühe ein freies Eckchen, sie hockt sich hin. Um sie sind Gerede, Lärm und derbe Gerüche. Vor ihr auf einer Bank sitzt eine Frau mit ihrem nur wenige Monate altem Kind. Das Kind, trotz des Lärms, schläft, eine kleine blonde Haarsträhne klebt auf der nassen Stirn, liebevoll betrachtet die nicht mehr junge Frau ihr schlafendes Kind. Sie seufzt, ihre Augen und die meiner Mutter begegnen sich. Sie nicken und lächeln sich zu. In solchen Zeiten, sagt meine Mutter, ein Kind durchzubringen, erfordert sicher viel Kraft und Mut. Ach so schlimm sei das nicht, entgegnet die andere, wenn man es gewollt habe, das Kind, es also ein Liebeskind sei, dann ergebe sich alles wie von selbst, und, man müsse bedenken, dass Frauen selbst in viel schwereren Zeiten Kinder zur Welt gebracht und aufgezogen hätten, im Dreißigjährigen Krieg oder in die Zeit der Napoleonischen Kriege zum Beispiel, nein, die Liebe entscheide alles, die Liebe zum eigenen Kindchen, und sie streichelt, während sie spricht dem schlafenden Wurm übers Gesicht. Sie fahre jetzt nach Berlin und dann weiter nach Hannover, redet die Frau weiter, dort habe sie Verwandte, ihr Mann sei irgendwo in Sibirien, schon seit einem Jahr habe sie keinerlei Nachricht. Da seufzt meine Mutter auf und sie denkt daran, dass sie jetzt zu ihrem Mann fährt, dass er nicht mehr weit entfernt von ihr ist, dass sie sich bald sehen und in die Arme schließen werden, und alles kommt ihr auf einmal nicht mehr so schwer vor ...
Doch vor dem Lagertor schwindet ihr der Mut wieder. Denn als sie die patrollierenden, bewaffneten Posten in den fremden, feindlichen Uniformen sieht, kommt sie sich in ihren ärmlichen Kleidern, unfrisiert, abgerissen tatsächlich wie eine Abgesandte des besiegten, am Boden liegenden Volkes vor. Sie nimmt allen Schneid zusammen, tritt an das gestreifte, mit Zetteln und Plakaten beklebte Postenhäuschen heran, wartet, dass der hinter einer halben Scheibe sitzende Uniformierte sie anspricht. Indes, im Augenblick scheint er beschäftigt, stempelt irgendwelche Papiere ab, klebt mehrere Briefe zu, wobei er die Falze mit seiner kräftigen, roten Zunge beleckt. Ihre Zungen sehen wie die unsrigen aus, denkt meine Mutter und sucht ein paar englische Wörter zusammen, mit denen sie das Vorzeigen ihrer Ausweise und des Einladungsschreibens begleiten will. Nach einer der Wartenden endlos scheinenden Zeit hebt der Uniformierte den Kopf; es ist ein rothaariger Sergeant mit einem kleinen Oberlippenbärtchen, welches akkurat um die geschwungene Form der Lippe geschnitten ist. Das verleiht ihm einen unmilitärischen, weichen Ausdruck. Seine Augen verändern sich als er die Frau vor seinem Fensterchen sieht. Sie blitzen auf. Fast scheint es, als ob er aufspringen will. Doch er bleibt sitzen, neigt sich nur verbindlich lächelnd ein wenig nach vorn.
Oh, Madame, fragt er, what I can doing for You? Meine Mutter schiebt ihre Ausweispapiere und den Brief unter der halben Scheibe durch, sucht nach den englischen Worten. Aber sie wollen ihr vor Aufregung nicht einfallen. Und so sagt sie auf Deutsch: Ich bin die Frau Ihres Gefangenen Eberhard Malef. Er hat die Gefangenennummer 23-56-789. Mit zusammengepressten Zähnen und großer Konzentration hat sie die Zahlen buchstabiert. Mit dem Finger zeigt sie auf den Brief, in dem Name und Nummer ihres Mannes stehen. Und plötzlich fallen ihr die englischen Worte ein: With the stamp of Your commander! ruft sie erleichtert. Wieder zeigt sie auf den Brief, den der Sergeant in den Händen hält, aber noch keinen Blick hineingeworfen hat, weil er meiner Mutter unentwegt ins Gesicht starrt.
Understand You, Sire? fragt sie jetzt mit Nachdruck und wiederholt: With the stamp of Your commander! Endlich scheint sich der Sergeant zu besinnen, er schaut in den Brief. Als er den Stempel der Königlichen Armee und die Unterschrift seines Kommandeurs entdeckt, strafft er sich, wirft noch einen Blick in den Pass, vergleicht das Bild darin mit dem Gesicht meiner Mutter, tut das einige Male, blättert in der Heiratsurkunde, die die Mutter mit den anderen Papieren durch das Fensterchen gereicht hat, stutzt, runzelt die Stirn, als er den Adler und das Hakenkreuz sieht, räuspert sich und sagt in holprigem Deutsch:
Oh, der R-e-i-c-h-s-a-d-l-e-r! Er lacht verlegen. O.k. never mind, the German empire is over, dann - All right, Madame! Wait a moment, please! Er tritt aus seinem Häuschen und meine Mutter sieht, der Mann ist ein attraktiver Kerl von mindestens einsfünfundachtzig, schneidig, wenn auch nicht mehr ganz neu, sitzt ihm die Uniform. Er sieht, dass meine Mutter ihn anstarrt. Er zieht die Uniformbluse straff, lächelt etwas unbeholfen, rückt an seinem Koppel, prüft den Sitz der Schirmmütze. Dann ruft er einen Posten herbei.
Die Mutter wird von dem Posten, einem struppigen schweigsamen Kerl, durch das Lager geführt. Come on, You do not look back! brummt er und schüttelt sie am Arm, wenn sie, weil sie sich umsehen will, stehen bleibt oder langsamer geht. Aua, ruft sie, lassen Sie das! Sein Griff tut ihr weh. Sie sieht Gruppen von Gefangenen bei irgendwelchen Arbeiten, deren Sinnhaftigkeit einem nicht sofort klar wird, wie alte Bretter von einem Haufen zu einem anderen stapeln, andere Bretter von Kalkresten befreien, Steine umschichten und zwei Meter daneben zu einem losen Haufen werfen, und natürlich Kehren, immer wieder Kehren. Mit großen langen Rutenbesen kehren sie in einer Linie, zehn Mann breit, den Appellplatz des Lagers. Sie kehren und schwingen wie die Schnitter auf dem Feld ihre Besen im Halbkreis, machen dann einen Schritt vorwärts und kehren weiter. Bedächtig, seltsam gründlich und schweigsam. Ein Posten läuft langsam mit. Andere Gefangene liegen müßig in der Frühlingssonne. Wahrscheinlich dürfen sie gerade eine Pause machen. Alle sehen mager aus und abgerissen, mit struppigen Bärten und filzigem Haar. Ein englischer Posten steht bei ihnen und raucht. Er wirft eine Kippe zu Boden und beobachtet mit gespanntem Grinsen wie sich zwei, drei Gefangene darum balgen. Langsam, zeremoniell greift er in ein Etui und nimmt sich eine neue Zigarette. Die Gefangenen folgen meiner Mutter und dem Posten mit den Augen. Ein paar Worte werden gerufen. Anzügliche und anstößige. Gemeiner Unflat. Der Posten droht. Die Rufer schweigen, andere kichern. In leiserem Ton werden Witze gerissen. Meine Mutter geht vorbei und schaut nicht auf. Was ist aus den stolzen deutschen Soldaten geworden? Aus den übermütigen, fröhlichen Jungen wie sie die Wochenschau immer gezeigt hat, wie sie ausgezogen waren ins Feindesland, blond, lachend, das Maschinengewehr lässig über der Schulter, wie sie rittlings auf den Kanonen saßen und wie Frauen und Mädchen ihnen zujubelten – jetzt ist da nur noch ein Haufen kläglicher, verdreckter Scheißkerle, gemein und verkommen, abgerissen und mager. Ob sich ihr Eberhard auch so verändert hat? denkt meine Mutter, während sie hinter dem englischen Posten hergeht. Über einundeindreiviertel Jahr haben sie sich nicht mehr gesehen. Nur ein paar wenige Briefe sind in dieser Zeit hin und her gewandert. Er war erst in Russland, bis Ende 44, wurde dann nach Kroatien verlegt, hat dort schlimme Dinge mit den Partisanen erlebt, ist einem der zahllosen Überfälle nur mit Mühe und Not entkommen, und ist dann in Italien von den Engländern gefangen genommen worden. Viel mehr weiß sie nicht. Keine Einzelheiten. Er wollte nicht drüber reden, und in seinen Briefen hat er davon ebenfalls geschwiegen. Das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, da ist Weihnachten gewesen. Weihnachten 44. Zu ihrer Hochzeit. Sie haben am 23. Dezember geheiratet. Wie gesagt, er in Uniform. Eine Kriegerheirat. Dafür gab es drei Tage extra Urlaub. Warum nicht, haben sie sich gesagt. Heiraten wollten sie sowieso. Warum also keine Kriegerheirat? Es waren nur die Eltern und ganz wenige Freunde eingeladen. Zwei Freundinnen von ihr, ein Kamerad von ihm. Mehr ging nicht. Die Männer waren an der Front. Die meisten Freundinnen ebenfalls abkommandiert. Luftschutzdienst. Lazarettdienst. Und so weiter. Sie haben zur Feier echten Französischen Sekt getrunken. Insgesamt zwei Flaschen. Hatte der Kamerad Stabsfeldwebel Gernot Lehmann mitgebracht. Vom Frankreichfeldzug beiseite gebracht und gut versteckt. Wann werden sie wieder Sekt trinken können?
Sie geht hinter dem Posten her. Vorn kommt ein flaches Gebäude mit verschiedenen Anbauten und einem hohen Schornstein in Sicht. Es ist der Speisesaal, daneben der Küchentrakt, die Lebensmittellager. Wieder wendet sich der Posten, der neben ihr herläuft und ein gleichgültiges Gesicht macht, an sie. Er knurrt: Come on. Quickly. There are the dining hall and the kitchen. Your husband is here. Sie hat jedes Wort verstanden. Das war gar nicht schwer. Gleich wird sie also ihren Eberhard sehen. Der Posten zieht eine Türglocke. Ein Messinggriff wie von einer alten Toilettenspüle, daran ein Draht, der seitlich neben der Tür durch ein Loch ins Innere des Hauses verschwindet und dann dort irgendwie den Glockenton erzeugt. Man hört einen dumpfen, mehrfach schwingenden Ton. Seltsam, denkt meine Mutter, die haben hier noch eine so altmodische Glocke. Sollte selbst diese Türklingel das berühmte Traditionsbewusstsein der Engländer und ihren Konservatismus bedeuten? Sie kommt nicht dazu, den Gedanken weiterzudenken, die Tür öffnet sich. McCormick, der Koch und Furier, erscheint. Es ist ein kleiner, dicklicher Mensch mit einem fröhlichen Gesicht. Oh yeah, ruft er und grient, Missis Malef! Come in, please. Dem Posten bedeutet er, wegzutreten. Der macht eine exakte Kehrtwendung, knallt die Hacken zusammen, berührt mit den Fingerspitzen den Mützenschirm und geht. Kleine Staubwölkchen kräuseln sich hinter ihm. Die Mutter, die ihm nachgeschaut hat, wendet sich McCormick zu, sie lächelt, tritt ein. Im halbdunklen Flur sofort, sieht sie ihn, den lange Entbehrten, ihren Eberhard. Er kommt ihr gar nicht mager vor, die Haare sind länger, um das Kinn Bartstoppeln. Er trägt eine britische Uniform, aber ohne Rangabzeichen und ohne Nachweis der Waffengattung. Sie weiß nicht, wie sie das finden soll. Im ersten Moment ist da Abwehr, das Fremde, aber in der Uniform steckt ja ihr Eberhard, ihr Mann. Sie gehen aufeinander zu. McCormick, der Schotte, beobachtet die beiden Deutschen, seinen Freund, den Lagerdolmetscher Frederik Paul, wie er ihn nannte, denn „Eberhard“ war ihm schwierig auszusprechen, beobachtet auch die Frau, eine hübsche Brünette, wenn auch vielleicht ein wenig zu mager, sieht wie sie sich in die Arme fallen, aber er sieht auch, zwischen ihnen ist noch Fremdheit, sie küssen und umarmen sich, aber es fehlt die Innigkeit, die intime Vertrautheit. Und er denkt an seine Verlobte, daheim in Dublin, auch sie hat er fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Würde sie nicht auch zögern und ein bisschen zurückschrecken, würde er nicht auch nach Fremde, nach dem verfluchten Feind riechen und sich anfühlen wie etwas, an das man sich nicht mehr erinnern kann. Oh, er versteht das alles und so sagt er spontan, fast ohne nachzudenken: Er wolle sie jetzt ein Zeit allein lassen, er biete ihnen ein schönes Plätzchen, wo sie niemand störe bei ihrem Wiedersehen. Und der freundliche Schotte schließt die Tür zum Vorratslager auf, weist mit dem Arm hinein, sagt: Go in, please, and have a good time! Er lacht leise.
Die Beiden treten zögernd in den großen kühlen Raum. Ehe sie sich recht besinnen, hat McCormick die Tür zugeschlagen. Sie hören seine sich entfernenden Schritte, hören ein gepfiffenes Liedchen. Da stehen sie nun, Julia, meine Mutter und Eberhard, mein Vater, und sie können es gar nicht fassen. Nach so langer Zeit endlich wieder beieinander, gesund und wohlauf, der elende Krieg zu Ende. Zuerst schauen sie sich um, halten die Hände noch ineinander verschlungen, dann lösen sie sich und staunen. Ein britisches Vorratslager ist dies also. Julia, wie lange hat sie sich nicht mehr satt gegessen, beginnt zu weinen. Sie weint, weil sie all diese Vorräte, diesen Reichtum sieht, sie weint, weil sie sich auf einmal so erbärmlich und abgerissen vorkommt, sie weint, weil sie ihren Mann wieder hat, weil er gesund ist, weil er den Krieg überstanden hat und weil alles bald vorbei sein wird und sie zusammen leben können. Sie weint, weil sie glücklich ist und weil ihr Jammer endlich einmal heraus muss. Eberhard, hilflos neben ihr, stellt ihr eine Kiste mit Corned Beef Büchsen hin. Sie soll sich setzen. Sie setzt sich und blickt zu ihm auf. Ihre Blicke begegnen sich. Zärtlich, hingebungsvoll schaut sie zu ihm, er aber, der sonst alles andere als ein Abenteurer ist, will die Frau, seine Frau, nur noch besitzen, eine wilde Brunst ist in ihm. Wie lange hat er kein Weib mehr im Arm gehalten? Wie lange seine Jule nicht mehr geküsst, wie lange nicht mehr ihre Haut gespürt?
Mir fällt es schwer, mir vorzustellen, was die Beiden in der britischen Vorratskammer miteinander getrieben haben. Es sind immerhin meine Eltern. Und Eltern sind eigentlich ohne jede Sexualität. Nie konnte ich mir denken, dass sie, wie alle anderen, wie ich selber, Sex gehabt haben. Ich erinnere mich noch, wie schockiert ich war, als ich, ein Vierzehnjähriger, beim Rumsuchen im elterlichen Schafzimmer im Nachtisch des Vaters ein Päckchen „Pariser“ gefunden hatte. Ich konnte es nicht glauben. Ich stand wie erstarrt und stierte auf die kleine Pappschachtel der Firma Kästner. Meine Phantasie weigerte sich, mir meinen Vater im Liebesspiel mit meiner Mutter vorzustellen, er auf ihr liegend, oder, noch schlimmer, sie auf ihm rittlings sitzend. Und doch müssen sie es getrieben haben. Und sicher hatten sie Spaß dabei. Warum nicht? Ich habe noch zwei Geschwister. Indes, nackt habe ich die Eltern nie gesehen. Weder einzeln noch zusammen. Wenn wir im Freibad waren, trugen sie altmodische Badeanzüge, verschwanden korrekt angezogen in der Umkleidekabine und kamen in Bademontur wieder heraus. FKK oder so gab es nicht. Auch zu Hause, zum Beispiel beim Baden, sahen wir die Eltern niemals nackt. Wenn sie sich baden wollten, mussten wir uns verdrücken … auch sexuelle Aufklärung hat es nie gegeben. Einmal hatte mir ein Schulfreund ein Pornografisches Foto gegeben. Mein Vater fand es in meinem Physikheft. Er war so erschrocken, dass er sich setzen musste. Dann fragte er mich ob ich von „sowas“ wüsste, er meine damit die gezeigte Stellung. Ich schüttelte den Kopf. Da war er zufrieden, zerriss das Bild, ermahnte mich, fragte nach dem Namen des Schulfreundes. Aber er hat mir keine runtergehauen. Still ging er davon. Am Abend hat mich meine Mutter dann merkwürdig durchdringend angesehen, gesagt hat sie nichts. Wenn die Eltern gewusst hätten, dass ich das Bild auch meinem zwei Jahre jüngeren Bruder gezeigt hatte, hätte es vielleicht doch ein paar hinter die Ohren gegeben …
Also hat Eberhard, mein Vater, sich in rasender Eile in jenem Vorratslager der Royal Army seiner englischen Uniformjacke entledigt, zog die Hose aus und die Schnürstiefel, während meine Mutter, sie war immer etwas schüchtern und genierlich, ihre alte Militätjacke aufknöpfte und in herzklopfender Erwartung das knielange Kleid hochraffte. Eine ungewöhnliche Vereinigung. Auf einer Kiste mit Corned Beef. Und es war natürlich unbequem, weshalb Eberhard, schon ganz rot im Gesicht, schließlich seine Uniformjacke als Unterlage zu Hilfe nahm, wobei er, stets auf Ordnung bedacht, das Futter, sprich die Innenseite nach unten legte. Trotzdem, die junge Frau fühlte sich nicht recht wohl. Es war alles doch ziemlich ungewohnt. Hoffentlich kommt auch keiner. Doch, diese Gefahr bestand nicht. Der hilfreiche Schotte war nicht sehr weit weggegangen, schließlich hatte er eine Wachpflicht, er hielt bei gebührlichem Abstand die Tür zum Lager die ganze Zeit im Auge, immerhin eine dreiviertel Stunde lang. Er hatte sich einen Klapphocker herbeigeholt, rauchte und las den „Observer“. Manchmal glaubte er hinter der Tür Stimmen und Geräusche zu hören, einmal sogar ein blechernes Poltern, da ließ er die Zeitung auf die Knie senken und verzog sein Gesicht zu einem verschmitzten Grinsen. Mit einem Seufzer sog er an seiner Pipe und stieß eine kleine Rauchwolke aus. Er fühlte sich gut. Und sein Old German hatte auch sein Gutes.
Als nach dieser dreiviertel Stunde, die für meinen Vater die schönste seines Lebens gewesen war, er korrekt angezogen, von innen klopfte, die Mutter hatte die Jacke zugeknöpft und sogar das Kopftuch wieder umgebunden, da eilte McCormick herbei und riss die Tür auf.
Oh hallo, rief er fröhlich, come on, You lovers! Am späten Nachmittag, die Besuchszeit war abgelaufen, die Abschiedsszene fand statt. Meine Eltern küssten sich wieder und wieder. Mein Vater flüsterte, er werde bald kommen, notfalls einfach abhauen. Der Schotte McCormick verabschiedete die Besucherin wie eine gute Bekannte, er hieß sie ihren Rucksack öffnen und stopfte Konserven, Schokolade, gezuckerte Kondensmilch und eine Flasche Scotch hinein. Caution! Do not lose! Und er lachte herzlich. Meine Mutter, die sich vorstellte, wofür sie diese Gaben daheim eintauschen könnte, wollte ihm zu Füßen fallen, McCormick aber hob sie auf, gab ihr die Hand und sagte in gebrochenem Deutsch: No Thanks! Lass uns Freunde bleiben, Missis! No more war!
Zwei Monate später. Der Jule wurde es häufig schlecht, sie musste erbrechen, auch war sie ein wenig voller geworden. Das waren also jene Übel, die schon von meiner Anwesenheit herrührten. Sie war schwanger. Eine eigene Wohnung besaß man nicht. Sie wohnte ja noch bei den Eltern in Strießen und ihr Mann war bisher nur zu Besuch gewesen, ein einziges Mal seit der Hochzeit. Jetzt nun würden sie eine richtige Familie. Das bedeutete, Platz werde man brauchen. Ihr Vater, dem sie zuerst davon erzählte, freute sich und er ging sofort daran eine Wiege zu zimmern. Er war Stellmacher und traute sich das zu. Im Keller schnitt er aus alten Brettern Holz zu. Ihre Mutter Martha, Großvater Heinersch´s zweite Frau, die erste, Marthas Schwester, war früh gestorben. Mit ihr hatte Heinersch einen Sohn, Mutters Halbbruder Werner. Der starb im Krieg an Gelbsucht. Martha war damals bereits ein bisschen verwirrt, vergesslich, kindisch, schon Monate später würde die Alzheimersche Krankheit sich vollständig ausprägen, sie lachte auf als sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter hörte: Ei, ei, ei, dos ies fei schie! Ne klahne Mahd or een Gung. Wann wird’s denne suweit sein?
Sie entstammte dem Erzgebirge und sprach wie ihr Mann, Mutters Vater, mein Großvater Heinersch, ebenfalls ein Erzgebirgler, diesen liebenswerten, manchmal schwer zu verstehenden Dialekt. Meine Mutter, ihre Tochter Julia, ebenda aufgewachsen, weigerte sich indes wie die Erzgebirgler zu sprechen, sie genierte sich, es schien ihr die Sprache halbwilder Dörfler, unzivilisiert und roh, eine Halskrankheit …
Die Jule schrieb ihrem Mann sofort einen Brief, schrieb, ihr Zusammensein bei der Royal Army in Braunschweig wäre, wie erwartet, nicht folgenlos geblieben. Es wäre etwas unterwegs. Dem Vater (damit war Großvater Heinersch gemeint) hätte sie alles erzählt, er zimmere eine Wiege, spräche von einem Kinderstühlchen und derlei Dingen, wir würden die kleine Stube bekommen (das bisherige Wohnzimmer der Großeltern), sie begnügten sich mit ihrem großen Schlafzimmer, dort könne ja sein alter Lehnsessel ohne weiteres aufgestellt werden. Er habe sich gefreut. Ob die Mutter verstanden habe, dass sie nun Großmutter werde, könne sie nicht sagen, es werde immer schlimmer mit ihr, die Demenz schreit fort, vor ein paar Tagen wäre sie von einem Nachbarn nach Hause gebracht worden, weil sie sich verlaufen hatte. Oh Gott, was noch werden würde, ihr, schrieb die Jule, graue davor – die eigene Mutter, eine Irre. Jedenfalls, schrieb sie weiter, der Kleine in ihrem Leib verführe sie zu enormer Fresslust. Schon fünf Kilo habe sie zugenommen. Ob das wohl am Ort der Zeugung liege?
Dieser „Kleine“ – das war also ich. Das erste von drei Kindern. Die Geschwister würden im Abstand von zwei und drei Jahren folgen. Mein Bruder Johannes und meine Schwester Magdalena.
Eberhard in Braunschweig, mitten in einer Lagerbesprechung beim Commander, empfing diesen bedeutsamen Brief und sprach sofort mit seinem schottischen Freund McCormick. Bis zur offiziellen Entlassung aus dem Lager wollte er nicht warten. Auch wusste er, man würde man ihn wegen seiner Dolmetscherfunktion gern noch länger behalten wollen. Es war sogar schon ein paar Mal von einer richtigen Anstellung bei der Army gesprochen worden. Der Commander hatte sich freundlich mit ihm unterhalten und ihm eine Zigarre aus seiner Privatkiste angeboten. Die gleiche Sorte, die auch Churchill angeblich raucht. Sie schmeckte übrigens scheußlich, hatte einen Beigeschmack und brannte auf der Zunge.
Aber, auf solche Perspektive, nämlich bei der Royal Army zu bleiben, wollte es mein Vater indes nun nicht mehr ankommen lassen, jetzt wo seine Frau ein Kind erwartete. Er beschloss, sich aus dem Staube zu machen. Er musste fliehen. Unbedingt. Das war ein Jahr nach Kriegsende und von einem deutschen Standort aus offenbar nicht sonderlich schwierig. Sonst hätte es mein Vater auch niemals gewagt, ein Held ist er ja nie gewesen, auch nicht besonders wagemutig. Ihm lagen die diplomatischen Lösungen und die sicheren Wege mehr. McCormick wurde eingeweiht und er, der Freund, hatte nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, er half bei den Vorbereitungen. Und es war, wie gedacht, gar nicht schwer. Vater fuhr immer einmal in der Woche mit einem kleinen Transport in die Stadt Braunschweig, das Lager befand sich ein paar Kilometer südöstlich vor den Toren. Es ging um Besorgungen und Einkäufe für die Küche, die zusätzlich zu den regulären Armee-Lieferungen, unternommen wurden. Einen großartigen Begleitschutz gab es nicht. Man verließ sich darauf, dass nichts passiere. Und es war ja auch noch niemals etwas vorgekommen. Vater war Dolmetscher und Einkäufer in einem. So auch diesmal. Und es kam niemandem in den Sinn, etwas dabei zu finden, dass er dieses Mal einen Zivilmantel übergezogen hatte. Im Gegenteil, einer der Begleitsoldaten scherzte, ob er mit dem Mantel etwa fliehen wolle. Mein Vater lachte und sagte, das habe er nicht nötig, ihm gefalle es bei der Army so, dass es egal sei, ob er Zivil trüge oder nicht. Der Fahrer erzählte einen Witz. Denn Winston Churchill hatte sich, was sein Verhältnis zur britischen Armee betraf, ähnlich geäußert. Lachend kamen sie in Braunschweig an. Doch das Lachen sollte ihnen vergehen. Als sie zurück wollten, fehlte mein Vater. Eine Streife, geführt von einem Sergeant, wurde losgeschickt, ihn zu suchen. Nach einer Stunde kamen sie zurück. Ohne Ergebnis. Das Funkgerät war nicht einsatzbereit, man wollte einen Funkspruch ins Lager und an den Stab absetzen. Mein Vater, listig wie Odysseus, hatte vorsorglich die Batterien unbrauchbar gemacht. Der Major, ein älterer Reservist, fluchte auf die Deutschen im Allgemeinen und auf meinen Vater im Besonderen, sprach vom Standrecht. Schließlich wurde die Zeit knapp. Man musste zurück ins Lager. Dort vernahm man den Schotten McCormick. Der wusste von nichts. Eine Fahndung wurde herausgegeben und zurückgezogen. Der Stab hatte befohlen: Suche einstellen. Der Mann wäre in drei Wochen sowieso entlassen worden. Man hatte Wichtigeres zu tun. Das Lager sollte aufgelöst und Teile der Einheit zurück in die Heimat versetzt werden. Endlich wieder auf die Insel! Dem Kontinent den Rücken kehren. That´s great! Was kümmert einen da ein geflohener deutscher Entlassungskandidat. Man schrieb den 17. September 1946. Bis zu meiner Geburt waren es noch 5 Monate.
Wenn ich an meinen Vater denke, an das erste Bild von ihm, das mir im Gedächtnis geblieben, so sehe ich mich an seiner Hand über die blaue Eisenbrücke gehen, die bei uns „Das blaue Wunder“ genannt wird. Es ist eine riesige Konstruktion, die hoch in den Himmel ragt, mit Eisenstreben und genieteten Pfeilern, sie erscheint dem Knaben kolossal, und sie ist ein Wunder - das blaues Wunder wird sie genannt. Ich gehe an der Hand des Vaters über braungraue, trockene Holzbretter, die den Fußbelag der Brücke bilden. Zwischen diesen Brettern gibt es kleine Spalten von knapper Fingerbreite, man sieht durch sie hindurch das Wasser glitzern in bräunlicher, bodenloser Tiefe, es wirbelt unter den Füßen dahin, schäumt sich an den Pfeilern auf, und der Geruch des Flusses steigt empor, ein seltsamer, aber unvergesslicher Geruch, ein Gemisch aus Maschinenöl, verwesenden Pflanzenresten, Abfällen und frischem Wasser, brackig und nach Moder, nach Fischresten und nassem Kies. Ich fasse die Hand des Vaters fester. Doch die Bretter sind sicher und ertragen noch viel größere Gewichte als das meinige und das des Vaters. Im Gleichschritt brächte eine Kompanie Soldaten die Brücke zum Einsturz, sagt der Vater, denn sie sei eine Hängebrücke, und die vertrage keine Schwingungen marschierender Soldaten. Als uns in der Brückenmitte ein Trupp russischer Soldaten entgegenkommt, bekomme ich es mit der Angst. Doch die Russen gehen lachend und rauchend und wie ihnen befohlen, „ohne Tritt“ vorbei, einer wirft eine Kippe in hohem Bogen in die Brückentiefe, und nichts passiert. Die Brücke erzittert nicht. Für sie sind wir alle miteinander winzige Menschlein, die auf ihr herumkrabbeln. Diese Brücke und der Fluss, das sind für mich die ersten Eindrücke von Größe und von der weiten Welt, in der wir leben. Flüsse ziehen durchs Land, sie münden ins Meer, sie verbinden die Völker, sie sind die eigentlichen Adern. Der Vater erklärt mir, mich an der Hand haltend, die Welt. Er spricht davon, wie sich der Fluss in die Landschaft gegraben, wie er erst sie und wie er uns Menschen dann geformt hat. Die Menschen nutzen die Flüsse. Ohne Flüsse gäbe es kein menschliches Leben. Früher ist die Elbe dort oben geflossen, sagt der Vater, und zeigt auf die Wipfel der Bäume an der oberen Kante des Elbhanges. Ich kann das nicht glauben. Doch, sagt der Vater, in Jahrmillionen hat sich das immerwährend fließende und alles abschleifende Wasser in die Erde gefressen und so die Täler, auch unser Elbtal geschaffen. Wieder sehe ich auf das unter der Brücke dahingleitende Wasser, es kommt mir geheimnisvoll wie eine Zauberkraft vor, Ehrfurcht beschleicht mich ... ich bestaune das Wissen meines Vaters ...
Oder, ein anderes Bild: Die Eltern unternahmen, was heute eine Seltenheit, wo alles motorisiert und auf schnelle heftige Erlebnisse aus ist, mit uns Kindern an den Wochenenden ausgedehnte Wanderungen in die abwechslungsreiche, hügelige Umgebung der Stadt.
Wie rituelle, vorherbestimmte Handlungen wurde die Wanderroute, die Kleidung, Speisen und Getränke, die Utensilien, welche man mitzunehmen gedachte, ausgewählt. Schon am Morgen standen wir Jungen, und so manches Mal auch die kleine Schwester, neben dem Vater am Küchentisch und beobachteten, welcher Proviant zurechtgemacht und eingepackt wurde. Wir Jungen waren beide, ich wie auch Johannes, Verehrer derber geräucherter Würste, während Marmeladenbrote mit einem Naserümpfen als Mädchennahrung abgelehnt wurden. Auch Obst, Äpfel, frische Gurken, ein beliebtes Häppchen zwischendurch, lehnten sie ab. Von den Getränken wurde gesüßter und mit Zitrone versetzter Tee in bauchigen, silbern glänzenden Thermokannen mitgenommen, allerdings war immer auch eine Einkehr in einer Dorfgasthofstube ersehnt, wo wir dann unter Rehgehörn und nachgedunkelten Landschaftsbildern, hinter mit todtrockenen Fliegen verklebten Scheibengardinen, auf blank polierten Holzstühlen sitzend, Waldmeisterlimonade vom Fass, den absoluten Favoriten unserer Jungenkehlen, in großen, wenn auch nicht ganz sauberen Henkelgläsern serviert bekamen. Ganz selten und wie an eine Auszeichnung kann ich mich auch an den Trunk dunklen, süßduftenden Malzbieres erinnern, das um unsere Lippen einen klebrigen, weißlichen Rand hinterließ. Oder an Bockwürste, rauchig und fett, die ihren heißen, blasigen Saft beim allzu hastigen Hineinbeißen zu verspritzen gezwungen waren.
Während der kulinarischen Vorbereitungen und der Auswahl der geeigneten Kleidung für alle Teilnehmer durch die Mutter, visitierte der Vater noch einmal die Wanderkarten. Oft habe ich, wenn ich an diesen Wanderungen teilnehmen durfte, bewundert, wie genau der studierte Vermessungsingenieur diese Karten analysierte, wie er, es waren ausnahmslos sogenannte millimetergenaue Messtischblätter, verzeichnete, an welcher Wegbiegung jener eingezeichnete größerer Baum, dieses oder jenes Bauernhaus oder ein Felsvorsprung zu finden wäre, und er freute sich dann, wenn das Vorausberechnete genau an der Stelle des Weges auftauchte, wo er es infolge seines Kartenstudiums vorzufinden erwartet hatte. Stets rief er dann aus, dass es doch ein kleines Wunder sei, solche exakte Karten zu besitzen und sie auch lesen zu können, nichts in der freien Natur könne ihm überraschend in den Weg treten, alles sei im Vorhinein erkundet, berechnet und eingezeichnet. Er war mit Leib und Seele Vermesser und auch Karthograph, jede Kartenwinzigkeit erfreute sein Herz, es waren für ihn Kunstwerke, Präzisionsblätter, segensreiche Erfindungen menschlichen Genauigkeitssinnes. Ich habe ihn in vollkommener Erregung und Endrückung so manches Mal zittern sehen, wenn er wieder einmal einen Beweis für die Exaktheit seiner Blätter gefunden hatte.
Hier, sagte er zum Beispiel vor einem alten, verwitterten Blutkreuz mitten im Wege verharrend, hier liegt nun dieser Stein, den Menschen vor Hunderten Jahren gesetzt haben, als an dieser Stelle einer von ihnen zu Tode kam, und hier liegt er noch, millimetergenau verzeichnet, eingepasst in die Koordinaten eines dieser Messtischblätter, und wenn sich zwei Menschen, sagen wir, einer aus dem östlichsten Deutschland und einer aus dem Westen Frankreichs, nur mit einer diesen Karten bewaffnet, hier verabredeten, dann fänden sie sich unfehlbar an diesem Punkt zusammen, sie könnten nicht irre gehen, dank der Genauigkeit geometrischer Präzision, ja sie würden sich, nähmen sie es ganz genau, im Ankommen sogar gegenseitig auf die Füße treten, so exakt, so wunderbar genau sind diese Karten. Mein Vater wischte sich den Schweiß aus dem Nacken und strahlte übers ganze breite Antlitz. Wir, seine Söhne, schauten zu ihm auf und doch habe ich so manches Mal in den Augen besonders des Bruders Johannes Unglaube und einen leisen Spott zu sehen geglaubt. Überhaupt war Vater ein Verehrer der unbelebten Natur und der Geografie. In einem kleinen Leinensäckchen sammelte er seltenes Gestein, das er dann zu Hause fein säuberlich mit winzigen Zetteln beschriftete und in gerahmte Holzkistchen einsortierte. An manchen Abenden dann, aber auch schon unterwegs konnte er lange Reden über die gefundenen Steine halten. Er drehte die leblosen, kantigen Gesellen, die zumeist einfarbig und grau, aber manchmal auch bunt glitzerten, in seinen Händen, betrachtete sie mit Liebe und Inbrunst und sprach etwa folgende Worte, die so klangen, als läse er aus einem Lehrbuch vor: Hier seht ihr einen wunderschönen Halbedelstein, wie er in dieser Gegend nicht selten vorkommt. Ein Mineral, aus reinem Kohlenstoff mit eingelagerten Quarzkristallen und dem typischen Glimmer der Vorgebirgsgesteine. Leider ist er nur hier an den zwei, drei seiner gezackten Spitzen durchsichtig, der Rest bleibt unserem forschenden Auge verborgen. Wir sehen nur die rötlich schimmernde Oberfläche, die da und dort (er zeigte mit dem Finger darauf) mit blauen und silbernen Äderchen durchzogen ist. So ein Wunderwerk hat Mutter Natur erschaffen und über Jahrmillionen auf uns vererbt, dass wir es finden und uns daran erfreuen. Genauso hat dieser Stein schon ausgesehen, als es weder Menschen noch Tiere, vielleicht ein paar Einzeller in den Meeren gegeben hat. Wie viele Augen mögen ihn schon betrachtet und dann gedankenlos weggeworfen haben, bis er uns, den Malefs, ins Gesichtsfeld kam. Man könnte, nein, man müsse geradezu, so sagte mein Vater, vor Ehrfurcht niederknien, selbst vor einem solch unbelebten Stein. Seht ihn euch genau an, meine lieben Jungs, denn, wenn ich ihn hier liegen lasse, seht ihr ihn zum letzten Mal, und spätestens in vielen Millionen Jahren wird dieser steinerne Klumpen sich einreihen in den großen Zyklus aller Materie, er wird seine Form verlieren, vielleicht eingeschmolzen werden, wenn er auf seiner Wanderung mit seinem flüssigen Wesensbrei zusammenkommt. Ihr runzelt die Stirnen, rief der Vater emphatisch aus, als er unsere Zweifel sah, natürlich wandern auch Steine, wenn sie auch keine Beine haben.
Keene Beene, ha, ha! Bruder Johannes lachte aus vollem Halse.
Ja, Steine wandern, rief der Vater und seine Augen leuchteten hinter der starken Brille. Wenn dieser zerklüftete Kerl hier erzählen könnte, wo er schon gewesen, wen er gesehen und was erlebt hat, ihr würdet staunen.
Doch weiter …
Meine Erinnerung will noch eine Geschichte werden. Lasst sie mich erzählen.
Es ist Sonntagvormittag. In unserer Wohnung, 3. Stock, Altbau, mit schiefen Wänden in drei Zimmern und einem Balkon, auf dem früher, nach dem Krieg, Kaninchen gehalten wurden, ist es seltsam still. Unnatürlich still geradezu. Wir, das sind mein Bruder Johannes, die Schwester Magda und die Mutter, aber auch die Eltern der Mutter, die verwirrte, ständig umhergeisternde Oma Martha, und ihr Mann, Opa Heinrich, kurz der Heinersch genannt, wir alle dürfen uns nicht „mucksen“, wir müssen ganz leise sein. Denn mein Vater, das Oberhaupt der Familie, unser aller Ernährer, er schläft. Durch den Türspalt habe ich gesehen: Er liegt auf dem grauschwarzen Plüschsofa, rücklings liegt er wie ein gefällter Baum, ein Arm hängt ihm, einem abgebrochenen Aste gleich, zur Seite; so liegt er und schnarcht. Tief und gleichmäßig geht sein Atem. Er war am Samstag zu einem Treffen mit Kollegen gegangen, es ist spät geworden, man hat viel getrunken. Jetzt schläft er seinen Rausch aus. Natürlich, das mit dem Trinken habe ich erst viele Jahre später erfahren. Damals fand ich es nur außergewöhnlich, dass unser Vater am Sonntagvormittag auf dem Sofa liegt, sich nicht rührt, schnarcht und wir leise sein müssen, wo wir doch lieber mit ihm an der Elbe spazieren gegangen, Steinchen ins Wasser geworfen, wieder einmal Kuh gespielt und auf allen Vieren im Gras herum gekrochen wären. In einem unbeobachteten Moment schleiche ich mich zu dem Schlafenden. Ich schubse ihn, zwacke ihn ins Ohrläppchen, packe seinen herabhängenden Arm und lass ihn hin und her baumeln. Aber der Vater rührt sich nicht. Ob er schläft? Er schnarcht. Oder ist er tot? Ich frage die Mutter. Sie sagt, nein, nein, er sei nicht gestorben, wer schnarche, könne nicht gestorben sein, nur etwas müde sei der Vater, weil er mit seinen Arbeitskollegen lange gefeiert hätte. Wieso man vom Feiern müde werde, will ich wissen. Da streichelt sie mir den Kopf und sagt, dies komme vom Bier, wenn man beim Feiern zu viel davon trinke, werde man ungeheuer schläfrig und müde. Wahrscheinlich habe der Vater zu viel Bier getrunken, er werde schon wieder erwachen, aber ich solle ihn dann nichts fragen, sondern irgendetwas spielen, mich in eine Zimmerecke verdrücken, denn, wenn ich den Vater nach dem Aufwachen zu viel frage, werde er mürrisch, weil ihm der Kopf weh tue.
Vom Schlafen? frage ich. Nein, vom Bier, sagt sie und zieht dem Schlafenden die Decke gerade, die sie ihm aufgelegt hat und die weggerutscht ist. Sie seufzt.
Ich gehe, wie mir geheißen, in eine Ecke des Zimmers und beschäftige mich mit meinem blauen Rennauto, mein Lieblingsspielzeug aus dünnem gestanzten Blech mit einer großen roten Nummer auf der Seite, einem Fahrer, der eine Rennfahrerbrille trägt - das Auto hat mir mein anderer Großvater, der Vater meines Vaters, geschenkt. Er heißt Eberhard, aber die einen nennen ihn nur Hardl oder Puttel, wie die Großmutter, seine Frau, welche indes nur „Großi“ genannt werden darf – sie will es so. Sagt einer mal etwas anderes, wird sie böse, bekommt enge Augen, die kleine energische Frau. Sie heiße „Großi“ sagt sie dann. Die anderen, wie mein Vater, rufen den Großvater „Vatel“, meine Mutter sagt „Großvatel“. Über die Entstehung dieser Namen weiß ich nichts. Es ist eben so. Ich werde den „Großvatel“ an anderer Stelle noch ausführlicher vorstellen. Er ist ein lustiger Mensch, der mit uns Kindern allerlei Späße macht, sogar Witze erzählt er manchmal, was ihm Ermahnungen von der weiblichen Seite, seiner Frau und meiner Mutter, einbringt. Doch, er macht sich nichts draus. Immer wieder macht er seine Albereien. Zum Beispiel hat er, wenn er abends noch zu Besuch war und wir ins Bett mussten, den Kopf ins Schlafzimmer gesteckt (wir schlafen alle in einem Raum, auch die Eltern) und lachend „Guten Nakscht!“ gerufen, worüber wir, besonders mein Bruder und ich (die Schwester war noch zu klein), laut lachen mussten.
Guten Nakscht! riefen wir dann zurück und kicherten – Guten Nakscht!
Und er antwortete „Guten Nakscht!“. Das wäre noch eine Weile so weiter gegangen, aber die Mutter kam herbei, rief zu ihm: Nun ist es aber genug! Schluss jetzt, Großvatel! Die Kinder sollen schlafen! Sie drängt ihn beiseite und wollte die Tür schließen. Der Großvater war einer, der auf seine Schwiegertochter hörte. Also zog er den Kopf ein und machte kehrt. Vorher aber winkte er uns nochmal zu, dabei bewegte er den Mund. Seine Augen lachten. Wir wussten genau, was er sagen wollte: „Guten Nackscht!“ sagen seine stummen Lippen. Wir richteten uns in den Betten auf, jauchzten und winkten zurück ...
Ich hocke also in der Zimmerecke und spiele Autorennen, während der Vater schläft und schnarcht. Natürlich geht mein Spiel nicht geräuschlos vonstatten. Das Auto surrt und ich imitiere Gas geben, Bremsen quietschen und die Hupe. Eine Weile geht das so. Die Uhr kenne ich noch nicht richtig, weiß also nicht, wie lange ich schon spiele, noch wie spät es ist. Die Mutter hat in der Küche zu tun. Sie muss auch ab und zu nach der verwirrten Oma sehen, die, in ihrem Schlafzimmer eingesperrt, die Koffer vom Schrank geholt hat. Sie will andauernd verreisen. Nach Hause fahren! murmelt sie in einem fort. Nach Hause! Es ist ein Kreuz mit ihr. Mutter muss sie beruhigen, die Koffer wieder wegräumen, das Kleid zuknöpfen, das sich die Alte halb ausgezogen hat, sie muss ihr die Nase putzen, denn andauernd läuft der Großmutter, sich erneuernden kleinen Eiszapfen ähnlich, weißlicher Schleim aus der Nase. Natürlich tropft der überall herum, was Mutter, die eine Reinlichkeitsfanatikerin ist, zur Raserei bringt. Sie muss einen Lappen holen. Alles aufwischen. Meine Mutter stöhnt. Sie ist mit unserer Schwester im achten Monat schwanger. Voller Verzweiflung sieht sie, sogar auf der kleinen Nussbaumkommode hat die Großmutter ihre Tropfen hinterlassen. Ist das nicht furchtbar. Aber es geht noch schlimmer. Ein paar Monate später wird die Großmutter im Laufen unter sich machen. Sie hinterlässt Spuren, die nicht nur hässlich aussehen, nein, sie riechen auch.
Bei all diesen Tätigkeiten kann die Mutter natürlich nicht nach mir sehen, und auch nicht nach Bruder Johannes, der auf dem Bauch durch die Küche robbt und beinahe das herabhängende Plastiktischtuch mit allem auf dem Tisch stehenden Geschirr heruntergezogen hätte, er ist etwas über 2 Jahre, ich bin fast fünf. So spiele ich also unbeaufsichtigt mein Autorennen. Und der Vater liegt immer noch auf dem Sofa. Schon wieder ist ihm, da er manchmal den herabhängenden Arm hebt und sich im Schlaf über den Bauch streicht, die rotkarierte Decke verrutscht. Ich will ihm helfen, richte die Decke, wie ich es von der Mutter gesehen, ziehe sie glatt. Dabei kommt mir die Idee auf Vaters Bauch mit meinem blauen Rennauto zu fahren. Er schläft ja, er wird nichts merken. Eine bergige Stecke. Das wird Spaß machen. Gedacht – getan. An der Schulter ist der Start. Ich habe das Auto aufgezogen. Es ruckt los, aber da ist die Deckenkante, wo es still steht. Ich hebe es darüber weg. Mit energischem Surren klettert es zur höchsten Erhebung des Vaterbauches, doch gerade dort befindet sich eine große Falte, es hält an, scheint zu zögern, die Antriebsräder vibrieren ungeduldig, schließlich das Fahrzeug gleitet nach links ab, rast in den Abgrund zwischen linkem Arm und Hüfte, kommt auf der Seite liegend zum Stillstand, die Hinterräder surren, werden leiser und langsamer, bis die Aufzugsfeder erschlafft ist. Was ist zu tun? Wie komme ich an das Auto? Muss ich über den Vater klettern? Seine linke Körperhälfte liegt der Wand zu gekehrt. Die Wand ist mit einem Wandteppich, einem Fresko, wie die Mutter immer sagt, behängt: Toskanische Landschaft mit Zypressen, Olivenhainen, Weinterrassen und einer altrömischen Villa. Ich beschließe es zu wagen. Zerre einen Hocker heran, um einen höheren zu Ausgangspunkt zu haben, klettere hoch. Der väterliche Bauch ragt wie ein zum Ausbruch bereiter Vulkan in die Höhe, er zittert und bebt unter der alten Wolldecke. Vorsichtig und unendlich langsam beginne ich darüber zu klettern. Ich beuge mich vor. Schon kann ich mit den Fingerspitzen mein Rennauto berühren – da kommt es zum Ausbruch. Ein schnappender, ächzender Laut ertönt. Ein Prusten und Schnaufen. Mein Vater fährt hoch, reißt die Augen auf. Oh, weh, denke ich, ich habe ihn aufgeweckt. Sein schöner Schlaf ist dahin.
Was ist denn hier los? brüllt der Vater in einer Lautstärke, über die er selber erschrocken scheint, denn er fährt leiser fort: Wie kommst du auf meinen Bauch?
Er packt mich, hält mich fest, schüttelt mich, ich soll ihm Auskunft geben. Doch, ich bringe vor Schreck kein Wort heraus. Schließlich kann ich mein Auto erfassen, halte es hoch. Zum Beweis, wer der Übeltäter gewesen ist. Doch, das erregt den Vater nur noch mehr. Er schüttelt mich, dass mir der Kopf hin und her wackelt. Los, sag, du Lümmel, was dir eingefallen ist, auf mir, während ich schlafe, mit dem Auto zu spielen. Gib es einmal her! schreit er. Zögernd und zitternd reiche ich ihm mein Spielzeug, denn ich ahne, was nun kommt. Er wird das blaue Rennauto behalten, mein Lieblingsspielzeug wird weggeschlossen.
Erst weine ich den halben Tag, dann trotze ich zwei Tage, endlich aber kommt mir eine Idee. Ich muss den Vater wieder gütig stimmen, ihn umschmeicheln. Ich weiß, lange hält sein Zorn nicht in ihm aus, irgendwann entweicht er heimlich und still. Von der Mutter habe ich gesehen, wie sie es macht, wenn sie bei ihrem Mann etwas erreichen will. Sie umgarnt ihn. Sie lächelt ihn an und spricht mit leiser, sanfter, dunkel vibrierender Stimme. Trotz und Härte hilft bei ihm nichts. Nein, man muss seine harte Schale aufweichen. Das hat auch seine Mutter, die Großi, einmal zu meiner Mutter gesagt. Zufällig hörte ich es, als ich, von den Erwachsenen unbeachtet unter dem Küchentisch saß. Der Hardl, sagte sie (sie nennt ihn, obwohl er nicht Eberhard wie ihr Mann, sondern Eberhardt heißt, nennt ihn wie ihren Mann, den Großvater, nur „Hardl“), der Hardl ist ein weicher Mann, sagte sie, gegen Liebe und Freundlichkeit ist er machtlos. Da hat er keine Gegenwehr.
Also entwickle ich einen Plan. Eine Offensive von Freundlichkeit will ich starten.
Wir haben zur Straße hinaus einen Balkon. Ein wahres Monstrum von 6 oder 7 Quadratmetern, mit geschmiedeten Eisenstäben, der Boden aus schweren Eichenbohlen, an der Brüstung und den drei Seiten mit Holz verkleidet, so dass man nicht hindurchsehen kann. Noch vor Jahren haben mein Vater und der Heinersch, sein Schwiegervater, auf diesem Balkon zur Selbstversorgung eine Karnickelzucht betrieben.
Es gibt sogar ein paar Fotos davon.
Ich stehe mit dem Heinersch vor den Karnickelboxen. Es sind zwei Etagen, unten vier Käfige mit den Alten, oben vier mit dem Nachwuchs. Man sieht die Türen aus dünnem Drahtgeflecht, man sieht wie die Karnickelnasen von innen daran schnuppern. An der Seite steht ein großer aus Weiden geflochtener Tragekorb. Mit dem wird das Futter, einfaches Gras, von den Elbwiesen geholt. Auf dem Hausboden wird es getrocknet, damit man einen Wintervorrat hat. Schön war es, auf dem Boden den Heugeruch zu riechen. Er hält sich lange, dieser Heugeruch, selbst nach Jahren hat es noch nach unserem Heu gerochen, als schon ewig keines mehr gelagert wurde. Vor einiger Zeit, als ich, ein erwachsener, reifer Mann, einmal unser altes Haus besuchte, mir den Hausbodenschlüssel hatte geben lassen und hinaufgestiegen war, in diese staubige, trockene Dämmrigkeit, selbst da ist es mir vorgekommen, als schnüffelte ich noch den betäubenden Heugeruch aus meiner Kinderzeit …