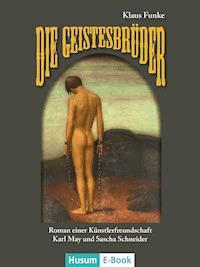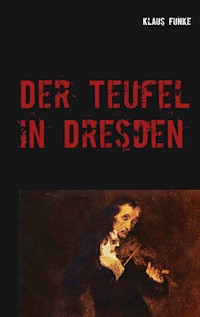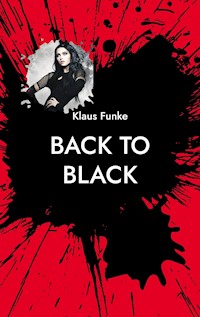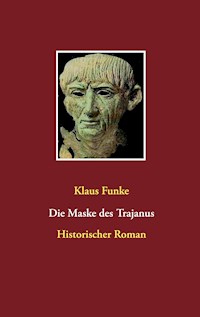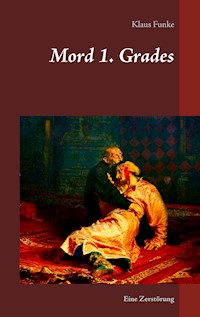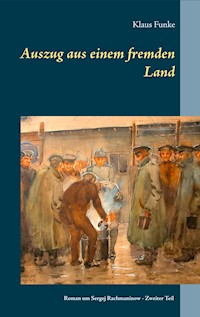Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Aber Sie zieren sich wie ein Püppchen. Nehmen Sie sich an Puschkins - Mozart und Salieri - ein Beispiel: Warum soll Rachmaninow, vielleicht sogar am Totenbett seines Freundes und Kollegen, diesen nicht umgebracht haben? Mit einem vertauschten Medikament zum Beispiel oder mit einer schlimmen Nachricht, mit irgendetwas? Lassen Sie sich etwas einfallen. Bedenken Sie, er hätte sich eines musikalischen Konkurrenten entledigt. Einfacher geht es nicht. Haben Sie Mut mein Lieber. Haben Sie Mut zu einem Mord." Funke schreibt Geschichten von einem, der auszog vom Schreiben zu leben. Skurril, humorvoll, voller Witz und Einfälle - ein literarisches Kabinettstück ersten Ranges. Und immer hat man das Gefühl - es ist wahr, was da berichtet wird. Ja, so geht es zu im deutschen Literaturbetrieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch: Der Autor lässt sein Alterego Franz Malef über seine Erfahrungen mit verschiedenen Verlagen plaudern. Funke erzählt unterhaltsam und köstlich. Nicht nur schmunzeln muss man da, nein laut auflachen könnte man manchmal. Dabei ist die Sache durchaus ernst. Ja, so geht es zu im deutschen Verlagswesen. Einen Weg der verlorenen Illusionen erlebt der Erzähler. Und, es wird nicht besser – „von nun ging´s bergab!“, sang Hilde Knef – nein, immer dubioser werden die Verlage, auf die der Erzähler trifft. Bis er schließlich sein Schicksal in die buchstäblich eigenen Hände nimmt und zu einem Self-Publishing-Verlag geht. Natürlich ist das alles im Goetheschen Sinne Dichtung und Wahrheit, aber das Buch zeigt, wie es einem ergehen kann, wenn man auszieht, vom eigenen Schreiben zu leben…
Zum Autor: Klaus Funke, geboren in Dresden, ist ein bekannter Autor erfolgreicher Romane wie „Zeit für Unsterblichkeit“, „Der Teufel in Dresden“, „Die Betrogenen“ u.v.a. Er schrieb auch Kriminalromane („Franzi“, „Das Gold der Toten“) und satirische Erzählungen („Die Poeten“, „Kammermusik“). Mit dem Roman „Meine Verlage“ legt er so etwas wie ein ironisierendes literarisches Vermächtnis vor, mit viel Humor und Selbstironie.
Alle guten Verlage sind verschieden in ihrer Art, alle schlechten gleichen sich – so könnte man mit Leo Tolstoi sagen.
Es gibt Verlage, die pflegen ihre Autoren wie die Kaninchenzüchter ihre Zuchtböcke, sie achten vorsorglich auf jeden Autor und animieren ihn zu neuen Werken, und es gibt andere, denen sind ihre Autoren vollkommen gleichgültig, ja, man hat den Eindruck, dass sie den Verleger und seine engsten Mitarbeitern nur stören, abhalten von der eigentlichen verlegerischen Arbeit, ihnen im Wege sind. Es gibt Verlage, die kümmern sich um Lesungen für ihre Autoren, zahlen pünktlich die Honorare, schicken zum Geburtstag eine Karte oder senden sogar mal ein Buch als Geschenk oder eine Schachtel Pralinen, eine gute Flasche Wein; und es gibt wiederum andere, die zahlen weder Honorare, noch organisieren sie irgendwelche Lesungen, noch wissen sie, wie alt ihre Autoren sind, wann sie Geburtstag haben, wo sie wohnen, noch welchen Geschlechts sie sind.
Ich habe es im Laufe meines Schriftstellerlebens mit zahlreichen Verlagen zu tun gehabt. Ich erinnere mich, wenn ich richtig gezählt habe, an vierzehn Häuser.
Ja, das Wort „Häuser“ ist ein gerne gehörtes Wort bei Verlagen. Alle wollen sie „Häuser“ sein, man habe in ihrem „Haus“ veröffentlicht, lassen sie verlautbaren, ihr „Haus“ habe unsereinem zu literarischem Ruhm verholfen, titeln sie. Ob man schon in ihrem „Hause“, und wenn ja, welche Titel, herausgebracht habe, wird man von ihnen gefragt. Es zeugt von der Maßlosigkeit und der übersteigerten Selbstbewertung, dass jeder Verlag sich am liebsten „ein Haus“ – ein Verlagshaus – nennen möchte. Unwillkürlich fällt einem der abgedroschene englische Spruch „my home is my castle“ ein oder „unser Haus ist eine feste Burg“. In Wahrheit tragen nur wenige Verlage diesen Ehrentitel zu Recht, meist größere und bedeutendere. Die kleinen und unbedeutenderen bleiben bei dem Titel „Verlag“, manchmal auch heißen sie Edition oder Verlagsgruppe, vor allem dann, wenn sie, meist durch Zukäufe oder Übernahmen, ein ganzes Bündel von Verlagen zusammenzuhalten in der Lage sind. Dabei haben diese Verbünde oft nur eine steuerrechtliche Bedeutung. Nach der deutschen Wende und Wiedervereinigung sind viele ehemalige ostdeutsche Verlage, die dem Existenzdruck unterlegen waren, auf diese Weise, und weil sie meinten ins Trockene zu kommen, unter den Schirm eines solventen Westverlages gekrochen. Eine meist nur scheinbare Rettung, denn dem Westverlag ging es oft nur darum, das häufig erlesene Programm der armen ostdeutschen Brüder und Schwestern mitsamt der Lizenzen zu erwerben. Ja, die Lizenzen waren überhaupt der wahre Grund. Ich werde noch auf einige Beispiele zurückkommen…
Meinen ersten Verlag – wie auch mehrere andere noch, mit denen ich im Vertrag stand – gibt es heute nicht mehr. Kleinere und mittlere Verlage haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von oft nur wenigen Jahrzehnten. Dann geben sie ihr Dasein auf. Wer ist schuld daran? Im Grunde ist der Leser neben dem Buchhändler der Hauptfeind jeden Verlages. Die einen lesen zu wenig, die anderen verkaufen zu wenig. Das eine hängt häufig mit dem anderen zusammen. Ein causales Perpetuum: Weil zu wenig gelesen wird, wird zu wenig verkauft – oder andersherum: weil zu wenig verkauft wird, wird zu wenig gelesen. Verlage und Buchhändler stehen zwar an derselben Front, sie geben sich aber gegenseitig die Schuld am Bücherund damit am Autorensterben. Natürlich ist es immer der Andere, nie ist man es selber, der die Schuld trägt.
Mein erster Verlag hieß „Die Tenne“. Man hatte eine Erdgeschosswohnung in der Dresdner Neustadt angemietet und sie als Heimat des Verlages eingerichtet. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, hier einen Verlag zu vermuten. Von außen sah das Etablissement aus wie eine Wohnung von Langzeitarbeitslosen: Graue, vom Zigarettenrauch vergilbte Gardinen, ungeputzte, blinde Fensterscheiben, die Tür zum Hausflur braun gestrichen, zerkratzt, mit einem zerbeulten Briefkasten, davor ein Abtreter, verfilzt und niedergetreten, beschmutzt mit Resten von Zigarettenasche und einigen – kippen. An der Tür ein blaues Blechschild „Die Tenne – Dresdner Verlag“. Keine Namen von Geschäftsführer oder Ansprechpartnern. Keine Telefonnummer. Nichts weiter. Im Hausflur roch es nach Katzendreck und faulem Obst. Die Fliesen des Fußbodens, graublau und gelb, waren eine Ewigkeit nicht mehr gesäubert worden. Weiter hinten standen ein abgetakelter Kinderwagen, ein kaputtes Fahrrad und eine Holzkiste mit Kartoffeln, aus denen Keime hervorschauten, die aussahen wie sprießender Spargel.
Drei Türen gab es auf jeder Etage. Die Tür zum Verlag war gleich rechts, die erste.
Ich klingelte.
Ein Buchhändler, zu dem ich seit einiger Zeit regelmäßig ging, weil ich mir von Ihm als ganz und gar neuer und naiver Autor Kontakte, Mut und Anerkennung versprach, hatte mir geraten, es doch einmal mit „der Tenne“ zu versuchen. Die hätten eine ganze Reihe noch unbekannter, aber auch bekannter Dresdner Autoren aufgenommen und herausgebracht. Kleine Auflagen zwar, aber nette Titelcover, keine Zuzahlungen. Also ging ich hin. Ich hatte ein Manuskript im Gepäck, eine Erzählung, humorvoll, skurril, ganz im Stile Thomas Bernhardts, der damals mein großes Idol war. Es war mein erstes vollständiges Werk, überschaubar, nur knapp 120 Seiten. Es hieß „Ein Kammerkonzert“. Es beschrieb die Arroganz des Dresdner Kunstbetriebes, die Ignoranz der Bildungsbürger, besonders der Musiker, zugleich das Kleinkarierte dieser Künstlerwelt. Und es war ein bisschen in der Sprache des ewig räsonierenden Thomas Bernhardt geschrieben. Ich war gespannt, wie es richtige Verleger, und für die hielt ich die beiden Akteure des Tenne-Verlages, aufnehmen würden. Mein Herz klopfte nun doch ein wenig, als ich nach dem ersten Klingeln und einem zaghaften Klopfen, zu dem ich mich entschlossen hatte, hinter der Tür schlurfende Schritte und dein Hüsteln hörte.
Die Tür wurde geöffnet und in einem Schwall Zigarettenrauch, der von drinnen nach draußen, zu mir in den Hausflur drang, sah ich einen kleinen drahtigen Mann, um die Vierzig, mit unordentlichen Haaren und einem Oberlippenbärtchen. Es war einer der beiden Verlagsakteure. Er hieß Volker Moertel. Indes, er stellte sich mir nicht vor. Ich erfuhr seinen Namen erst später.
Ich sagte meinen Namen und, dass wie telefoniert hätten.
Ach ja, krächzte zwischen zwei kleineren Hustenanfällen der Moertel, achhem, achhem, Sie sind das? Der mit diesem Manuskript, das da „Ein Kammerkonzert“ heißt? Komischer Titel. Aber gut, ganz originell. Kommen Sie rein… und er trat beiseite, machte mir Platz.
Es war als träte ich in eine Nikotinhölle. Mir fiel das Atmen schwer. Ich musste husten. Moertel führte mich über einen kurzen, halbdunklen Flur, wo ich nichts sah außer zahllose Papierstapeln und verschiedene Bananenkisten, die mit Büchern vollgestopft waren, in ein großes, vielleicht zwanzig oder dreißig Quadratmete großes Zimmer. Zwei Schreibtische, darauf Computer, Tastatur, Drucker, standen sich jeweils über Eck gegenüber; fast wie Boxer, dachte ich, der eine in der blauen, der andere in der roten Ecke.
Hier sitze ich! sagte der kleine drahtige Herr Moertel. Dort drüben, er zeigte mit dem Arm auf den Schreibtisch gegenüber, sitzt mein Kompagnon, Herr Ruprecht Schwarz… und er ergänzte scharf und hustend, wenn er da ist! Wenn der Herr mal da ist… Das klang nicht gerade freundlich. Und es sollte sich bald bestätigen, dass die beiden Herren, wiewohl in einem Verlag gemeinsam arbeitend, doch ziemlich gegensätzliche Typen waren. Was mir auffiel: Es war mit weißer Farbe ein Strich quer über den abgenutzten Parkettfußboden gezogen, er teilte sozusagen das Zimmer in zwei Hälften, deren Mittelpunkt der jeweilige Schreibtisch bildete. Drüben stand, ebenfalls mit weißer Farbe auf den Fußboden gemalt das Wort „Lyrik“, hüben, auf der anderen Seite das Wort „Prosa“. Moertel sah meinen Blick. Er lachte. Ja, so sehen alle gleich, wie wir unsere Refugien aufgeteilt haben. Der da, er wies auf den leeren unbesetzten Schreibtisch und meinte seinen Kollegen, ist für die „Lyrik“ zuständig, ich für die „Prosa“. Ich verstehe nichts von Lyrik, halte sie für einen literarischen Irrweg, der bald verschwunden und verunkrautet sein wird. Mein Feld ist die Prosa. Schreibe ja selbst ein wenig. Und er nahm ein Büchlein aus dem Regal und gab es mir. Es hieß „Die Wanderung von A nach B“. Können es ja mal lesen, sagte Moertel gnädig, geben Sie es mir irgendwann zurück. Er nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und versetzte dem Computer einen Schlag mit der flachen Hand. Der Bildschirmschoner verschwand, der Bildschirm erzitterte und das Schreibprogramm war wieder zu sehen.
Ja, ich bin ein handfester Typ, war früher Fernfahrer, bin mit meinem 40-Tonner quer durch Europa gerollt, bis ich das Büchermachen entdeckte… man hat ja beim Fahren viel Zeit zum Nachdenken. Habe schon immer gerne und viel gelesen. Was soll man machen nachts auf einem Parkplatz, wenn man nicht schlafen kann? Freilich, Nutten gibt´s überall, aber man hat nicht immer Lust drauf. Also las ich. Alles mögliche. Am liebsten Reisebeschreibungen und Biografien, auch Romane. Irgendwann kam ich drauf, es mit dem Büchermachen selber zu versuchen. Und so hab ich angefangen. Den Schwarz (er zeigt wieder nach drüben zum anderen Schreibtisch) hab ich später kennengelernt. Der hatte auch die Schnauze voll von seinem Beruf. War Lehrer. Hat auch Gedichte geschrieben. Igitt. Jedenfalls haben wir uns zusammengetan. Es lief ganz gut, die erste Zeit. Na ja, wie das so ist, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat, glaube ich, der alte Hesse mal gesagt… o.k.
Moertel lachte, zündete sich eine neue Zigarette an. Nehmen Sie Platz, Herr… Herr… äh, Malef. Na zeigen Sie mal her. Haben Sie das Ganze auf einer Diskette gespeichert?
Ich nickte und gab sie ihm,
Na dann wollen wir mal sehen. Er schob die Diskette in seinen PC.
Ach Mist, knurrte er, Sie haben auf „Works“ geschrieben. Das muss ich erst konvertieren. Einen Moment. Merken Sie sich. Grundsätzlich in Zukunft mein Lieber: Alles mit Word. Da haben wir es leichter. Mein Pagemaker freut sich, wenn er Word kriegt. Wissen Sie, was Pagemaker ist?
Ich schüttelte den Kopf
Moertel hielt mir einen Vortrag, bei dem er 2 Zigaretten verbrauchte. Verstanden hatte ich nichts.
Also gut, rief der ehemalige Fernfahrer, ich schau mir das in Ruhe an. Reden wir mal über die Vertragsmodalitäten. Wo haben Sie bisher veröffentlicht?
Ich zuckte die Achseln, machte mein Versagergesicht: Nirgends!
Na, das ist ja nicht viel… aber, macht nichts… Sie wissen ja: Wissen ist Macht, aber nichts wissen macht nichts! Will sagen, mir sind die Anfänger am liebsten. Die sind noch gefügig und anstellig. Nehmen Sie aber mal so einen etablierten Autor – wir haben einige bei uns im Hause (merken Sie, lieber Leser, da war es wieder: der rauchende Moertel bezeichnete seinen Verlag als ein „Haus“. Ein Verlagshaus! Ein Lacher, wenn ich die Bude sah, in der ich mich befand) – die kommen hier rein, diese Pinkel, fuhr der ehemalige Fernfahrer fort, und denken sie könnten uns sagen wie´s läuft. Erst kürzlich war einer hier – Freudenthaler! Kennen Sie den? – Lars Freudenthaler, ein enger Freund von meinem Kollegen Schwarz; der war bei einem großen Verlag rausgeflogen, ein anderer hatte sogar Pleite gemacht und nun suchte er etwas neues, ein neues Bett, in das er sich legen könnte. Natürlich, mein Kompagnon, der Schwarz da – wieder zeigte er auf den verwaisten Schreibtisch – hat dem Freudentaler sofort das Blaue vom Himmel versprochen, Sonderbedingungen, Auflagenhöhen, die wir uns niemals leisten können ohne Zuzahlung des Autors und so weiter, und, stellen Sie sich vor, Schwarz sagte ihm, er, sein Freund Freudentaler, bekäme ein Lektorat, wo sämtliche Augen zugedrückt würden. Riesige Mehrarbeit für uns, denn die Manuskripte von Freudenthaler sind immer unter aller Kanone. Kein Wunder, dass der Freudentaler, als er dann mit mir ums Praktische reden wollte, denn mein Herr Kompagnon versteht von der Praxis des Büchermachens nicht die Bohne, na ja, ein Lehrer eben, dass der Freudentaler dann vor mir die große Lippe riskierte. Aber, mein Lieber, das macht er nicht mit meinem Vater sein´ Sohn – ich war Fernfahrer, wissen´Se. Da hab ich ihm erstmal das Öl abgelassen… und der Freudentaler wurde so klein – Moertel zeigt mit Damen und Zeigefinger wie klein er meinte. Na, was soll ich sagen, zum Schluss musste der große Freudentaler meine Bedingungen akzeptieren: Autorenhonorar erst nach den ersten verkauften 500 Stück, und dann nicht höher als 7%, Auflagenhöhe für die erste Auflage von maximal 700 Stück, Mitfinanzierung des Druckes, wenn er auf einem farbigen Deckelbild bestünde, kostenlose Lesungen, dabei Buchverkauf nur durch den Verlag und so weiter… Sie verstehen?
Moertel machte eine elegante Handbewegung und feixte. Nur damit Sie wissen, mein Lieber, wie bei uns der Wind weht… aber, Sie sind ja Anfänger, noch nichts veröffentlicht, da ist ja Demut eine Grundtugend. Klar?
Was sollte ich darauf sagen? Ich nickte zustimmend.
Worauf der rauchende Fernfahrer, nicht zu mir, sondern auf seinen Bildschirm starrend, ausrief:
Na sehen Sie, ich wusste doch, dass wir uns verstehen würden… Also, und jetzt wandte er sich mir wieder direkt zu, ich werde mir Ihr Manuskript mal zu Gemüte führen. Seien Sie froh, dass Sie an mich geraten sind… mein Kompagnon… der würde… Moertel winkte ab.
Rufen Sie mich in 3 Wochen mal an. Dann kann ich Ihnen mehr sagen… ob Ihre Ergüsse etwas taugen oder nicht… hier hustete Moertel zweimal hintereinander, sprang auf, reichte mir die Hand.
Bis bald also!
Als ich auf die Straße trat, atmete ich, wiewohl es nur die Dresdner Stadtluft war, die ja nicht für ihre Frische bekannt ist, erst einmal tief durch, blähte meinen Brustkorb wie ein Taucher, wenn er an die Oberfläche kommt, und ging dann tief in Gedanken zu meinem Auto, das ich sozusagen um die Ecke geparkt hatte. Ich fuhr damals einen FIAT, großes Modell „Tempra“, 2 Ltr.- Maschine. Der brauchte ganz schön Benzin, hatte auch einen beängstigenden Ölverbrauch. Ich würde mich verändern müssen, dachte ich, als ich die Tür öffnete und einstieg. Ein neues Leben, mein Eintritt in die Bücherwelt, dachte ich, erforderten auch ein neues Auto.
Schon nach reichlich einer Woche rief ich bei der „Tenne“ an.
Diesmal war der andere, Ruprecht Schwarz, am Telefon.
Eine barsche, abgehackte Stimme erklang. Gar nicht wie ein Lehrer, dachte ich.
Ja, ich höre.
Ich sagte meinen Namen, verwies auf Moertel, fragte nach meinem Manuskript.
Der ist nicht da. Wir haben uns das aufgeteilt. Er übernimmt die Anfänger und das Vertragliche, ich die etablierten Dichter und die Presse. Ich kenne ihr Manuskript nicht.
Was? Sie wissen nicht davon? fragte ich, ziemlich enttäuscht.
Was heißt wissen? Ich weiß, dass Sie ein Manuskript eingereicht haben. Mehr aber nicht.
Was? Sie sprechen nicht gemeinsam über Ihre Neueingänge?
Wo denken Sie hin? Das geht gar nicht. Nur ganz kurz, meistens. Wir kämen zu nichts anderem. Herr Moertel wird sich bei Ihnen melden.
Aber, insistierte ich, er hat gesagt, ich solle anrufen.
Na, wenn er das gesagt hat… trotzdem, ich kann Ihnen nicht helfen.
Könnten Sie nicht wenigstens Herrn Moertel informieren, dass ich angerufen hätte. Bitte.
Ja, gut. Kann ich machen.
Wann ist er denn wieder erreichbar?
Was weiß ich. Er ist jetzt zwei oder drei Tage nicht da, hat für seine alte Firma eine Fernfahrt übernommen. Bulgarien, Ungarn, Balkan… so, die Richtung.
Ja, geht denn das? Immerhin leitet er einen Verlag.
Was heißt hier: Leitet? Ich bin ja auch noch da.
Ich meine, können Sie sich das leisten? Bei all den Manuskripten und Korrekturen, bei den anstehenden Andrucken etc.
Sie sehen ja, dass es geht. So ist er eben, der Moertel, manchmal, wenn er Geld braucht. Ich kann da nichts machen. Wenn in seinem Kopf der Druck zu groß und im Geldbeutel der Bestand zu klein geworden ist. Er müsse sich befreien von Über- und Unterdruck, wie er immer sagt. Gut. War es das jetzt? Oder haben Sie noch Fragen?
N… N… nein, mir reicht es. Ich melde mich nächste Woche. Hoffentlich ist Herr Moertel dann wieder da?
Wenn er keinen Unfall hatte, sicher.
Unfall? Muss man denn damit rechnen?
Man muss immer mit allem rechnen, als Autor sollten Sie das wissen. Im letzten Jahr ist er auf der A4 in die Leitplanken gefahren. 5 Stunden Stau, der LKW war Schrott. Bis an sein Lebensende muss er nun dafür zahlen…
Mein Gott.
Na, haben Sie mal Hunderttausend Schulden… also, dann. Adieu.
Auf Wiederhören.
Ich war platt. Und eine Menge Illusionen hatte ich auch verloren. Was waren das für Verhältnisse! Der eine Verleger fährt Brummis, statt sich um seinen Verlag zu kümmern, der andere spielt den Lyrikguru. Ist taub für die Realität. Tolle Verhältnisse. Wirklich.
Irgendwie brachte ich die paar Tage rum, rief in der nächsten Woche wieder im Verlag an.
Diesmal, ich hörte es sofort am Husten, war Volker Moertel dran.
Das erste, was er fragte, war: Sie bringt wohl die Ungeduld um?
Wieso?
Nun, weil Sie sich schon letzte Woche nach Ihrem Manuskript erkundigt haben, statt die 3 Wochen zu warten, wie ich Ihnen geraten hatte.
Aha, dachte ich, sie reden also doch miteinander. Laut sagte ich:
Immerhin ist es schön, dass Sie wieder in Ihrem Büro sitzen und nicht hinterm Lenkrad irgendeines 40-Tonners.
Der Schwarz ist ein altes Quatschfass… und Sie, mein Lieber, geht überhaupt nicht an, was ich in meiner Freizeit mache…
Wieso Freizeit? Ich dachte, Sie sind in erster Linie Verleger…
Überlassen Sie das Denken den Pferden, die haben den größeren Kopf.
Das war aber ein uralter Witz…
Na und? Wenn Sie wissen wollen, ob ich Ihr Manuskript gelesen habe, dann sage ich Ihnen: Ja, ich habe es gelesen! In diesem Zusammenhang – welche Note hatten Sie denn in Orthographie und Grammatik… mein Lieber, das ist ja fünfte Klasse Notabitur… gut, aber sonst, ganz gut. Ja, ganz gut. Und ziemlich politisch. Aber das macht nichts. In der Kulturpolitik kann man ja heute nicht scharf genug formulieren… Da werden uns die Postsozialisten zujubeln, ein paar andere dagegen die Nase rümpfen… wie gesagt, das macht nichts. Aufmerksamkeit ist das Wichtigste, was ein Buch, was ein neuer Autor braucht. Kommen Sie also in den nächsten Tagen mal her. Wir müssen über ein paar Textstellen reden… Also.
Ich verabschiedete mich. Bis übermorgen oder so…
Ja, ja… kkkiihhh, kkkiihhh… und wieder hustete Moertel wie einer von der Isolierstation.
Ich ging hin. Moertel war alleine, sein Kompagnon wieder nicht da. Wir hatten kaum ein paar Minuten über den Text gesprochen, als die Tür aufging und eine Dame hereingestöckelt kam. Nun ja, eine Dame war sie vielleicht nicht ganz, eher eine schrille Punk-Lady, ganz in schwarzes Leder gekleidet, enge Hosen, High-Heels mit, wie wir früher gesagt hätten, Pfennigabsätzen, grell geschminkt und mit einer hoch toupierten Löwenmähne in Henna-rot, freilich war die Dame nicht mehr ganz jung, so um die Dreißig schätzte ich. Sie beachtete mich nicht, ging direkt auf Moertel zu, rief mit schriller Stimme überlaut: „Hey, Moerti, dein Schatzi ist da!“, sie gab ihm einen Kuss…
Munter schnatterte sie los: War grade in der Nähe und da wollte ich mal sehen, was du so machst…
Moertel wischte sich die Schminke von der Wange, er war ein wenig unwillig, gab ihr zu verstehen, dass sie nicht alleine wären. Da drehte sich die Dame auf ihren überhohen Absätzen herum, lächelte mit ihrem breiten, geschminkten Mund, zeigte mit ihren rotlackierten Krallen auf mich.
Der da? Ist das etwa einer von deinen Dichtern, Moerti?
Ja, das ist Franz Malef, unser neuer Autor, wir wollten gerade seinen Text durchgehen.
Was? Ein Neuer? Zeig mal her, was der so schreibt… und sie trat an Moertels Schreibtisch und nahm ungeniert einen Packen Papier in die Hand. Sie begann zu lesen, zog die nachgezogenen Brauen hoch. Lachte. Mein Gott, was ist das für ein geschraubtes Zeug… „dort fließt ein Plasmastrom von Chaos: Viel der Augen fanden unter den Gästen ihre wahren Besitzer, und die plötzlich Sehenden taumelten blind durch eine unbekannte, fremde Wirklichkeit…“ Das versteht ja kein Mensch: Plasmastrom!? Sie begann zu kichern, legte das Papier wieder hin.
Moertel war verlegen geworden. Liebling, was du gelesen hast, ist nicht von Herrn Malef, das ist ein Klassiker, den wir herausbringen wollen.
Ein Klassiker? Etwa vom ollen Joethe?
Nein, von Jurij Brezan. Der Krabat…
Mann, Moerti, Krabat, das ist doch uralter Quatsch. Zeig mit lieber mal was von diesem Herrn Malef da.
Nein, bitte, Giesa, das geht jetzt nicht. Bitte. Geh mal über die Straße zum Bäcker, trink dort einen Kaffee, iss ein Stück Quarktorte und komm in einer dreiviertel Stunde wieder. Dann sind wir hier weiter…
Nee, ich denk nicht dran, jetzt, wo ich gerade hier bin. Wo´s spannend wird. Ich will doch auch mal sehen, wie Du mit deinen Dichtern umgehst… und wie die so drauf sind.
Sie zog ihr kurzes Lederjäckchen aus, drunter trug sie eine Art Lederbluse, oder besser ein Gebilde von genieteten Riemchen und Schnallen, alles aus schwarzem Leder, was viel Haut, auch Teile von ihrer Brust und dem Bauch sehen ließ.
Moertel machte ein betretenes Gesicht. Es war ihm sichtlich peinlich, wie sich seine Freundin hier zeigte, wie sie sich aufführte.
Ich wollte ihn schon fragen, in welchem Bordell er die Dame aufgegriffen hätte, aber, klar, ich beherrschte mich, fragte natürlich nichts, war gespannt wie mein neuer Verleger mit der Situation fertig werden würde.
Die Dame Giesa indes setzte sich, ihr Lederjäckchen auf einen der Buchstapel werfend, wohin es in hohem Bogen flog und wie ein Fensterleder hängen blieb, setzte sich direkt auf Moertels Schoß, schlang ihre nackten Arme um seinen Hals.
Sei doch nicht so ein Miesepeter, Moerti. Schau, deine Giesa ist jetzt bei dir. Freu dich lieber und schau, was an mir dran ist. Eine ganze Woche haben wir uns nicht gesehen. Was musst du auch immer in der Welt rumkurven mit deinen Brummis?
Moertel machte sich aus Giesas Armen frei, hob sie behutsam von seinem Schoß und sagte zu mir:
Pardon, mein Lieber. Das ist Giesa Blümel, eine gute Freundin, manchmal sogar meine Muse.
Meine Muse! Mensch, das ist geil, was? rief die Dame.
Ich nickte zerstreut. Mein Blick haftete an ihren Fleischteilen. Ich wagte zu fragen: Was machen Sie denn so, wenn Sie nicht gerade Ihren Moerti besuchen?
Ich?
Ja, Sie.
Ach, ich arbeite in einem Dentallabor. Nichts Aufregendes. Aber, wenn Sie mal ein Gebiss brauchen… hi, hi, hi, wieder kicherte sie. Hab heute frei genommen… extra wegen Moerti.
Sie machte einen Schmollmund, was wegen der Schminke ein wenig clownesk aussah… aber der hat ja wie immer keine Zeit für mich.
Bitte, Giesa, ließ sich Moertel vernehmen, bitte geh doch rüber zum Bäcker. Je eher du gehst, desto eher sind wir hier fertig und dann hab ich Zeit für dich… komm gib deinem lieben Moerti einen Kuss… und dann ab…
Und tatsächlich, die Dame stöckelte zu ihrem Jäckchen, hob es auf, warf es sich über die Schulter, gab ihrem Moerti ein Küsschen und verschwand.
Moertel atmete hörbar auf. Er schaute auf die Uhr. Na los, da wollen wir mal…
Ich sollte im Laufe meiner Bekanntschaft mit ihm noch ein paar weitere solche Damen kennen lernen. Ich glaube, im Ganzen waren es vier. Alle, wenn man nur ihr Outfit sah, irgendwie aus den Randgebieten zur Halbwelt. Ob die eine oder andere direkt dem Rotlichtmilieu entstammte, konnte ich nicht feststellen. Moertel, ein typischer Berufskraftfahrer, immer ein wenig vulgär, immer ein wenig roh und verdorben, hatte einen Hang zu diesem Milieu. Rauchen – Saufen – Weiber. Es war fast unglaublich, dass ein solcher Mann Bücher machte, ja sogar selber welche schrieb. Einmal habe ich ihn – das war Jahre später. Da gab es den Verlag schon nicht mehr – in einem Gartenlokal an der Elbe im Kreise seiner Kumpels angetroffen. Er hat mich nicht erkannt, das konnte er auch nicht mehr, denn er war derartig betrunken, dass, wie gesagt wird, seine Gesichtszüge entgleist waren. Es tropfte und saftete aus all seinen sichtbaren Körperöffnungen, aus den Augen, der Nase, dem Mund. Und er sah ziemlich verwahrlost aus. Die Haare fettig, lang und wirr, das Kinn unrasiert, abgerissene, lange nicht gewaschene Klamotten. Er lallte und redete unverständliches Zeug, ein unerfreuliches Bild, aber immerhin, die Zigarette dampfte...
Zurück. Die Dame war gegangen, wir redeten über meinen Text. Und auf einmal zeigte sich Moertel geistvoll, witzig, voller Ideen, sprachlich gewandt, sprühte. Ja, er entwickelte sogar eine gewisse Seriosität und Würde. Ich staunte. Diese Seite kannte ich nicht an ihm, hatte sie nicht vermutet.
Es stellte sich heraus, dass er, was meinen Text anging, ein regelrechtes Überarbeitungskonzept hatte. Und er hatte sich viel Mühe damit gegeben, sogar Notizen gemacht. Meine Zeilen müssten stringenter, logischer, konsequenter werden, sagte er. Ja, und er hatte Recht, mein Manuskript machte den Eindruck, als wäre alles zu flüchtig hingeschrieben, auch mit vielen orthografischen Fehlern, die selbst ein Schüler in der 8. Klasse nicht mehr machte; auch in der Satzstellung, der Grammatik wären massenhaft Mängel. Ich bekam einen roten Kopf, einen Moment schwankte ich, ob ich aufstehen und davonrennen sollte. Kritik an meiner Schreiberei vertrug ich nur schlecht. Es war wie früher, als meine Mutter mir an meinen Aufsätzen herumkorrigiert hatte. Einmal zerbrach ich ein Lineal aus bloßer Wut, ein anderes Mal bin ich aufgesprungen und bis zum Dunkelwerden um unser Viereck spaziert, die Hände auf dem Rücken wie der ergrimmte Beethoven. An den dachte ich damals immer. Das kam vom Klavierüben. „Die Wut über den verlorenen Groschen“ war mein Lieblingsstück. Da – dada – dideldideldum - . Es hämmerte mir im Kopf umher, wenn ich wütend war… Da – dada – dideldideldum - ich hatte es mir eingeübt, beherrschte es zur Not ganz gut.
Indes, Moertel blieb gelassen, ruhig und ernst, geduldig wie ein Lehrer las er mir die Stellen vor. Er beobachtete mich aufmerksam, lächelte in sich hinein. Ich schämte mich. Jedes falsche Wort peinigte mich. Warum bin ich nur hierher gegangen? dachte ich.
Väterlich sagte Moertel: ja, ja, mein Lieber, das erlebe ich oft bei Neulingen, verzweifeln Sie nicht. Man denkt, man ist perfekt und dabei stellt sich heraus, man ist über das Schulniveau noch nicht viel hinaus. Aber das macht nichts. Ihr Text ist wirklich gut, glauben Sie mir, er hat etwas… er hat Kraft und Ausstrahlung, aber ist noch ein wenig roh, er muss wie ein Diamant geschliffen werden. Und er ergänzte: Seien Sie in Zukunft etwas langsamer, dafür aber gründlicher. Dann kommt ein besserer Text heraus…
Unter diesen Gesprächen und den Textzitaten mochte vielleicht eine knappe halbe Stunde vergangen sein, Moertel hatte in den letzten Minuten immer wieder verstohlen auf seine Uhr geschaut, als wir draußen im Hausflur plötzlich Schlüsselgeklapper hörten, die Tür geöffnet wurde und Ruprecht Schwarz, Moertels Kompagnon, hereintrat.
Ich kannte Schwarz flüchtig, hatte ihn ein paar Mal im Buchladen von Gulm-Notteck getroffen, als er dort seine Literaturzeitschrift „Die Ohren“ ausgelegt und mit dem Buchhändler in seiner knappen, abgehackten Sprechweise Allgemeines und Geschäftliches besprochen hatte. Schwarz war ein kleiner, etwas rundlicher Mann mit einer Brille und hellen, aufmerksamen Augen. Auffallend an ihm war sein flacher Hinterkopf und die kurzen Arme und Beine. Immer trug er eine abgewetzte braune Lederjacke, schwarze Jeans und ziemlich niedergetretene Sandalen. Mit schnellen Schritten ging er auf seinen Kollegen zu, klopfte ihm auf die Schulter, sagte: Na? Gut vorwärts gekommen? Dann blickte er sich nach mir um, reichte mir die Hand, rief: Aha, Sie sind also unser Neuer?
Er trat mit drei, vier schnellen Schritten an seinen Schreibtisch, packte seine Aktentasche aus – er trug immer eine helllederne Aktentasche, die womöglich schon seinem Vater gehört hatte – stellte eine silberne Thermoskanne und seine dunkelblaue Brotschachtel auf die Schreibtischplatte, bückte sich, steckte einen lose herumliegenden weißen Stecker in eine Elektrodose hinter seinem Schreibtisch. Sein Computer begann zu summen.
Moertel hatte den Verrichtungen seines Kollegen aufmerksam zugesehen, er schien sie genau zu kennen. Plötzlich räusperte er sich, sagte: Du, Ruprecht! Ich muss mal dringend weg. Nimm dich doch bitte unseres lieben Malef an. Du wolltest ja den Text sowieso noch selber kennenlernen… zu mir ergänzte er: Wir schauen immer wechselseitig auf die Texte. Unser Arbeitsprinzip. Herr Schwarz wird also sein Auge auf Ihre Zeilen werfen. Die Gelegenheit ist jetzt da – ich muss mal weg – und wieder zu seinem Kollegen: Wir brauchten noch einen alternativen Titel. Du weißt schon, irgendetwas Griffiges. Und dann den Klappentext… hier, ich gebe Dir die Diskette… und Moertel zog die Diskette aus dem Laufwerk seines Rechners, gab sie seinem Kompagnon. Dann, ein wenig hastig und auf seine Uhr schauend, zog er sich seine Jacke über und stürzte grußlos davon.
Wir, Schwarz und ich, blickten ihm nach. Schwarz zischte durch die Zähne: Ich wette, da steckt wieder irgendein Weib dahinter… na egal, rücken Sie schon mit Ihrem Stuhl über die Grenzlinie. Da wollen wir mal…
Ich tat wie mir geheißen und in Gedanken sah ich den Moertel draußen über die Straße stürzen und in dem Backwarenladen verschwinden, wo es sich seine Giesa bei Kaffee und Kuchen gutgehen ließ.
Schwarz hatte inzwischen schon die Diskette in seinen Rechner geschoben und angefangen, meinen Text zu lesen. Er tat das konzentriert, seine Stirn runzelte sich. Er machte sich Notizen. Ich saß da und wartete. Nach einer mir endlos erscheinenden Zeit – er konnte indes nur einen Teil des Textes gelesen haben, lehnte sich Schwarz in seinem Schreibtischsessel zurück und schnaufte.
Also, ich muss schon sagen, begann er, da haben Sie ja Ihren Bernhardt gründlich gelesen, allzu gründlich. Was Sie da anbieten, ist eine Nachahmung. Ich weiß, er hob, wiewohl ich noch kein Wort gesagt hatte, abwehrend die Hände, Sie werden einwenden, das hätten Sie nicht absichtlich getan, es entstamme Ihrer übergroßen Liebe zu diesem Autor. Ja, ja, das machen viele Anfänger und junge Autoren: Sie ahmen nach. Aber trösten Sie sich. Die großen Autoren geben sich damit nicht ab, sie schreiben hemmungslos und großflächig ab. Wenn Sie wüssten, wie auf diese Weise in der deutschen Literatur schon betrogen worden ist. Die allergrößten sind zugleich die allerschlimmsten. Nehmen Sie Thomas Mann, nehmen Sie Kafka oder Dostojewski. Alle haben sie abgeschrieben. Thomas Mann bei Fontane, Kafka und Dostojewski bei E.T.A. Hoffmann. Ihr Thomas Bernhardt wiederum bei Dostojewski. Und Karl May hat gleich ganze Seiten aus verschiedensten Lexika abgeschrieben. Aber, es hat ihnen allen nicht geschadet. Nein, wenn Sie hier Ihren Bernhard nachahmen wollen, so tun Sie das immerhin. Es ist in der Kunst üblich, besonders auch in der Musik. Sogar Mozart hat nachgeahmt, nämlich den Papa Haydn. Oder Richard Strauß hat bei Bruckner, der wiederum hat bei Wagner und Brahms Anleihen genommen. Und Gustav Mahler hat gleich überall was zusammengeklaut. Nein, nein, mein Lieber, schreiben Sie ruhig ein bisschen wie Thomas Bernhardt. Es geht ja auch um den beabsichtigten Tonfall. Und Bernhardt eignet sich nun mal besonders, wenn man räsonieren und granteln will. Also, verstehen Sie, ich hab da nichts dagegen. Ich weiß Bescheid. Freilich, meinen Kollegen Moertel stört das. Aber, das macht nichts. Er kennt sich in der Literatur sowieso nicht so gut aus – hat wahrscheinlich immer das Falsche, auf alle Fälle nicht genug gelesen, und so weiß er nicht, dass uns Ihre Nachahmerei eher nützen als schaden wird… also, um das abschließend zu sagen: Den Stil lassen wir so. Ist sogar ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für Sie… und auch für uns.
Er starrte mich an. Und? Was schauen Sie so entsetzt? Etwa überrascht?
So, fuhr er fort, nun den Klappentext. Am besten… ja, bewährt hat sich immer, man zitiert was aus dem Text und gibt dann den eigenen Senf dazu… er blätterte und blätterte in meinem Manuskriptausdruck. Es dauerte ein paar Minuten. Dann plötzlich fand er eine Stelle.
Hier! rief er, das nehmen wir! Und sogleich las er vor… „…ein älterer Herr aus der ersten Reihe hat zu mir herüber gestarrt, mit seinem Konzertbesucherblick…“
Ich war zögerlich, wusste nicht, ob dies wirklich die Stelle wäre, die man herausgreifen sollte, aber ich kam nicht dazu, meine Bedenken zu artikulieren, denn Schwarz hatte sein Vorlesen unterbrochen. Er hatte den Kopf erhoben und die Stirn gerunzelt. Aus dem Treppenhaus waren polternde Schritte zu hören. Kurz darauf wurde die Tür aufgerissen und Moertel stürzte herein. Er war hochrot im Gesicht. Er schnaufte…
Schwarz machte mir Zeichen, flüsterte: Da ist was schief gegangen…
Und tatsächlich, indem Moertel zu seinem Platz ging, brummte er ärgerlich: Diese verdammte, kleine Schlampe… das lass ich nicht mit mir machen…
Schwarz, von seinem Platz aus hinter seinem Rechner, fragte: Ist es wiedermal aus? Hast du sie zum Teufel gejagt?
Ach, Scheiße, schnaufte Moertel und zerrte sich die Jacke von den Schultern, lasst mich in Ruhe… Weiber! Wie weit seid ihr gekommen?
Ich hatte mich auf meinem Stuhl umgedreht, schaute Moertel ins immer noch rote Antlitz: Wir sind beim Klappentext… wenn Sie mal hören wollen. Und ich fing an, den Text zu zitieren.
Moertel hörte zu, aber er war noch zu aufgeregt, zu fahrig und unkonzentriert. Er sagte: Ja, ist ganz gut… lasst mich mal ein paar Minuten zur Ruhe kommen. Soll ich uns einen Kaffee machen?
Meine Illusionen flogen davon wie Seifenblasen. Das war nun mein erster Tag in einem Verlag. Wer hätte das gedacht, nichts von hochgeistiger Atmosphäre, nichts von sprachlicher Noblesse, stattdessen Rangkämpfe zwischen zwei Leuten, Kompetenzgerangel, primitiver Alltagskram, Niederungen. Ich hätte gedacht, dass man mir etwas zur Strategie des Verlages, zu den Programmzielen, zu den anderen Autoren sagen würde, vielleicht zu erfolgreichen Büchern. Pustekuchen.
Moertel war an die Kaffeemaschine gegangen. Er kam mit drei Tassen, drei Löffeln, einem Sahneblister, wo die Sahnenäpfchen wie die Patronen in einem Gurt aneinander hingen, an den Schreibtisch von Schwarz, zog einen Stuhl heran, setzte sich. Eine Weile schwiegen wir, dann platzte Schwarz in seiner abgehackten Sprechweise heraus: In sechs Wochen… Buchmesse. Das ist jetzt das Wichtigste… und zu mir: Sie kommen doch?
Was sollte ich machen, ich nickte.
Schwarz: Gut.
Moertel: Wir wollen versuchen, ob wir dort noch eine Lesung unterbringen. Ansonsten halten Sie sich an unserem Stand auf… beobachten das Getriebe.
Schwarz (zu Moertel): Sag mal, kriegen wir die Fahnen und den Druck bis dahin hin?
Moertel: Wenn du ein bisschen mitmachst…
Schwarz: Na hör mal…
Moertel: Ich frag ja nur… also gut, wenigstens einen Probedruck für die Messe werden wir schon schaffen…
Schwarz: Kostet?
Moertel: Den Probedruck können wie gerade noch stemmen…
Schwarz: Hast du schon wegen der Auflagenhöhe…?
Moertel (er schaute mich von der Seite an): 500 dachte ich
500! überlegte ich (Moertel hatte darüber noch nicht mit mir gesprochen), das wäre ja eine winzige Auflage. Enttäuscht, mit heiserer Stimme fragte ich: Ist das nicht ein bisschen wenig?
Moertel und Schwarz, fast gleichzeitig: Na hören Sie mal! Keiner kennt Sie auf dem Büchermarkt. Was denken Sie, wer Sie sind? Dan Brown? Was machen wir, wenn Ihr Titel floppt, wir aber 2000 gedruckt haben? Wollen Sie den Druck bezahlen?
Ich schüttelte den Kopf.
Moertel, väterlich: Nein, mein Lieber, wir müssen Sie erst mal einmal ein wenig aufbauen.
Aufbauen?! Wie wollten die beiden das schaffen? Wie wollten sie dabei vorgehen? Das erste Mal, dass ich, was diesen Tenne-Verlag betraf, echte Zweifel bekam. Zwei Amateure, der eine ein ehemaliger Lehrer, der andere ein Fernfahrer, bildeten sich ein, Verleger zu sein. Freilich, ich hatte keine Ahnung von der Tätigkeit eines Verlegers. Hatte nur irgendwelche romantischen Vorstellungen. Stellte mir das Verlegerleben so vor, wie es sich alle vorstellen. Was man eben so darüber gelesen hat. Mein Gott, was hatte mir der Buchhändler da nur „für einen Laden“ empfohlen? Wusste er, wie es hier zuging? Wusste er überhaupt etwas vom Verlagsgeschäft? Oder wollte er mir einen Streich spielen?
Ziemlich verwirrt verließ ich an diesem Tag die Parterrewohnung – das Verlagshaus des Tenne-Verlages.
Indes, der Termin der Buchmesse rückte näher und näher. Dann war es soweit.
Meine erste Buchmesse. Leipzig. Im zeitigen Frühjahr.
Aber es gab Enttäuschungen in Hülle und Fülle. Es fing schon mit dem Parkplatz an. Weit weg vom Messegelände. Fußmarsch über Betonwege und durch künstlich wirkende Grünanlagen. Es regnete, dann graupelte es, ein fürchterlicher Wind pfiff. Mit mir liefen andere Messebesucher. Die Mäntel geschlossen, die Schirme aufgespannt, die Nasen in die Schals vergraben.
Dann das große Messehaus. Eine riesige Empfangshalle mit Schaltern wie auf einem Flughafen. Stimmengewirr. Werbeplakate. Ziemliche Schlangen vor jedem Schalter. Moertel hatte mir eine Besucherkarte hinterlegen wollen. Das war schief gegangen. Keiner wusste was. Ich musste eine Tageskarte kaufen. Kostete ein Heidengeld. Fast zwanzig Euro.
Ich entwertete die Karte, stieg die breite große Empfangstreppe hinauf. Mit mir Dutzende, Hunderte Besucher. Ich hatte ein Messe-Programm und einen Messeführer erworben. Bunte Grafiken mit kleinen Zahlen, hinten eine Legende, die erklärte, wer sich hinter den Zahlen verbarg. Der Tenne-Verlag hatte seinen Stand in der Messehalle III, Gang C, Messestand 231.
Ich kam in die sogenannte Glashalle, einem Werbetempel für Radio- und Fernsehstationen. Die Glashalle ist eine Art Drehscheibe, ein Verschiebebahnhof, von dem aus es über diverse Glasröhren in die verschiedenen Messehallen geht.
Diese verschiedenen, ich will sie Parkbuchten nennen, Radiostände ähnelten sich zum Verwechseln. Oben das Logo der Sendeanstalt, hinten eine verschieden farbige Trennwand, mit Großfotografien der jeweiligen literarischen Stars geschmückt, dann die obligate Couch, mal in Blau, mal in Grün oder Rot, sogar in Gelb. Diese Farbunterschiede waren das einzig Verschiedene zwischen den jeweiligen Anstalten. Vor dem Podium Stuhlreihen. Billigstes Plastikgestühl. Meist in Schwarz, die Polsterung allerdings in den jeweiligen Anstaltsfarben. Die Sendungen wurden häufig live ausgestrahlt. Kein Wunder, dass sich schon Minuten, manchmal eine halbe Stunde vor dem Beginn, Besucher und Neugierige einfanden. Eine Live-Sendung. Da wollte man dabei sein. Vielleicht würden die Lieben daheim einen am Klatschen erkennen.
Ich ging an mehreren dieser Radio- und Fernsehstände vorbei, natürlich stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn ich selber mal da oben sitzen würde, aber dann wandte mich ab, frustriert und leicht ärgerlich, und strebte gemäß den Hinweisschildern der Halle III zu.
Die Halle war riesig, die Luft abscheulich, der Menschenstrom unerträglich. Wie in einem riesigen Supermarkt für Bücher. Einem Ameisenhaufen nicht unähnlich, Besucher wie die Ameisen, Bücher wie die gesammelten Holzstückchen des Waldes. Verkäufer zu beiden Seiten der Gänge in kleinen, ja winzigen Sperrholzkabinetten. Das alles erinnerte an einen Basar im Orient. Eifrig hatten die Verlage ihre Bücher in Regalen aufgereiht, in Pyramiden gestapelt, meist nur wenige und immer dieselben Titel. Die aber in einer verwirrenden Unzahl.
Wiewohl die Verlagsstände klein und eng, hatte man dennoch für Tische und Stühle gesorgt, für Kaffeemaschinen, für Kaffeetassen und Löffel, für Stapel von Prospekten und Visitenkarten.
Ich schritt die Gänge entlang, auf der Suche nach dem Stand des Tenne-Verlages. Endlich fand ich ihn. Es war ein sogenannter Eckstand, also nach zwei Seiten offen. Ein wenig teurer als die Nachbarstände – Ruprecht Schwarz erklärte mir die Vor- und Nachteile, nannte den Preis. Ganz schön happig! sagte ich. Gewiss, entgegnete Schwarz, aber mit dem Vorteil, den Eckstände nun einmal haben. Man wird von zwei Seiten wahrgenommen.
Moertel empfing mich mit einer effektvollen Geste. Er hob die Arme zum Himmel wie ein Prophet und rief ziemlich laut:
Da ist er ja, unsere neue Hoffnung! Schauen Sie, hier ist Ihr Buch! Und er griff hinter sich und holte ein schmales Büchlein von einem Stapel. Ich hatte es noch nicht zu Gesicht bekommen. Erst Stunden vor Eröffnung der Buchmesse war es aus dem Druck gekommen. Ich nahm es in die Hand.
Mein erstes Buch!
Ein unbekanntes Glücksgefühl durchströmte mich. Ich drehte es hin und her, betrachtete das schmale Exemplar. Ja, das Cover sah ansprechend aus. Ich nickte zufrieden. Es war so geworden wie ich es mit dem Grafiker Jürgen Frühauf – einem der vielen Dresdner Grafiker, ein im Grunde armer Schlucker, der sich von Auftrag zu Auftrag hangelt – besprochen hatte. Gulm-Notteck, der Buchhändler mit seinen – wie es mir damals schien – tausendundzahllosen Verbindungen hatte mich mit dem Grafiker bekannt gemacht. Gulm-Notteck gestaltete seinen abgelegenen Laden immer mit verschiedenen Ausstellungen Dresdner Bildender Künstler aus und wertete ihn und sich selber auf diese Weise auf. Offenbar hielt er sich für eine Art Kunst-Mäzen. Irgendwann war der Grafiker Frühauf an der Reihe gewesen. Er hatte eine Reihe von Radierungen ausgestellt. Durchaus sehenswerte Bilder darunter. Er kam hin und wieder vorbei, um mit dem Buchhändler zu reden und die Erlöse aus dem Verkauf seiner Werke zu kassieren, denn die ausgestellten Bilder waren, was den Reiz der Ausstellungen ausmachte, zu durchaus erschwinglichen Preisen verkäuflich. Bei einem solchen Besuch hatte der emsige Buchhändler mir den Grafiker Frühauf vorgestellt. Eine Bekanntschaft entwickelte sich. Ich besuchte ihn in seinem Atelier, lernte seine Freundin Mia kennen. Eine etwas überspannte Person, von der ich zuweilen glaubte, sie fühle sich in der Dresdner Neustadt wie auf dem Montmartre und sie bilde sich ein, sie sei eine Freundin von Modigliani: strohblond, die Frisur ewig strähnig, ohne erkennbare Fasson oder Schnitt, sehr blass, abgemagert, in seltsamen, durchweg schwarzen Kleidern, mit übermäßig schwarz bemalten Lidern wie Asta Nielsen; eine Eule, dachte ich, mit gelben dünnen Fingern, ewig rauchend. Ich war so leichtsinnig und hatte ihr einmal ein Manuskript von mir gegeben. Es war ein Roman über einen Muttermord. Nach Wochen erhielt ich ihn zurück, mit einer Unmenge Anmerkungen und Ergänzungen, die genug Stoff für einen neuen Roman ergeben hätten…
Jedenfalls, der Künstler Frühauf war von meinem Text, der in der Tenne erscheinen sollte, begeistert und, ohne dass ich ihn beauftragt hätte, hatte er in wenigen Tagen ein Cover entworfen, eine Radierung, die meinen Text, vielleicht ohne dass er es gewollt hatte, ganz und gar passend satirisch ergänzte.
Später, als er erfuhr, mein Text hätte die Dresdner Bildungsbürger, besonders die Musiker der Staatskapelle, verärgert, wollte er, weil er, wie er sagte, ein paar solvente Kunden unter den Mitgliedern der Kapelle hätte, aussteigen und das Cover zurückziehen. Aber da war es schon zu spät – die Grafik war als Titelbild gedruckt. Schade, unsere Bekanntschaft litt darunter. Frühauf schämte sich seiner eigenen Grafik, schämte sich vor seinen zahlenden Kapellen-Kunden. Und seine Freundin heizte ihm kräftig ein. Seit sie mein Manuskript gelesen hatte, konnte sie mich nicht mehr leiden. Schade. Ich habe beide seither nicht mehr wiedergesehen.
Also, das Büchlein lag gut in der Hand, die Titelgrafik gefiel mir. Ich gab das Buch dem Moertel zurück. Gut geworden, sagte ich, wirklich gut. Moertel strahlte. Wie viel haben Sie denn nun gedruckt? wagte ich zu fragen.
Ach, das ist nur ein Probedruck von 20 Exemplaren, damit wir hier etwas vorzeigen können. Wir werden 500 Stück machen.
500 Stück! Mein Gott, dachte ich, viel Lärm um nichts.
Wollen Sie einen Kaffee? Moertel tat großspurig, er fühlte sich an seinem Stand wie ein Gastgeber. Schwarz hatte sich entschuldigt. Er wolle sich mal umgucken, hatte er gesagt und war verschwunden.
Später erfuhr ich, dass er unter Platzangst litt. Die Messehalle machte ihm Panik, er musste ab und zu an die frische Luft. Sein Wort vom „Umgucken“ war eine Notlüge.
So saß ich da, trank meinen Kaffee. Er schmeckte sogar. Von der missglückten Hinterlegung der Freikarte sage ich nichts.
Ich mochte vielleicht 10 Minuten gesessen haben, ich hatte die vorbeiziehenden Besucher betrachtet, einige waren am Stand des Tenne-Verlages sogar stehen geblieben. Moertel hatte Auskünfte gegeben. Mein Herz klopfte. Wenn sie sich nun nach mir und meinem ausgelegten Buch erkundigten? dachte ich. Ich legte mir ein paar Sätze zurecht. Aber es fragte keiner nach mir und es hatte auch keiner mein Buch in die Hand genommen. Auf einmal löste sich eine junge Frau aus dem Besucherstrom. Sie trat an „unseren“ Stand und es stellte sich heraus, dass sie den Moertel kannte.
Moertel wandte sich zu mir und rief: Darf ich Ihnen Erdmute van Hersteen vorstellen. Erschrecken Sie nicht vor dem Namen, wir nennen sie alle nur die „Erdi“, sie ist eine bekannte und veritable Dichterin.
Die Dichterin lächelte, sie gab mir die Hand. Sie hatte eine kleine, feste Hand und große hellblaue Augen. Diese funkelten und glänzten, standen ein wenig vor, so wie man es von Schilddrüsen-Erkrankten kennt. Die „Erdi“ hatte brandrote Haare, die sie kurz fast wie ein Mann geschnitten trug. Diese Haare und die Augen waren es, was einem im Gedächtnis blieb, was auffiel und sie von anderen unterschied. Natürlich hatte ich noch nichts von ihr gelesen. Und ich bin ja, was Lyrik und Gedichte angeht, bis heute ziemlich voreingenommen und ablehnend. Der Buchhändler Gulm-Notteck hatte ein paar Mal von Erdmute van Hersteen gesprochen und sie als eine Dichterin mit einem besonders kritischen Geist beschrieben. Ihre scharfe Zunge sei gefürchtet. Sie mache auch vor Kollegen nicht halt. Ich fragte, ob sie (wegen des Namens) Holländerin sei. Da antwortete der Buchhändler mit dem Zitat eines bekannten Dresdner Kolumnisten, der einmal, auf die Dichterin van Hersteen angesprochen, gekalauert hatte, die van Hersteen wäre so wenig Holländerin wie die Carla Bruni Französin sei…
Sie hielt meine Hand noch in ihren Händen, da sagte sie: Ach Sie sind das neue Wunderkind von Herrn Moertel? Der uns allen das fürchten lehren wird, wie Herr Moertel sagt… sie kicherte, schaute mich herausfordernd an.
Ich blieb stumm, wahrscheinlich bin ich sogar rot geworden.
Die Dichterin fuhr fort: Na, ich hab mal ein bisschen in Ihrem Büchlein herumgelesen… Also, wirklich, Herr Malef, dies muss ich sagen, Ihr Text hat Sprachwitz und ist originell… vielleicht schreib ich mal ´ne Rezension… indes, sie drohte mir mit dem Finger, was Sie da über die Dresdner Musikszene geschrieben haben, das wird Ihnen nicht nur Freunde machen… das ist schon ziemlich starker Tobak. Man wird sie mit den Fiedelbögen aus der Stadt treiben… ha, ha, ha. Sie lachte, kramte in ihrer Handtasche, besann sich aber und schimpfte: So ein Mist, dass man hier nicht rauchen kann! Sie setzte sich auf einen der Plastikstühle, verlangte einen Kaffee, schlug die Beine übereinander.
Vielleicht hatte sie erwartet, dass ich mich mit ihr über ihr neuestes Buch unterhalten werde, welches ebenfalls im Tenne-Verlag erschienen war, ein Lyrikbändchen mit dem seltsamen Titel „Die Erotik des Versagens“, denn sie hatte das Buch aus dem Regal gezogen und es sich demonstrativ auf das nackte Knie gelegt; aber erstens kannte ich das Buch nicht und über Lyrik, was hätte ich da schon sagen können, und zweitens war just in diesem Augenblick ein weiterer Gast am Stand des Verlages erschienen. Alle Köpfe wandten sich ihm zu. Es war ein bärtiger Typ vom Schlage des Wundermönchs Rasputin, mit lässiger Bekleidung und in Sandalen (immerhin, es war März, draußen lagen noch Schnee), mit einer schmuddeligen Lederaktentasche, die zu allem Unglück schief zugeschnallt war und so den Eindruck des Existenzialistischen, alle Menschenordnung verachtenden Sonderlings, verstärkte. Später stellte sich heraus, dieser Mann war durchaus kein Existenzialist, er war pedantisch, penibel und akkurat in seinem Schreiben, er hieß Lars Freudenthaler. Ein in Dresdens Dichterkreisen bekannter Mann, der, wiewohl an Jahren jünger, mir weit voraus war, und schon eine Handvoll Romane und Erzählungen veröffentlicht hatte. Natürlich, ich war wahrscheinlich der einzige am Stand des Tenne-Verlages, der diesen Kerl und sein Werk nicht kannte. Er wirkte auf den ersten Blick ein wenig knurrig und abweisend, schlecht gelaunt, aber er war ein loyaler Typ mit einer tüchtigen Portion eigenwilligen Humors und Ironie, die er besonders versprühte, wenn es gegen andere Kollegen ging. Er hat mich später viele Male verhöhnt und ich musste es mir zähneknirschend gefallen lassen. Einmal, das war viele Monate nach unserer ersten Begegnung auf der Buchmesse, war ich zu einer Lesung von ihm gegangen, die er in dem historischen Elbkirchlein „Marie am Wasser“ in Hosterwitz abhielt. Ich staunte, welchen Zuspruch er hatte. Die Kirche war gut gefüllt. Hinterher trat ich an einen kleinen Tisch, wo er Autorenexemplare signierte. Die Zuhörer standen in langer Schlange an. Er schaute auf, lächelte mich an und sagte: So eine Kirche wirst du nie voll kriegen, mein Lieber, und wenn du noch so viele Bücher schreibst… auch später hat er immer wieder abfällige Bemerkungen zu meinen Texten und Büchern gemacht, sie waren umso heftiger, je bekannter und erfolgreicher ich wurde. Ein typischer Schriftsteller also, der dem anderen nicht die Druckerschwärze auf dem Papier gönnt. Schriftsteller sind Neidhammel. Alles erträgt ein Schriftsteller, nur nicht den Erfolg eines Kollegen. Dieser Neid lässt nur mit der Bekanntheit und Größe des Kollegen nach. Da verbeißt man es sich. Kollegen auf Augenhöhe sind ein regelrechtes Feindbild… so wie sich Hunde auf der Straße gegenseitig heftig anknurren und anbellen, wenn sie ungefähr gleich groß sind.
Doch davon wusste ich damals auf der Buchmesse noch nichts. Ich wunderte mich nur, dass Freudenthaler es vermied, mir die Hand zu geben oder mir gerade in die Augen zu blicken. Aber vorerst, auch durch den Messetrubel abgelenkt, achtete ich nicht weiter darauf. Also, mit Freudenthaler und mir kam kein Gespräch zustande. Das war auch nicht weiter schlimm, denn der Stand des Tenne-Verlages war auf einmal umlagert. In den letzten Minuten waren immer mehr Leute am Stand stehen geblieben. Viele kannten Volker Moertel oder auch die van Hersteen oder den Freudenthaler. Man unterhielt sich, lachte, trank Kaffee. Moertels Assistentin – irgendeine Blondine aus seinem umfangreichern weiblichen Bekanntenkreis – ließ schon die vierte oder fünfte Maschine durchlaufen, die Tassen reichten nicht und musste gespült oder vom Nachbarstand ausgeborgt werden.
Auf einmal erscholl der Ruf von Ruprecht Schwarz, der wieder zurückgekehrt war: Seht mal, wen ich euch hier mitgebracht habe!
Er hatte das laut und an alle gerichtet, besonders natürlich zu Moertel und den Autoren, ausgerufen. Er zog einen weißhaarigen mittelgroßen Mann in die Mitte des Kreises.
Schwarz ergänzte laut und lachend: Ich ging im Strome der Menschen so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn… und plötzlich, Leute, traf ich ihn… na, wen?
Ein paar der Umstehenden murmelten einen Namen, tuschelten, lachten, stießen sich an. Schwarz, das Gemurmel aufgreifend, rief mit lauter Stimme:
Ja, liebe Leute, ich fand ihn, den Großen, den einmaligen sächsischen Literaturpapst… unseren hochverehrten Eberhardt Hochleitner… Beifall! Beifall!
Tatsächlich, es klatschten ein paar in die Hände. Zwei oder drei Stimmen ließen sogar ein „Hoch! Hoch!“ hören.
Der so Bejubelte lächelte verlegen, hob die Hände. Das sei zu viel der Ehre! Nein, er bitte um weniger Aufsehen. Er hatte das leise und mit heiserer Stimme gesagt. Dabei kannte jeder – auch ich - seine Radiostimme. Die klang sonor und schwingend, manche Frau soll dabei schon ins Schwärmen gekommen sein. Er war Literaturredakteur beim mitteldeutschen Kultursender „Rossini“. Dort hatte er feste Sendeplätze. Außerdem rezensierte er in verschiedenen Tageszeitungen, trat in literarischen Talkshows auf, hatte einen literarischen Talentewettbewerb ins Leben gerufen. Kurz, er war in wenigen Jahren eine Institution geworden. Dabei hatte er auch beträchtliche Schwierigkeiten zu überwinden gehabt. So war offenbar geworden, dass er als Student in Leipzig für die Staatssicherheit spioniert hatte. Er, wegen seines Vaters halb Südtiroler und mit einem Südtirolischen Pass versehen, hatte sich als informeller Mitarbeiter anwerben lassen. Sie hatten ihm alles Mögliche vorgemacht, ihn mit Auslandseinsätzen und hohen Prämien geködert, und Hochleitner, damals als Student schon Kandidat der SED, im Grunde dem System und dem Sozialismus ohne Vorbehalte treu ergeben, ließ sich ködern. Er hatte eine Schwäche – das war das Geld. Zeitlebens hing er am Gelde wie kaum ein anderer…
Woher ich das alles weiß?
Nun, zum einen hatte viel in den Zeitungen gestanden, auch im Internet, besonders nachdem im Zuge der Evaluierung der Mitteldeutschen Rundfunkanstalt Hochleitners Engagement mit dem DDR-Geheimdienst öffentlich geworden war; zum anderen hatte er mir selber davon einiges erzählt. Das war, als wir uns näher kennen gelernt und ich, weil zur selben Zeit Student in Leipzig wie Hochleitner, vorgetäuscht hatte, über seine Zuträgertätigkeit Näheres zu wissen. Freilich war das gelogen, denn ich wusste nichts, aber ich hatte mir gedacht, um in näheren Kontakt mit diesem wichtigen Rundfunkmann zu kommen, könne es nicht schaden, seine Neugier zu beleben. Denn Hochleitner war zu dieser Zeit in geradezu panischer Manier darauf versessen, mit Leuten zu reden und in Kontakt zu kommen, von denen er meinte, sie wüssten etwas aus seiner Vergangenheit. Ich gebe zu, keine feine Art von mir, aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Ich musste diese Chance nutzen, wenn ich im Literaturbetrieb eine Stufe höher kommen wollte… und Leute, die Praxis gab mir Recht: Es gelang… doch, von alldem später, wenn es in meiner Erzählung chronologisch an der Reihe ist.
Damals zur Frühjahrsbuchmesse in Leipzig wusste ich von alldem nichts, ich staunte nur den berühmten Hochleitner an, beobachtete ihn, studierte seine Mimik, seine Gesten, lauschte seiner Stimme, von der ich später einmal in einer Rezension als dem Klang eines Cellos vergleichbar schwadronieren würde. Freilich, das war eine ungeheure Speichelleckerei, aber irgendwie stimmte es auch. Denn es war wahr, er hatte eine wunderbare Stimme, ein Geschenk der Natur, so wie Frank Sinatra mit einer einmaligen Stimme ausgezeichnet war oder Manfred Krug oder Walter Niklaus oder andere, eine Gabe, die ihn hervorhob, ohne dass er zunächst irgendetwas Besonders leisten musste. Nur einfach, indem er redete, egal was, einfach nur reden…
Sofort hatte sich um Eberhardt Hochleitner am Stand des Tenne-Verlages, wo er nun eingetroffen war, ein Kreis von Verehrerinnen und Bewunderern gebildet.
Ich stand ebenfalls dabei und überlegte angestrengt, wie ich es anstellen könnte, von ihm bemerkt und angesprochen zu werden. Ich fühlte, dass ich dieses Mannes bedürfe, um einen guten Schritt voranzukommen auf meiner kaum begonnenen Schriftstellerllaufbahn. Und tatsächlich, wie es im Leben häufig geht, der Zufall kam mir zu Hilfe oder besser Moertels Talent und seine Sucht sich in den Mittelpunkt zu spielen. Es war klar und vollkommen natürlich, Moertel wollte seine Neuerscheinungen anpreisen. Und wenn der Autor, wie in meinem Fall, zufällig zur Hand wäre, gleich den ganzen Autor als Zugabe dazu. Ein solch bekannter Radiomann an seinem Stand. Das musste genutzt werden. Später erfuhr ich, Hochleitner war zwar von Schwarz angesprochen worden, mit zum Stand des Tenne-Verlages zu kommen, aber die erste Frage des Berühmten an Schwarz war nicht etwa nach dem Tenne-Verlag, sondern, ob denn Frau van Hersteen auch schon anwesend wäre. Und, als Schwarz dies bejahte, lächelte Hochleitner und rief: Na, dann wollen wir mal!“
Hochleitner war, wiewohl von seinem Äußeren nicht unbedingt ein Frauentyp, allem Weiblichen besonders zugetan. Er wusste, es waren vor allem Frauen, die ihn und seine Stimme liebten, die sich besonders durch den Klang und das Tempre erotisch stimuliert fühlten. Und so suchte er Frauenkontakte, wo sie sich ergaben, nicht unbedingt eines Abenteuers wegen, nein, er wollte geliebt und verehrt werden. Er wollte sich in seiner Berühmtheit sonnen. Frauen waren sein Spiegel, vor dem sich seine Eitelkeit hin und her drehen konnte. Und dies liebte Eberhardt Hochleitner über alles. Gut, er hatte auch zwei oder drei (ich wusste es nicht so genau) gescheiterte Ehen hinter sich, musste Alimente für ein halbes Dutzend Kinder zahlen – woher sich auch neben seiner Wettleidenschaft beim Pferderennen sein enormer Geldbedarf erklärte - und er lebte mit einer viel Jüngeren und der gemeinsamen Tochter zusammen. Aber sonst war er durchaus nicht der stürmische Don Juan, nein, er war eher der leise Genießer… ich werde noch mehr von ihm zu berichten haben, denn er hat in meinem Schriftstellerleben eine ziemliche Rolle gespielt.
Moertel also zog den Hochleitner am Ärmel und wies auf mich, sagte: Sehen Sie, Verehrtester, hier haben wir unseren neuen Bestsellerautor, Franz Malef. Gerade haben wir sein neues Buch herausgebracht. Ein bemerkenswertes Büchlein. Vielleicht lesen Sie mal selbst!
Und Moertel drückte Hochleitner mein „Kammerkonzert“ in die Hand. Der nahm das Buch, schaute auf das Titelbild, zog die Augenbrauen hoch, murmelte irgendwas. Moertel zog weiter an Hochleitners Ärmel und schob ihn zu mir. Er musste dabei sogar ein wenig sanfte Gewalt anwenden, denn der große Radiomann war im intensiven Gespräch mit Erdmute van Hersteen gewesen, er hatte ihren nackten Unterarm gehalten, sich zu ihr geneigt, ihr ins Ohr geflüstert. Die van Hersteen hatte dazu gelächelt. Und die Dichterin verfügte über ein ganz bezauberndes Lächeln. Sie hatte ganz reizende kleine Fältchen um den Augen und zwei noch reizendere Grübchen, links und rechts des Mundes. Aus den Augenwinkeln hatte sie beobachtet, das hatte ich gesehen, ob ihre Intimität mit dem großen Literaturmann auch genügend bemerkt und gewürdigt würde. Beinahe ein wenig unwillig entließ sie Hochleitner, schaute stirnrunzelnd zu mir herüber.
Hochleitner trat vor mich hin, reichte mir die Hand.
Ich freue mich, Herr Malef, freue mich über jeden neuen Autor, den wir in Sachsen entdecken.
Ich reichte ihm die Hand, machte sogar eine leichte Verbeugung. Seine Hand war groß, breit und warm. Man fühlte sich in dieser Hand geborgen, vielleicht sogar ein wenig gefangen.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, entgegnete ich artig, einem so bekannten Mann der Literatur zu begegnen, das ist mir eine Freude, zugleich einer Ehre… ich machte eine kleine Pause, fragte:
Sie haben auch in Leipzig studiert, hörte ich? Genau wie ich… und ich fügte die Jahreszahlen an, von 66 bis 71.
Aha, sprach Hochleitner, das ist ja interessant…
Ich sah wie seine Augen sich verdunkelten und auf der Stirn ein blasser Streifen erschien.
Wenn ich wiedermal in Dresden bin, sprach er weiter, sollten wir uns treffen, vielleicht hab ich bis dahin auch ihr Buch – er klopfte mit dem Knöchel auf das Titelblatt – gelesen. Dann können wir reden, über die Zukunft und über die Vergangenheit… Einverstanden?
Hochleitner hatte mir bei seinen letzten Worten tief und ernst in die Augen geblickt, dann hatte er sich abgewendet, den Arm grüßend gehoben und war wieder zu Erdmute van Hersteen getreten.
Ich habe dann mit Eberhardt Hochleitner auf der Buchmesse kein weiteres Gespräch gehabt. Es ergab sich nicht.
Die nächste Begegnung mit ihm fand fast zwei Wochen später statt. In Dresden und zwar im sogenannten Rudolf-Plattner-Haus – das war weit vor dem Krieg der Wohnsitz des bekannten Dresdner Autors Rudolf Plattner gewesen. Es beherbergte seit zwei oder drei Jahren einen Literaturzirkel, welcher als amtlich eingetragener Verein Lesungen und verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen organisierte – da sollte die Buchpremiere meines Tenne-Buches „Kammerkonzert“ stattfinden. Ich war aufgeregt, nachts lag ich wach, meine Nerven flatterten, ich hatte ja noch nie vor Publikum öffentlich gelesen. Aber es war unumgänglich. Es musste sein. Moertel sprach mit mir, fragte, ob ich jemanden kenne, der die Moderation übernehmen könne. Mir fiel niemand ein. Wen kannte ich damals schon, der so etwas machen würde, einen, der bekannt, berühmt und geachtet wäre. Da schlug der Moertel den Eberhardt Hochleitner vor. Ich hätte mich doch mit ihm zur Buchmesse so angeregt unterhalten und inzwischen habe er außerdem erfahren, dass Hochleitner von meinem Buch sehr angetan wäre. Rufen Sie ihn doch einfach mal an. Das macht sich besser, als wenn der Verlag sozusagen hochoffiziell anfragt. Außerdem, Moertel wurde verlegen und ergänzte leise, wenn ich ihn der Autor fragt, werde das Honorar vielleicht nicht so hoch ausfallen oder er mache es sogar umsonst. Aus neuer Freundschaft, sozusagen…
Gut, sagte ich, ich versuch´s…
Hochleitner hatte mir seine Visitenkarte zugesteckt. Für alle Fälle, hatte er gesagt und gelächelt, wenn mal was wäre, wenn ich eine interessante Information hätte… Klar, hatte ich geantwortet, und vielen Dank.
Also rief ich ihn am anderen Tage an.
Nein, er hat nicht nach dem Honorar gefragt. Er hatte mein Buch gelesen und schien davon angetan. Wenn er nach Dresden käme, sagte er, würde er vor der Premiere mit mir kurz reden wollen. Dann könnten wir auch, sprach er weiter, vielleicht am nächsten Tag – er bliebe noch 2 Tage in Dresden – uns noch einmal treffen und über alles andere reden… er sagte nicht, was er mit „alles andere“ meinte, aber ich wusste, er würde wissen wollen, was ich über ihn aus seiner Leipziger Studentenzeit wisse. Und ich hoffte, ich könnte ihn für weitere Text von mir begeistern. Nach dem „Kammerkonzert“ hatte ich eifrig weiter geschrieben. Mir war die Idee gekommen, ich müsste über Musik schreiben. Mein Buchhändler hatte mir geraten nach einem Kernthema, nach einem Alleinstellungsmerkmal für mein Schreiben zu suchen. Ich hatte nachgedacht und war auf die Musik gekommen. Da kannte ich mich ein wenig aus. Mein Bruder war Konzertmeister im Gewandhausorchester, meine Schwester spielte Violine in der Dresdner Staatskapelle. Meine ganze Kindheit und Jugend hindurch war ich von Musik umgeben. Es fiedelte in allen Räumen, es wurde über nichts anderes gesprochen als über Musik. Auch über die Schrullen, an welchen die Musiker litten. Natürlich spielte auch ich ein Instrument – Klavier. Aber ich hatte wenig Neigung zum Üben, lieber las ich oder zeichnete. Oft gab es Tränen, wenn ich wieder durch