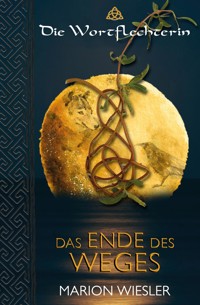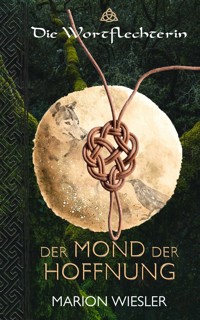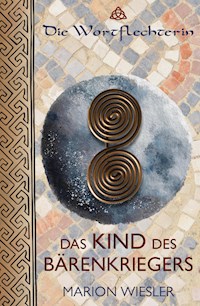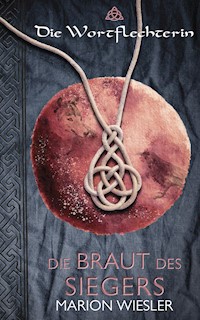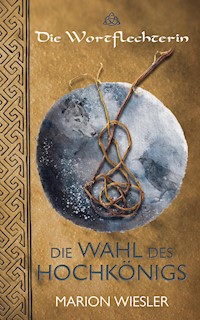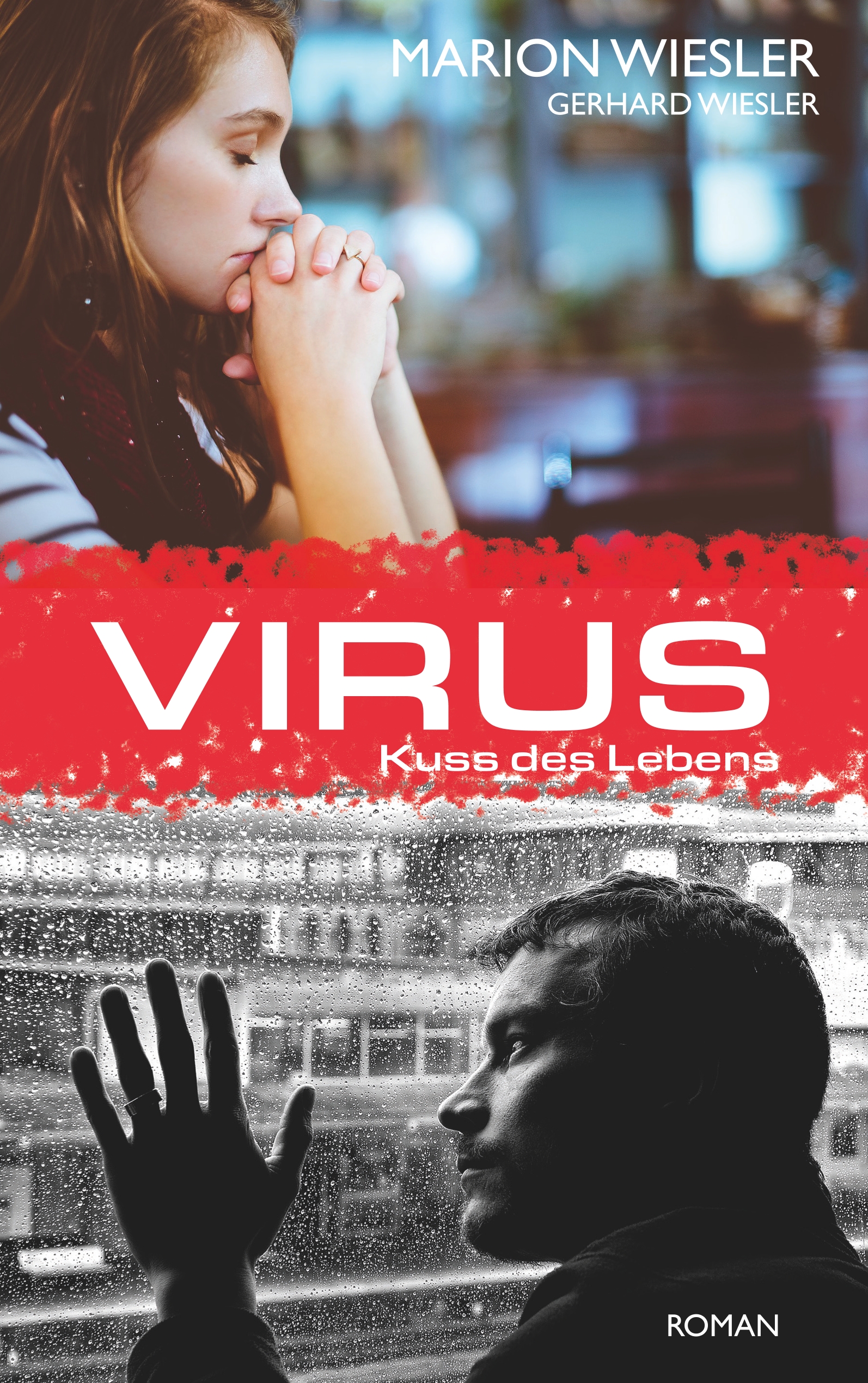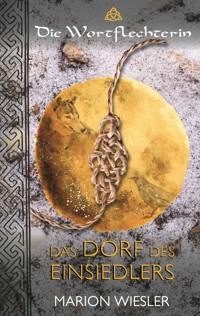
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helvetien, 39 v.Chr. Es lastet ein grausames Gebot auf der Bardin Arduinna. Nur durch ihre ständige Wanderschaft kann sie den Mann schützen, den sie liebt. Getrieben von der Hoffnung, das Gebot zu lösen und zu ihm zurückkehren zu können, gelangt die Bardin mit ihren außergewöhnlichen Begleitern, einem Wolfshund und einem Raben, in die eisigen Berge. Dort trifft sie auf einen wortkargen Einsiedler, der eine noch größere Last als sie zu tragen scheint. Durch die Macht ihrer Geschichten und ihre Hingabe hofft sie, sein Herz zu befreien, aber damit nähern sie sich beide möglicherweise dem Untergang. Ein Kurzband der Keltenroman-Serie "Die Wortflechterin". Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Herzschlag jener Zeit in dir!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marion Wiesler
Das Dorf des Einsiedlers
Ein Kurzband der Keltenroman-Serie "Die Wortflechterin"
Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Herzschlag jener Zeit in dirInhaltsverzeichnis
Ich bin Arduinna
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Kapitel 1: Der achte Winter des Fluches
Kapitel 2: Die Fremde
Kapitel 3: Der Unterstand
Kapitel 4: Morgentanz
Kapitel 5: Nachts
Kapitel 6: Eine Geschichte
Kapitel 7: Eine erstaunliche Bitte
Kapitel 8: Milch
Kapitel 9: Die Ziege
Kapitel 10: Das Geständnis
Kapitel 11: Ein eiskaltes Bad
Kapitel 12: Gespräch am Morgen
Kapitel 13: Die Felsen
Kapitel 14: Im Wald
Kapitel 15: Die beiden Alten
Kapitel 16: Ins Dorf
Kapitel 17: Anders als erwartet
Kapitel 18: Heimkehr
Kapitel 19: Abschied
HINTERGRÜNDE ZUR SERIE
GLOSSAR
Marion Wiesler
Impressum
Marion Wiesler
Die Wortflechterin
Das Dorf des Einsiedlers
Kurzband
Ich bin Arduinna
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Prequel)
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Das Kind des Bärenkriegers
Der Mond der Hoffnung
Das Ende des Weges
Der unabhängige Kurzband
Das Dorf des Einsiedlers
spielt im Winter vor
Die Wahl des Hochkönigs
marionwiesler.at
Kapitel 1: Der achte Winter des Fluches
Schön hatten die Berge ausgesehen, als ich ihnen nahe kam. Wie so vieles, wenn man es nur aus der Ferne betrachtete.
Ich fluchte. Es gab keinen Weg hier, nur Felsen und Steine. Und Schnee. Eisigen Schnee, der durch den Regen rutschig wurde. Doch dies war die Richtung gewesen, die mir die Götter am Morgen gewiesen hatten. Weiter hinauf. Dorthin, wo es keine Bäume mehr gab, keinen Schutz oder Unterschlupf. Ich hasste die Götter. Ich hasste den Regen, den Schnee und die Kälte. Und ich hasste den Fluch, der mich zwang, seit bald mehr als zwei-mal-vier Jahren unterwegs zu sein.
Cú trottete mit gesenktem Kopf neben mir, Wasser lief sein struppiges Fell hinab. Rannte der Hund sonst immer ein Stück voraus, um den Weg zu erkunden, an diesem Morgen hielt er sich nahe bei seiner Herrin. Ebenso wie die Rabin Branna, die mit eingezogenem Kopf auf meiner Schulter saß und beleidigt krächzte, wenn meine Füße den Halt verloren und ich mich ruckartig mit meinem Haselstab abstützen musste.
Mehr als einmal war ich versucht zu sagen: »Dann flieg doch!« Aber selbst dazu fehlte mir die Kraft, all meine Aufmerksamkeit musste ich auf das Weiterkommen legen.
Der Tag hatte sich noch nicht seiner Mitte zugehoben und bereits jetzt machte ich mir Sorgen, wo wir heute Nacht schlafen sollten. Noch nie war ich so hoch in den Bergen gewesen, dass es keine Bäume mehr gab, unter denen man Schutz fand. Kein Holz, mit dem ich ein Feuer machen könnte, um mich zu wärmen. Die Anstrengung trieb mir den Schweiß ins Gesicht, das Wetter ein Frösteln über den ganzen Körper. Ich trug alles, was ich an Gewand besaß. Stiefel, die ich aus Hasenfell genäht hatte – nicht besonders schön, aber immerhin warm. Nadelgebundene Fußlinge, die mir eine Bäuerin für eine Geschichte geschenkt hatte. Unter meiner Camisia und dem Peplos meine Braccae und darüber die Braccae des toten Mannes, über den ich vor ein paar Tagen weiter unten im Wald gestolpert war. Noch immer haftete den Beinkleidern schwach der Geruch der beginnenden Verwesung an, aber die Wärme der dick gewebten Wolle war ein Segen. Über all dem dann noch mein Umhang, den ich mir im Laufe des Winters aus den Fellen erlegter Tiere genäht hatte und der nun regengetränkt immer schwerer wurde. Sogar eine Haube aus Leder und gefilzte, wenn auch löchrige Handstrümpfe aus Wolle hatte der Tote besessen. Beides leistete nun mir gute Dienste. Ich dachte oft an den Toten. Alt war er gewesen, mager und faltig. Ich fragte mich, ob er wohl im Winter erfroren war und nun, wo weiter talwärts der Frühling begann, langsam auftaute. Erstaunlich wenig Tiere hatten ihn bis jetzt angenagt.
Ich riss meine Gedanken wieder zu den Steinen, die rutschig unter dem vereisten Schnee zu meinen Füßen lagen.
Die kalten Monde waren selbst weiter unten im Tal eine Herausforderung, doch zumindest hatte ich immer genügend Holz für ein wärmendes Feuer und oft auch eine Höhle gefunden. Es war der härteste Winter, den ich je erlebt hatte. Oft war ich tagelang im eisigen Schlechtwetter festgesessen und hatte mich von Moosen, Flechten und Rinden ernährt. Hatte meinen Unterstand mit Schnee abgedichtet und mein Ende kommen sehen. In meiner Heimat gab es so gut wie nie solch eisige Kälte und auf all den Jahren meiner Wanderschaft war ich fast immer in der Nähe des Meeres gewesen, wo es selten so kalt wurde. Mit Sehnsucht dachte ich an den Winter, den ich ganz im Süden verbracht hatte, in jenem Gebiet, das nun den Römern gehörte und das sie Gallia Transalpina nannten. Herrlich warm war es dort selbst nach der Wintersonnwend gewesen. Gewiss, ich hatte dort schlimme Dinge gesehen, aber im Augenblick würde ich jede Gemeinheit der Römer gerne gegen diese schneidende Kälte eintauschen.
Ich sehnte mich nach der Heimat meiner Kindheit zurück wie noch nie. Ich sollte nun die Geschichten der Gallier den Silurern vortragen, um dieses Wissen am Leben zu erhalten, sollte mich darin üben, Lieder über die Barden und Druiden zu formen, die der Macht der Römer zu Opfer gefallen waren, nicht hier in den hohen Bergen durch Eis und Schnee stapfen auf der Suche nach einem Ziel, das die Götter jeden Morgen vor meiner Nase baumeln ließen wie der Bauer eine Rübe vor dem störrischen Gaul.
Wenn mein Maistir Tegid gewusst hätte, dass jene Reise zu den Carnuten sein Tod war, wenn er geahnt hätte, was weiter mit seinem Schützling geschah, hätte er wohl den Weg über das schmale Meer angetreten? Ja, hätte er, dachte ich bitter, während ich mir den Regen aus dem Gesicht wischte und den Umhang enger um die Schultern zog. Er hatte damals die Götter durch den Druiden befragen lassen und die Götter hatten uns losgeschickt. Und die Götter schickten mich nun jeden Morgen auf meinen Weg, und diesen Winter eben hier in die lebensfeindlichen Berge. Es hatte keinen Sinn, darüber zu jammern. Nun war ich hier und sich darüber zu beklagen, machte es nicht besser.
Cú winselte leicht, sah mich mit einem beleidigten Blick an.
»Ja, ich weiß«, sagte ich. »Wir haben schon weitaus Schöneres erlebt …«
Und vielleicht würden wir bald nichts mehr erleben. Wenn es nicht bald wieder bergab ging, in wärmere oder zumindest baumreichere Gebiete, dann würden wir wohl noch vor dem nächsten Sonnenaufgang erfrieren. Selbst Cú konnte mich nicht so sehr wärmen, dass wir ohne Feuer, völlig durchnässt, eine Nacht durchhielten.
Ich zwang mich zu einem Lächeln, Regentropfen rutschten von meiner Nase hinab.
»Wir sollten den Göttern wohl danken, Cú, dass sie uns nicht schon im strengsten Winter hier herauf geschickt haben.«
Der Hund senkte seinen Kopf wieder und trottete weiter. Branna auf meiner Schulter schüttelte sich in einem verzweifelten Versuch, den Regen loszuwerden. Feine Wassertropfen flogen in meine Augen.
»Schööön«, krächzte die Rabin und ich fragte mich, ob der Vogel wie so oft einfach Worte wiederholte oder vielleicht doch ein Gefühl für Neckerei hatte.
Wir fanden einen schmalen Überhang, einen Fels, der uns ein wenig Schutz vor dem Wetter bot. Ich presste mich auf das Fleckchen trockenen Boden, ich konnte gerade aufrecht sitzen. Cú und Branna ließen sich neben mir nieder und wir teilten ein wenig von meinen Vorräten. Es war einen Viertelmond her, dass wir das letzte Mal lebenden Menschen begegnet waren und Brot und schrumpelige Äpfel für eine Geschichte erhalten hatten. Davon war so gut wie nichts mehr übrig, obwohl ich diese Köstlichkeiten äußerst sparsam eingeteilt hatte. Dafür hatte ich noch etwas von dem weißen Hasen, den wir tags zuvor erjagt hatten. Ich hatte ihn am Abend über einem kargen Feuer gebraten, viel Holz hatte ich nicht gefunden. Er war ein wenig zäh geworden und auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Aber es war wohl alles, was wir heute zu essen hatten, denn bei dem eisigen Regen war an Jagd nicht zu denken.
Branna quetschte sich auf meinen Schoß, nutzte meine verschränkte Beine wie ein Nest. Ja, wir waren alle müde. Müde, nass und kalt. Ich suchte in meinem großen Ziegenfellbeutel, ob sich nicht vielleicht doch noch ein weiteres Stück Tuch darin befand, das trocken und wärmend war, obwohl mir der Inhalt des Beutels so vertraut war wie meine Hände. Alles darin war feucht und klamm, selbst das Ziegenfell konnte den tagelangen Regen nicht völlig abhalten, überall drang die Nässe durch jede Naht ein. Auch die Rehhaut, die ich mit einem langen Seil zur Rolle gebunden hatte und nachts als Unterlage nutzte, war nass.
Ich seufzte.
Wie groß war die Versuchung, ein wenig zu schlafen. Aber es würde nicht lange dauern, bis ich in meiner durchnässten Kleidung zitternd aufwachte.
Und wenn ich nicht mehr erwachte? Wenn die Götter mich hier in diese unwirtliche Gegend geschickt hatten, um meinem Leben ein Ende zu bereiten? Bis zum Tod oder einem Zeichen der Götter, würde mein Fluch dauern, hatte Morfran damals verfügt. Aber hatte ich mich denn nicht an alles gehalten, was das cynnedyf von mir verlangte? Nie war ich länger als einen halben Mond an einem Ort geblieben. Nicht, seit ich erlebt hatte, was geschah, wenn ich dieses Gebot missachtete. Ich hoffte nur, dass Morfran, der damals das cynnedyf über mich gesprochen hatte, unter seinen Folgen ebenso zu leiden hatte wie ich, wie es bei einem Fluch geschah. Und fragte ich nicht Tag für Tag die Götter, wohin ich gehen sollte? War das den Göttern vielleicht inzwischen lästig geworden?
Die Augen fielen mir zu. Ich könnte doch einfach hier bleiben. Alleine. Niemandem geschähe ein Leid, wenn ich den halben Mond überschritt. Ein Glucksen wanderte meine Kehle hinauf. Es würde keinen halben Mond brauchen, ehe ich erfroren oder verhungert war.
Ich fühlte Cús nasse Schnauze, die sich auf meinen Oberschenkel legte. Ohne ihn und Branna hätte ich längst aufgegeben. Wäre ich längst tot. Verdammtes cynnedyf. Ich wollte einfach nur noch, dass es ein Ende hatte. Zwei-mal-vier Jahre waren genug. Ich hatte jedes Gefühl für Zeit hier in den Bergen verloren. War der zwei-mal-vierte Jahrestag des Fluches vielleicht gar schon vorbei? War das Fest des Gleichgewichts zwischen Hell und Dunkel schon vergangen oder noch vor uns? Weit vor uns konnte es nicht mehr sein, auch wenn hier heroben noch tiefster Winter herrschte.
Ich musste eingeschlafen sein, denn ich träumte. Jenen Traum, der mich seit Jahren immer weitergehen ließ. Es war ein bilderloser Traum, nicht mehr als ein Gefühl tief in meinem Herzen und eine Stimme, die keinen wahren Klang hatte, sondern direkt in meinem Kopf wisperte wie der Wind in den Wäldern. Eine Stimme, die mich warm und liebevoll einhüllte wie eine Mutter ihr neugeborenes Kind.
Du wirst mich finden, sagte die Stimme, ohne Worte zu benützen. Du wirst mich finden, es mag vielleicht noch dauern. Doch ich werde da sein. Dann hat unser Weg ein Ende.
Ich erwachte, weil Cú mein Gesicht ableckte. Es fiel mir schwer, dem Traum den Rücken zu kehren.
Der Regen hatte nachgelassen und war in ein sanftes Nieseln übergegangen. Die Wolkendecke zeigte vereinzelte Risse, ein leichter Wind kam auf.
Ich lächelte müde, streckte mich.
»Ja, wir sollten weitergehen.«
Wie so oft gab der Traum mir Hoffnung und machte mich traurig zugleich. Anfangs, als das cynnedyf mich in die Fremde gestoßen hatte, träumte ich oft. Und auch wenn die Stimme in meinem Traum keinen zuordbaren Klang hatte, so war ich mir doch sicher, dass es Loïc war, der mich rief. Ich wischte den Gedanken an sein Gesicht von mir. Die Götter, das Schicksal und mein Maistir Morfran hatten verfügt, dass uns kein gemeinsames Leben beschieden war. Die Träume waren im Lauf der Jahre seltener geworden. Ich war nicht mehr das junge Mädchen, die kaum erwachte Frau, die ich damals gewesen war. Da konnte mein Herz sich noch so sehr nach Loïc sehnen, nach dem tiefen Wissen, dass er und ich von den Göttern für einander bestimmt waren. Ja, das waren wir. Und irgendwann würden wir auch wieder beieinander sein. Vereint.
Seid uns gnädig, ihr Götter …
Es dauerte immer eine Weile, bis ich nach solch einem Traum mein Herz wieder verschlossen hatte, es wie eine Nuss in einer harten Schale in Sicherheit brachte.
Nun war keine Zeit für Träume. Nun galt es, einen Platz für die Nacht zu finden und vielleicht im nachlassenden Regen doch noch etwas zu jagen.
Der Weg wurde leichter zu folgen, ja, es wurde tatsächlich so etwas wie ein Weg. Keiner, den Menschen gingen, eher das Bett eines Bächleins, das sich in unzähligen Sommern hier eingegraben hatte. Und er führte talwärts. Weg von der eisigen Kälte und dem Schnee des Gipfels.
Langsam begann ich wieder meine Zehen in den Fellschuhen zu spüren und meine Finger. Ich atmete die Luft ein, die immer noch kalt und feucht war, aber mit jeder Mannlänge einen Hauch milder zu werden schien.
Branna erhob sich hoch in die Lüfte, als der Regen aufhörte, und Cú lief, wie es seine Gewohnheit war, ein wenig voraus, um gleich darauf wieder zu mir zurückzukehren. Kein Herrscher konnte einen besseren Spähtrupp haben als ich.
Ich fühlte mich beinahe beschwingt, als wir uns immer mehr von dem eisigen Felsenbereich entfernten. Langsam fanden sich zwischen den Felsbrocken wieder Flecken mit Erde und gelblichem Wintergras, plattgedrückt von den wohl erst kürzlich abgetauten Schneemassen. Kleine knorrige Büsche tauchten immer wieder auf, es waren Pflanzen, die mir unbekannt waren. Kahl trotzten sie der unwirtlichen Gegend. Über mir eilten die Wolken grau über den Himmel. Hier und da hörte ich in der Ferne ein Pfeifen, das jedes Mal Cú hoffnungsvoll aufblicken ließ, doch nie erspähte ich das Tier, das die Geräusche machte.
Plötzlich blieb Cú vor mir stehen, die Nase in den Wind gehoben. Seine Nackenhaare richteten sich auf. Branna, die über uns Kreise zog, schien jedoch nichts Auffälliges zu bemerken, sonst wäre die Rabin längst krächzend auf meiner Schulter gelandet.
Ich kniete mich neben meinen Hund. »Was ist es, Cú?«
Vielleicht etwas Essbares … Ohne mich viel zu bewegen, zog ich die Hanfschlinge aus meinem Gürtel und hob einen Stein auf, von denen es hier mehr als genug gab. Ich war geübt mit der Schleuder und selbst mit meinen klammen Fingern standen die Aussichten nicht schlecht, gemeinsam mit der Hilfe meiner Gefährten jedes Tier zu erlegen, das uns begegnete.
Doch Cú senkte seine Schnauze zu Boden, und da sah es auch ich. Kein Wunder, dass Branna oben am Himmel kein verändertes Verhalten zeigte. Da war eine Spur im weichen Boden zwischen zwei Felsbrocken.
Eine menschliche Spur.
Der Größe nach wohl der Fuß eines Mannes.
Mein Blick glitt über die Landschaft. Nachdem es bis vor kurzem geregnet hatte und die Spur nach wie vor zu sehen war, konnte der Fremde noch nicht allzu weit weg sein. Ich wunderte mich, dass Branna ihn nicht sah.
Ein Mensch. Hier, in dieser Einöde. Mein Herz klopfte, doch ich wusste nicht, ob vor Freude oder Angst. Wer befand sich um diese Zeit des Jahres freiwillig in einer Gegend wie dieser? Ich hatte den ganzen Tag kein jagdbares Wild gesehen, es gab auch keine zu fällenden Bäume. Nur jemand wie ich, der der Gegend unkundig und verrückt genug war, dorthin zu gehen, wohin die Götter ihn schickten, verirrte sich hierher.
Verirrt – ja, das war der andere wohl auch.
Ich erhob mich, sah mich erneut um. Weit lag das Land unter einer dicken Wolkenschicht vor mir. Als wäre ich selbst bei Sonnengott Lug und blicke auf die Welt hinab. Vor lauter Regen war mir noch gar nicht aufgefallen, wie schön die Aussicht war. So fühlte sich also wohl Branna, wenn sie hoch oben am Himmel kreiste. Endlos weit schien das Land, voller Berge und Hügel und keinerlei Siedlung, die ich erspähen konnte. So fern der Menschen war ich wohl noch nie gewesen.
Die Rabin kam zu mir geflogen, krächzte. Also doch. Ich war tatsächlich nicht alleine hier.
Meine Hand schloss sich fester um meinen Haselstab und ich folgte der Richtung, die die Rabin mir vorgab.
Kapitel 2: Die Fremde
Latobio fluchte. Verfurzter Regen. Verfurzte Ziege. Er war dem Vieh gefolgt, das sich von seinem Pflock losgerissen hatte. Schließlich konnte er es sich nicht leisten, eine seiner beiden Ziegen zu verlieren. Geschickt waren sie ja immer, wenn es darum ging, auszubüxen. Hätte wenigstens warten können, bis das Wetter besser war, dummes Vieh. Das hatte sie jetzt davon, war in die Schlucht gerutscht.
Und er hinterher.
Da saß er nun, hielt die meckernde Ziege an ihren Hörnern fest, dass sie nicht noch weiter abrutschte. Er fand kaum Halt auf den Steinen, die den abschüssigen Untergrund bedeckten. Hatte die Ziege denn nicht bemerkt, dass hier im Winter ein Felsrutsch gewesen war? Er hatte keine Ahnung, wie er wieder den steilen Hang hinauf käme, mit der Ziege. Seine Hände waren blutig, aufgeschürft vom Sturz. Der Geruch machte die Ziege noch unruhiger und sie wand sich in seinem Griff.
»Kopfkrankes Vieh!«, rief er. »Willst etwa ganz abstürzen?«
Eines ihrer Hörner verfing sich in seinem struppigen Bart. Er kämpfte, sich zu befreien, drohte, noch weiter hinabzurutschen. Es war ein weiter Weg die Schlucht hinab, bis ein paar Bäume sie bremsen würden.
Plötzlich hörte er jemanden rufen. Seit er im Herbst sein Dorf verlassen hatte, hatte er keine menschliche Stimme mehr gehört, und er war überzeugt, sich zu täuschen. Doch dann hörte er es erneut. Und dazu das Gebell eines Hundes.
Schwalbenfurz! Die Göttin der Jagd mit ihrem Gefolge war wohl gekommen, ihn zu holen.
Er hob den Kopf, soweit es die bockende Ziege erlaubte.
Oben an der Kante des Abhangs entdeckte er ein Wesen, das wenig Göttliches an sich hatte. Sah mehr wie ein armes Weiblein aus, eingehüllt in ihren Umhang und auf einen langen Stab gestützt. Er hatte immer gedacht, die Göttin der Jagd zeige sich den Menschen als wunderschöne Frau. Daneben stand ein großer, grauer Hund, einem Wolf gleich, der aufgeregt bellte.
Die Ziege in seinen Armen wurde noch unruhiger, wand sich hin und her. Er verlor den Halt und rutschte ein Stück weiter den Hang hinab, ehe er sich mit dem Fuß erneut an einem vorstehenden Felsstück abstützen konnte.
Das Gebell verstummte, und als er wieder aufsah, konnte er den Hund nicht mehr entdecken. Die Frau hatte ihren großen Beutel abgelegt und wickelte ein Seil von einer Rolle Tierhaut, das sie sich um den Bauch band.
»Halte durch!«
Im nächsten Augenblick sah er nur noch ihren Kopf über die Felskante ragen, sie hatte sich wohl flach auf den Boden gelegt, und das Hanfseil glitt zu ihm hinab.
Indem er sein Bein streckte, versuchte Latobio sich soweit hochzuschieben, dass er das Ende des Seils erreichen konnte. Er hoffte, das kleine Weib war stark. Sonst würde sie im nächsten Augenblick mit ihm die Schlucht hinabstürzen.
Die Kraft der Verzweiflung gepaart mit der Hoffnung auf Rettung durchströmten ihn. Er riss das Horn der Ziege aus seinem Bart, spürte den Schmerz an seinem Kinn. Die Ziege zuerst.