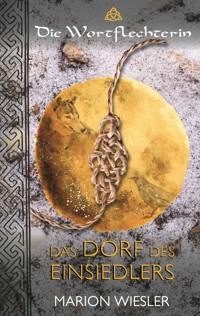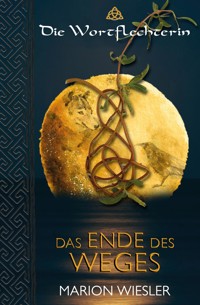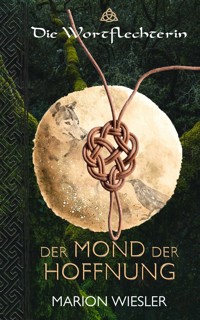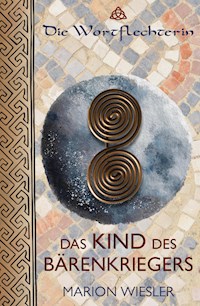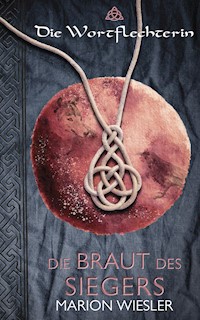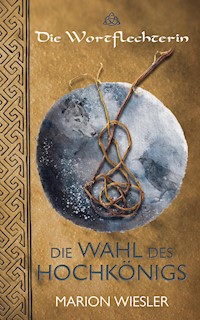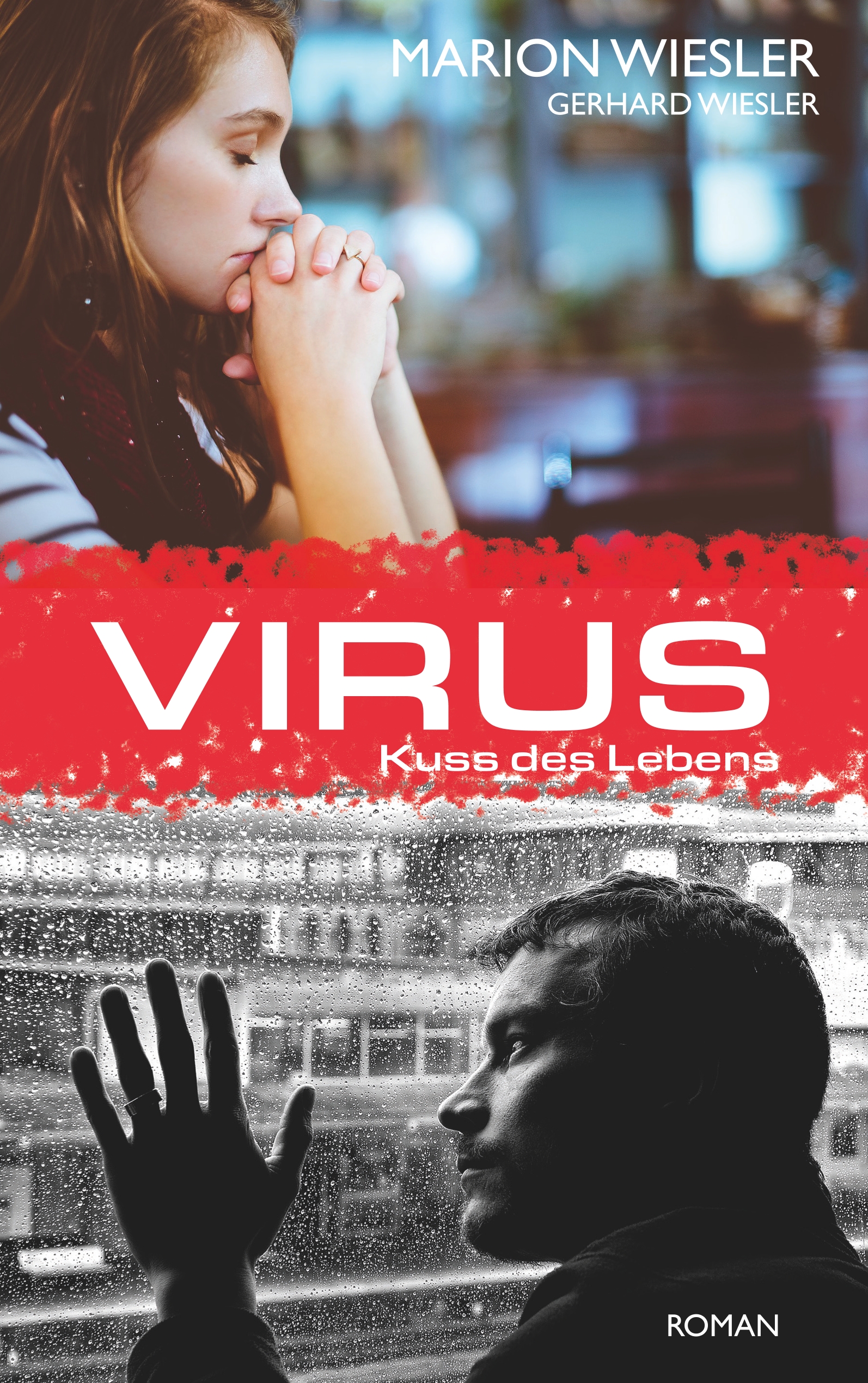6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Bardin, verflucht, nie sesshaft zu sein. Eine große Liebe. Gute Geschichten und treue Gefährten. Norikum, im Jahr 38 vor unserer Zeitrechnung. Seit drei-mal-drei Jahren ist die Bardin Arduinna gezwungen, nie länger als einen halben Mond an einem Ort zu verweilen, will sie das Leben ihres Geliebten nicht in Gefahr bringen. Ein Sturz in einen eisigen Fluss beraubt sie ihres kargen Besitzes. Es könnte ihr Tod sein, wären da nicht ihr treuer Wolfshund und ihr Rabe – und ein zufällig vorbeikommendes Geschwisterpaar. Doch die Gnade der Götter scheint nicht allzu lange zu währen – überraschende Ereignisse stoßen Arduinna in einen Strudel voller Zweifel. Nichts gilt mehr, das bis jetzt sicher schien. Haben die Götter sie verlassen? Band 4 der Keltenroman-Serie »Die Wortflechterin« Ein spannender historischer Roman zur Keltenzeit, mit starken Frauen, vielfältigen Geschichten und einem unterhaltsamen Raben. Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Noricum im Jahre 38 vor unserer Zeitrechnung
Ich bin Arduinna
Prolog: An einem fernen Ort
Kapitel 1: Der Fluss
Kapitel 2: Ein Fund
Kapitel 3: Das Erwachen
Kapitel 4: Der Vater des Mädchens
Kapitel 5: Alleine
Kapitel 6: Der Wunsch der Schwester
Kapitel 7: Die Erstfrau
Kapitel 8: Am Arrabo
Kapitel 9: Die Fibel
Kapitel 10: Ein Entschluss
Kapitel 11: Gespräch unter Frauen
Kapitel 12: Beim Druiden
Kapitel 13: Eine Überraschung
Kapitel 14: In der Großen Halle
Kapitel 15: Eine Bitte
Kapitel 16: In der Werkstatt
Kapitel 17: Besuch vom Druiden
Kapitel 18: Vor der Türe
Kapitel 19: Verkündung
Kapitel 20: Nächtliches Gespräch
Kapitel 21: Vorbereitungen
Kapitel 22: Auf der Jagd
Kapitel 23: Am Teich
Kapitel 24: In der Werkstatt
Kapitel 25: Bei dem Jungen
Kapitel 26: Ein Opfer
Kapitel 27: Ein Bad
Kapitel 28: Sonnwendnacht
Kapitel 29: Eine unerwartete Begegnung
Kapitel 30: Rückkehr
Kapitel 31: Eile
Kapitel 32: Rüdes Erwachen
Kapitel 33: Unterwegs
Kapitel 34: Nachtlager
Kapitel 35: Im Wald
Kapitel 36: Reisetag
Kapitel 37: Bei Freunden
Kapitel 38: Das Gehöft
Kapitel 39: Ein Lied
Kapitel 40: Vercana
Kapitel 41: Sein Weib
Kapitel 42: Ein Gespräch
Kapitel 43: Vom Fluch
Kapitel 44: Im Stall
Kapitel 45: Die Hunde
Kapitel 46: Neue Erkenntnis
Kapitel 47: Ein Abend mit der Bardin
Kapitel 48: Kennenlernen
Kapitel 49: Die Weihe
Kapitel 50: Das Zeichen
Kapitel 51: Ein Opfer
Kapitel 52: Das Feuerspiel
Kapitel 53: Ihre erste Geschichte
Kapitel 54: Eine letzte Nacht
»Die Wortflechterin«
Bücher aus der »Welt der Wortflechterin« :
Marion Wiesler
Impressum
Marion Wiesler
Die Wortflechterin
Das Fest der Sonnwend
Band 4
Noricum im Jahre 38 vor unserer Zeitrechnung
(für die Geschichte bedeutsame Orte)
Bragnreica:
Das heutige Deutschlandsberg, das ich als Herrschersitz des Voccio erkoren habe
Solva:
Später Flavia Solva, bei Leibnitz
Murus:
Der Fluss Mur
Croudiminio:
in der Nähe des heutigen Hartbergs
* historisch nicht nachgewiesene Namen
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband)
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Ich bin Arduinna
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Prolog: An einem fernen Ort
Jemand schreit. Ich schreie, stelle ich fest. Alle in der Taverne starren mich an, wie ich da aus dem Schlaf hochschrecke. Ich japse nach Luft, wie ein Ertrinkender. Eisig schnürt es mir die Kehle zu.
Eingeschlafen bin ich, mitten am Tag.
Welch furchtbarer Traum, wie Nebelfetzen, kaum erinnerbar. Nur, dass es um dich ging, cara Arduinna. Um dein Leben.
Sie lachen nun, wo sie meine verschlafene Verwirrung merken. Ein alter Händler nickt mir milde zu. Wir sind alle müde, warten in der engen Gaststube, dass die Unwetter enden, schlafen seit zwei Tagen sitzend, gestrandet wie der riesige Fisch in einer deiner Geschichten.
Ich reibe meine Hand, bringe Leben in die steifen Finger. Der graue Eintopf in der Schale vor mir auf dem Tisch ist kalt geworden, eine dünne Haut überzieht ihn. Ich schiebe ihn von mir, greife lieber zu dem hölzernen Becher mit Bier. Der erste Schluck beruhigt meinen Atem.
Ich habe dich angeschrien im Traum. Gebrüllt mit dir. Was ist geschehen? Wo bist du?
Der Sturm rüttelt an den Fensterläden. Vereinzelte Regentropfen finden ihren Weg bei den Ritzen herein.
Der neunte Winter ohne dich. Bist du in Sicherheit? Hast du ein Dach über dem Kopf?
Ich bin es so leid. Zu warten. Dass dieser verdammte Fluch ein Ende nimmt. Ich will dich wieder bei mir haben. So nah bist du mir immer noch. Mit dir rede ich mehr als je mit meinem Weib. Sie hat immer auf meine Worte gewartet und ich hatte keine für sie. Dir möchte ich so viele geben, und du kannst mich nicht hören.
Wie lange noch?
Neun Jahre schon.
Ich tue, was ich kann.
Kapitel 1: Der Fluss
Der Abhang zum Fluss hinunter war kurz, aber steil. Überall Weiden und Gestrüpp, nur hier eine Stelle, die von Rehen und anderen Tieren genutzt wurde. Tief hatten sich deren Spuren in das nasse Erdreich gegraben, waren sie in den Flecken von eisigem Schnee sichtbar, ein schmaler Weg den Hang hinab. Seit mehr als einem Viertelmond konnten die Wettergötter sich nicht entscheiden, kämpfte der Wintergott mit dem des Sommers – heftige Schneefälle wechselten mit strahlendem Sonnenschein, um in strömenden Regen überzugehen. Und ich Tag für Tag mittendrin, ohne schützendes Dach über dem Kopf.
Der Fluss rauschte laut, halb untergetauchtes Buschwerk am Ufer verriet, dass er mehr Wasser führte als gewöhnlich. Cú winselte, als ich mehr rutschend als gehend mich den Hang hinunter begab. Branna nützte die Pause, um im Geäst einer Weide zu rasten, deren kahle Zweige tief über den Fluss hingen. Mein Wasserschlauch war voll mit geschmolzenem Schnee, aber der Hunger trieb mich. Ich würde mich im Gebüsch an der Wasserstelle niederlassen und warten, dass Tiere zum Trinken kamen. Gleichzeitig könnte ich meinen Angelhaken an der Schnur in den Fluss halten und vielleicht einen Fisch fangen. Zwei Möglichkeiten zugleich, das war besser, als hungrig jagen zu gehen.
Ein schmaler Streifen am Ufer, voller Tierspuren in Schnee und Erdreich. Ich holte die kleine Birkenrindendose mit meiner Angelschnur und dem scharfen Haken aus meinem Beutel. Es war zu schlammig, um den Beutel oder meine Rehhautrolle abzulegen, und so ließ ich beides quer über meine Schulter geschlungen. Es war schattig hier und meine Finger wurden rasch klamm, als ich die gewalkten Handstrümpfe auszog, um die Schnur an einen abgebrochenen Ast zu binden.
Branna über mir krächzte und ich sah auf. Die Rabin hob sich gegen die blasse Sonne ab, spreizte die Flügel.
»Nur Geduld«, sagte ich.
Cú zwängte sich neben mich, trank gierig. Wir waren bereits lange unterwegs heute und hatten seit gestern kein sauberes Gewässer gefunden, nur dreckige Lacken nach all dem Regen.
Ich steckte die Angel in den Schlamm, sah dem Haken nach, der rasch in der Strömung die Schnur straff spannte. Mein letztes Stückchen Brot hing daran. Es gab bessere Orte zum Fischen. Aber der Hunger war nicht wählerisch.
Ich beugte mich vor, als etwas vorbeitrieb, das menschengemacht aussah, war es ein Korb? Anzeichen einer Siedlung etwas flussaufwärts. Ich hob den Kopf, bemüht, den kurvigen Flusslauf entlangzublicken, machte einen kleinen Schritt, um besser an dem Gestrüpp vorbei zu sehen.
Der Boden unter mir gab nach, ich rutschte ab. Meine Beine fanden keinen Halt. Ich warf mich auf den Bauch, doch da war nur Wasser, kein Ufer mehr, weggerissen vom Fluss.
Mein Knie schlug auf einen Stein, mein Ziegenfellbeutel zog mich weiter, Wasser schlug über mir zusammen.
Eisige Kälte lähmte mich.
»Halt dich fest!«, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf.
Ich schlug um mich, kam an die Oberfläche, japste gierig nach Luft.
Mit der Linken schaffte ich es, einen Ast zu erlangen, krallte mich mit den Fingern fest. Erneut schlug Wasser über mir zusammen, riss die Strömung an mir.
So kalt.
Wieder kam mein Kopf in die Höhe, ich hörte Cú bellen, dann spürte ich seine Zähne, die meinen Ärmel packten, daran zerrten. Branna kreischte über mir, krallte sich in meine Schulter, als wolle sie mich herausziehen. Der Ast, den meine klammen Finger griffen, knackte. Lange würde ich mich nicht halten können.
So kalt.
Ich würde Cú mit mir ziehen. Ich kämpfte gegen die Strömung, doch der Zug an meinem Körper war zu stark. Etwas stach in meine Seite, stach von außen, wo innen meine Brust verzweifelt nach Luft schrie.
Immer wieder schwappte Wasser über meinen Kopf, immer wieder versuchte ich, Atem zu holen, doch meine Kehle wollte sich nicht öffnen, eingefroren, eisig.
So kalt. So unendlich kalt.
Alles verlangsamte sich, Brannas Krächzen, meine Bewegungen, das Rauschen des Wassers. Friedlich wurde es beinahe, wäre es nicht so kalt.
Ich musste nur loslassen. Cú konnte mich nicht halten, wenn ich den Ast losließ. Ich fühlte meine Finger nicht mehr, wollte sie zwingen, sich zu öffnen. Einfach loslassen.
Aufgeben. Sich dem Flussgott hingeben. Lange genug hatte ich gekämpft. So viele Jahre.
»Du wirst nicht aufgeben!«, schrie die Stimme in meinem Kopf. »Bei den Göttern, kämpfe! Du musst leben! Kämpfe!«
Der Nebel in meinem Kopf lichtete sich einen Augenblick, ich holte Luft, spürte Kraft sich in mir aufbäumen.
Erneut tauchte mein Kopf unter Wasser, vom Gewicht des vollgesogenen Ziegenfellbeutels gezogen. Ich tastete nach meinem Gürtel, dorthin, wo etwas schmerzte, fühlte einen Ast, der sich unter den Lederriemen geschoben hatte und versuchte, mich mit der Strömung mitzureißen.
»Weg damit!«, schrie die Stimme.
Mein Gürtel …
Alles war daran, was ich brauchte …
Doch er nutzte mir nichts, wenn er mich in den Tod zog.
Ewig schien es zu dauern, bis meine Finger es schafften, den Haken des Gürtels zu öffnen. Der Schmerz ließ nach, wie eine Luftblase schoss mein Kopf wieder an die Oberfläche, ich sah Cú, die Beine in das Ufer gestemmt, an meinem Ärmel zerrend, sah meine Hand, die sich an den Ast klammerte, der eine Wurzel war, doch fühlte ihn nicht.
Erneut zog mich etwas nach unten. Ich schob den Riemen meines Ziegenfellbeutels die Schulter hinab, strampelte mich mit den Beinen aus ihm heraus, bis er an meinen Füßen vorbei mit dem Fluss mitschwamm, die Rehhautrolle mit ihm.
Nun schaffte ich es, mit der anderen Hand nach der Wurzel zu greifen, mich ein Stück hoch zu ziehen, dass ich meinen Arm darüber legen konnte, den Fuß des Uferbaumes zwischen Oberarm und Brustkorb eingeklemmt.
Meine Beine waren taub.
»Raus!«, schrie die Stimme. »Kämpfe!«
Cú zerrte und zerrte, doch der Fluss zog in die andere Richtung, nahm mir die Luft. Der Umhang. Schwer war er, dicke Wolle, vollgesogen, eng an meinem Hals. Ich versuchte, mich höher zu kämpfen, doch mein Arm rutschte ab, erneut tauchte ich unter. Der Umhang schob sich empor, wollte meinen Kopf nach hinten reißen. Ich half mit der Hand nach, schlüpfte aus der engen Umklammerung.
Luft.
Ich bekam erneut die Wurzel zu fassen, schob mich hoch, leichter nun.
Cú zerrte, Branna zerrte. Mein Knie berührte den Boden, kaum fühlbar, ich zwang es, sich höher zu schieben, auf das Ufer hinauf.
Fester Boden unter meinem Bauch.
Noch ein kleines Stück.
Erde unter mir, feste, unbewegliche Erde.
Schlamm und Schnee.
Ausruhen.
Cús Zunge, die mich ableckt, seine Schnauze, die mich in die Seite stößt. Brannas Schnabel, an meinem Gesicht, ihr schrilles »Moooorgn« in meinem Ohr.
Ausruhen. Nur einen Augenblick.
Doch sie hörten nicht auf.
Schleckten und stießen und krächzten.
Ich rappelte mich hoch, die Hände gefühllos, auf alle viere. Fiel hin, das Gesicht in den Schlamm.
Das Zittern begann, schüttelte mich. Meine Zähne schlugen aufeinander, laut und schnell.
Feuer. Ich musste Feuer machen. Ich konnte Cú und Branna nicht alleine lassen. Kämpfe, hatte die Stimme geschrien. Nicht aufgeben.
Feuer. Du musst dich wärmen. Kälte und Hitze töten schneller als Durst. Viel schneller.
Feuer. Wie soll ich Feuer machen. Mein Feuerspiel in dem Beutel an meinem Gürtel, den Fluss hinab. Das Schlageisen, der Feuerstein, der Zunder, in der kleinen Birkenrindendose.
Egal. Auf. Ein Schritt nach dem anderen.
Holz. Es braucht Holz für Feuer.
Ich versuchte, aufzustehen. Kroch auf allen Vieren, auf dem Bauch. Wand mich wie eine Schlange den kurzen Abhang hinauf. Taumelnd wie ein Wurm, den man aus einer Schale Met gerettet hatte, dachte ich und musste beinahe lachen, doch es wurde ein Würgen, ein Husten. Ich spuckte Wasser. Cú schleckte mich ab, winselte.
Irgendwann waren wir oben, auf der ebenen Fläche, in dem breiten Tal. Kein Schatten hier wie unter den Weiden, sondern etwas Sonne.
Holz. Aufstehen.
Ich kam ins Sitzen, Branna hüpfte auf meine Oberschenkel, reckte mir ihren großen Schnabel ins Gesicht.
»Guuuut«, gurrte sie.
Alles war weg.
Egal. Feuer.
Meine Hand tastete dennoch an meinen Hals, nach der Fibel, die an einem Lederband dort hing. Nicht hing. Weg war. Alles war weg. Wirklich alles.
Wozu weiter.
Cú schubste mich an. Ja. Feuer. Wärmen. Dann suchen, vielleicht hatte der Fluss meine Sachen ja weiter unten wieder von sich gespuckt.
Ich stand auf.
Schwärze.
Kapitel 2: Ein Fund
Zwei-mal-drei Tage würde es noch dauern, bis das Heilmittel für seine Frau fertig wäre, hatte der Druide gesagt. Es gefiel Smertrios gar nicht, dass er nun nichts tun konnte. Es dauerte ihm alles zu lange. Drei Tagesreisen waren es dann wieder nach Hause, wo Vercana auf das Mittel wartete.
Missmutig stapfte er durch den Schneematsch. Zu jeder anderen Gelegenheit würde er sich freuen, mit seiner Schwester Sanna und ihrem Mann Ferchar auf die Jagd zu gehen, viel zu selten sahen sie einander. Er liebte es gewöhnlich auch, durch den Wald zu streifen. Aber eben nicht jetzt. Er war froh, dass sie auf dem Rückweg in Ferchars Dorf waren, in der sonnigen Ebene. Auch wenn er in der Siedlung erst wieder nur wartend herumsäße.
Er ging langsamer als Sanna und Ferchar, in Gedanken versunken. Sein erstes Weib hatte gebratenen Hasen geliebt. Vercana mochte ihn auch. Es waren nur ein paar Tage, versuchte er sich aufzumuntern. Nur ein paar Tage ...
Trotz aller schwerer Gedanken konnte er nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf seine Lippen schlich, als er Sanna da so vor sich sah, mit ihrem beschwingten Gang, als gäbe es keine Sorge auf der Welt. Seine Schwester lachte, sah strahlend zu ihrem Mann, dem Reix des Bärenstamms. Ferchar war immer noch ein beeindruckender Mann, selbst ohne seinen Umhang aus Bärenfell, in der Blüte seines Lebens. Und sie hatten ja durchaus Grund, gut gelaunt zu sein. Fünf Hasen baumelten an einer ledernen Schnur über Ferchars Schulter. Nicht, dass der Reix sie geschossen hätte, der Bogen war nie seine Waffe gewesen. Drei hatte Sanna erlegt und zwei Smertrios. Es freute ihn, dass Sanna immer noch besser war als er. Dass sie nicht im Laufe der Jahre zu einer langweiligen Rigana geworden war, sondern sich ihre Eigenart behalten hatte. In Braccae auf die Jagd ging wie ein Mann und besser schoss als ihr Bruder, mit dem Bogen, den er ihr gebaut hatte.
Er hörte, wie Ferchar sie neckte, dachte an Vercana daheim, die schwach und blass im Bett gelegen hatte, als er sie verließ. Sie war ein gutes Weib, fleißig und liebenswürdig. Er wollte sie nicht verlieren.
Vor ihm blieb Sanna plötzlich stehen, hob ihre Hand vor die Brust Ferchars, um ihn am Weitergehen zu hindern. Hatte sie erneut einen Hasen entdeckt? Doch sie nahm nicht ihren Bogen von der Schulter.
Smertrios trat näher. Ein Vogel sprang einige Mannlängen vor ihnen mit gespreizten Flügeln herum und krächzte laut.
»Ist nur ein Rabe«, sagte Smertrios.
Doch Sanna schüttelte den Kopf.
Nun sah Smertrios es auch. An der Kante zu dem kurzen Abhang, der zum Arrabo hinabführte, lag ein Tier. Auf den ersten Blick hätte er es für einen Wolf halten können. Wölfe und Raben taten sich oft zusammen, um sich Beute zu teilen. Doch als das Tier nun aufsprang, ähnelte es manchen der struppigen Hunde, die es in Ferchars Siedlung und auch bei ihm daheim gab.
Die Nackenhaare gesträubt, die Zähne gefletscht, verstellte es ihnen breitbeinig den Weg.
Und dahinter – ein Mensch, auf dem Boden liegend. Eine Frau, klein und zart, voller Schlamm und das Gewand und Haar klatschnass, regungslos.
Sanna hatte nach dem Arm ihres Mannes gegriffen, als sie ihrer gewahr geworden war. Obwohl Smertrios hinter ihr stand, spürte er die Angst in ihrem Blick und er wusste, was sie dachte. Keine vier Monde war es her, dass man Ferchars Erstfrau Eana aus dem Wasser gezogen hatte. Nicht hier am Fluss, sondern aus dem kleinen See hinter dem Dorf, hatte Sanna ihm erzählt. Dennoch … erneut ein Wasseropfer?
Der Reix des Bärenstammes nickte seiner Frau zu und machte einen Schritt vorwärts.
Der Wolf oder Hund knurrte lauter, der Rabe flatterte in die Höhe, kreischte.
Ferchar hielt inne. Smertrios' Griff um seinen Bogen wurde fester, seine andere Hand griff langsam nach dem Köcher an seinem Gürtel, bereit, einen Pfeil herauszunehmen.
»Wir wollen doch helfen!«, sagte Sanna zu den Tieren.
Smertrios schüttelte den Kopf.
»Wer sagt, dass sie sie beschützen wollen? Vielleicht haben sie nur Sorge, wir stehlen ihnen ihre Beute.«
Ein bitterböser Blick seiner Schwester traf ihn.
Inzwischen hatte Ferchar einen der Hasen von dem Riemen gelöst und schleuderte ihn weit von sich. Doch die Tiere ließen sich nicht weglocken. Der Vierbeiner warf nur einen kurzen Blick dem fliegenden Fleisch nach, der Rabe flatterte erschrocken hoch, rannte dann aber auf die Menschen zu, den Schnabel weit aufgerissen und fauchend.
Smertrios ging in die Hocke. Er legte den Bogen neben sich und öffnete die Fibel an seiner Schulter. Als der Rabe in seine Nähe kam, warf er den wollenen Umhang über das Tier.
»Einer weniger«, sagte er.
Der Wolfshund bellte nun, knurrte, machte einen Satz vor, als wolle er den Raben retten, sprang dann aber sogleich zurück zu der Frau auf dem Boden.
Während Smertrios den Raben in seinem Umhang gefangen hielt, deutete Ferchar mit dem Kopf nach links.
»Ich lenke ihn ab.«
Er schritt auf den Wolfshund zu, die toten Hasen an ihrem Riemen vor sich her tragend. Er ließ sie hin und her baumeln, machte lockende Geräusche.
Der Blick des Hundes pendelte zwischen den drei Menschen hin und her. Er rührte sich nicht von der Stelle, Nackenhaar und Schweif drohend aufgerichtet, die Zähne entblößt.
»Verdammt noch mal, wir wollen doch helfen«, sagte nun auch Ferchar.
»Wir könnten ihn mit dem Bogen …«, sagte Smertrios, doch Sanna unterbrach ihn wütend:
»Nein! Du wirst ihn nicht erschießen! Er will nur seine Herrin beschützen!«
Er sparte sich zu sagen, dass er ihn nur verschrecken wollte. Es war keine Zeit für Rechtfertigungen.
Während Sanna sich von der anderen Seite her näherte, sprach sie leise und sanft: »Bist ein guter Hund. So ein guter Beschützer.«
Ein Seitenblick des Tieres auf Ferchar, dann schoss der Hund zu Sanna hin, bereit zum Angriff. Smertrios ließ den Raben in seinem Umhang los, der augenblicklich hochflog, packte seinen Bogen und sprang seiner Schwester bei. Mit dem Bogen schlug er dem Wolfshund auf die Schnauze, der jaulte auf. Der Rabe stürzte sich hinab auf Smertrios, versuchte, mit dem Schnabel auf ihn einzuhacken. Smertrios nutzte erneut den Bogen, sich zu verteidigen, wirbelte ihn in der Luft herum, während Sanna mit einer raschen Bewegung ihren Umhang über den Wolfshund geworfen hatte und ihn nun fest umschlungen hielt, so eng, dass er blind und wie geknebelt unter dem Umhang sie nicht erwischen konnte.
Der Reix des Bärenstammes nutzte den Tumult und stürzte zu der Fremden hin.
Er griff nach der Schulter der Frau. Vorsichtig drehte er sie auf den Rücken. Sie krümmte sich, hustete.
Er hob sie in eine sitzende Position, stützte ihren Rücken.
»Bel sei Dank!«, hörte Smertrios Sanna rufen.
Für einen Augenblick war wohl Sanna unaufmerksam, und der Hund schaffte es, sich zu befreien. Der Rabe ließ von Smertrios ab. Beide Tiere stürmten auf Ferchar und die Frau zu. Smertrios lief hinterher, in Sorge um seinen Schwestermann.
Doch da war keine Spur mehr der gefletschten Zähne. Schwanzwedelnd leckte der Vierbeiner den Schlamm aus dem Gesicht der Frau. Der Rabe hüpfte um sie herum und krächzte »Mooorgn! Guuut! Moorgn!«
»Bei Bel!«, rief Ferchar, der sie immer noch im Sitzen hielt. »Ich weiß, wer das ist!«
Sie rührte sich kaum, zitterte, aber schien nicht wirklich bei Bewusstsein. Ihre Finger flogen in die Höhe, berührten die Schnauze des Hundes, der sie immer noch ableckte.
»Ist gut«, flüsterte sie. »Feuer. Du … musst kämpfen.«
Ferchar schlang seinen Umhang um sie, hob sie hoch und trug sie in seinen Armen, der Hund und der Rabe sprangen aufgeregt um ihn herum.
»Wir müssen sie ins Warme bringen«, sagte Ferchar, ob zu den Tieren oder zu Sanna und ihm, wusste Smertrios nicht. Er griff nach seinem Umhang und den zusammengebundenen Hasen, die in dem Tumult am Boden gelandet waren.
Sie eilten den Rest des Weges ins Dorf zurück.
Kapitel 3: Das Erwachen
Es war das Zittern, das mich aufweckte. Und der Geruch nach brennender Kohle. Für einen Moment öffnete ich die Augen und da war Cú, eng an mich geschmiegt, seine Schnauze direkt vor meinem Gesicht. Sein warmer Atem blies auf meine Wangen.
Ich schloss die Augen erneut. Cú war hier, Cú war ganz ruhig, ich musste in Sicherheit sein. Doch da war etwas anderes, neben seinem weichen Fell, das ich auf meiner nackten Haut spürte. Da war ein Arm. Ein Arm, der sich um mich schlang. Und ein Körper, warm und tröstlich, in meinem Rücken.
Immer noch fror ich. Wieso war mir kalt? Ich fühlte dicke Felle und Decken auf mir liegen. Dennoch ließ sich das Zittern nicht aufhalten.
Ich versuchte, mich zu erinnern. Der Fluss. Das eisige Wasser. Die Stimme.
Dann ein Gesicht, vertraut irgendwie, aber mir wollte nicht einfallen, woher. War es er, der nun hinter mir lag? Hatte er …? Ich war nackt.
Ich lag so still, wie das Zittern es erlaubte.
Wer auch immer er war, er hatte mich in ein Haus gebracht. Und Cú hatte es zugelassen.
Andere verschwommene Erinnerungen kamen. Man hatte mich ausgezogen, Hände, die das nasse Gewand von meinem Körper schälten. Hände, die mich mit einem warmen feuchten Tuch säuberten. Eine Hand, die mir etwas Heißes einflößte.
Wie lange hatte ich danach geschlafen?
Vorsichtig öffnete ich die Augen erneut einen Spalt. Cú. Dahinter ein flackernder Raum, goldgelbe Schatten, die über eine Bretterwand zuckten. Eine Truhe davor.
Die Hand auf meinem Körper bewegte sich, umschlang mich fester, rieb über meine Hüften, meine Schenkel, meinen Arm. Ich fühlte warmen Atem in meinem Nacken. Hörte ein leises Summen.
Ich versuchte, soweit wach zu werden, dass ich mir ein Bild meiner Lage machen konnte. War ich in Gefahr? Ruhig halten, bis ich mehr wusste. Noch ahnte die Person hinter mir wohl nicht, dass ich wach war.
Ich hörte das Knarzen einer Türe. Cú hob den Kopf. Dann das Knarren eines Holzbodens.
»Sie schläft noch«, sagte die Stimme hinter mir. Das war keine Männerstimme.
Erleichtert atmete ich ein und musste niesen.
»Nun ist sie wohl wach«, sagte die Frau hinter mir und ich meinte, ein Lächeln in ihrer Stimme zu hören.
Cú schleckte mir über das Gesicht und ich drehte mich auf den Rücken, schob mich auf meine Ellbogen. Das Zittern wurde noch stärker.
Neben mir richtete sich nun eine Frau auf, vielleicht so alt wie ich, mit hellbraunem Haar und grünen Augen und – ebenfalls nackt. Es schien sie nicht im Geringsten zu stören, dass noch jemand im Zimmer war.
Ich wandte meinen Blick zur Türe.
Der Mann, der dort stand, trat nun näher ans Bett. Ja, es war das Gesicht, das ich gesehen hatte. Freundliche Augen mit Fältchen ringsum. Ein Bart, der nicht ganz gleichmäßig wuchs. Ich brauchte einen Augenblick, bis ich wusste, woher ich ihn kannte. Ohne den Bärenumhang war er mir nicht so vertraut.
»Der Bärenanführer«, krächzte meine Stimme. Ich musste husten, Cú sah mich mit schiefgelegtem Kopf an.
Die Augen des Mannes lächelten, als er sich ans Bett setzte. Cú wedelte mit dem Schwanz. Ich schob mich am Betthaupt ins Sitzen, darauf bedacht, meine Nacktheit mit den Fellen bedeckt zu halten. Die Frau neben mir lächelte den Mann an.
»Sieh, sie kennt dich noch!«
Sie reichte mir einen Becher von der Truhe neben dem Bett. Ich nahm einen vorsichtigen Schluck, warmer Wein, süß und stark, unverdünnt.
»Ich habe dich zwar in Bragnreica eingeladen, uns hier zu besuchen«, sagte der Bärenanführer. Ferchar. Ja, Ferchar, fiel mir ein, hieß er. »Aber ich hätte nicht gedacht, dass du zu uns schwimmen möchtest.«
Er lachte, dieses unbekümmerte Lachen, das ich schon an Voccios Hof angenehm gefunden hatte.
»Und ich bin Sanna«, sagte nun die Frau auf der anderen Seite von mir.
»Mein Weib«, fügte Ferchar hinzu, Stolz in der Stimme.
Immer noch kniete sie nackt da. Sie merkte wohl meinen Blick auf ihren Körper.
»Du warst eiskalt«, sagte sie. »Nackte Haut auf nackter Haut wärmt immer noch am Besten.«
Ich nickte.
Die Luft im Zimmer war ungemein warm und stickig.
»Geht es dir besser? Frierst du noch?«, fragte Sanna.
Ich schüttelte den Kopf, doch meine Zähne klapperten.
Nun sah ich auch Branna, die hinter mir vom Betthaupt herunter geflattert kam und direkt auf meinen Bauch sprang.
»Guuut!«, gurrte sie und rieb ihren Schnabel an meiner Wange. Wie ungewöhnlich, dass sie in einer Kammer mit Fremden ausharrte.
»Ich bin in den Fluss gefallen«, sagte ich. Es klang beinahe wie eine Frage. Ja, der eiskalte Fluss.
»Aber du bist wohl wieder herausgekommen. Wir fanden dich oberhalb des Abhangs, der zum Ufer führt«, sagte Ferchar. »Deine Begleiter haben dich äußerst eindrucksvoll beschützt.«
Er tätschelte Cú den Kopf, der es sich gefallen ließ.
Nun fiel mir die rote Linie auf dem Unterarm seiner Frau auf, getrocknetes Blut.
»Das tut mir leid, wenn sie euch verletzt haben«, sagte ich, immer noch mit klappernden Zähnen.
»Es ist nur ein Kratzer«, sagte Sanna. »Sie sind kluge Tiere, deine beiden. Vielleicht hätten wir dich sonst gar nicht gesehen.«
Ich kraulte Hund und Rabin, voller Dankbarkeit.
»Du solltest nun schlafen«, sagte Ferchar. »Dich ausruhen. Oder hast du Hunger? Du musst Hunger haben.«
Beim Wort Hunger begann mein Magen wie auf Befehl zu knurren. Ferchar und sein Weib lachten.
»Das beantwortet wohl diese Frage. Ich hole dir etwas. Oder willst du hinaus kommen, zur Feuerstelle?« Ferchar war bereits aufgestanden.
»Ja, ich würde schon. Aufstehen. So schön warm es hier auch ist. Aufstehen wäre wohl gut.«
Sanna sprang aus dem Bett, schlüpfte in eine lange Camisia aus feiner Wolle.
»Die anderen werden sich freuen, dich zu sehen.« Sie schlang sich einen Gürtel aus einer feingliedrigen Kette um die Mitte.
Die anderen … Ich bereute sogleich, Ferchars Angebot, mir Essen hierher zu bringen, abgelehnt zu haben. Ich erinnerte mich an seine Männer im Lager in Bragnreica, bärtige Krieger, bereit zu Witzen und Kämpfen.
Cú war ebenfalls vom Bett hinab gesprungen und sah mich auffordernd an. Ja, es war wichtig, aufzustehen. Mir würde wärmer werden, wenn ich mich bewegte, als wenn ich liegen blieb. Einfach aufstehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Als hätte ich nicht erneut alles verloren.
»Mein Kleid …«, sagte ich zögerlich.
»Das war voller Schlamm, ich habe es meinen Mägden zum Waschen gegeben. Du kannst eine Camisia von mir haben. Und warme Fußlinge.«
Sanna drehte sich zu einer Truhe.
Ferchar zog sich lächelnd zurück.
»Ich lasse euch beide dann alleine.«
Er schloss die Türe hinter sich und ich merkte, dass Sanna kurz innehielt. Sie schmunzelte, dann reichte sie mir eine Camisia aus Wolle, dunkelgrün gefärbt und fein gewebt. Dazu Fußlinge, so dick gefilzt, dass sie beinahe als Schuhe hätten dienen können.
»Er ist begeistert, dass du hier bist. Und er hat sich furchtbare Sorgen gemacht. Der Arrabo ist nicht zu unterschätzen.«
Vorsichtig stand ich auf. Meine Beine fühlten sich etwas schwach an, aber stark genug, mich zu tragen. Es war doch nur kurze Zeit gewesen, die der Fluss mich umschlungen hatte. Kein Grund, sich wie ein Kranker zu fühlen. Nach etwas Suppe würde es mir besser gehen.
Unter Sannas aufmerksamem Blick schlüpfte ich in Camisia und Fußlinge und Sanna legte mir noch eine dicke Decke über die Schultern. Ihr Arm blieb auf meinem Rücken liegen, als sie mich zur Türe führte, Cú und Branna hinter uns.
Mal wieder hatten die Götter mir alles genommen. Aber zumindest waren sie gnädig gewesen und hatten mir den Bärenkrieger geschickt. Ich dankte ihnen im Stillen, als wir aus dem Schlafgemach traten.
Kapitel 4: Der Vater des Mädchens
Hatte ich beinahe angenommen, dass Sanna mich nun in die Große Halle ihres Dorfes führen würde – immerhin war Ferchar Anführer des Bärenstammes – so war ich sehr erleichtert, dass wir uns in einem geräumigen, aber nicht allzu großen Raum wiederfanden. In der Mitte brannte in einer erhöhten, aus Weidengeflecht und Lehm gebauten Feuerstelle ein Feuer, das noch mehr tröstliche Wärme verbreitete als die Kohleschale im Schlafgemach.
An einer Stange, die zwischen der Türe zu Sannas und einer anderen Kammer an zwei Eisenketten von der Decke baumelte, hingen meine Camisia und mein Peplos zum Trocknen. Schäbig sahen sie aus im Vergleich zu dem fein gewebten Gewand, das ich nun trug.
Ganz in der Nähe der Feuerstelle stand ein niedriger Tisch, umgeben von Fellen und Polstern. Der Holzboden war aus sorgfältig gehobelten Brettern, doch abgesehen von der Güte aller Gegenstände – der Webstuhl in der Nähe der Türe hatte kunstvoll geschnitzte Holme, die Truhen ringsum waren mit eingebrannten Mustern verziert und hatten glänzende Beschläge – unterschied sich dieses Haus nicht von dem eines Handwerkers oder Kriegers. Der Achtung nach, die man Ferchar in Bragnreica entgegengebracht hatte, hielt ich den Bärenstamm für einen großen Stamm, dessen Reix eine prunkvolle Halle unterhielt. Aber vielleicht zog er es nur vor, abseits der Halle zu wohnen.
An dem niedrigen Tisch saß Ferchar mit einem Mann. Der Fremde wandte mir den Rücken zu, drehte sich jedoch um, als Ferchar zu uns hersah. Er neigte grüßend den Kopf.
Ich nickte zurück, ein wenig verwirrt. Auch er kam mir bekannt vor. Wohl einer der Krieger, die ich in Ferchars Lager in Bragnreica gesehen hatte.
Der Bärenkrieger eilte auf uns zu und nahm meinen Arm, um mich zum Tisch zu führen. Ich musste lachen.
»Deine Sorge ist rührend, aber ich kann gehen. Ich bin nicht verletzt, nur durchfroren.«
Ich hatte mich noch nicht auf den weichen Polster hingesetzt, da kam eine rundliche Dienerin auf Sannas Befehl schon mit einer Schüssel voll Eintopf herbei, den sie aus einem Kessel über dem Feuer geschöpft hatte.
Cú hatte den Mann am Tisch angeknurrt, sich dann aber zu meinen Füßen hingelegt, und ich hörte, wie er sich schmatzend mit der Zunge über die Lefzen fuhr, während Branna nicht so zurückhaltend war, sie sprang augenblicklich auf den Tisch und sah mit schiefgelegtem Kopf in die Schüssel hinein.
Über das ernste Gesicht des Mannes mir gegenüber huschte ein Lächeln.
Ich sah ihn an.
»Du warst im Tempel in Solva«, sagte ich. Wärme durchflutete mich mehr, als die Felle und Decken es vermocht hatten. Es geschah so selten, dass ich Menschen wiedersah.
»Du erinnerst dich an mich?«, fragte er.
»Wie könnte ich dich vergessen. Oder deine Tochter.« Ich musste husten, als ich an das begabte Mädchen dachte. »Ist sie hier? Ich würde mich sehr freuen, sie wiederzusehen.«
Der Mann verzog ein wenig das Gesicht, er freute sich offensichtlich nicht so wie ich. Das Mädchen hatte mir eine Geschichte erzählt und sie hatte ein Talent dafür. Ein großes Talent, wert, ausgebildet zu werden. Ich erinnerte mich, dass ihr Vater davon nicht sehr begeistert gewesen war.
Er schüttelte den Kopf.
»Sie ist nicht hier.«
Sanna sah erstaunt auf mich und den Mann.
»Smertrios ist mein Bruder«, sagte sie. »Und Aislin seine Tochter. Welch Zufall, dass ihr einander kennt!«
»Kennen ist zu viel gesagt«, meinte Smertrios. »Wir haben sie am Markt in Solva erzählen gehört.«
»Und danach haben wir im Tempel miteinander gesprochen«, ergänzte ich. »Und du hast deiner Tochter dann erlaubt, Ogmios, dem Gott der Redekunst, ein Opfer darzubringen.«
Über Sannas Gesicht glitt ein Lächeln, das etwas Belustigtes an sich hatte.
Ihr Bruder senkte den Blick, beinahe verlegen. Dann zuckte er die Schultern.
»Sie opfert ihm ständig. Wenn ich ihr sage, dass ich dir erneut begegnet bin …«
»Schade, dass jetzt im Winter die Wege so schwer zu bereisen sind. Sonst könnten wir sie holen lassen«, sagte Sanna und ließ sich neben mir auf einem Polster nieder. Cú hob den Kopf und sie kraulte ihn hinter dem Ohr.
»Du hättest sie gleich mitbringen sollen, Smertrios, anstatt alleine zu kommen. Du weißt, wie gerne wir sie hier haben.«
»Sie muss sich um Vercana kümmern«, sagte Smertrios und es klang, als hätte er das schon öfter gesagt.
Sanna wandte sich an mich und setzte zu einer Erklärung an.
»Smertrios’ Weib ist krank, deshalb ist er hier, denn das Heilwissen an ihrem Gehöft reicht nicht aus, ihr zu helfen.«
»Nun lass Arduinna doch erst einmal essen«, sagte Ferchar. »Alles andere hat Zeit.«
Ich nickte dankbar und vertiefte mich in meinen Eintopf, nachdem ich still den Göttern für die Nahrung und den sicheren Ort gedankt hatte. Ich schlurfte den dicken Saft, wohltuend heiß und salzig, bis nur noch die weichen Rüben und Fleischstücke übrig waren, die ich mir mit Genuss in den Mund schob. Es schien Ewigkeiten her, dass ich etwas Warmes in den Magen bekommen hatte. Kaum war ich mit dem Eintopf fertig, deutete Sanna der rundlichen Dienerin und diese brachte mir eine Schüssel mit süßem Hirsebrei aus einem Topf, der nahe der Feuerstelle stand.
»Oder willst du lieber noch Eintopf?«
Ich schüttelte den Kopf. Hirse. Ich war geübt darin, Wild zu jagen, Wurzeln, Kräuter und Blattwerk zu Eintöpfen zu verarbeiten, aber was mir der Wald nie bot, war Getreide. Ich liebte Getreide. Branna versuchte inzwischen, in der leeren Eintopfschüssel noch letzte Reste herauszukratzen. Sie war wohl ebenso hungrig wie ich.
Ich war froh, dass niemand sprach. Dass sie mich einfach essen ließen. Nach dem Schreck meines Sturzes machte sich langsam Erleichterung breit. Ich war nicht ertrunken. Der Flussgott hatte mich wieder ausgespuckt. Die Freundlichkeit, der ich hier nun begegnete, überforderte mich beinahe.
Seit ich Grannamuro kurz nach Samhain verlassen hatte, war ich nur auf wenige Gehöfte und Weiler gestoßen. Das Land hier bestand großteils aus lichtem Wald und ich hatte mich durch das kalte Wetter gekämpft, wie schon so viele Jahre immer wieder.
Und nun, nachdem ich beinahe gestorben war, saß ich in einem warmen Haus umgeben von Menschen, die ich kannte. Nicht gut kannte, aber kannte.
Als wollten die Götter etwas gutmachen.
Kapitel 5: Alleine
»Ich muss mich nun um das Leben da draußen kümmern. Ich werde deine beiden Begleiter mitnehmen, dass sie hinaus kommen. So ergeben wie sie dir sind, muss ich mir wohl keine Sorgen machen, dass sie weglaufen«, sagte Sanna, als ich wieder ins Bett kroch.
»Ganz gewiss nicht.« Ich nahm eher an, dass sie nicht mit ihr mitgehen würden.
»Ich werde ihnen zu essen geben. Solange du geschlafen hast, haben sie jedes Futter verweigert.«
Cú hob den Kopf und wedelte mit dem Schwanz und Branna spreizte die Flügel. Ja, das Wort Essen verstanden sie nur zu gut …
Erneut musste ich husten. Die Luft in der Kammer war stickig und Kohlenstaub-geschwängert.
Der Eintopf und die Hirse hatten mich schwindlig gemacht. Mein Magen war es nicht mehr gewohnt, so viel zu essen, schon gar nicht, wenn er von Husten und Kälte gebeutelt wurde. Als Sanna meinte, dass ich mich wieder hinlegen solle, war das ein willkommener Vorschlag gewesen.
Sie beugte sich zu mir und schob die Decken rund um mich fest, wie man ein kleines Kind ins Bett stecken mochte.
»Und du bleibst schön hier liegen und ruhst dich aus. Das ist ein Befehl. Der Befehl der Frau des Anführers.«
Sie beugte sich noch tiefer, ihr Gesicht nahe an meinem. Ihre Augen blickten suchend über meine, sie strich mir eine verschwitzte Haarsträhne hinters Ohr.
Es tat gut, umsorgt zu werden. Einfach hier liegen zu können und für nichts verantwortlich zu sein.
Sanna zögerte, verharrte halb über mich gebeugt.
»Was machen Barden, wenn es ihnen nicht gut geht?«, fragte sie. »Ich meine, für hier.«
Sie deutete auf ihre Brust und setzte sich auf die Bettkante. Cú, der bereits ungeduldig zur Türe gegangen war, legte sich mit einem Seufzen hin. Branna war nicht so geduldig, sie krächzte ein »Raabe!«, ehe sie sich auf dem Kopf ihres vierbeinigen Freundes niederließ. Sanna bemerkte es nicht. Ihr Blick ruhte auf einem Bogen, der neben dem Bett an der Wand hing, gemeinsam mit einem gefüllten Köcher.
»Den Kindern erzählt man Geschichten, wenn sie krank sind«, fuhr sie fort, »oder singt ihnen Schlaflieder. Aber man kann wohl einem Barden nichts vorsingen. Das würde ihn doch höchstens belustigen …«
»Was machst du, wenn es dir schlecht geht?«, fragte ich matt.
Ihr Lächeln war warm, als hätte ich sie genau das Richtige gefragt. »Oh, das ist einfach. Ich lasse Pfeile fliegen. Das habe ich immer schon gemacht. Ich bin wirklich gut darin, besser als die meisten Männer.«
Unwillkürlich lächelte ich.
»Dann bist du das, von der Ferchar erzählt hat in Bragnreica. Die den Bogenbewerb gewann.«
»Das hat er erzählt?« Sie wirkte erstaunt.
Ich erinnerte mich an das Leuchten in den Augen des Bärenkriegers, als er mir von dieser Frau erzählte. Ich hielt es damals für die Begeisterung an der Geschichte, nun wurde mir klar, dass es die Liebe zu seiner Frau war. Ich beneidete sie.
»Das hat er«, sagte ich und hustete.
Sie strich mit der Hand über die Bettdecke und dann huschte ein verschmitztes Lächeln über ihr Gesicht.
»Er hat auch viel von dir erzählt. Auch von den anderen Barden dort und ihren Liedern auf der Leier, aber hauptsächlich von dir, deinen Geschichten und was du getan hast. – Oh, das macht ein Barde wohl, wenn es ihm schlecht geht! Er spielt sich selbst ein paar Lieder auf der Leier.«
Ja, ich hatte mir oft zum Trost ein Lied gespielt auf meinen einsamen Wanderungen. Bis zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren, als meine Leier zerstört worden war. Es schmerzte immer noch, daran zu denken.
»Ich habe keine Leier mehr«, sagte ich.
»Ja, natürlich … leider.«
Sie vermutete wohl, dass ich meine Leier mit all den anderen Sachen im Fluss verloren hatte, aber ich hatte keine Lust, den Irrtum aufzuklären. Es war auch unerheblich.
Sie warf erneut einen Blick auf ihren Bogen.
»Dort habe ich Ferchar kennengelernt«, sagte sie. »Auf dem Weg nach Bragnreica. Smertrios und ich waren damals unterwegs, um für unseren Stamm einen ganz besonderen Bogen zu finden … Er ist ein wirklich guter Bogenbauer, mein Bruder. Und Ferchar ein wirklich guter Mann«, fügte sie mit einem Lächeln hinzu. Sie betrachtete mich erneut wie eine Mutter ihr krankes Kind betrachtet und erhob sich dann mit einem Seufzer.
»Du sollst jetzt aber wirklich schlafen. Und ich muss sehen, dass die Männer in der Halle nicht zu viele Dummheiten anstellen …«
Ich sah Sanna nach, wie sie mit Cú und Branna das Zimmer verließ. Leise schloss sie die Tür hinter sich.
In einem eigenartigen Zustand war ich. So wie damals, in jenem ersten Mond, nachdem Morfran mich verflucht hatte. Froh, am Leben zu sein. Froh, im Warmen und in Sicherheit zu sein. Und seltsam unberührt von allem anderen. Es war ein gefährlicher Zustand, wusste ich, ließ einen die wichtigen Dinge missachten. Ich hatte damals viel Zeit vergeudet, anstatt mich für das Leben im Wald vorzubereiten. Und ich war nachlässig gewesen, was das Zählen der Tage betraf. Nun, inzwischen waren drei-mal-drei Jahre vergangen, ich hatte genug Erfahrung, dass sich so etwas nicht mehr wiederholen würde. Es war ja nur ein Tag, ein einziger Tag, den ich mir gönnte, mich auszuruhen und die Gedanken an all das Verlorene von mir zu schieben. Nur ein Tag, kein halber Mond.
Alleine. Einfach noch ein wenig schlafen.
Hier, im Warmen, Geborgenen.
Ich schmiegte mich in die Decken und Felle. Meine Lunge schmerzte etwas, aber mein Körper war an Kälte und Nässe gewöhnt, in ein paar Tagen wäre der Husten wieder vorbei. Das Knie war aufgeschürft, auch das würde rasch heilen.
Meine Augen wollten mir schon wieder zufallen, meine Hand legte sich von selbst unter die Kuhle meines Halses, dort, wo sie jede Nacht ruhte, auf Loïcs Fibel.
Dort, wo nun nichts war.
Keine Fibel an ihrem ledernen Band.
Die Wohligkeit machte eisiger Kälte Platz.
Dass ich erneut alles verloren hatte, damit konnte ich leben. Aber dass ich Loïcs Fibel verloren hatte … Gestorben war ich beinahe in dem Fluss, gestorben, ohne ihn jemals wiedergesehen zu haben.
Die Tränen kamen, still und warm zuerst, dann heftig und heiß. Das Zittern begann erneut, ein Japsen nach Luft. Der Schreck suchte sich seinen Weg, schüttelte mich wie ein Hund seine Beute. Dann tauchte die Erinnerung auf. An die Stimme, die in meinem Kopf geschrien hatte. Es war Loïcs Stimme gewesen, ganz gewiss. Ihr Klang war in mein Gehör eingeritzt wie das Bardenzeichen in meine Schläfe.
Ich schnappte nach Luft, als tauchte ich erneut aus dem eisigen Fluss auf. Ja, es war seine Stimme gewesen. Alle Zweifel, die mich in Solva befallen hatten, waren mit einem Schlag wie weggewischt. Mochte die Stimme sonst immer klanglos gewesen sein, sodass ich schon befürchtet hatte, es wäre nicht er, der des Nachts mit mir sprach, nun war ich sicher. Warm durchflutete mich die Gewissheit.
Ein Schluckauf stieg empor, ließ mich lachen. Es war keine zwei Monde her, dass ich seine Fibel erst erhalten hatte. Ich hatte davor ohne sie gelebt. Ich würde es eben wieder tun.
Loïc hatte mich angebrüllt. Er hatte mir das Leben gerettet. Er war hier, bei mir. Das Band zwischen uns war stark wie eh und je. Stärker, wurde mir klar. Noch nie hatte er so direkt mit mir geredet, als fühle er nicht nur meine Stimmung, sondern sähe mich.
Ich zog den Rotz die Nase hoch und wollte die Tränen in meinen Ärmel wischen, unterließ es aber, denn die Camisia, die Sanna mir gegeben hatte, war zu wertvoll.
Es gab keinen Grund zu weinen. Mochten die Götter ihren Spaß daran haben, mich von Herausforderung zu Herausforderung zu schicken, sie waren doch äußerst gnädig, dass sie mich gerade hier hatten halb ertrinken lassen. In der Nähe von Menschen, die mich kannten und aufgenommen hatten. Ich sollte den Göttern eine Dankesgabe darbringen.
Ich schob die Felle und Decken von mir und stand auf. In diesem Augenblick öffnete sich die Türe und die rundliche Dienerin stand darin, eine Schüssel in der Hand.
Sie sah mich an, warf einen Blick hinter sich, als überlege sie, ob sie melden solle, dass ich aufgestanden war.
»Ich …«, sagte ich, wie ein ertapptes Kind, das um eine Ausrede verlegen war. Doch sie verstand mein zielloses Schulterheben wohl als Scham.
Sie deutete mit dem Kopf zu einem Holzkübel, der in der hinteren Ecke der Kammer stand und mit einem dicken Brett abgedeckt war.
Ich nickte.
Sie stellte die Schüssel, aus der es dampfte und duftete, auf die Truhe neben dem Bett und schob das kurze Tuch zurück, das um ihren Kopf gewickelt war und nach vorne rutschte.
»Die Herrin sagt, sie befiehlt, dass das aufgegessen wird.«
Ich nickte erneut und konnte ein Lächeln nicht verkneifen. Ich hatte doch gerade erst gegessen. Wie dünn musste ich aussehen, dass sie meinte, mich mästen zu müssen. Doch der Duft ließ meinen Magen knurren. Es gab kein Zuviel an Essen, wenn es Winter war.
Einen Augenblick später war ich wieder alleine. Ich nutzte den Kübel, mich zu erleichtern. Es war dunkel in der Kammer, nur durch die kleine Rauchöffnung unter dem Dach schien fahles Licht herein. Ich hörte Kinder rufen und lachen.
Ich schob den Fensterladen ein Stück auf und schaute hinaus. Hell war es, obwohl der Himmel mit Wolken bedeckt war. Strahlend weißer Schnee verhüllte das Dorf. Es hatte also geschneit, während ich geschlafen hatte.
Auf dem Weg, der neben dem Haus vorbei führte, standen zwei Frauen, in ein Gespräch verwickelt. Die eine trug einen in Decken gehüllten Säugling auf dem Arm, die andere ein Bündel Schilf auf dem Rücken. Sie lächelten beide über die Versuche des Säuglings, das wippende Schilfrohr zu greifen.
Hinter einer freien Fläche, auf der im Sommer wohl Gemüse wuchs, liefen drei Kinder. Das Mädchen stockte, sah zu mir her. Ein schüchternes Lächeln schob sich in ihr Gesicht, einen kurzen Augenblick, ehe zwei Schneebälle sie trafen. Sie riss erschrocken die Augen auf, dann sah sie wieder zu mir und lachte, winkte mir zu. Hinter ihr hielten nun auch die beiden Buben inne, das nächste Wurfgeschoss bereits in Händen, und folgten dem Blick ihrer Freundin. Auch sie winkten, ehe sie jauchzend weiterliefen.
Tief atmete ich ein. Die kalte Luft tat gut. Sie legte sich angenehm weich und kühl auf meinen Rachen, der sich rau anfühlte wie die Zunge einer Kuh.
Der Schnee würde nicht halten, wieder nicht, wie so oft in den letzten Tagen, dazu roch es zu feucht.
Schnee. Und ich durfte im Warmen sein.
Branna kam über das Dach angeflogen, landete zielsicher auf meinem Arm.
»Mooorgn«, krächzte sie und rieb ihren Schnabel an meiner Wange. Sie roch nach Fisch, vereinzelte Schneeflocken glitzerten auf ihrem Gefieder.
Das Dorf lag friedlich da. Nicht nur, weil der Schnee die Geräusche dämpfte und alles wie eine kalte Decke einhüllte. Die Menschen hier hatten etwas Zufriedenes.
Hinter mir knarrte die Tür.
Ich drehte mich um und ein junger Bursche stand da, dünn und schlaksig, unter einen Arm einen Korb geklemmt, eine rauchende Pfanne in der anderen Hand.
Für einen Augenblick wirkte er verlegen und wandte den Blick von mir ab. Oder vielleicht war er auch nur durch Branna verwirrt, die auf dem Bett auf ihn zu hüpfte und ihn neugierig betrachtete.
»Guuutermann«, gurrte die Rabin mit schiefgelegtem Kopf.
»Ich soll mich ums Feuer kümmern«, sagte der Bursche.
Er leerte den Inhalt der Pfanne – einige Stücke glühender Kohlen – in die große Eisenschale, die in der Mitte des Raumes stand, ehe ich etwas sagen konnte. Asche schwebte wie ein Nebel hoch, sank wieder nieder.
Dann schichtete er einige dünne Holzstücke darauf, die rasch zu rauchen und zu brennen begannen.
»Die Herrin sagt, es muss ordentlich warm sein.«
Er legte Kräuter ins Feuer, die er ebenfalls in dem Korb mitgebracht hatte. Der Duft von Beifuß und Lattich breitete sich aus. Ich hustete.
»Der Druide hat es angeordnet«, sagte der Bursche beinahe entschuldigend. Er wedelte mit seinen langen Händen über den Flammen und warf einen Blick zur Fensteröffnung.
»Soll ich es schließen?«, fragte er. »Als der Druide dich untersuchte, sagte er, Wärme wäre nun das allerwichtigste.«
»Als … der Druide mich untersuchte?« Ich hatte keine Erinnerung daran. Heiß schoss Angst in mir hoch. Ich starrte ihn wohl an, denn der Bursche hielt in seinem Weg zur Fensteröffnung inne.
»Ja. Als man dich herbrachte. Er hat mir auch die Kräuter heute gegeben.«
»Wann … war das? Wie lange bin ich schon hier?«
Niemals die Anzahl der Tage missachten. Niemals vergessen, mitzuzählen. Zweimal war es geschehen, einmal im allerersten Mond nach dem Fluch, als ich durch das Fieber eine Nacht verloren hatte. Und einmal, als ein Mann mich nicht gehen lassen wollte … nie wieder. Das erste Mal hatte Loïc einen Unfall mit dem Pferd erlitten, das andere Mal – ich wusste nicht, was Loïc damals passiert war, wusste nur, dass er lebte, weil ich in der nächsten Nacht erneut die Stimme im Traum spürte. Doch ich wusste, was dem Mann widerfahren war. Allen, die meinem Herzen nahe standen, geschah Unheil, wenn ich länger als einen halben Mond an einem Ort verweilte.
Der Bursche starrte mich immer noch an, als müsse er sich Sorgen um meinen Verstand machen.
»Gestern. Man hat dich gestern hierher gebracht, nachdem man dich am Fluss fand. Du hast doch selbst dem Druiden gesagt, dass dein Hund ihn beißt, wenn er dir zu nahe kommt.«
Ich fühlte Röte in meine Wangen steigen.
»Oh«, sagte ich.
Gestern. Ich brauchte eine Schnur … Mein Gürtel, an dem auch mein Knotenband hing, trieb irgendwo im Fluss …
Während der Bursche den Fensterladen schloss, sah ich mich im Zimmer um. Vor dem Gewichtswebstuhl neben der Fensteröffnung stand ein Korb, in dem einige Rollen mit gelbem Garn lagen. Die Rigana würde mir gewiss verzeihen, wenn ich ein kurzes Stück nahm. Eine dünne Schicht Kohlestaub lag auf den Wollknäueln, als ich eines hochhob.
»Ich gehe dann«, sagte der Bursche hinter mir, »wenn du nichts mehr brauchst.«
Ich nickte, in Gedanken ganz woanders.
Mein Blick schweifte über den Webstuhl, während ich mir den Wollfaden um das Handgelenk band und in eines der Enden einen Knoten machte. Ein Knoten für eine Nacht. Sieben in jedem Ende der Schnur, auf keinen Fall auch nur einer mehr.
Auch auf dem Webschwert, das auf dem Litzenstab lag, fand sich Staub. Es musste Monde her sein, dass jemand hier gewebt hatte.
Es kratzte an der Türe. Branna krächzte, jenes begeistere Krächzen, wenn Cú sich näherte.
Ich öffnete ihm und er schüttelte sich, zufrieden grinsend. Zielstrebig ging er auf die Truhe zu, auf der die Schüssel mit Essen stand. Branna saß daneben, fiel mir erst jetzt auf. Ich konnte froh sein, wenn sie noch etwas übrig gelassen hatte.
Kapitel 6: Der Wunsch der Schwester
Sie sah nicht mehr ganz so bleich aus, stellte Smertrios fest, als er Arduinna am Abend wiedersah. Dennoch war ihr anzumerken, dass es sie Mühe kostete, am Tisch zu sitzen und zu lächeln.
Lenius, der schlaksige Junge, der seit längerem als Ferchars Bursche diente, legte gerade Holz in der Feuerstelle nach, obwohl es ohnehin ungewöhnlich warm war im Haus. Während die rundliche Tlachtga am Webstuhl stand, saß Sanna gegenüber der Fremden am Boden und ölte ihren Bogen. Sie hatte wohl gerade etwas erzählt, als Smertrios mit Ferchar eintrat, denn sie unterbrach sich mit einem »Ach, nicht so wichtig« und lächelte ihrem Mann entgegen.
Arduinna hustete und schlang eine Decke enger um sich.
»Der Arrabo hat dich ordentlich durchfroren«, sagte Ferchar. Er warf seinen Umhang auf eine der Truhen neben der Türe und sogleich eilte Lenius, ihn aufzuhängen. Smertrios sah den belustigten Blick, den Sanna ihrem Mann zuwarf.
»Nicht so schlimm«, sagte Arduinna mit heiserer Stimme. »Morgen geht es mir wieder gut.«
Ferchar setzte sich zu den beiden. Smertrios wusste nicht so recht, ob er Lust dazu hatte. Er hasste die Untätigkeit, zu der er hier gezwungen war. Gewiss, er hatte heute Ferchar zu den Pferden begleitet. Er hatte nach seinem Ochsen gesehen, der draußen auf der Weide stand bei den anderen Kühen, alle den Kopf verdrossen gesenkt und den Schneefall erduldend. Daheim stünde das Tier nun im Stall. Aber sie hatten daheim auch nur vier Kühe, nicht eine ganze Herde wie hier.
Aber sonst hatte er nichts getan, es gab hier für ihn nichts zu tun. Er hatte gedacht, er käme hierher, der Druide gäbe ihm ein Heilmittel für Vercana, und er führe wieder nach Hause, anstatt tagelang warten zu müssen. Immerhin hatte er gleich eine ganze Lieferung seiner Bögen mitgebracht und Ferchar hatte großzügig gezahlt. Vielleicht sollte er hinüber in die Große Halle gehen. Bei den Kriegern war immer etwas los am Abend, es würde ihm die Zeit verkürzen, ihren Witzen zu lauschen.
Sanna sah zu ihm auf.
»Setz dich doch. Tlachtga, bring den Männern Met.«
Er legte seinen Umhang ab, ließ sich an der Schmalseite des niedrigen Tisches nieder. Der Hund unter dem Tisch knurrte ihn an, was einen erstaunten Blick seiner Herrin zu ihm zur Folge hatte.