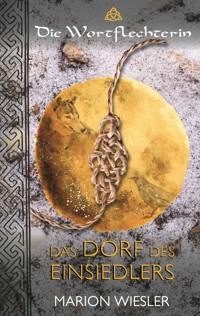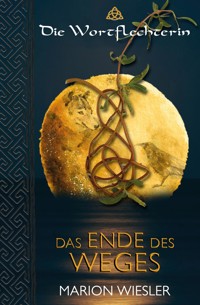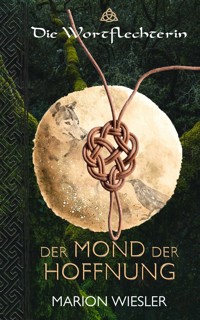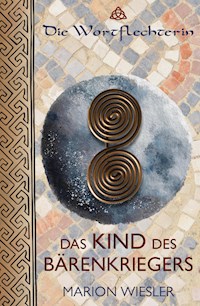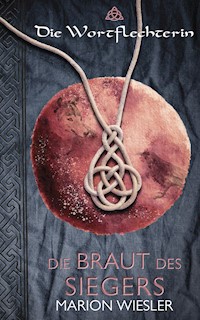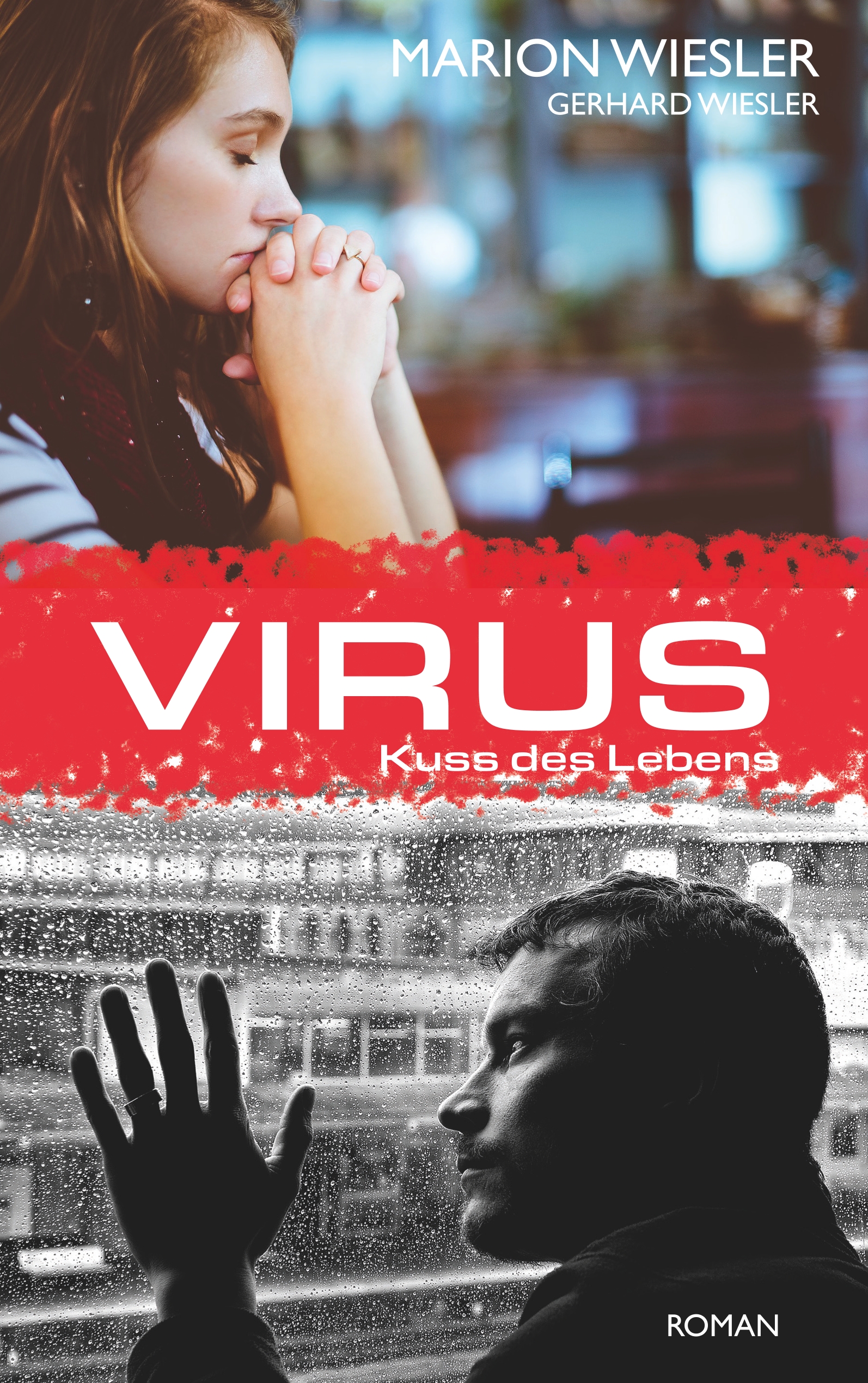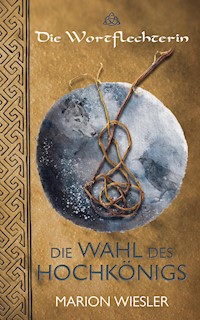
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Machtvolle Worte sind die Gabe der Bardin, der Mond ihre Herrin, ein Fluch ihr Antrieb. Norikum, im Jahr 38 vor unserer Zeitrechnung. Ihr eigener Meister hat ein grausames Gebot über die junge Bardin verhängt: nur durch ihre ständige Wanderschaft kann sie den Mann schützen, den sie liebt. Sie ist auf sich gestellt, in einer gefährlichen Welt als Frau alleine unterwegs mit einem Wolfshund und einem Raben, abhängig von ihren eigenen Fähigkeiten, um zu überleben. Nun zwingt eine Verletzung ihres treuen Begleiters sie zu einem Aufenthalt in der befestigten Stadt des norischen Herrschers Voccio. Dieser will die keltischen Stämme nördlich der Alpen unter seiner Herrschaft vereinen, um den Römern machtvoll entgegentreten zu können. Arduinnas Fähigkeit, Worte gezielt wie Pfeile zu nutzen, macht sie zum Spielball im Kampf um die Macht – und plötzlich geht es um Leben und Tod. Band 1 der Keltenroman-Serie "Die Wortflechterin" nach dem Prequel "Die Zeit des Aufbruchs". Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marion Wiesler
Die Wahl des Hochkönigs
Keltenroman
Die Wahl des HochkönigsBand 1 der Serie "Die Wortflechterin"Inhaltsverzeichnis
Landkarte
Noricum
Weitere Bände der Serie
Arduinnas Lied
Prolog: Drei-mal-drei Jahre zuvor in Gallien
Kapitel 1: Tanz in den Morgen
Kapitel 2: Ein einsamer Hof
Kapitel 3: Der Keiler
Kapitel 4: Der Morgen danach
Kapitel 5: Gair, der junge Krieger
Kapitel 6: In der Duron
Kapitel 7: Erstmals in der Großen Halle
Kapitel 8: Der Unglücksvogel
Kapitel 9: Ein Geschenk und eine Drohung
Kapitel 10: Der junge Herrscher
Kapitel 11: Das Wettreiten
Kapitel 12: Am Weg zurück
Kapitel 13: Ein Abend in der Halle
Kapitel 14: Allein mit dem Herrn Bragnreicas
Kapitel 15: Das Morgenritual
Kapitel 16: Der Beginn der Verhandlungen
Kapitel 17: Die Wettkämpfe
Kapitel 18: Das blaue Auge
Kapitel 19: Alleine im Stall
Kapitel 20: Die Verhandlungen
Kapitel 21: Das Ende des Abends
Kapitel 22: Der Anführer des Bärenstammes
Kapitel 23: Ein nächtliches Gespräch
Kapitel 24: Nachts im Stall
Kapitel 25: Eine bedeutende Begegnung
Kapitel 26: Vercingetorix
Kapitel 27: Verwirrung
Kapitel 28: Erinnerungen
Kapitel 29: Treffen im Mondenschein
Kapitel 30: Gespräch mit den Herrschern
Kapitel 31: Ein Treffen im Stall
Kapitel 32: Das Pferdeopfer
Kapitel 33: Die Verkündung
Kapitel 34: Zurück zur Duron
Kapitel 35: Lauschend
Kapitel 36: Bei Voccio
Kapitel 37: Fortschritte
Kapitel 38: In der Halle
Kapitel 39: Geflochtene Worte
Kapitel 40: Abends
Kapitel 41: Erneute Enttäuschung
Kapitel 42: Desaster
Kapitel 43: Entscheidung
Kapitel 44: Unruhe
Kapitel 45: Der Beginn
Kapitel 46: Der Kampf
Kapitel 47: Der Wein
Kapitel 48: Tumult
Kapitel 49: Die Feier
Kapitel 50: Abschiede
Kapitel 51: Bei der Kräuterfrau
Kapitel 52: Eine einzige Nacht
Kapitel 53: Ein neuer Morgen
Lust auf ...
GLOSSAR
GESCHICHTEN:
PERSONEN:
Weitere Bücher der Serie
Weitere Bücher aus der Welt der »Wortflechterin« :
Geschichtliches
Danksagung
Impressum
Landkarte
Noricum
im Jahre 38 vor unserer Zeitrechnung
(für die Serie bedeutsame Orte)
mit * versehene Namen sind historisch nicht nachgewiesen
Bragnreica:
Das heutige Deutschlandsberg, das ich als Herrschersitz des Voccio erkoren habe
Solva:
Später Flavia Solva, bei Leibnitz
Murus:
Der Fluss Mur
Arrabo und Aba acos:
Raab und Feistritz
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband)
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Arduinnas Lied
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Prolog: Drei-mal-drei Jahre zuvor in Gallien
Ich konnte mich nur auf die spitzen Steinchen konzentrieren, die in meine Unterschenkel drückten. Die Erde, auf der ich vor Morfrans Beinen kniete, war alles, was mir noch Halt bot. Ich würde nicht weinen. Ich würde nicht schreien und schon gar nicht zu Loïc stürzen.
Der eiserne Griff Morfrans in meinem Nacken würde es nicht ermöglichen.
Vorsichtig hob ich den Kopf und sah durch meine zerzausten Haare hindurch. Alle standen sie da. Und ich in der Mitte, angestarrt wie ein fliegendes Kalb, bloß in meinem dünnen Kleid, ohne Gürtel, mit offenem Haar, wie frisch aus dem Bett gerissen.
Nicht einmal eine Nacht war uns vergönnt gewesen.
Jemand musste Loïc's Vorhaben verraten haben.
Meine Augen suchten ihn. So wie ich von meinem Maistir zu Boden gedrückt wurde, so wurde er von seinem Vater an jeglichem Widerstand gehindert. Die Finger des Reix gruben sich tief in Loïcs Oberarm. Man hatte ihm nicht einmal die Zeit gegeben, seine Camisia anzuziehen, mit nacktem Oberkörper stand er vor allen. So, wie ein Krieger in den Kampf ziehen mochte. Ich konnte seine Umarmung noch um mich fühlen und es schmerzte, dass er mich nun nicht schützend halten konnte. Sein Vater war stark, ein mächtiger Krieger, ruhmreich im Kampf gegen die Römer gewesen, wenn auch nicht auf Dauer. Aber es war nicht der Reix alleine, der Loïc zum Stillhalten zwang. Da waren die beiden Krieger hinter ihm, zwei derer, von denen wir heute Morgen im Wald gefunden worden waren, engumschlungen. Sie drückten die Spitzen ihrer Speere in Loïcs Rücken, wie man einen bissigen Wolf im Zaum hielt.
Der Sohn des Reix.
Behandelt wie ein Gefangener.
Doch seine Augen ruhten nur auf mir. Ich konnte sehen, wie seine Wangen zuckten. Er presste die Zähne aufeinander. Ich liebte dieses Gesicht. Ich würde nicht weinen.
Neben ihm ein Fremder, edel gekleidet. Ein schwerer, prunkvoller Torque um den Hals, dicke goldene Reifen an den Armen. Der Reix der Mandubier. Der Vater von Loïcs Braut. Jenem blassen Mädchen, das sich an ihreMutter, oder was die rundliche Frau sonst sein mochte, drängte. Und rundum Krieger. Männer mit Schwertern. Dahinter Händler, Handwerker, Bauern. Ganz Vesontio hatte sich versammelt, um Teil zu haben an dem, was hier geschah.
Und ich in der Mitte …
Nein, ich würde nicht weinen.
»Ist das die Art, wie die Sequaner ihre zukünftige Rigana begrüßen?«, donnerte der fremde Reix über den Platz vor der Großen Halle. »Ist das die Art, wie sie Bündnisse einhalten? Es ist ein Schlag ins Gesicht jeglicher Gastfreundschaft, dass wir hier ankommen und der Mann, der meine Tochter, edelste der Mandubier, zur Frau bekommen soll, muss erst verzweifelt gesucht werden – und aus den Armen einer Käuflichen gerissen werden, mit der er auf und davon wollte!«
»Sie ist keine Käufliche!«, schrie Loïc. »Bei Lug, sie ist die Frau, der mein Herz gehört, und das können alle wissen!«
Morfrans Griff in meinem Nacken zog sich zusammen, als müsse er eine Schlange an der Flucht hindern.
»Schweig!«, zischte Loïcs Vater und riss ihn am Arm. »Du hast schon genug Unheil angerichtet!«
Die Menge ringsum flüsterte, wie eine Meereswelle drang ihre Schaulust auf mich ein, ertränkte mich.
»Nun«, sagte der Reix der Mandubier mit kalter Stimme. »Wenn dieses Weib ihm so den Kopf verdreht hat, dass er darüber einen Krieg zwischen unseren Stämmen in Kauf nimmt ...«
»Nein!« warf Loïcs Vater hastig ein. »Nein, niemand will Krieg. Wir wollen ein Bündnis mit euch. Es war nur die Dummheit der Jugend.«
Seine Finger bohrten sich noch fester in Loïcs Arm.
Ich senkte den Kopf, starrte auf mein Kleid, das voller Staub war. Es war keine Dummheit. Wir hatten einander gefunden. Seit ich mich erinnern konnte, hatte mein alter Maistir mir immer wieder Geschichten erzählt, in denen es um die Liebe ging. Ich hatte gemeint zu wissen, was Liebe war, hatte es in jeder Faser meines Körpers gespürt, als Tegid, mein geliebter Maistir, in meinen Armen gestorben war. Aber Loïc war noch mehr. Tegid war die Hand gewesen, an der ich durch die Kindheit geführt worden war. Loïc war ein Gefühl von Heimat, wie ich es seit meinem Aufbruch von jenseits des schmalen Meeres nicht mehr gespürt hatte. Ein Erkennen.
Als ich vor mehr als einem Mond an unserem ersten Abend hier von Morfran vorgestellt wurde und für alle ein Lied sang, hatte Loïc mich danach angesprochen. Er stellte aufmerksame Fragen und wusste Dinge über den Helden des Liedes, die mir selbst fremd waren. Er hatte mich angelächelt, dass mein ganzer Körper zu klingen begonnen hatte wie die Saiten meiner Leier. Als er meine Finger wie nebenbei berührte, erschraken wir beide, denn wie ein Blitz in eine trockene Eiche war das Feuer des Erkennens in uns gefahren. Wir kannten einander. Wir waren von den Göttern dazu bestimmt, eins zu sein.
Tag für Tag freute ich mich auf den Abend in der Halle. Loïc brachte mich zum Lachen. Liebkoste mich mit seinen Augen. Bald suchten unsere Hände verstohlen den Weg zueinander. Bald lagen wir einander heimlich und voller Sehnsucht in den Armen. Er liebte mich wie ich ihn. Mich, die junge Bardin, die mit dem großen Morfran, Morfran der Habicht, gekommen war.
Dessen Griff in meinem Nacken wurde noch fester, er zerrte mich hoch.
Ich wagte es, Morfran anzusehen. Wütend blitzten seine Augen mich an. Er hatte recht, wütend zu sein, das wusste ich. Ich war letzte Nacht mit Loïc aus der Dunon verschwunden, als ein Bote meldete, dass seine Braut am nächsten Morgen ankäme. Loïc hatte seinen Torque abgenommen, all seine goldenen Armreifen und etwas Proviant in ein Bündel gepackt und mich angefleht, mit ihm davonzureiten, ein neues Leben zu beginnen. Mit ihm. Weil wir zusammengehörten wie Leier und Lied.
Und ich war gerne gegangen. Mein Dasein war nicht leicht gewesen, seit Tegid gestorben war. Morfran war nur Härte und Strenge. Kaum ein Lob, nie ein warmes Lächeln.
Aber die Flucht war dumm gewesen. Das sah ich nun ein.
Morfrans Griff in meinem Nacken schmerzte.
Loïcs Vater starrte mit nervösen Augen in unsere Richtung.
»Wer weiß, wenn ich die Sache nun so betrachte, ob nicht die Carnuten absichtlich ihren Barden mit diesem jungen Vögelchen geschickt haben, um einen Keil zwischen das Bündnis der Sequaner mit den Mandubiern zu treiben!«
Morfrans Hand in meinem Nacken nahm mir beinahe den Atem, als seine Finger sich zusammenkrallten.
»Nie würden die Carnuten so etwas tun«, sagte er mit seiner tiefen, wohlklingenden Stimme.
Wie konnte er seine Stimme so ruhig und kräftig halten? Sein angespannter Griff an meinem Nacken zeigte mir deutlich, wie viel Anstrengung es den Barden kosten musste, so beherrscht zu sprechen.
»Doch ich gebe zu, dass es ein Fehler war, meine Schülerin mitzubringen. Ich bin gewöhnt an ihre Stimme, ich habe nicht bedacht, dass sie in eurem Sohn Gefühle erzeugen könnte.«
»Wenn ich nur die leiseste Spur finde, dass du doch im Sinne der Carnuten ...«, sagte Loïcs Vater drohend.
»Nun, die Sache ist wohl recht einfach«, fuhr der Reix der Mandubier dazwischen und trat einen Schritt vor, die Hand auf seinem Schwertgriff ruhend. Ich zog die Schultern hoch. Er war ein beeindruckender Mann, keiner, dem man zu widersprechen wagte. Die Sonne glitzerte auf seinem goldenen Torque. Er sah langsam in die Runde, schien jeden Bewohner der Dunon zu betrachten, der hier neugierig staunend dastand. Er nickte, als hätte er nun einen Entschluss gefasst.
»Bei den Göttern, die dies hier sehen, da dieses Mädchen der Grund des Übels ist, verlange ich, dass sie hingerichtet wird! Ein Opfer für die Götter, für den Frieden zwischen unseren Stämmen und für eine gesegnete Ehe unserer Kinder!«
Die Menschen ringsum sogen die Luft ein, murmelten aufgeregt.
Ich meinte, dass meine Beine nachgeben würden, wenn Morfran mich nicht am Nacken hielte.
Der gab ein eigenartiges Stöhnen von sich.
»Nein!«, schrie Loïc.
»Sie ist eine Bardin!«, warf sein Vater beinahe empört ein. »Sie steht unter dem Schutz der Götter!«
»Eine Bardin?« Der Reix der Mandubier schnaubte. »Sie ist ein junges Weib, kaum älter als meine Tochter!«
Morfran zog mich näher, sein Arm presste mich fest an ihn, seine breite Brust warm in meinem Rücken. Fast schützend, schien es mir, würde er nicht gleichzeitig mit der anderen Hand meinen Kopf zur Seite drücken, um meine linke Schläfe zu offenbaren.
»Hier!«, rief Morfran und seine Stimme klang plötzlich schrill. »Sie trägt das Zeichen der Barden, die Götter haben sie als solche anerkannt.«
Der Reix der Mandubier trat an uns heran. Die Menge ringsum schien ebenfalls näher zu kommen, neugierig, gespannt. Sie alle hatten mich singen gehört, und doch wollten sie es genauer sehen.
Der Reix roch nach Pferd und Rauch, auf dem dicken Schnurrbart glänzte Schweiß trotz des kühlen Frühlings-morgen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen betrachtete er die drei blauen Punkte, ein nach vorne geöffnetes Dreieck, einem singenden Mund gleich. Tegid hatte es mir eintätowiert, ein wenig überhastet, als wir vor bald drei Sommern über das schmale Meer nach Gallien gekommen waren.
Die Augen des Reix fixierten mich.
Ich zwang mich, den Blick nicht zu senken. Morfrans Hand auf meiner Stirn war kalt, sein Griff fest.
»Seit die Römer über uns herrschen, zählen die Barden nicht mehr so viel wie einst ...«, sagte der Reix ruhig und kalt. »Die Ehre meiner Tochter und das Bündnis zweier Stämme sollten solch ein Opfer wert sein ...«
Er wandte sich ab, sein Blick glitt zu Loïc. »Das wird meinen zukünftigen Tochtermann vielleicht lehren, sein Weib zu achten und zu lieben.«
Ich sah Loïcs Hand zu seiner rechten Seite greifen, doch man hatte ihm sein Schwert abgenommen, als die Krieger uns heute zurück nach Vesontio geschleppt hatten.
Morfran stieß mich erneut zu Boden, schritt einmal im Kreis um mich, als müsse er nachdenken.
Ich keuchte, Staub legte sich in meinen Mund.
Schweigen breitete sich über den weiten Platz vor der Großen Halle, alle sahen gespannt auf den Mann, der erst gestern gemeinsam mit dem Barden der Dunon Heldenlieder gesungen hatte.
»Ihr habt Recht«, sagte Morfran ruhig. »Sie muss bestraft werden. Sie hat beinahe einen Krieg, nein, zwei Kriege entflammt, zwischen drei Stämmen, die eigentlich in Freundschaft verbunden sind. Ich kann nicht über den Sohn der Sequaner bestimmen, doch ich kann dafür sorgen, dass sie ihre Strafe erhält und die Götter besänftigt werden.«
Er war so viel jünger als die beiden Herrscher, lange nicht alt genug, mein Vater zu sein. Doch er hatte eine Wirkung, mehr einem Krieger denn einem Barden gleich. Er ließ die Menschen verstummen, wenn er das Wort erhob.
Er sah zu mir hinab. Seine Augen glänzten fiebrig, wie ich es noch nie erlebt hatte. Sein Haar war verschwitzt, seine Wangen blass. Er hatte wohl die ganze Nacht nicht geschlafen. Meinetwegen. Meiner Liebe zu Loïc wegen, die drei Stämme in den Krieg stürzen könnte.
Ich zitterte am ganzen Körper. Er war noch nie milde zu mir gewesen und es würde mich nun nicht wundern, wenn er doch zu seinem Messer griff. Er hatte mich nur aufgenommen, weil ich nach Tegids Tod verzweifelt zu ihm gerannt war, blutüberströmt. Weil die Rigana der Carnuten sich meiner angenommen hatte, ihm die Verantwortung für mich übertragen hatte. Er würde mich opfern, wenn er damit den Verdacht von seinem Stamm waschen konnte.
Morfran wandte den Blick ab, als müsse er sich losreißen. Er klatschte je dreimal in alle vier Himmelsrichtungen, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erwecken.
»All ihr Götter, die ihr uns hier seht, all ihr Menschen vom Stamm der Sequaner, all ihr Edlen der Mandubier, höret meine Worte! Ich, Morfran der Habicht, oberster Barde der Carnuten, spreche hiermit über Arduinna, Bardin geboren im Stamm der Silurer jenseits des schmalen Meeres ...« Er ließ seine Stimme schweben, zögerte kurz.
Nein, dachte ich. Nein, nein, das würde er nicht tun! Er würde nicht einen Fluch über mich sprechen! Nicht jeder Barde besaß diese Gabe, noch weniger den Mut, doch ich war mir sicher, dass er es könnte.
Ein Fluch, nur durch den Tod auflösbar, wenn nicht gar über mehrere Leben und Generationen reichend. Hasste er mich so sehr, dass er die Folgen, die solch ein Spruch auch für den Fluchsprecher bewirkte, auf sich nahm?
Er warf mir einen kurzen Blick zu und ich meinte, mein Herz bliebe stehen.
»Ja«, fuhr er fort, »über dieses junge Weib spreche ich ein cynnedyf, wie Flüche in ihrer Heimat genannt werden.«
Ein cynnedyf war kein Fluch, schoss es mir durch den Kopf. Ein cynnedyf war lösbar, war ein Gebot. Ich wusste, dass er den Unterschied kannte und verstand.
Und doch hatte er es Fluch genannt … in meinem Kopf drehte sich alles.
Sein Blick ruhte nun fest in meinen Augen.
»Von heute an, bis die Götter sie durch den Tod oder ein eindeutiges Zeichen erlösen, sei es Arduinna, der Bardin, untersagt, länger als einen halben Mond an einem Ort zu verweilen. Tut sie es dennoch ...«
Ich starrte Morfran an. Ein cynnedyf bis zum Tod war beinahe dasselbe wie ein Fluch. Er hatte nur kluge Worte gewählt, um selbst den Folgen des Fluchsprechens zu entgehen. Wie feige.
Nun grinste er gequält und sah zu Loïc hin.
»... bleibt sie länger als einen halben Mond an einem Ort, so werden jene Menschen, die ihrem Herzen nahe stehen, dafür büßen und es wird ihnen Unheil widerfahren. So sei es, dies sind die Worte Morfrans des Habichts, oberster Barde der Carnuten, im Angehör der Götter!«
Er spuckte in alle vier Himmelsrichtungen, um den Fluch zu bekräftigen.
Stille lag über dem Platz, als hielten alle die Luft an.
Ich zitterte so stark, dass ich mich mit den Fingern in den lehmigen Boden krallen musste, um nicht zusammenzubrechen.
Als niemand antwortete, blickte ich vorsichtig zum Reix der Mandubier. Der sah fragend zu seiner Tochter hin. Anscheinend stand es ihr zu, zu beurteilen, ob ihr dies genügte.
Sie nickte, hastig.
»So sei es!«, schallte schließlich die Stimme des Reix der Mandubier über den Platz.
Dann die von Loïcs Vater: »So sei es.«
Immer mehr Stimmen nahmen die Bekräftigung auf.
»So sei es!«
Bald hatte die ganze Dunon das cynnedyf bezeugt.
Morfran griff nach seinem Messer und schnitt mir eine Strähne meines Haares ab. Sorgsam wickelte er sie um seinen Finger.
Wie ein rotgoldener Ring.
Das cynnedyf war nun bindend.
Ich sah zu Loïc. Er hatte die Lippen so fest aufeinander gepresst, dass sein Mund zu verschwinden schien. Ganz leicht schüttelte er den Kopf, als er meines Blicks gewahr wurde. Er sah so verzweifelt aus, dass ich über seiner Trauer fast mein eigenes Elend vergaß.
Morfran zog mich hoch, sprach nahe an meinem Ohr.
»Pack deine Sachen. Noch ehe Bel in seinem Sonnenwagen den höchsten Stand erreicht hat, verlässt du die Dunon. Bevor sie es sich noch anders überlegen.«
Er stockte kurz.
»Mögen die Götter mit dir sein.«
Ein Händler nahm mich für den ersten halben Mond in seinem Haus in der Nähe Vesontios auf.
Ich war nun auf mich gestellt. Zwei-mal-sieben Sommer alt und von jetzt an für immer alleine unterwegs.
Es war ein hoher Preis für eine große Liebe.
Kapitel 1: Tanz in den Morgen
Die Welt drehte sich um mich, rasend schnell, und würde mir den Weg weisen. Der Wind der Bewegung strich kühl über meine geschlossenen Augen, umstreichelte meine hochgereckten Arme. Meine Füße tanzten auf dem niedergetretenen Gras, Ballen, Sohle, Ballen, Sohle … Cú sprang wie jeden Morgen aufgeregt bellend um mich herum, und über mir, nein neben mir, nein doch über mir hörte ich Brannas Flügelschlagen und ihr tiefes Krächzen. Und da war es, das Gefühl, nun, in diesem Moment, genau jetzt, das wilde, kreiselnde Drehen anhalten zu müssen.
Ich schwankte, berauscht von dem Strudel, in den ich meinen Körper getanzt hatte.
Ich öffnete die Augen.
Noch war der Himmel ein blasses Grau, das unausgeschlafene Gesicht des Tages. Die Welt wartete darauf, dass sich die Sonne wie ein Lächeln auf die Lippen der Erdenkante legte. Es war die Zeit, zu der ich jeden Morgen das Tanzen und die Götter meinen weiteren Weg entscheiden ließ, unbeeinflusst von den richtungsweisenden Strahlen des Sonnengotts.
Der erste Blick, wenn ich nach dem wilden Drehen die Augen öffnete, wies mir die Richtung, und heute ging es weiter, ein wenig südlich des Sonnenaufgangs durch das junge Wäldchen hindurch, an dessen Rand wir gestern Abend unser Lager aufgeschlagen hatten.
Ich ließ mich ins Gras fallen, das rund um mich hoch und voller reifer Samen stand. Eine Wolke aus dünnem Samenstaub erhob sich in die Luft, regnete sanft herab.
Cú sprang neben mich, leckte mein Gesicht. Seine großen Tatzen landeten auf meinen Oberschenkeln, sein Gewicht warf mich fast um. Ich streichelte sein struppiges Fell, schob ihn lachend von mir.
»Das wird dir gefallen, Cú, wir gehen weiter aus den Bergen hinaus.«
Ihm hatte das ewige Bergauf und Bergab der letzten Monde nicht behagt. So viele Höhlen, die erforscht werden mussten, so viele unübersichtliche Wegstrecken, auf denen er hektisch vor und zurück hatte laufen müssen, um seine Herrin zu beschützen.
Branna ließ sich nun auf meiner Schulter nieder, den schwarzen Kopf zur Seite geneigt, die feinen Federn ein wenig aufgestellt, eifersüchtig darauf bedacht, dass der Hund nicht mehr Zuneigung bekam als sie. Streichle mich, sagte diese Geste und ich erfüllte ihr den Wunsch, kraulte das glänzende Gefieder mit meinem Zeigefinger. Die Rabin streckte genüsslich den Kopf und ein wohliges »Mooorgn« drang aus ihrem Schnabel.
Es war ein Morgen wie beinahe jeder Morgen. Seit drei-mal-drei Jahren nun schon. Erst mit Calis, dem alten Hofhund, dann alleine, danach mit Cú und nun seit einem Jahr auch mit Branna. Drei-mal-drei Jahre war ich schon unterwegs und noch immer kein Ende in Sicht.
Nach dem ersten Jahr der erzwungenen Wanderschaft war ich sicher gewesen, nun würden die Götter mir ein Zeichen senden, dass das cynnedyf aufgehoben sei. Erneut die Hoffnung nach dem dritten Sommer, drei, die Zahl der Götter. Und nun – drei-mal-drei …
Längst war ich nicht mehr die junge Frau, die verwöhnte Bardin, ungewöhnt an schwere Arbeit. Andere in meinem Alter hatten bereits eine Schar Kinder. Oder waren an ihren Kindern gestorben. Dünn war ich geworden, sehnig und zäh. Ein Wesen der Wälder ebenso wie fremder Höfe und Dörfer, weit, weit gewandert seit jenen Tagen in Vesontio bei den Sequanern. Und immer noch voller Hoffnung …
Vor allem an Tagen wie heute, wo ich des Nachts wieder die Stimme gefühlt hatte, jenes sanfte Raunen, das mich umarmte und daheim fühlen ließ.
Mein Blick glitt dorthin, wo wir heute gehen würden. Es sah nach einem guten Weg aus. Jeder Weg, der nicht in hohe Berge führte, war gut, fand ich seit dem letzten Winter.
Kein Lüftchen regte sich, als hielte die Welt den Atem an, ehe sie vom Sonnenlicht erfüllt wurde. Ich nahm einen tiefen Atemzug der milden Morgenluft. Es war um so viel wärmer hier als noch vor ein paar Tagen in den Bergen. Es würde heiß werden.
Als ich mich erhob und hinabbeugte, um meinen Ziegenfellbeutel aufzuheben und zu dem langen Haselstab zu greifen, stutzte ich. Da – ja, genau neben meinen Sachen. Es war nur ein Blackenblatt, groß und feuchtkühl, wie man es verwendete, um Käse oder Butter einzuwickeln und insofern von keinerlei Nutzen für mich, denn ich besaß keines davon. Aber auf dem Blatt hatte ein Käfer Spuren seines Hungers hinterlassen, feine Linien, an denen nur noch die dünnen Blattrippen zu sehen waren. Die Linien stachen mir ins Auge, wie auffällige Muster es immer zu tun pflegten. Vorsichtig fuhr mein Finger darüber. Es sah aus wie zwei Menschen in inniger Umarmung. Meine Augen begannen zu brennen. Zwei Menschen in inniger Umarmung … ich in inniger Umarmung? Ich verbat meinem Herzen, schneller zu klopfen. Obwohl die Hoffnung, eines Tages das cynnedyf zu lösen, alles war, das mich weitergehen ließ, so durfte ich mich nicht der Trügnis eines einzelnen Zeichens hingeben. Zu oft hatten die Symbole, die ich zu finden meinte, mich schon getäuscht.
Cú kam neugierig näher, schnupperte, und auch Branna war von meiner Schulter gehüpft und wollte schon nach dem Blatt, das ihre Herrin offenbar so interessant fand, mit dem Schnabel greifen.
»Nicht!«, rief ich und schob die Rabin zur Seite, die daraufhin beleidigt vor sich hinkeckernd davonstolzierte. Sie konnte empfindlich sein wie die verwöhnte Tochter eines Reix.
Ich zog ein dickes Stück Leder aus meinem Ziegenfellbeutel und ritzte das Muster, das die Kiefer des Käfers erzeugt hatten, neben eine große Anzahl anderer Zeichen, die ich in den letzten Jahren gesammelt hatte.
Irgendwann würden all diese geritzten Linien auf meinem Lederstück plötzlich Sinn ergeben, sich mir vollständig offenbaren. Vielleicht heute. Vielleicht morgen. Vielleicht nie. Bis dahin würde ich eben das Beste daraus machen.
Der Sonnenball kletterte über die Kante der Welt, die Strahlen trafen mich wie ein Kuss des Vaters, der sein Kind aus dem morgendlichen Schlummer weckt. Etwas lag in der Luft. Ich hoffte, es war etwas Gutes. Ich nahm den Beutel, der all meinen Besitz enthielt, die zusammengerollte Rehhaut, die mir als Bett diente, und meinen langen Haselstab. Zeit, mich auf den Weg zu machen.
Kapitel 2: Ein einsamer Hof
Am späten Nachmittag stießen wir auf einen Weg, breit genug für einen Pferdewagen, und wir folgten ihm ebenso, wie der Fluss es tat, der Wasser aus den Bergen ins Tal trug. Branna hatte es sich auf meiner Schulter bequem gemacht und Cú trottete müde mit hängender Zunge neben mir her. Jede Steigung, die wir erklommen, bot erneut die Aussicht über sanft dahinrollende Hügel und dichten Wald, unterbrochen von Wiesenflächen, die von Rehen und anderen Tieren baumlos gehalten wurden. Die Verlockung, jagen zu gehen, kribbelte in meinen Fingern, doch es fühlte sich nicht richtig an, ein so großes Tier zu erlegen, wenn ich nicht vorhatte, lange genug an einem Ort zu bleiben, um es aufzubrauchen.
Und nun eine Straße, Wagenspuren im lehmigen Boden. Cú warf immer wieder einen Blick zu mir hinauf. Straßen hießen Menschen und Menschen hießen ein Dach über dem Kopf, hießen Fleischreste und Knochen, ohne dafür jagen zu müssen.
Ich lächelte. Ja, nach der Zeit in den Bergen hatte ich nichts dagegen, wieder unter Menschen zu kommen.
Wenig später entdeckten wir einen schmalen Pfad, der von der Straße abbog. Cú sah mich fragend an und trabte dann voran, die Nase nahe am Boden. Branna flog mit, kam wieder zurück und ließ sich beruhigt auf meiner Schulter nieder. Ich hatte die besten Späher, die man sich wünschen konnte.
Am Ende des Pfades stießen wir auf einen einsamen Hof, eine Hütte und ein Stall, beides aus unbehauenen Baumstämmen und Flechtwerk gebaut und schon lange nicht mit frischem Lehm verputzt. Davor brannte ein Feuer, über dem ein verbeulter Kessel hing, dessen Duft nach Suppe bis zu mir drang. Das Ganze war mit einem Zaun umgeben, dessen Balken teilweise morsch und schief waren. Die Tiere, die sich innerhalb der Einfriedung befanden – ein Schwein und zwei Ziegen – schienen ihn dennoch als Grenze zu akzeptieren, als wäre er aus Stein. Der Wald wuchs so nahe an die Gebäude heran, dass ich mich fragte, ob diese Menschen überhaupt Felder besaßen, gerodet hatten sie zumindest rund um die Gebäude nichts.
Das waren arme Bauersleute hier, die wohl selbst kaum genug zu essen hatten.
Ich zögerte. Das Recht der Gastfreundschaft galt in dieser Gegend gewiss wie überall auf der Welt und die Pflichten des Gastgebers ebenso. Ich wollte den Leuten nicht zur Last fallen.
Doch noch ehe ich überlegen konnte, umzudrehen, hatte eine alte Frau uns bereits entdeckt.
Erst blickte sie mich abschätzend und vorsichtig an, doch dann stahl sich ein zahnloses Lächeln in ihre Falten, als Cú sich mit aufgestellten Ohren neben mich setzte, ganz höflicher Gast, der auf Einladung wartet.
»Komm nur, mein Kind, komm nur her«, schnarrte die Stimme der Alten über den Zaun. Ihr Gewand und ihr langer grauer Zopf hatten Flecken von weißem Staub. Sie kniete vor der Hütte und rieb Getreide zwischen zwei Steinen zu Mehl. Also mussten sie doch irgendwo Felder besitzen. Aber nicht genug, sich eine Rundmühle leisten zu können.
Ich warf einen Blick auf Branna, die es sich in einem der nahen Bäume bequem gemacht hatte. Es war soundso besser, wenn die Rabin nicht mitkam. Der Vogel liebte alles, was glänzte, und auch wenn ich in dieser schäbigen Hütte keine glitzernden Schätze erwartete, so reichte das Chaos, das Branna auf ihrer Suche danach verursachen konnte.
Ich öffnete den Riegel des Einlasses im Zaun. Die Bastriemen, die das schmale Tor hielten, würden bald durchgeschabt sein. Schwein und Ziegen wichen vor Cú zurück. Ich hörte keinen Hund bellen, unerwartet, auf so einem einsamen Gehöft im Wald. Mit einer kleinen Geste deutete ich Cú, neben mir zu bleiben, schließlich freute sich nicht jeder, von dem großen Tier bestürmt zu werden.
Grüßend senkte ich den Kopf. »Einen friedvollen Abend dir, verzeih, wenn ich störe.«
»Schwalbenfurz, du störst nicht. Es ist spät, du wirst ein Lager für die Nacht brauchen. Hast du dich verirrt, Kindchen?«
Wie konnte man sich verirren, wenn man nicht wusste, wohin man unterwegs war?
Die Alte sah besorgt aus. Als wäre ich keine erwachsene Frau, sondern ein junges Mädchen. Vielleicht lag es an meinen großen Augen oder daran, dass ich eher klein war und dünn. Vielleicht sah die Alte auch nur schlecht.
»Ich bin auf dem rechten Weg, keine Sorge. Doch eine Nacht unter eurem Dach würde ich nicht ablehnen.«
»Bist du unterwegs nach Bragnreica?«
»Wohin?«
»Bragnreica. Voccios Duron. Eine Tagesreise die Straße entlang.«
Duron nannte man eine Dunon hier, vermerkte ich.
»Ich bin fremd hier«, sagte ich, doch die Alte fuhr fort, als müsste ich doch wissen, wovon sie sprach.
»Voccio. Unser Reix, der Oberste der Noricer. Schon seit drei-mal-sechs Sommern.«
Hinter dem Haus trat eine jüngere Frau hervor, angelockt wohl von unseren Stimmen. Ihre Hände waren voller Erde und hielten eine hölzerne Schüssel mit Rüben.
»Einen friedvollen Abend dir. Ich bin Arduinna, auf Wanderschaft.«
Die Augenbrauen der Frau zogen sich leicht zusammen. Wir sprachen dieselbe Sprache, doch ich konnte nicht leugnen, dass ich von weit her kam, so sehr ich mich auch immer bemühte, die Klangfarbe der Region anzunehmen, durch die ich mich gerade bewegte.
»Auf Wanderschaft?«, fragte die Alte. »Ganz alleine?«
Ich zuckte die Schultern. »Ich habe meinen Hund.«
Die jüngere Frau musterte mich nach wie vor, nickte dann.
»Du gehst nach Bragnreica?«
»Nein. Nein, ich denke nicht. Vielleicht.«
Die beiden Frauen warfen einander einen Blick zu, voller Zweifel über meine Worte.
»Ist ein guter Ort, Bragnreica«, sagte die Alte. »Er ist ein großer Mann, Voccio. Hat uns die Daker vom Leib gehalten. Und die Boier auch. Ein guter Mann.«
Die Jüngere klang nicht so angetan. »Von allem nur das Beste für ihn. Holt sich die besten Krieger, die besten Handwerker … Als er erfuhr, dass die Menschen zu meiner Schwester kamen – mögen die Götter sie schützen – weil sie für jede Krankheit ein Kraut wusste, da hat er sie holen lassen.«
Sie versank in Schweigen, zupfte ein paar welke Blätter von einer der Rüben.
Die Alte nickte. »Wir haben nie wieder von ihr gehört. Könnten sie durchaus gebrauchen hier.«
»Du wirst Hunger haben.« Die Jüngere riss sich aus ihren Gedanken und wandte sich an die Alte. »Hol die Männer.«
Die Alte wischte sich die mehligen Hände in ihr Kleid und trippelte davon.
»Freiwillig bist du bestimmt nicht unterwegs«, sagte die Jüngere und kam näher heran. Ihr Blick blieb auf der dünnen Narbe hängen, die sich quer über meine linke Wange zog. Dann wanderten ihre Augen weiter zu den drei eingeritzten blauen Punkten auf meiner Schläfe. Das Zeichen schien ihr nichts zu sagen.
Ich straffte mich. »Nein. In meiner Heimat nennt man es cynnedyf. Ein Gebot. Oder Fluch.«
Ich sagte immer noch Heimat. Nach all den Jahren.
»Oh«, sagte die Bauersfrau. Ihr Blick glitt kurz in Richtung Wald. »Ein Fluch.«
Ich biss mir auf die Lippen. Es hatte keine Notwendigkeit gegeben, das cynnedyf zu erwähnen. Ich war schon zu lange nicht unter Menschen gewesen, solch eine Nachlässigkeit passierte mir gewöhnlich nicht.
»Es ist mehr ein Gebot, das die Götter mir auferlegt haben.«
»Du meinst, so wie es manch großem Held verboten ist, bestimmte Speisen zu essen? Oder einen Bach zu überqueren?« Sie sah mich misstrauisch an.
»Ja«, lächelte ich. »Genau so.«
Nicht wirklich. Aber mein Magen knurrte und der Duft aus dem Kessel war gar so verlockend.
Sie nickte. »Dann komm nur herein. Es ist noch etwas Suppe da und Brot.«
Das Haus war dunkel und angenehm kühl. In der Feuerstelle lagen nur die verkohlten Reste einiger Holzscheite. Die Bauersfrau hieß mich auf einem Fell Platz zu nehmen und ging wieder hinaus.
Cú ließ sich neben mir nieder, mit einem wohligen Seufzen. Ich legte meinen Ziegenfellbeutel, die Rehhautrolle und den Haselstab ab und streckte die Beine aus. Meine Füße waren voller Staub, doch man hatte mir beim Eintreten keine Wasserschüssel gereicht, um sie zu waschen. Wenn ich mich so umsah, dann war es offensichtlich, dass man hier auf solche Gepflogenheiten der Gastfreundschaft nicht viel Wert legte.
Es war lange her, dass ich in einem Haus gewesen war, bestimmt mehr als einen Mond. Das Fell, auf dem ich saß, hatte kahle Stellen, wie alle Felle, die hier rund um die Feuerstelle lagen. Der Boden darunter war nur gestampfter Lehm in einem rötlichen Braun. Hinten, an der Schmalseite des Hauses, erkannte ich im Dunkel eine Erhöhung, auf der weitere Felle und Decken lagen. Sonst gab es nicht viel. Ein paar Kisten, Körbe, ein paar tönerne Töpfe. Einen Webstuhlrahmen, der in der Nähe der Türe an der Wand lehnte, nur halb bespannt, die Gewichtssteine auf einem Haufen daneben.
Ich kraulte Cú.
Draußen hörte ich Branna krächzen und eine Amsel ihr wütend antworten.
Es roch nach Erde und Pilzen.
Langsam breitete sich die Kühle des Hauses angenehm in mir aus und vertrieb die Hitze des Wanderns.
Mein Blick streifte zur Tür, in Erwartung der Bauersfrau. Ich sah ein paar flache runde Brotscheiben mit einem Loch in der Mitte zwischen Kräuterbüscheln von den Dachbalken hängen. Mir lief der Speichel im Mund zusammen. Ich hatte heute nur ein paar Beeren gegessen.
Auf einem Querbalken neben der Türe entdeckte ich eine Puppe, aus Stoffresten genäht, und daneben ein paar kleine, geschnitzte Holztiere. Es gab also Kinder hier.
Langsam wurde ich unruhig. Zulange dauerte es schon, dass die Frau zurückkam.
Es gab nur die eine Türe. Ich mochte es nicht, in einem fremden Haus gefangen zu sein, mir meines Fluchtweges nicht sicher sein zu können. Was, wenn die beiden Frauen nicht so freundlich waren, wie sie wirkten? Und die Männer, die die Alte holen ging, erst recht nicht?
Ich warf einen Blick auf Cú, der entspannt auf der Seite lag und den kühlen Lehmboden genoss. Das machte mich wieder ruhiger. Der Hund hatte ein gutes Gespür für die Gefahren eines Ortes. Draußen schwand langsam das Tageslicht, früh, hier im Schatten des Waldes.
Gemeinsam mit der Bauersfrau trat auch die Alte ein und hinter den beiden zwei Männer, einer blond, einer weißhaarig.
Ich erhob mich, senkte den Kopf zur Begrüßung. Cú hob den seinen, in der Hoffnung auf Futter.
»Willkommen in unserem bescheidenen Haus«, sagte der jüngere Mann. Er hatte denselben müden Blick wie seine Frau. Sie alle musterten mich.
Die Alte hatte ein paar dünne Zweige und etwas Brennholz in den Armen und legte diese nun in die Feuerstelle. Ihr Mann, der einen brennenden Kienspan hielt, zündete das Feuer an. Bald wäre es mit der angenehmen Kühle im Haus vorbei. Die junge Frau stellte den verbeulten Kessel von draußen zum Feuer und reichte mir eine Schüssel mit dampfendem Eintopf und dazu eine harte Scheibe Brot vom Dachgebälk.
»Vielen Dank, ihr seid zu großzügig.«
Der jüngere Mann hatte den Löffelbohrer und die Säge abgelegt, die er in den Händen gehalten hatte, und trat nun auf mich zu. Er war groß und ragte wie ein Baumstamm vor mir auf. In seinem Bart hingen Holzspäne. Ich legte den Kopf in den Nacken und lächelte ihn an, hielt seinem musternden Blick stand. Diese Menschen hier waren misstrauisch, wie es mir so oft widerfuhr. Eine Frau mit einer fremden Sprachmelodie alleine unterwegs. Für jene, die ihr Leben lang auf ihrem Stück Feld und Weide hockten, musste ich fremdartig wie ein Wesen aus der Anderswelt wirken.
Der Mann, offenbar zufrieden mit meinem Anblick, erwiderte mein Lächeln, doch es erreichte nicht seine Augen.
»Setz dich doch wieder und iss. Weib, auch wir sind hungrig.«
Sein Tonfall hatte sich von einem Augenblick auf den anderen gewandelt. Die Frau eilte, Schüsseln zu holen.
Die Alte und ihr Mann setzten sich neben mich und Cú, der den Alten neugierig abschnüffelte.
»Ein schöner Hund ist das«, sagte der Alte.
Die Flammen in der Feuerstelle fanden genügend Nahrung um höher aufzuflackern. Das Gesicht des Alten zeigte keinerlei Gier. Man hatte schon öfter versucht, mir Cú zu nehmen. Es war noch keinem wohl bekommen.
»Ja«, antwortete ich.
»Iss«, sagte die jüngere Frau.
Ich sprach einen raschen Dank an die Götter, ehe ich die Flüssigkeit aus der Schale schlürfte und die festeren Bestandteile mit den Fingern aß. Es war das Beste, das ich seit langem zu mir genommen hatte. Brot. Egal wie alt. Rüben und Linsen. Nach den Monden voll rohem und gebratenem Fleisch und mageren Wurzeln lechzte mein Körper danach.
Die Bauersleute betrachteten mich neugierig. Ich wusste, dass man von mir erwartete, dass ich etwas über mich erzählte, ich wusste aber auch, dass man sich in Geduld fassen würde, bis ich gegessen hatte. Ich bemühte mich, nicht zu rasch alles in mich hineinzuschlingen. Die Frau verteilte Eintopf an die anderen. Wir aßen schweigend, leise schlürfend und die Finger abschleckend.
Als die Schüsseln leer waren, deutete ich auf die Puppe neben der Türe.
»Ihr habt Kinder?«
Ich fragte mich, warum sie nicht mit uns aßen.
Die jüngere Frau senkte den Kopf. Es war die Alte, die antwortete.
»Tot. Das Fieber, vor drei Wintern.«
Ich bereute, gefragt zu haben. Schweig und lerne, hatte Tegid immer gesagt.
»Oh. Das tut mir leid.«
Die Alte warf einen Blick auf die jüngere Frau.
»Sie kriegt einfach keine Kinder seitdem. Ist wie ausgetrocknet.«
Der alte Mann musterte mich erneut. Seine Augen zeigten nun die Gier, die ich vorhin in Bezug auf Cú erwartet hatte.
»Wir haben ihm schon gesagt, er soll eine neue Frau nehmen. Oder eine dazu. Ein Hof ohne Kinder stirbt.«
Cú spitzte die Ohren. Er fühlte meine Anspannung.
»Wer sagt denn, dass es an mir liegt?«, warf seine Sohnesfrau ein, die Stimme bitter wie Galläpfel.
Der alte Mann lachte, ein unangenehmes Lachen. Die Lippen der Jüngeren wurden schmal.
»Es ist Aufgabe der Frau, Kinder zu kriegen, nicht die des Mannes«, sagte ihr Gatte.
Die Hände der Frau ballten sich in ihrem Schoß zu Fäusten.
»Aber machen kann sie Kinder ebenso wenig, wie eine Ziege ohne Bock Milch gibt.«
»Nun, ich wäre auf alle Fälle die Falsche«, beeilte ich mich zu sagen. »Ich würde nichts nützen, denn die Götter verbieten mir, länger als einen halben Mond an einem Ort zu bleiben.«
Da mir eine Bemerkung über den Fluch bereits herausgerutscht war, machte es keinen Unterschied, mehr zu sagen. Im Gegenteil, es beruhigte die jüngere Frau vielleicht, dass es sich nicht um etwas handelte, das eine Gefahr für die Ihren war.
Die Blicke der Bauersleute, die gerade noch feindselig aufeinander gerichtet gewesen waren, wurden mitleidvoll.
»Wie traurig«, sagte die Jüngere und es klang ehrlich. Die Alte nickte.
»Bist also ein Streuner wie dein Hund?« Der Alte kratzte seinen Bart.
»Das ist also dein Gebot«, sagte die Jüngere. »Sie ist wie ein Held, den die Götter mit einem Gebot belegt haben, damit er nicht übermütig wird.«
Die beiden Männer sahen mich zweifelnd an.
»Ein Held?«, sagte der Alte und die Vorstellung war für ihn offenbar nicht mit meinem Anblick vereinbar.
Ich lächelte und im schwachen Feuerschein wirkte es vielleicht sogar echt. Ich wünschte, man hätte mir das cynnedyf wegen einer Heldentat auferlegt.
»Ich will euch eine Geschichte erzählen«, sagte ich rasch.
Ich hatte lange nicht erzählt, all die Zeit in den Bergen nicht. Sollten sie ruhig meinen, ich würde nun meine eigene Geschichte darbringen. Nun, es war meine Geschichte, eine meiner Geschichten. Eine der vielen, die ich auf meiner Wanderschaft aufgelesen hatte. Tegid wäre stolz auf mich. Ich war zwar nicht die Bardin geworden, zu der er mich ausgebildet hatte, aber ich konnte Menschen mit meinen Worten Freude bringen.
Die Männer wechselten in eine bequemere Sitzposition, während die Frauen nach einem Korb voller Schafvlies griffen und begannen, Dreck und Grassamen daraus zu klauben, um es fürs Spinnen vorzubereiten.
Vor dem Haus krächzte Branna, Cú antwortete mit einem kurzen, beruhigenden Bellen.
Der Alte lachte. »Selbst dein Hund sagt, dass du erzählen sollst! Man freut sich immer, Neues zu hören.«
Ja, Cú liebte Geschichten. Genauso wie Branna, die nun, wo die Sonne untergegangen war, wohl den Kopf unter den Flügel steckte und darauf wartete, dass ich morgen früh dieses Haus wieder verließ.
Mein Blick schweifte über meine Zuhörer. Längst wusste ich, welche Geschichte ich erzählen würde. Ich hatte sie als Kind in Dubris gehört, jenem Hafen, von dem die Schiffe Britanniens, wie die Insel Albion seit Caesars Feldzug genannt wurde, nach Gallien fuhren.
Das Feuer knisterte und warf goldrote Muster auf die Gesichter der Bauersleute. Ich klatschte einmal laut in die Hände, um die Wesen der Anderswelt zu dieser Geschichte einzuladen, und fühlte die Götter dieses Waldes lauschen. Die ganze Welt liebte Geschichten, sie woben ein Netz durch alles Leben hindurch, vom zarten Grashalm bis hin zu den mächtigen Göttern.
»Einst«, begann ich und blickte jedem meiner Zuhörer nacheinander in die Augen, »lebte ein Bauer, der hatte drei Töchter. Eines Tages, als die Mädchen die Wäsche am Fluss wuschen, setzte sich eine Nebelkrähe neben ihnen nieder und fragte krächzend die Älteste: ›Willst du mich heiraten?‹
Die Älteste warf einen Stein nach der Krähe und sie flog beleidigt davon. Am nächsten Tag jedoch kam der Vogel wieder und fragte nun die mittlere Tochter, doch auch diese verscheuchte sie. Als die Krähe am dritten Tag wiederkehrte und die Jüngste fragte …«
Ich machte eine kurze Pause, ließ meine Stimme in der Luft schweben wie ein Staubkorn im Sonnenschein. Die Hände der Frauen waren langsamer geworden, ihre Augen auf mich geheftet.
»… da sagte die Jüngste: ›Ich will dich heiraten. Ein Mann ist so gut wie der andere und du bist zumindest hübsch.‹«
Die Frauen lachten.
»Am nächsten Tag wurden sie vermählt. Als sie vom Haus der Braut fortgingen, da sagte die Nebelkrähe: ›Dir steht ein Wunsch frei. Willst du, dass ich bei Tag Mann und bei Nacht Krähe sei – oder bei Tag Krähe und bei Nacht Mann?‹
Die Bauerstochter hatte nicht geahnt, dass ihr Bräutigam überhaupt Mann sein konnte und war angenehm überrascht.«
»Das glaube ich!«, rief die Alte.
»Was sollte sie wählen?«, fragte ich lächelnd.
»Den Mann des Nachts«, sagte der Weißhaarige, »Da kann ein Mann Mann sein!«
Ich schüttelte sanft den Kopf. »Sie wählte den Mann bei Tag und die Krähe des Nachts.«
Der Sohn des Alten verzog den Mund, doch seine Frau nickte. Jede Bäuerin, die einen Hof zu bearbeiten hatte, würde bei Tag einen Mann mit kräftigen Händen einer Krähe vorziehen.
»Sie liebte beide, den Mann und die Krähe. Im Laufe der Zeit gebar sie ihrem Mann einen Sohn. Doch in jener Nacht war sanfte Musik zu hören, die Mann und Weib in tiefen Schlaf fallen ließ. Und als sie am Morgen erwachten, war das Kind verschwunden.«
Die jüngere Frau schlug die Hand vor den Mund.
»Im nächsten Jahr geschah es erneut, sosehr sich die beiden auch bemühten, wach zu bleiben. Darüber war das Weib so verzweifelt, dass ihr Mann beschloss, mit ihr zu seinen Schwestern zu ziehen. Sie packten ihre Sachen und der Mann mahnte sie, auch ja nichts zu vergessen. Als sie auf dem Pferdewagen saßen und unterwegs waren, fragte er noch einmal, ob sie auch ja nichts in dem alten Haus zurückgelassen hatte. ›Meinen Kamm!‹, sagte die Frau erschrocken. In diesem Moment verwandelte sich der Pferdewagen in eine welke Rübe und der Mann mitten am Tag in die Nebelkrähe. Kreischend flog er davon.«
»Hat ihm wohl nicht behagt, dass er nun immer ein unfrisiertes Weib hätte!«, grinste der Alte und wurde von seiner Frau unsanft in die Rippen gestoßen.
Ich fuhr fort: »Aber sein Weib folgte ihm. Doch kaum hatte sie einen Hügel erklommen, war er bereits unten im Tal, und kam sie im Tal an, war er bereits wieder über der Kuppe des nächsten Hügels. Als es Nacht wurde, erblickte sie ein Häuschen, in dem brannte Licht. Als sie näher kam, stand ein kleiner Bub davor, der lächelte sie an, dass ihr ganz warm ums Herz wurde, und eine alte Frau bot ihr ein Bett für die Nacht. Am nächsten Morgen erwachte sie und folgte wieder der Nebelkrähe bis zum Abend, wo sie erneut ein Häuschen mit einem Kind und einer alten Frau fand, in dem sie übernachten konnte. Auch der dritte Tag verlief gleich, nur dass es im dritten Haus kein Kind gab und die Alte sie bat, nachts wach zu bleiben und zu versuchen, die Krähe zu schnappen, sollte sie ins Zimmer kommen. Die arme Bauersfrau war jedoch so müde, dass sie die Augen nicht offenhalten konnte -«
Der jüngere Mann schnalzte mit der Zunge, missbilligend und enttäuscht.
»- und sie erwachte erst, als etwas in ihre Hand fiel. Eine goldene Fibel. Sie schreckte hoch, doch statt der Krähe erwischte sie nur noch eine Feder eines Flügels. Als sie am Morgen der Alten davon erzählte, sagte diese: ›Er ist über den Hügel der giftigen Dornen geflogen. Du wirst Schuhe aus Eisen brauchen für deine Hände und Füße, wenn du ihm folgen willst.‹
So ging die Frau zu einem Schmied und lernte, Schuhe aus Eisen zu fertigen und schmiedete sich welche für Hände und Füße. Dann machte sie sich auf den Weg über den Hügel der giftigen Dornen, ein mühsames Unterfangen, denn sie durfte keine einzige Dorne berühren, wollte sie nicht eines schrecklichen Todes sterben. Und als sie auf der anderen Seite ankam, da erfuhr sie, dass ihr Mann an diesem Tag mit der Tochter eines mächtigen Herrschers vermählt werden sollte.«
»Hühnerverkacktes Elend!«, entfuhr es der Alten.
»Na, wenigstens hat sie schmieden gelernt«, sagte ihr Mann.
»Psst!«, machte die jüngere Frau.
»Nun war es so«, erzählte ich, »dass es in diesem Land üblich war, bei Hochzeiten ein großes Rennen abzuhalten zu Ehren der Götter. Alle würden daran teilnehmen, außer dem Koch, der sich um das Essen kümmern musste. Als der Koch nun eine Fremde über den Hügel der giftigen Dornen kommen sah, drückte er ihr den Kochlöffel in die Hand, um endlich einmal auch bei dem Rennen mitmachen zu können. Und als die Frau denn nach dem Rennen das Essen den Hochzeitsgästen servierte, da ließ sie die Fibel und die Feder in die Schüssel des Brautmannes fallen. Mit dem ersten Löffel Suppe erwischte er die Fibel und ein aufgeregter Schauder durchfuhr ihn. Er sprang auf, als er auf dem zweiten Löffel die Feder fand.
›Wer hat dieses Essen gekocht?‹, rief er. Und so brachte man die Frau zu ihm und er erkannte sie wieder und der Fluch, der auf ihm gelegen hatte, fiel ab von ihm und er würde nie mehr eine Nebelkrähe sein.
Glücklich machten sich die beiden auf nach Hause und es störte sie wenig, wie mühsam der Weg über den Hügel der giftigen Dornen war, wo die Frau immer nach einem Dutzend Schritte die eisernen Schuhe abnehmen und ihrem Mann zuwerfen musste, dass er unbeschadet durch die Dornen zu ihr aufschließen konnte.
Zu guter Letzt schafften sie es über den Hügel und als sie abends zu den Häusern kamen, erkannten sie in den Kindern ihre eigenen Söhne und nahmen sie glücklich mit sich. Und nur manchmal, wenn der Wind bläst, vermisst der Mann es, als Krähe zu fliegen. Doch dann blickt er sein Weib an, das ihn nie aufgegeben hatte, und ist glücklich.«
Für einen langen Augenblick herrschte Schweigen. Das alte Ehepaar sah einander lächelnd an. Der jüngere Mann hatte den Kopf gesenkt, während sein Weib mit einem Seufzer sich wieder daran machte, das Schafvlies von Grannen und Blätterkrümeln zu befreien.
»Du hast dein Essen wohl bezahlt«, sagte der jüngere Mann nach einer Weile. »Nun lass uns noch etwas Bier trinken.«
Seine Frau legte das Vlies weg, doch er war schon vor ihr aufgestanden und ging hinaus.
Spätnachts erwachte ich. Von meiner Schlafstelle neben der glosenden Feuerstelle aus konnte ich zweistimmiges rhythmisches Stöhnen hören. Anscheinend wussten Bauer und Frau einander doch zu schätzen.
Kapitel 3: Der Keiler
Der Tag hatte nicht so begonnen, wie ich es mochte. Wie zu kurz gekochte Puffbohnen lag es mir im Magen, dass ich zu lange geschlafen hatte. Das ungewohnte Bier am Abend, die stickige Luft in der Hütte – ich war erst erwacht, als die Bauersleute sich kurz vor Sonnenaufgang regten, und dann hatte ich mitgeholfen, die nötigen Morgenarbeiten zu verrichten. Hatte die Glut in der Hütte wieder angefacht und dann mit einem brennenden Span die Feuerstelle im Freien entzündet, damit das Feuer drinnen wieder ausgehen konnte und es im Haus kühl blieb. Es würde erneut ein heißer Tag werden, selbst hier im Wald. Ich hatte geholfen, das Schwein zu füttern und Erbsen auszulösen.
Die Sonne stand bereits über den Bäumen, als ich durch das schmale Tor schritt und Branna mir auf die Schulter sprang, als wäre ich von einer weiten Reise zurückgekehrt. Die Rabin rieb ihren Kopf an meiner Wange, gab leise, klackernde Laute von sich und sperrte den Schnabel auf, in der Hoffnung auf Leckerbissen. Ich brach ein Stück von der Brotscheibe ab, die die Bauersleute mir mitgegeben hatten.
»Guten Morgen, Branna«, sagte ich und fühlte mich gleich wieder besser.
»Moorgn!«, krächzte Branna.
Ich schritt zügig den schmalen Pfad entlang, der zu der Straße gelangte, der einzige Weg, der von dem Hof wegführte. Der alte Bauer hatte mir ein kleines Stück Leder geschenkt, mit dem ich das Loch in meinem Bundschuh geflickt hatte. Bei jedem Schritt spürte ich die verdickte Stelle in der Sohle, wo in den letzten Tagen durch das Loch im Leder Steinchen und Sand in meinen Schuh gekommen waren. »Habt Dank«, dachte ich jedes Mal, wenn ich den Fuß aufsetzte, obwohl der Druck auf den Ballen unangenehm war. Bis zum Abend hätte ich den Schuh wieder eingegangen. In ein paar Tagen würde ich Leder für völlig neue Sohlen brauchen. Oder wie so oft bloßfüßig laufen.
An der Kreuzung, wo der Trampelpfad auf die staubige Straße traf, hielt ich an. Das flaue Gefühl in meinem Magen kehrte zurück. Ich hatte weder gestern Abend der Mondgöttin für den neuen Tag gedankt noch heute Morgen die Götter um den Weg gefragt, und nun, wo die Sonne bereits hoch am Himmel stand, war es zu spät. Sonnengott Lug würde mir auch im schnellsten Drehen immer verraten, wo er sich befand.
Ich blickte in beide Richtungen. Branna verließ meine Schulter und landete neben mir und Cú, mit schiefgelegtem Kopf beäugte sie den Boden auf der Suche nach Würmern und Käfern. Cú setzte sich und beobachtete mit aufgestellten Ohren seine gefiederte Freundin. Die beiden waren es immer zufrieden, egal, wo sie waren. Nur ich war es, die es weiter drängte, auf ein Ziel zu, dessen Richtung ich nicht kannte.
Wir könnten flussabwärts die Straße entlang gehen, wie gestern. Irgendwann würden wir auf Bragnreica stoßen. Ich schloss die Augen. Die Nacht in der Hütte mit den Bauersleuten war mir eigentlich schon wieder genug an Menschen für ein paar Tage gewesen. Wenn ich mir nun eine Duron vorstellte … Ich fühlte einen Schauder meinen Rücken hinunterlaufen. Andererseits … Bragnreica hieß Menschen … und Menschen hieß vielleicht Nachricht von ihm, von dem ich so oft geträumt hatte. Ich verdrängte die vielen Bilder, die sich in meinem Kopf formten.
Wir könnten aber auch den Weg zurückgehen, den ich gestern gekommen war. Ich wusste nicht, was die Götter heute für uns entschieden hätten. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir zurückgeschickt wurden, um festzustellen, dass ich dort, wo wir landeten, von Hilfe war. Ich könnte natürlich auch den Fluss verlassen, der laut neben uns rauschte, und quer durch den Wald gehen …
Ich seufzte. Dann setzte ich mich neben Cú und Branna, die Beine gekreuzt und meinen Ziegenfellbeutel im Schoß.
»Was meint ihr? Bragnreica, zurück oder querfeldein?«
Cú gähnte herzhaft, die Zunge nach oben gerollt wie ein Schneckenhaus, und ließ seine Vorderpfoten nach vorne wandern, bis er lag.
Ich lachte. »Hierbleiben? Nein, so gemütlich finde ich es nicht an dieser Wegkreuzung.«
Branna warf mir nur einen kurzen Blick zu, aufmerksam damit beschäftigt, einen dunklen Stein mit ihrem Schnabel hin und her zu schieben. Es war ein hübscher Stein, nichts Besonderes, wohl ein kleines Stück Fels aus den Bergen, das im Fluss hier ins Tal gereist war, denn es war rund und glatt, nicht so kantig wie Berggestein. Eine Geschichte über die Wanderung des Steins von einer hohen Bergspitze herab ins Tal, von den Wassergeistern hin und her geworfen und zu guter Letzt von einem Bären beim Fischfang aus dem Fluss getatzelt, formte sich in meinem Kopf. Geschichten lauerten überall.
Branna hatte den Stein in den Schnabel genommen und suchte nun ein geeignetes Plätzchen, um ihren Schatz aufzubewahren. Wie so oft war ich dieses Plätzchen und der Stein landete mit einem sanften »Krahhh« in meiner Hand. Pass gut darauf auf schien Brannas Blick zu sagen.
Ich betrachtete ihn genauer. Ein guter Stein. Rund, glatt, angenehm kühl in meiner Hand. Und er hatte ein kurzes Stück den Weg entlang Richtung Bragnreica gelegen. Dies sollte als Hinweis der Götter für heute genügen.
Ich lächelte.
»Wenn du meinst, Branna. Dann lasst uns gehen.«
Vielleicht würde es doch noch ein guter Tag werden.
Die Sonne schien heiß über den Fluss herüber und der hohe Wald, an dessen Kante der Weg verlief, lag auf der falschen Seite, um Schatten zu bieten. Einige Fuhrwerke waren an uns im Laufe des Morgens vorbeigefahren, doch niemand hatte uns angeboten, uns mitzunehmen. Ich hatte das wenige Brot mit meinen beiden Gefährten geteilt und konnte an Cús nervösem Laufen erkennen, dass er hungrig war. Plötzlich hörte ich aus dem Wald zu unserer Linken über all dem Vogelgezwitscher, das uns den ganzen Tag begleitet hatte, mehrstimmiges Krächzen. Branna, die die letzte Zeit faul auf meiner Schulter gesessen und Haarsträhnen aus meinem Zopf gezupft hatte, hob den Kopf. Auch Cú verlangsamte seinen Lauf und spitzte die Ohren, schnüffelte mit hocherhobener Schnauze.
Branna ignorierte Krähen, doch wenn eine Schar Raben rief, so hieß das meistens, dass sie umliegende Gefährten über ein frisches Stück Aas benachrichtigten. Selbst ich konnte nun, als eine leichte Brise zwischen den Bäumen herauswehte, den stechend süßlichen Geruch von Verwesung wahrnehmen, der sich auf meinen Rachen legte wie eine dünne Schicht Butter auf warmes Brot. Frisch war dieses Aas nicht mehr. Aber groß.
Cú sah mich an, sein Schwanz wedelte aufgeregt und fragend. Auch Branna trippelte auf meiner Schulter von einem Bein auf das andere.
Ich nickte. Die Tiere hatten Hunger.
»Lauft nur, ich komme nach.«
Sofort erhob die Rabin sich in die Lüfte und verschwand im Wald. Cú schien selig zu grinsen, als er davonlief.
Ich musste Zweige zur Seite schieben und mich durch Buschwerk kämpfen, um den beiden zu folgen. Ich war noch nicht weit gekommen, als ich plötzlich, näher als das Kreischen der Rabenschar, ein entsetzliches Jaulen hörte, gefolgt von einem wütenden Krächzen.
Mir wurde eiskalt. Für einen Augenblick stockte ich, dann rannte ich los.
Brannas Kreischen wies mir den Weg. Doch es fehlte Cús Gebell, mit dem er sonst Beute vor sich herjagte. Da war nur Winseln zu hören, Jaulen.
Ich achtete nicht auf die Dornenranken, die mein Kleid zerrissen, und die dünnen Äste, die mir ins Gesicht peitschten. Noch im Laufen zog ich die lange Hanfschlinge aus meinem Gürtel und einen kugelrunden Stein aus dem Gürtelbeutel. Ich hatte immer zwei Wurfgeschosse bei mir, man wusste nie, wann man die Schleuder benötigte. Drei, wenn man den kleinen Stein mitrechnete, den Branna mir heute gegeben hatte. Obwohl ich auch noch meinen Haselstab in der Hand hielt, schlüpfte mein Mittelfinger bereits in die Schlaufe am einen Ende der Schnur, die andere Hand hielt den Stein in dem Lederschiffchen, von dem aus er eine tödliche Waffe werden konnte.
Bald hatte ich eine kleine Lichtung erreicht, gerade groß genug, dass die Sonne zur Mittagszeit den Boden erreichte. Vom Aas irgendeines Tieres war nichts zu sehen, das Gekrächze der Rabenschar erklang auch von noch tiefer aus dem Wald.
Doch am anderen Rande der Lichtung lag Cú zwischen den Wurzeln einer Buche, die Augen panisch aufgerissen, blutüberströmt.
Mein Cú. Mein Beschützer, mein Bruder.
Ich musste mich zwingen, den Blick abzuwenden. Zu ihm zu eilen musste noch warten. Denn zwischen ihm und mir stand ein Keiler, im Begriff, erneut auf den Hund loszustürmen. Branna flatterte laut kreischend um das Wildschwein herum, versuchte, es von ihrem Freund abzulenken, peckte auf das borstige Tier ein, flog hoch, sobald es den Kopf nach ihr herumwarf, stürzte sich wieder hinab.
Ich wirbelte die Hanfschlinge mit dem Stein darin über meinem Kopf. Branna flog hoch, als sie das Geräusch hörte. Ich ließ das lose Ende der Schnur los, der Stein zischte durch die Luft, traf den Keiler in der Flanke. Irritiert wandte er sich um, grunzte schmerzerfüllt und wütend. Branna stürzte wieder herab, erwischte ihn mit ihrem scharfen Schnabel beim Auge, während ich den zweiten Stein einlegte. Ich schrie so laut, dass selbst das Kreischen der Raben nicht mehr zu hören war. Der Stein traf den Keiler an der Schnauze und schaffte es, dass das Borstenvieh den Angriff auf Cú aufgab. Es warf sich herum. Ich packte meinen Haselstab fester, richtete ihn auf den Eber, bereit, mich zu verteidigen. Doch der Keiler starrte mich einen Augenblick an und donnerte durch das Gebüsch davon.
Ich wagte nicht aufzuatmen. Eilends steckte ich die Schlinge zurück in den Gürtel und rannte über die Lichtung auf Cú zu, wo ich den Stab fallen ließ und mich neben ihn kniete.
Cú versuchte sich aufzurichten, sank aber sofort wieder zusammen. Mit zittrig fliegenden Händen streichelte ich ihn, tastete vorsichtig über seinen Körper. Neben seinem rechten Auge begann sich eine Beule zu bilden, das Lid war bereits zugeschwollen. Sein Brustkorb hob und senkte sich wie der Flügelschlag eines Vögelchens, ich war mir nicht sicher, ob nicht eine oder mehrere Rippen gebrochen waren. Über mir zog Branna kreischend weite Kreise. Andere Raben antworteten. Ich wandte meinen Blick Cús Hinterlauf zu, wo der Keiler ihn offenbar mit seinen Hauern aufgespießt und über die Lichtung geschleudert hatte.
Ein tiefer langer Riss klaffte den Oberschenkel entlang.
Ich fühlte Übelkeit hochwallen, fühlte meine Brust so furchtbar eng werden wie ich es nicht mehr erlebt hatte, seit Tegid gestorben war. Da war nichts als Hilflosigkeit. Ich war alleine, mitten in einem Wald voller Tiere, die nur zu gerne sich an einem verwundeten Hund gütlich täten. Mein Wasserschlauch war fast leer, ich war nachlässig gewesen, weil wir doch dem Fluss entlang gingen.
Ich brauchte Wasser, Wasser, um die Wunde zu reinigen, Wasser, um einen Umschlag zu machen, Wasser, um in der Nacht für den Hund zu trinken zu haben. Aber ich konnte Cú hier keinesfalls alleine lassen …
Cú hob ein wenig den Kopf, ganz still war er geworden, kein Winseln, kein Jaulen. Seine lange Zunge schleckte mein Gesicht, und ich merkte jetzt erst, dass ich mich weinend zu ihm gebeugt hatte. Nein, ich durfte nicht weinen. Ich musste eine Lösung finden. Cú und Branna waren alles, was ich an Familie hatte. Nie gab ein Held meiner Geschichten auf, ich täte es genauso wenig.
Ich zog die Nase hoch und lächelte Cú an.
»Guter Junge. Keine Sorge, das schaffen wir schon.«
Ich streichelte seinen Kopf und hinter meiner Stirn arbeitete es fieberhaft. Ich musste verhindern, dass Wölfe oder andere Tiere sich Cú näherten, während ich einen Bach suchte.
Als ich mich erhob, landete Branna neben mir, immer noch aufgeregt und verwirrt.
»Das hast du gut gemacht, Branna«, sagte ich.
Die Rabin flatterte zu ihrem Freund, hüpfte um ihn herum, wie um ihn zu inspizieren, und begann dann, unter den umliegenden Bäumen Moos auszurupfen und herbeizubringen.
»Guut«, gurrte die Rabin, leise und sanft.
Mir stiegen die Tränen in die Augen, als ich das sah.
Aber ich hatte nun anderes zu tun. Eilig sammelte ich am Rand der Lichtung Äste zusammen, immer den Blick auf Cú gerichtet. Ich fand einige trockene Flechten und hatte im Nu ein Feuer entfacht. Wenn ich etwas in all den Jahren meiner Wanderschaft gelernt hatte, dann war es, mit meinem Schlageisen Feuer zu machen. Der Geruch nach Rauch würde den nach Blut überdecken und Tiere fernhalten. Ich nahm meinen Umhang aus dem Ziegenfellbeutel und deckte Cú damit zu, der Hund zitterte. Die Lichtung lag bereits im Schatten, bald würde es dunkel werden. Ich musste mich beeilen.
»Ich gehe Wasser holen, Cú.