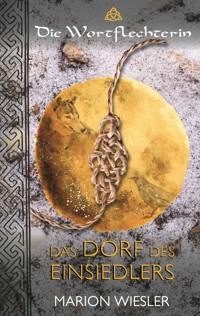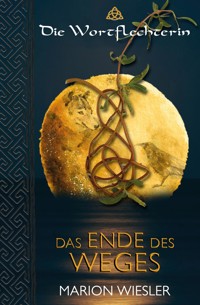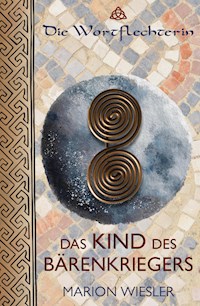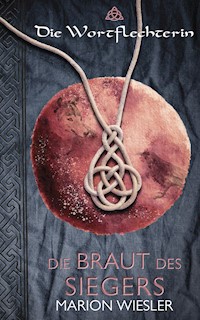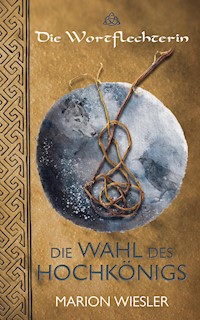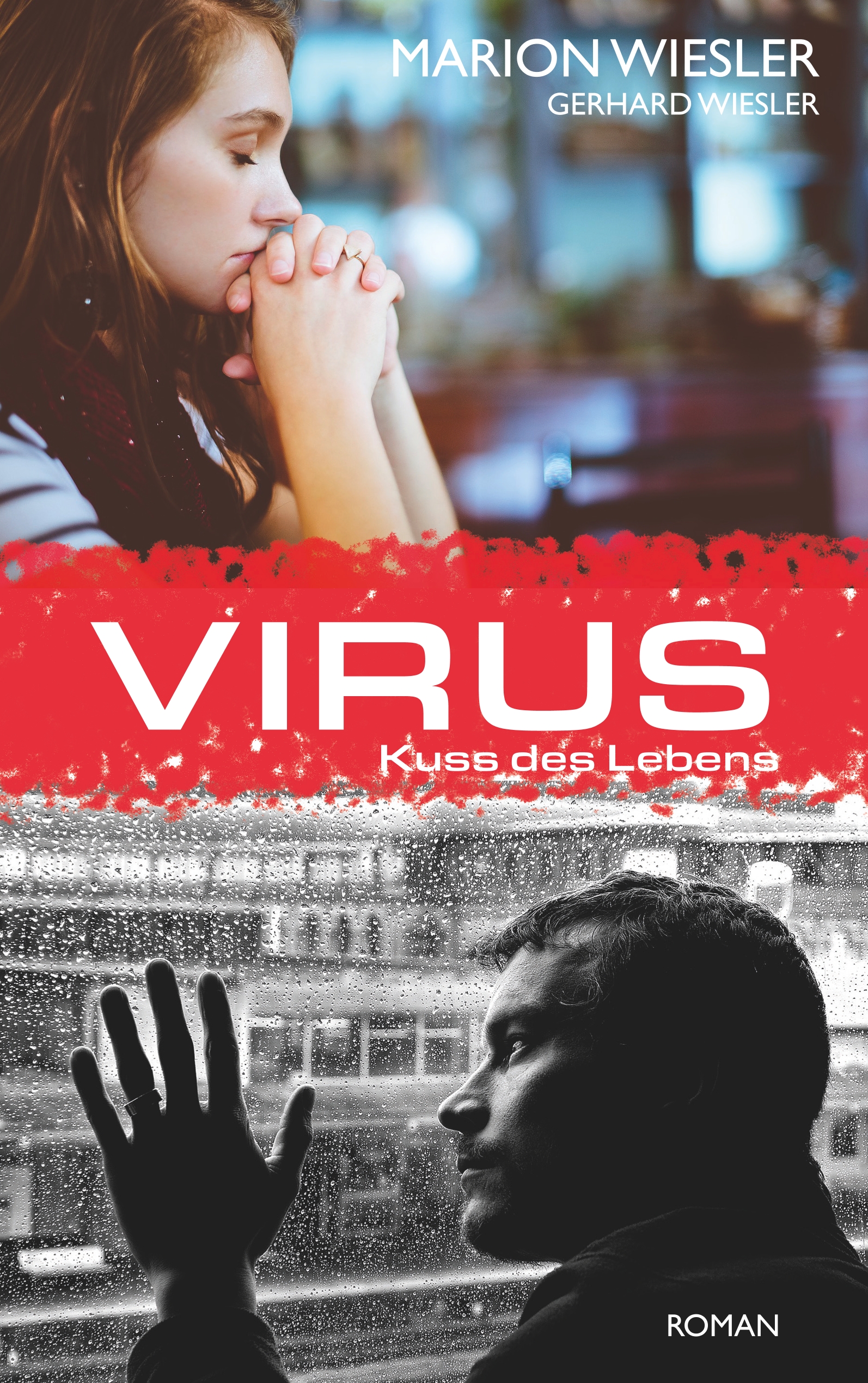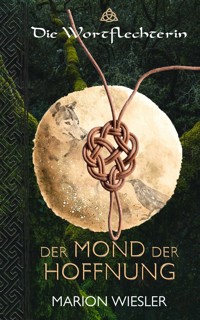
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Bardin, verflucht, nie sesshaft zu sein. Eine große Liebe. Gute Geschichten und treue Gefährten. Gallien, im Jahr 37 vor unserer Zeitrechnung. Seit neun Jahren wandert die Bardin Arduinna mit ihrem Wolfshund und ihrem Raben dem Gebot ihres Maistirs folgend durch die Welt. Nun naht der neunte Jahrestag und sowohl Arduinna als auch Loïc ahnen, dass sie an jenem Tag an dem Ort sein müssen, wo alles begann. Werden sie es rechtzeitig nach Vesontio schaffen? Und weshalb mehren sich die Berichte von toten Barden? Band 6 der Keltenroman-Serie »Die Wortflechterin« Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marion Wiesler
Der Mond der Hoffnung
Keltenroman
Band sechs der Keltenroman Serie "Die Wortflechterin"Inhaltsverzeichnis
Arduinnas Welt
Noricum
Ich bin Arduinna
Prolog: Der Herbst vor dem Fluch
Kapitel 1: Das Heiligtum von Ovilavia
Kapitel 2: Im Lager der Sueben
Kapitel 3: Wegstrecken
Kapitel 4: Wartend
Kapitel 5: Verhandlung
Kapitel 6: Das Götterurteil
Kapitel 7: Die Wirtin
Kapitel 8: Bei Sonnenaufgang
Kapitel 9: Abreise
Kapitel 10: Erneute Verhandlung
Kapitel 11: Ritt durch die Nacht
Kapitel 12: Erinnerungen
Kapitel 13: Samis' Bericht
Kapitel 14: Ein Gehöft
Kapitel 15: Der Salzhändler
Kapitel 16: Die Weggabelung
Kapitel 17:Ungewissheit
Kapitel 18: Entscheidung
Kapitel 19: Ankunft
Kapitel 20: Neuigkeiten
Kapitel 21: Säuberung
Kapitel 22: Ein Zeichen
Kapitel 23: Entscheidung
Kapitel 24: Unterwegs
Kapitel 25: Tongios’ Geschichte
Kapitel 26: Der Geschichte zweiter Teil
Kapitel 27: Angst
Kapitel 28: Am Wegesrand
Kapitel 29: Das Schwarzvogelei
Kapitel 30: Schweigen
Kapitel 31: Vor Vesontio
Kapitel 32: Abschied
Kapitel 33: Tagundnachtgleiche
Kapitel 34: Ein Wunderwerk
Kapitel 35: Bei den Bauersleuten
Kapitel 36: Zweifel
Kapitel 37: Der rechte Zeitpunkt
Kapitel 38: Eine Begegnung
Kapitel 39: In Vesontio
Kapitel 40: Beruhigung
Kapitel 41: Im Nemeton
Kapitel 42: Ein Traum
Kapitel 43: Die Riten
Kapitel 44: Ein weiterer Traum
Kapitel 45: Süßes Brot
Kapitel 46: Damasia
Kapitel 47: Der Kriegerzug
Kapitel 48: Rotkehlchen
Kapitel 49: Der Barde
Kapitel 50: Brigantion
GLOSSAR
GESCHICHTE(N)
PERSONEN
ORTE
Impressum
Marion Wiesler
Die Wortflechterin
Der Mond der Hoffnung
Band 6
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband)
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Das Kind des Bärenkriegers
Der Mond der Hoffnung
Das Ende des Weges
Informationen und gratis Kurzband auf
www.marionwiesler.at
Arduinnas Welt
Karte inspiriert von der berühmten Tabula Peutingeriana
Noricum
Verzeichnis der Orte und ihrer heutigen Namen im Glossar
Ich bin Arduinna
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot.
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Prolog: Der Herbst vor dem Fluch
Sie standen einander gegenüber, wie so oft. Beide waren sie dreckig, keuchten. Der Boden war rutschig, es hatte geregnet. Die Lichtung von unzähligen Übungskämpfen zertrampelt.
Loïc hatte vorhin gegen Coelius gewonnen. Wie immer. Manchmal war er sich nicht sicher, ob sein Freund ihn nicht siegen ließ, weil Loïc nunmal der Sohn seines Reix war. Gegen den Berg hatte er verloren. Auch wie immer. Wie sie alle. Nicht umsonst nannten sie ihn Berg. Er war nicht der Schnellste, aber riesig und standhaft wie ein Fels.
Alle anderen hatten ihre Übungskämpfe beendet. Saßen und standen in einem weiten Kreis um sie herum. Auch dies wie immer, wenn Loïc und Baldram sich miteinander maßen. Es wurde ihnen niemals langweilig.
Der alte Krieger hatte auf einem umgefallenen Baumstamm Platz genommen. Sie wechselten sich ab, die Alten. Jeder hatte andere Fähigkeiten, die sie den Jungen beibrachten. Aber jeder von ihnen hatte Spaß daran, Loïc und Baldram gegeneinander kämpfen zu lassen. Die beiden waren gut. Obwohl auch Baldram gegen den Berg verlor, aber der Berg zählte nicht. Und die beiden hatten einen ungeheuren Ehrgeiz gegeneinander. So vergnügt und freundschaftlich beide mit den anderen fochten, gegeneinander kannten sie keine Gnade. Ihre Siege hielten sich die Waage. Der Baum am Rande der Lichtung zählte gleich viele eingeritzte Striche für jeden. Sie wussten, dass ihre Kameraden Wetten abschlossen.
Loïc griff nach dem Schild, den einer der jungen Burschen ihm reichte. Er wog das Übungsschwert in seiner Hand. Er überlegte, wie er Baldram überraschen konnte. Sie hatten schon so oft gegeneinander gefochten, sie kannten jede Hinterlist, jede ungewöhnliche Hiebfolge des anderen. Ihre Kämpfe dauerten oft lange. Seine Linke fasste fester nach dem Griff des Schilds. Seine Rechte schwang das Schwert locker auf und ab, um sich an sein Gewicht zu gewöhnen. Schartig war es und stumpf, ein altes Schwert eines Kriegers. Gut für die Übungskämpfe. Sie sollten einander schließlich nicht töten. Jedesmal ein anderes Schwert, ein anderer Schild, um sie geistig und körperlich beweglich zu halten. Sie zu fordern.
Loïc sah Baldram in die Augen. Blau blitzten sie ihm entgegen. Loïc presste die Lippen aufeinander. Er kannte diesen Blick. Baldram hatte einen Plan, wie er Loïc heute besiegen könnte. Das letzte Mal hatte er es hinter Loïcs Schwertarm geschafft und ihm den Knauf seines Schwertes in den Oberschenkel gerammt. Tagelang hatte Loïc kaum gehen können danach. Das würde ihm nicht noch einmal passieren.
Der alte Krieger erhob sich, die jungen ringsum wurden still. Ein Bub, der zum ersten Mal heute bei den Schwertübungen hatte dabei sein dürfen, rutschte aufgeregt hin und her.
Loïc fasste sein Schwert fester, beugte leicht die Knie. Gleich würden sie das Zeichen erhalten zu kämpfen. All seine Aufmerksamkeit war auf Baldram gerichtet. Nur seine Ohren lauschten dem Wort des Alten entgegen.
Doch das Zeichen kam nicht. Stattdessen hörte er von weit weg jemanden seinen Namen rufen. Eine Sinnestäuschung wohl. Es hatte nach einer Frauenstimme geklungen. Frauen hatten hier auf der Lichtung nichts verloren, wenn die Krieger sich mit den Waffen übten. Obwohl jeder wusste, dass sie manchmal just zu diesen Zeiten in den Wald gingen, Pilze zu sammeln, um einen Blick auf die jungen Männer zu erhaschen, die einander keuchend und stöhnend mit dem Schwert oder ringend bekämpften.
Die Stimme kam näher. Loïc sah Baldrams Augen flackern. Der geeignete Moment, ihn anzugreifen. Man musste jede Ablenkung des anderen nutzen. Aber er tat es nicht. Der Alte hatte nicht das Zeichen gegeben. Einmal hatte Loïc es gewagt, bereits vor dem Zeichen des Alten loszupreschen. Es war ihm nicht gut bekommen.
Loïc wagte es, seinen Blick auf die anderen schweifen zu lassen. Sie alle blickten hinter ihn, selbst der Alte. Nun hörte Loïc Schritte nähereilen. Er richtete sich auf, drehte sich um. Hörte Baldram hinter sich den Augenblick nutzen, um vorzustürmen, hörte die scharfe Stimme des Alten, die den jungen Sueben zurechtwies. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Baldram mit gesenktem Kopf stehenblieb.
»Loïc!« Es war keine Frauenstimme gewesen, sondern einer der Handwerkerburschen, kein Dutzend Winter alt, dessen Stimme sich vor Aufregung beinahe überschlug. »Loïc! Sie kommen dich holen!«
Loïc sah verwirrt zu dem Jungen, dann zu dem Alten.
»Wer?«
»Männer aus Vesontio.«
Sein Vater war gestorben. Das war sein erster Gedanke. Es gab keinen anderen Grund, ihn drei Jahre vor der Zeit zurückzuholen.
»Du sollst heiraten«, sagte der Junge.
Loïc sah das breite Grinsen in den Gesichtern der anderen.
Heiraten.
Heimkehren.
Zu Menschen, die er nicht kannte. Zumindest musste er noch nicht deren Anführer sein. Vater lebte noch.
Er sah zu Baldram hin, der ihn angrinste.
»Dann fichst du ab nun andere Kämpfe, mit einem anderen Schwert. Hoffentlich ist es nicht stumpf.«
Die Älteren grölten. Die Jüngeren verstanden den Witz nicht.
Coelius trat auf Loïc zu. »Lass uns eilen. Wir sollten die Männer deines Vaters nicht warten lassen.«
Loïc nickte. Grinste nun selbst. Sagte zu Baldram: »Immerhin früher als du. Ich schick dir dann meinen Erstgeborenen als Übungsgegner. Den schaffst du vielleicht zu besiegen, solange er noch ein Kleinkind ist.«
Baldram sprang auf ihn zu, Loïc hob sein Schwert. Doch der Suebe griff ihn nicht mit der Waffe an, grinste nur und stieß ihn freundschaftlich mit der Faust gegen die Schulter.
»Ich werde dich vermissen, Sequaner.«
Kapitel 1: Das Heiligtum von Ovilavia
Ich hatte von Morfran geträumt. Er war vor mir gestanden, sein Schwert auf mich gerichtet. Doch es waren seine Worte, die mich durchbohrten, die wie unzählige Pfeile in mich drangen, in meine Beine, meine Arme, den Rumpf. Ich war verwundert gewesen, hatte ich doch immer gedacht, dass seine Worte sich in meinem Kopf festsetzen würden und ich meinen Geist vor ihm schützen müsste, doch nun krümmte ich mich unter den spitzen Schmerzen, die in meinen Körper drangen. Ich hatte die Hände vor meinen Bauch gelegt und all meine Sorge galt dem Kind in mir, das mein Maistir gewiss noch vor mir töten würde.
Doch dann hatte ich ihn gesehen, keinen Schritt schräg hinter dem Habicht stehend, mit einem Lächeln im Gesicht. Tegid, mein alter Maistir, mein Vater und Vatervater. Am liebsten wäre ich zu ihm gelaufen, hätte mich in den Schutz seiner Arme geworfen, doch Morfran stand zwischen uns und die Schmerzen kosteten all meine Kraft, um nicht zusammenzubrechen. Tegid hielt etwas in seiner Hand, hielt es hoch, seine Augenbrauen leicht gehoben, wie er mich immer angesehen hatte, wenn ich ihm Gelerntes wiedergeben sollte. Dann war ich aufgewacht.
Wir waren in Ovilavia, wohin uns die beiden Männer mit ihrem Pferdewagen mitgenommen hatten. Jenem Wagen, der tags zuvor beinahe Samis überfahren hatte. Die Frauen der beiden Brüder hatten uns mit reichhaltigem Essen, warmem Wasser zum Säubern und einer gemütlichen Schlafstelle verwöhnt. Doch wo auch immer ich den gestrigen Abend verbracht hätte, es wäre ein Abend der Feier gewesen, denn die Götter hatten mir gezeigt, dass ein Mensch entgegen meiner bisherigen Überzeugung kein Ort war und Samis daher bei mir bleiben konnte, ohne dass nach einem halben Mond ihm oder Loïc Schlimmes geschah. Dass daher auch das Kind in mir nicht dem Tod geweiht war, wenn ich es nicht innerhalb eines halben Mondes nach seiner Geburt bei Ferchar und Sanna unterbrachte. Ich war in den Nemeton gegangen und hatte den Beutel mit Schmuck, den ich am Tag davor gefunden hatte, den Göttern als Dankopfer dargebracht. Ich hatte mit dem Druiden geredet und er hatte für mich die Götter befragt. Ja, ich hatte den Willen der Götter richtig verstanden. An meiner Erleichterung hatte ich gemerkt, dass ich mir bei aller Freude doch nicht völlig sicher gewesen war.
Und dann dieser Traum …
Ich verließ noch im Dunkeln das Haus, befahl Cú, bei Samis zu bleiben und legte auch meine Sachen so hin, dass der Junge sie sogleich sehen würde, wenn er erwachte. Er sollte nicht Angst haben, dass ich mich davongeschlichen hatte wie erst zwei Tage zuvor in Lauriacon. Doch ich brauchte ein wenig Zeit alleine, um in Ruhe über diesen Traum nachzudenken.
Gleich neben der Türe des Hauses fand sich ein Platz unter dem breiten Vordach, wo der Nieselregen, der in der Nacht eingesetzt hatte, nicht hinkam. Ich wählte einen Stapel getrockneter Schweinehäute, der dort lag, als Sitzgelegenheit, und schlug meinen Umhang eng um mich. Noch weilte die Siedlung in tiefer Ruhe. Die Luft strich kühl und feucht über mein Gesicht und duftete bereits nach Frühling. Mir blieb noch etwas mehr als ein halber Mond, um Vesontio zum Tag des Gleichgewichts zwischen Hell und Dunkel zu erreichen. Würde ich dort Morfran begegnen? Würde auch der Habicht zum drei-mal-dritten Jahrestages des Fluchs, den er gesprochen hatte, an den Ort zurückkehren? Umso wichtiger, mich gegen ihn zu wappnen. Hatte Tegid mir deswegen diesen Traum geschickt?
Ich schloss die Augen und ließ die Bilder der Nacht sich wieder in mir ausbreiten. Der stechende Blick unter den dunklen Haaren, die schmalen Lippen, aus denen ein Wort nach dem anderen herausblies wie ein Sturm, der alles um sich niederwälzte. Worte, die ich nicht verstand, und die mich trotzdem trafen wie Messerklingen. Das Schwert in seiner Hand, das er bereits im Großen Krieg gegen unzählige Feinde eingesetzt hatte und das in seinem Haus an der Wand gehangen hatte, während er uns Schüler unterrichtete, wie eine beständige Mahnung daran, dass unser Maistir mehr Künste beherrschte, als wir je beherrschen würden. Tödliche Künste.
Doch ich wendete meine Aufmerksamkeit auf den Mann, der in meinem Traum hinter ihm gestanden hatte und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Wie er mir fehlte! Wie wohltuend sein Anblick war! Tegid, mit dem grauen Haar und Bart, den Fältchen um seine Augen, die seinem Blick immer etwas Belustigtes gaben. Versinken könnte ich in dem Trost, den dieses Gesicht mir gab. Auch er war oft streng gewesen, doch immer voll der Liebe für mich, bis hin zu dem Augenblick, da er sein Leben für mich gab.
Erneut sah ich ihn die Augenbrauen leicht heben, als wollte er mir sagen, ich solle meine Aufmerksamkeit auf das richten, das nun wichtig war und nicht auf alte Sehnsüchte. So blickte ich denn auf seine Hand, die einen kleinen Gegenstand hielt.
So sehr ich mich bemühte, ich konnte nicht erkennen, was es war. Ich zog Schuhe und Fußlinge aus, stellte meine nackten Füße auf den kühlen Boden, um mich mehr mit der Göttin der Erde zu verbinden, war es doch die Erde, die die Gedanken der Toten in sich trug. Erneut schloss ich die Augen, wanderte zurück in den Traum. Doch wann immer ich versuchte, den Blick auf den Gegenstand in Tegids Hand zu richten, schob sich Morfrans Gesicht davor. So wie früher, als ich seine Schülerin war. Wann immer ich in den drei Jahren, die ich bei dem Habicht verbracht hatte, etwas erwähnte, das Tegid mich gelehrt hatte, verzog der oberste Barde der Carnuten angewidert den Mund und erklärte es zu Unsinn. Als wäre Tegid nicht ein hoch angesehener Barde jenseits des schmalen Meeres gewesen, sondern bloß ein Gaukler und Erzähler. Nur, weil die beiden Männer verschiedene Ansichten darüber hatten, was den Kern des Bardentums ausmachte. Der eine ließ seine Geschichten und Lieder aus dem Herzen fließen, der andere aus dem Kopf. Beide hatten sie mich ihre Kunst gelehrt, doch Morfran hatte nicht bewirken können, dass ich Tegids Wege aufgab. Egal, wie sehr er es versuchte. So wie jetzt, wo er sich in den Bildern in meinem Kopf vor Tegid und den Gegenstand in seiner Hand drängte. Ich verstärkte meine Anstrengung, voll des wütenden Trotzes. Natürlich wollte der Habicht nicht, dass ich sah, was mein alter Maistir mir als Hilfe für den Kampf gegen ihn anbot.
Je mehr ich mich anstrengte, umso unklarer wurden die Bilder des Traumes. Ich wusste, dass es der falsche Weg war. Träume ließen sich nicht mit Gewalt festhalten, sie waren wie feiner Nebel, den man nicht fassen konnte, dem man sich hingeben musste. Wie Wasser, das einem durch die Finger rann, wenn man es in seiner Faust bewahren wollte, das einen aber sanft umspielte, wenn man sich darin treiben ließ. Ich holte tief Luft, bemühte mich, alle Wut auf Morfran und alle Angst vor ihm loszulassen.
Tegids Gesicht wurde klarer. Der Blick meiner Kindheit, lächelnd, aufmunternd, voll des Vertrauens und doch auch der Forderung. Lange hatte ich ihn nicht so klar vor mir gesehen. Erneut hob er die Augenbraue, um mich daran zu gemahnen, dass ich meine Aufmerksamkeit seiner Hand zuwenden solle. Ich zwang meinen Blick seinen Arm hinab, doch das Ding, das er mir entgegenstreckte, war immer noch verschwommen, als hielte er es unter trübem Wasser. Grün und braun war es, das konnte ich erkennen, und klein. Ein Stein vielleicht?
Ausatmen. Keinen Widerstand leisten, alle Anstrengung aufgeben.
Am Rande meines Bewusstseins hörte ich die Türe neben mir sich öffnen und Cús kurzes Bellen zur Begrüßung.
Es riss mich aus meinen Gedanken, sofort hellwach für drohende Gefahr, auch wenn Cús Bellen freundlich gewesen war. Mein Blick zuckte in die Richtung des Geräusches.
Alle Gedanken an den Traum verflüchtigten sich ins Dunkel der vergangenen Nacht.
Samis stand in der Türe, noch ganz verschlafen, die Hand auf Cús Nacken. Er lächelte, und ich erwischte gerade noch den Moment, wo sich sein ängstlicher Blick in Erleichterung gewandelt hatte. So viel Angst in so einem jungen Kind, obwohl er doch mein Gepäck gesehen haben musste. Hatte er wirklich gedacht, ich wäre gegangen, ohne ihn und ohne Cú?
Ich griff nach seinen Händen, sah ihm geradeaus in die Augen. Nun war da wieder Sorge, als ihm wohl bewusst wurde, dass ich ihm etwas Wichtiges sagen wollte. Bis jetzt war dies immer gewesen, dass ich ihm erneut klar machte, dass er nicht mit mir gehen konnte.
»Samis«, sagte ich, »jetzt, da wir wissen, dass die Götter uns nicht strafen, wenn du bei mir bist, werde ich dich erst verlassen, wenn du es eines Tages wünschst. Und ich hoffe, dieser Tag ist noch in weiter Ferne und ist der Tag deiner Vermählung mit einem liebenswerten Mädchen.«
Ich war selbst beinahe erstaunt über diese Worte, die voller Ehrlichkeit aus meinem Herzen kamen. Ein halber Mond nur hatte gereicht, dass ich mich diesem Kind auf ewig verbunden fühlte. So war es eben, wenn die Götter es so bestimmten. Auch bei Loïc hatte es nur einen Augenblick gebraucht, um zu wissen, dass wir zusammengehörten.
Samis blies die Luft aus und mir wurde klar, dass er sich trotz der Ereignisse gestern wirklich nicht sicher gewesen war, dass ich ihn nicht doch wegschickte. Dann schlug er aber die Hände vors Gesicht und streckte mit einer angewiderten Grimasse die Zunge raus.
»Was?«, fragte ich, da ich nicht verstand, was er meinte.
So zog er die kleine Wachstafel aus seinem Gürtel, die er ständig bei sich trug, und ritzte mit dem Griffel etwas in das dunkle Wachs.
»PUELLAE«
Zur Verdeutlichung verzog er das Gesicht, als hätte er sauren Wein getrunken.
Ich lachte. »Du wirst deine Meinung über Mädchen schon noch ändern, wenn du älter wirst.«
Gerade, als ich ihm die Hand auf die Schulter legte, um mit ihm ins Haus zurückzugehen, erklang ein schepperndes Schlagen, das bei allen Menschen in jeder Siedlung gefürchtete Geräusch der warnenden Eisenstäbe. Ovilavia war groß, beinahe so groß wie Bragnreica, und doch dröhnten die Schläge so laut und durchdringend durch die morgendliche Stille, als schlüge jemand neben mir auf die eisernen Stäbe.
Die Bewohner der Siedlung eilten aus ihren Häusern. Überall öffneten sich die Türen, meist waren es die Männer, die vor ihren Frauen heraustraten, manche eine Axt oder zumindest ihr Messer in der Hand. Neugierige Kinder, die sich an ihren Müttern vorbeidrängten, wurden zurückgezerrt und ins Haus geschoben.
»Greifen sie an?«, fragten viele in Angst. Niemand schrie oder rief, es war das unterdrückte Sprechen jener, die sich in einer Gefahr wussten, die schon länger drohend über ihnen hing.
Wir hatten es bei unserer Ankunft gestern gehört, dass die Krieger der Sueben ganz in der Nähe über den Danubius gekommen waren und sich Kämpfe mit Voccios Männern lieferten, die der Magosreix geschickt hatte. Schon in Lauriacon hatte man uns davor gewarnt, dass es im Westen Krieg gab. Und nun waren wir wohl tatsächlich hineingeraten. Als wollten die Götter mir doch sagen, dass ich Samis nicht hätte mit mir nehmen sollen. Ich zwang den Gedanken zur Seite. Der Druide hatte gesagt, dass die Götter nichts dagegen hatten, dass jemand mich länger als einen halben Mond begleitete. Und auch ohne den Jungen war ich schon oft genug in gefährliche Lagen gekommen. Es war Zufall. Gewiss.
Samis drückte sich an mich und Branna kam aufgeregt keckernd von ihrem Schlafplatz auf dem Hausdach herab. Cú neben mir hatte die Nackenhaare aufgestellt und sein Blick streifte wachend über all die Menschen, die aufgeregt zusammenliefen.
Auch die beiden Brüder und ihre Frauen, in deren Haus wir geschlafen hatten, eilten heraus. Ihre Blicke glitten über mich und Samis, dann weiter über das Dorf. Die Eisenschläge hatten Gefahr verkündet, doch noch wusste niemand, was geschehen war. Es war kein Feuer, das in einem der Häuser ausgebrochen war, das würde man riechen. Ich hörte aber auch kein Kriegergetriller, wie es bei den meisten angreifenden Stämmen üblich war, um den Feind einzuschüchtern. Unter unmittelbarem Angriff schien Ovilavia also auch nicht zu stehen. Ein wenig ratlos standen die Menschen alle da, überzeugten sich, dass Nachbarn und nahe Verwandte wohlauf und nicht Anlass für den Warnklang gewesen waren.
Ein Mann kam in die Mitte des Dorfes gelaufen. Er war kein Krieger, trug wie manche, die gerade aus ihrem Schlaf geweckt worden waren, nur seine ungegürtete Camisia und sein Haar stand zerzaust vom Kopf ab. Im ersten Augenblick erkannte ich ihn nicht, denn es war gestern bereits dunkel gewesen, als ich in den Nemeton gegangen war, doch auf seiner Stirn war unverkennbar die blaue Sonne der Druiden zu sehen.
»Sie haben das Heiligtum gestohlen!«, rief er.
Wie eine Sturmböe schwoll die Unruhe nun an. Man hatte das Heiligtum gestohlen, das Herzstück ihrer Siedlung, das Zeichen göttlichen Schutzes.
Ich hatte das Standbild gestern Abend gesehen, als ich im Nemeton mein Dankopfer darbrachte. Eine Gottheit aus Holz geschnitzt, etwas größer als Samis und auf einem Felsbrocken stehend. Eine Göttin, mit vollen Brüsten, ihren Stamm zu nähren, und vor ihren Füßen ein Wasserbecken, rund um das Efeu wuchs, Zeichen der Unvergänglichkeit. Eine friedliche, wohlwollende und Reichtum verheißende Göttin, das Standbild geschmückt mit goldenen Ketten und rund um sie Schüsseln, Beutel und verschiedenste Gegenstände, die man ihr als Opfer dargebracht hatte. So wie ich es getan hatte.
Eine der goldenen Ketten hielt der Druide nun in die Höhe.
»Das ist alles, was von ihr geblieben ist.«
Wie ein einstimmiges Wehklagen erhob sich der Aufschrei der Menschen.
»Wie können sie in unsere Siedlung gekommen sein?«
»Das Tor wurde doch wie jeden Abend geschlossen!«
»Sie müssen sich schon davor Zutritt verschafft haben.«
»Vielleicht ist das Heiligtum ja noch hier, noch ist das Tor nicht geöffnet worden!«
Und plötzlich richteten sich alle Blicke auf mich und Samis. Cú knurrte.
»Sie! Sie ist gestern Abend nach Ovilavia gekommen! Und sie war im Nemeton!«
Die Menge näherte sich uns und ihre Blicke waren bedrohlich. Samis vergrub sein Gesicht in meinem Kleid, presste sich an mich.
»Sie ist eine Fremde! Sie muss es gewesen sein!«
Nur vereinzelt hörte ich Stimmen, die es anzweifelten, weil ich eine kleine, dünne Frau war und das Standbild der Göttin schwer und unhandlich, sodass es wohl zweier Männer bedürft hätte, es zu entwenden.
»Sie könnte andere hereingelassen haben und danach das Tor wieder geschlossen haben!«
»Das wäre dem Torwächter doch nicht entgangen!«
Branna flog in die Höhe, empört kreischend und bereit, jeden mit ihrem scharfen Schnabel anzugreifen, der sich mir weiter nähern würde.
Ich nahm meine wollene Kappe ab, schob mein Haar hinter das Ohr. »Ich bin Bardin von jenseits des schmalen Meeres und habe, bei den Göttern, nichts mit euren Kämpfen zu tun. Im Gegenteil, ich bin eine Vertraute Voccios und würde, wenn, wohl auf eurer Seite kämpfen.«
Der jüngere der beiden Brüder, der uns gestern mitgenommen hatte, stellte sich vor mich. »Sie ist Gast in meinem Haus und war seit unserer Ankunft immer bei uns. Ihr wisst, wie klein mein Sohn ist und dass mein Weib noch oft in der Nacht seinetwegen wach ist, es wäre ihr wohl aufgefallen, wenn die Fremde das Haus verlassen hätte.«
Er sah zu seinem Weib hin, das mit dem Säugling auf dem Arm neben ihm stand.
»Sie war die ganze Nacht im Haus«, sagte sie. »Und seht, wie dünn sie ist, niemals kann sie das Standbild heben.«
»Aber wie soll es sonst hergegangen sein?«
»Sie können über die Palisade gekommen sein«, warf ein älterer Mann ein.
»Ich sage dennoch, dass es die Fremde war, vielleicht hatte sie Helfer.«
»Ich stehe dafür ein, dass sie es nicht war«, sagte der Bruder, der uns gestern angeboten hatten, uns mitzunehmen. Vielleicht wähnte er sich in meiner Schuld, weil sein Pferdegespann beinahe Samis überfahren hatte, vielleicht hatte aber auch wie so oft die Geschichte, die ich gestern Abend ihm und seiner Familie erzählt hatte, ihn für uns eingenommen, dass er sich vor uns, die Fremden, stellte.
Die Wut der Umstehenden ebbte nur langsam ab, ich konnte verstehen, wie gerne man für solch ein Vergehen sogleich einen Schuldigen an der Hand hätte.
»Wir sind verloren, wenn sie unsere Göttin haben!«, riefen die ersten. »Wie sollen wir Ovilavia verteidigen, wenn sie uns unseren Schutz genommen haben?«
»Wir müssen vor allem Ruhe bewahren«, sagte der Druide, der mit seinen schlafwirren Haaren und den nackten Beinen nicht gerade ein Bild von Sicherheit vermittelte.
»Wie sollen wir Ruhe bewahren, wenn sie unsere Gottheit haben? Sie haben uns den Schutz der Götter genommen! Sie werden uns alle töten!«
Kinder begannen zu weinen, Frauen zu schluchzen.
»Noch haben sie uns nicht besiegt«, sagte der Druide. »Noch stehen Voccios Männer zwischen ihnen und uns, sie werden nicht zulassen, dass die Sueben Ovilavia einnehmen.«
»Aber sie haben unsere Göttin! Die Götter werden uns zürnen, dass wir nicht besser auf sie aufgepasst haben!«
»Das Heiligste haben sie uns genommen! Unheil wird über uns kommen, da brauchen die Sueben keinen Finger rühren!«
»Unsere Felder werden verdorren!«
»Oder Überschwemmungen zum Opfer fallen!«
»Ohne Schutz der Göttin werden die Frauen keine Kinder mehr gebären! All unser Reichtum wird uns zwischen den Fingern zerrinnen!«
Der Druide hob die Arme. »Ja, sie haben das Herz aus unserem Nemeton gerissen, aber noch schlägt es. Ich sage es erneut, wir müssen Ruhe bewahren. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden den Göttern beweisen, dass wir der Göttin würdig sind und nicht aufgeben!«
Zaghaft gab es zustimmende Rufe.
Ich wagte es, einen Schritt vorzutreten und meine Stimme über die wogende Unruhe ringsum zu erheben.
»Höret, ich bin weit gereist. Ich habe mehrfach Ähnliches in Gallien gehört, dass die Römer Stämmen ihr Heiligstes raubten, um sie einzuschüchtern. Anscheinend haben die Sueben davon auch erfahren.«
Ein verzweifelter Aufschrei. »Römer!«
»Aber es sind doch die Sueben, die vor unseren Toren kämpfen?«
»Wieso Römer? Belagern uns nun die Römer?«
»Es sind ganz bestimmt die Sueben, sie sehen nicht nach Römern aus.«
»Aber sie machen dasselbe wie die Römer! Sie werden uns alle niedermetzeln! Wir sind verloren!«
»Aber!«, rief ich über den Lärm. »Sie waren nicht immer erfolgreich! Ja, sie haben eure Göttin, doch dieses Standbild alleine macht noch nicht den Schutz der Götter über Ovilavia aus. Da ist der Nemeton, voll der Gebete und Erinnerungen an Opfergaben vieler Generationen. Da seid ihr, die ihr die Göttin in euch tragt. Sie haben nicht das Herz, sie haben vielleicht einen Arm. Ihr könnt Ovilavia nun verbluten lassen oder versuchen, die Wunde zu stillen. Jene Orte, die sich von solch einer Freveltat nicht unterkriegen ließen, haben gegen die Römer bestanden.«
Der Druide neben mir nickte und die Menschen murmelten, wandten sich fragend aneinander.
»So etwas ist hier noch nie geschehen, noch nie habe ich davon gehört, dass jemand es wagte, sich an einem Götterbild zu vergehen«, sagte der Druide leise zu mir.
Ich nickte. »Ich kenne es auch nur weit aus dem Westen.«
Er holte tief Luft, hatte sich nach dem Schrecken des Morgens wieder gefasst.
»Wir werden den Sueben beweisen, dass die Menschen in Ovilavia keine feigen Schafe sind. Wir sind nicht alleine. Der Geist der Göttin ist noch hier und Voccios Krieger sind greifbar nahe. Sie werden uns beschützen.«
Er wandte sich an einige der Männer, die in seiner Nähe standen.
»Wir müssen sogleich einen Boten in Voccios Lager schicken«, befahl der Druide. »Der Feind wird uns wahrscheinlich bald belagern, nun, wo er unser Heiligtum besitzt. Voccio muss uns zu Hilfe kommen.«
»Sie werden unsere Göttin schänden!«, rief eine Frau mit Tränen in den Augen.
»Die Göttin ist mächtiger, als wir denken«, sagte der Druide. »Selbst wenn sie ihr Standbild zerstören, sie ist mehr als ihr Bildnis. Wir wollen im Nemeton ein Opfer darbringen, während Voccio Nachricht gebracht wird, und uns für eine Belagerung rüsten.«
Ich fragte mich, woher Stämme von jenseits des Danubius diese Kriegslist kannten. Die Römer nannten es Evocatio, wenn ich mich recht erinnerte, und hatten damit schon vielen Dörfern in Gallien den Kampfmut genommen. Nur wenige hatten die Kraft gehabt, ohne das Gefühl des göttlichen Schutzes gegen die Römer zu bestehen. Manche hatten sogleich ohne die geringste Gegenwehr aufgegeben.
»Wieso wenden die Sueben eine Kriegslist der Römer an?«, fragte ich den jüngeren der Brüder.
Er zuckte die Schultern, doch der ältere meinte: »Sie sind nicht alleine. Sie haben Verbündete, die mit ihnen kämpfen, den Reix der Sequaner aus Gallien mit einem großen Kriegertrupp. Die Gallier hatten wohl genug Gelegenheit, römische Kriegsführung zu lernen.«
Ich nickte. Dann wurde mir die Bedeutung des Gesagten bewusst und ich hielt meinen Gastgeber am Ärmel fest, als er zu den anderen eilen wollte.
»Die Sequaner? Bist du sicher?«
Er nickte.
Ich starrte ihn an, unfähig, meine Hand von seinem Arm zu lösen. Die Sequaner. Natürlich, Sueben und Sequaner waren einander verbunden. Durch ein Geiselkind. Durch Loïc.
»Dann … vielleicht kann ich helfen.«
Ich fühlte Hitze in meine Wangen schießen wie bei einem jungen Mädchen. Mein Herz raste. Die Sequaner. Der Reix der Sequaner. Im Herbst, als ich von Noibio von seiner Begegnung mit einem Kriegertrupp gehört hatte, war es noch der Sohn des Reix der Sequaner gewesen. So war sein Vater inzwischen wohl gestorben und er ihm im Rang nachgefolgt.
Meine Hand fuhr zu der Fibel, die um meinen Hals hing. Loïc. Loïc befand sich dort in diesem Kriegslager. Es konnte nicht anders sein.
Samis sah mich erstaunt an, als ich nach dem Pfosten greifen musste, der das Vordach stützte, damit mir nicht die Knie weich wurden. Loïc. Nach drei-mal-drei Jahren. Hier. Nicht in Vesontio erst, sondern hier und jetzt. Loïc. Sein Name erfüllte mich und ließ mich zittern.
»Helfen?«, fragte der Druide an meiner anderen Seite, der immer noch mit den Männern besprach, was nun zu tun war.
Ich nickte, musste tief Luft holen, um reden zu können.
»Lasst mich zu den Sueben gehen und mit ihnen reden. Ich kenne den Anführer der Sequaner.«
»Ha!«, rief einer der Männer. »Nun hat sie sich verraten! Sie steckt mit den Dieben zusammen! Wahrscheinlich hat sie das Standbild nur wo versteckt und will nun die Gelegenheit nützen, es den Sueben zu bringen!«
Ich schüttelte den Kopf, fand es schwer, auf die Worte der Menschen ringsum zu achten, wo doch mein ganzes Inneres nur von einem Wort erfüllt war. Loïc.
»Dann lasst mich zu Voccio gehen, der in meiner Schuld steht, er wird gewiss Verhandlungen zustimmen, wenn er erfährt, dass ich den Anführer der Sequaner kenne.«
Sie murmelten, berieten sich.
»Sie ist eine Fremde«, hörte ich welche sagen. »Wieso sollten wir einer Fremden vertrauen?«
»Besser, sie geht, als sie erfährt, was wir zu unserer Verteidigung planen«, sagte ein anderer und erntete dafür Nicken.
Der Druide trat näher an uns heran, betrachtete mich aufmerksam.
»Wir haben nichts zu verlieren, wenn sie zu Voccio geht«, sagte er schließlich. »Sie soll zu ihm gehen, während wir uns für eine Belagerung rüsten. Voccio mag auf die Worte einer Bardin hören. Die Sueben schreiben den Barden keinen so hohen Rang zu und die Sequaner sind so der römischen Lebensart verhaftet, dass sie dort wohl eher um ihr Leben fürchten müsste, als etwas bewirken zu können. Selbst wenn sie den Anführer der Sequaner kennt, so ist er nicht der Herrscher über die Sueben und kann nicht über sie bestimmen.«
Damit gab er uns mit einer Geste seiner Hand frei. Samis sah zu mir hoch und ich nickte ihm zu. In die Menschen ringsum kam Bewegung, manche gingen in ihre Häuser, andere drängten sich um den Druiden, berieten sich mit ihm. Ein paar Frauen hatten sich zu einer Gruppe zusammengefunden, sprachen einander Trost zu. Niemand beachtete uns mehr, als wir uns von den beiden Brüdern verabschiedeten. Ich überlegte, Samis hier zu lassen, doch wenn die Männer recht hatten, dass eine Belagerung drohte, so wollte ich ihn bei mir wissen und nicht eingesperrt in einem fremden Ort. Ich mochte vielleicht tatsächlich Loïc wiederfinden und dennoch nichts für Ovilavia tun können.
Am Tor der Palisade hielt uns der Wächter auf. Er zwang mich, meinen Beutel zu öffnen und ihm meine Besitztümer zu zeigen. Samis’ Beutel, den der Junge aus dem Reisewagen mitgenommen hatte, als ich ihn fand, war zu klein, um ein kindsgroßes Standbild darin zu verbergen. Und selbst bei meinem hätte es ihm sogleich klar sein müssen, dass er viel zu leicht war für solch ein Gebilde aus Holz. Aber sollte er zufrieden sein, seine Pflicht getan zu haben.
Das Tor schloss sich sogleich hinter uns wieder.
Wir gingen rasch, ich musste mich zwingen, nicht zu laufen. Vor uns sah ich einen Reiter, der nach Westen eilte, wo in größerer Entfernung Zelte zu sehen waren. Der Bote von Ovilavia, der zu Voccios Lager ritt. Der Magosreix würde also schon alles über den Diebstahl des Heiligtums wissen, wenn ich ankam.
Wir hielten ebenfalls auf die Zelte der Noricer zu. Wenn ich Voccio überzeugen konnte, mit den Gegnern zu verhandeln, so würde ich Loïc sehen, ohne die Gefahr einzugehen, die der Druide berechtigterweise erwähnt hatte. Die Sueben hielten nicht viel von Barden.
Eine Fläche, vielleicht so groß wie Ovilavia, trennte die beiden Lager. Das Schlachtfeld, auf dem sich die beiden Kriegergruppen seit Tagen bekämpften. Verlassen und zerfurcht lag es so früh am Morgen da. Fruchtbare Felder, zertrampelt von unzähligen Hufen und Füßen. Hier kämpften nicht zwei kleine Kriegertrupps, hier kämpften zwei Heere. Es war nicht gesagt, dass ich überhaupt bis zum Anführer der Sequaner durchgelassen würde, ginge ich zum Lager von Voccios Gegnern.
Dennoch schrie alles in mir Loïcs Namen und meine Augen wollten nicht von den Zelten der Sueben weichen. Er war dort.
Auf beiden Seiten der großen Fläche war der Tag genauso zu Leben erwacht wie in Ovilavia. Feuer brannten, Männerstimmen drangen durch die Morgenluft. Der Nieselregen hatte aufgehört. Vor den Lagern, wie ein Schutzwall, lagen die Opfer des vorigen Tages, von ihren Stammesgenossen aus dem Schlachtfeld geholt und darauf wartend, nach dem Ende der Kämpfe verbrannt oder begraben zu werden.
Sie würden sich heute gewiss wieder eine Schlacht liefern. Loïc würde kämpfen. Loïc würde vielleicht fallen. Vielleicht war er gar schon verwundet und lag dort im Lager der Sueben in einem der Zelte und kämpfte um sein Leben. Und ich wollte Zeit vergeuden, indem ich erst zu Voccio ging, um ihn zu Verhandlungen zu überreden?
So nahe war er, beinahe in Sichtweite, und was, wenn mein Gang zu Voccio mich dann zu spät sein ließ?
Ich war nicht mehr Herr meiner Gedanken und Gefühle. Sie schossen durch meinen Kopf wie die Pfeile eines betrunkenen Jägers. Ich wusste nur, dass ich Loïc sehen musste. Dass er dort drüben, in Richtung des Danubius’ war und nicht in Voccios Lager.
Ich sah mich um. Ein kurzes Stück entfernt befand sich eine Hecke, die ein frisch gepflügtes Feld begrenzte. Zu den Sueben zu gehen, war gefährlich. Niemals würde ich Samis dieser Gefahr aussetzen, schlimm genug, dass er nun mit mir in einem Gebiet von kriegerischen Kämpfen war statt daheim in Rom.
Aus der Hecke leuchtete mir ein Weißdornbusch entgegen, wie er neben unserem Haus bei den Silurern gewachsen war. Unsichtbare Wesen bewohnten Weißdorne und waren gewillt, ihren wohlwollenden Schutz auf uns Menschen auszubreiten, wenn man sie darum bat und sie mit Hochachtung behandelte. Noch war er kahl und blühte nicht, aber er würde dennoch Samis beschützen, wenn ich den Unsichtbaren ein Opfer darbrachte.
Der Junge hatte nach meiner Hand gefasst, während ich nachdenklich dagestanden hatte. Er musste gemerkt haben, wie sehr meine Finger zitterten.
Ich löste meine Hand aus seiner und nahm ein langes Lederband aus meinem Beutel, das ich Branna um das Bein band, ehe sie von meiner Schulter flüchten konnte. Sie keckerte erbost und beschimpfte mich in einem fort.
»Popelfurz. Miiiist! Popelfurz!«
Sie wagte es aber nicht, nach mir zu pecken, wie sie es bei jedem Fremden täte, sondern versuchte nur, ihren Fuß wegzuziehen. Samis grinste, als er unseren kleinen Kampf sah. Verärgert saß die Rabin auf meiner Schulter, gab mürrische Laute von sich und versuchte, den Knoten mit ihrem Schnabel zu lösen.
»Samis«, sagte ich, während ich mit ihm zu der Hecke ging. »Siehst du die Zelte dort?« Ich deutete auf Voccios Lager und er nickte. Von weitem war das leuchtende Rot der Banner auf den Stangen vor den Zelten zu sehen. »Und dort drüben, das ist das Lager der Sueben.« Wieder nickte er. Ich holte tief Luft. »Ich werde zu den Sueben gehen, denn dort befindet sich jemand, der … dort befindet sich mein Herz. Ich will, dass du hier wartest, hier unter diesem Weißdorn. Er wird dich beschützen, gemeinsam mit Cú und Branna.«
Ich legte meinen Beutel, die Rehhautrolle und Samis’ Decke ab. Während der Junge etwas auf seine Wachstafel schrieb – ich konnte mir vorstellen, was es war – ritzte ich meinen Finger mit dem Messer und ließ einige Tropfen Blut als Nahrung für die Unsichtbaren auf die Wurzeln des Busches fallen. »Oh ihr Unsichtbaren, die ihr in meiner Kindheit mein Haus beschützt habt, beschützt diesen Jungen vor Gefahr und Unheil.«
Samis wartete ungeduldig, bis ich mich ihm zuwandte. Er hielt mir seine Tafel entgegen.
»NOLI ABIRE«
Natürlich wollte er nicht, dass ich wegging. Anstatt ihn zwischen verfeindeten Lagern alleine zu lassen, sollten wir nun wunderbare gemeinsame Tage erleben, da kein Mond drohend über uns hing, der eine Trennung verlangte. Und wir würden wunderbare Tage erleben. Gemeinsam mit Loïc.
»Samis, erinnerst du dich, was ich dir heute Früh gesagt habe? Ich werde dich nicht verlassen. Aber ich muss erst alleine diese Sache klären, ehe ich dich holen kann.«
Er biss sich auf die Unterlippe.
»Cú und Branna bleiben bei dir. Ich brauche dich, dass du auf sie aufpasst. Also, auf Branna vor allem …« Ich verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln und Samis antwortete mit der gleichen Grimasse. Wir kannten beide die Angewohnheit der Rabin, Dummheiten anzustellen. Ich band die lange Lederschnur an den Stamm des Weißdorns und diesmal peckte Branna doch tatsächlich nach mir, als ich sie von meiner Schulter stupste.
»Du darfst sie mit ein wenig von unseren Vorräten verwöhnen«, sagte ich dennoch, viel zu aufgeregt, endlich gehen zu können, als dass ich mich nun um die Erziehung des Vogels kümmern wollte. »Und sollte ich …« Ich warf einen Blick auf den Morgenhimmel, wo Lug gerade vollständig erwacht war, und dann hinüber zum Lager der Sueben, um die Entfernung abzuschätzen. »… sollte ich nicht zurück sein, wenn die Sonne den höchsten Punkt überschritten hat, dann nimmst du Cú und Branna und gehst in Voccios Lager. Dort bist du in Sicherheit und man wird sich um dich kümmern, selbst wenn die Krieger sich in Kämpfe gestürzt haben sollten bis dahin.«
Was nicht unbedingt der Fall sein musste. Die Sueben hatten das Heiligtum Ovilavias und Voccio hatte es inzwischen wohl von dem Boten erfahren, der uns voraus geritten war. Es war sehr wahrscheinlich, dass sie eine Weile beraten würden, was sie tun sollten, ehe man einen Angriff wagte.
Samis nickte mit ernstem Gesicht, die Hand auf Cús Nacken.
»Du bist verantwortlich für die beiden«, sagte ich. »Lass Cú mir nicht nachlaufen.«
Erneutes Nicken, doch ich sah die Tränen, die er unterdrückte.
»Hab keine Angst. Ich komme dich gewiss noch vor der Mittagszeit holen und dann, dann gibt es ein großes Fest, denn … denn mein Herz ist dann wieder heil und am rechten Ort. Alles wird dann gut, Samis. Alles.«
Er versuchte ein Lächeln.
»Vielleicht gibt es ja heute sogar noch Bohnen mit Speck für dich.«
Und die Umarmung Loïcs für mich …
Kapitel 2: Im Lager der Sueben
Ich hatte keine Augen für die Schönheit, mit der Lugs Licht an diesem Morgen zwischen den Wolken hervortrat. All meine Aufmerksamkeit, das kleine bisschen, das ich noch beherrschen konnte, musste ich darauf richten, nicht zu stolpern. So weich waren meine Beine, so uneben der Boden.
Drei-mal-drei Jahre. Oh, waren die Götter uns tatsächlich gnädig, dass wir gemeinsam nach Vesontio reisen könnten und dort das cynnedyf am Jahrestag ein Ende finden würde?
Mein Herz klopfte bis in meinen Hals, mein Mund war trocken. Drei-mal-drei Jahre. Würde er mich überhaupt noch erkennen? Würde er mich noch wollen? All den Träumen zum Trotz zweifelte ich plötzlich. Loïc hatte Kinder, denen er verantwortlich war. Er hatte ein Weib, das in meiner Erinnerung ein blasses Mädchen mit weichen Rundungen war. Und ich? Ich trug das Kind eines anderen in mir, unsichtbar noch, aber dennoch. Ich war dünn und zäh geworden, von Lieblichkeit gewiss weit entfernt.
Mein Atem flog so rasch, dass ich innehalten musste. Mein Herz raste, als wäre ich auf der Flucht. Ich holte meinen Kamm aus meiner Gürteltasche, fuhr mir damit durch mein Haar. Mit zitternden Fingern putzte ich mein Gewand ab, so gut es ging. Ich hatte mich gestern Abend gründlich gewaschen, doch weder mein Umhang noch mein Kleid darunter konnten leugnen, dass ich auf der Straße und im Wald lebte. Weit entfernt von der jungen, verwöhnten Bardin in prächtigem Gewand, als die er mich kennengelernt hatte.
Oh Ffraid! Lass ihn wohlauf sein und sich freuen!
Je näher ich dem Lager der Sueben kam, umso langsamer wurden meine Schritte. Mein Blick versuchte, die Gesichter der Männer zu erkennen, als könnte Loïc wie ein einfacher Krieger am Lagerrand Wache halten. Keines der Zelte war mit einem Banner geschmückt. Im Gegensatz zu den Noricern legten die Sueben wohl Wert darauf, dass niemand sah, wo ihre Anführer sich aufhielten.
Mein Näherkommen blieb nicht unbemerkt und zwei Männer schlenderten mir ruhig und gelassen einige Schritte entgegen, blieben abwartend stehen, die Hand am Heft ihrer Schwerter an ihrem Gürtel. Ihr Blick glitt hinter mich, doch ihrer Haltung nach schienen sie beruhigt zu sein, dass kein Kriegertrupp hinter mir her kam, sondern dass da nur ein einzelnes Weib, ohne Gepäck oder Lasttier, sich ihnen näherte. Alles hatte ich bei Samis unter dem Weißdornbusch gelassen, selbst mein Messer, meinen Haselstab und meinen Beutel, in dem sich die Tasche mit meiner Leier befand. Ich wollte alles vermeiden, das diesen kampfbereiten Kriegern auch nur den Verdacht geben könnte, dass von mir irgendeine Gefahr ausgehen mochte.
»Mögen die Götter euch segnen«, sagte ich, sobald ich in Hörweite war, und es brauchte all meine Kraft, meine Stimme nicht zittern zu lassen vor Aufregung.
»Das tun sie«, antwortete der Größere der beiden mit einem Grinsen.
Ich blieb vor ihnen stehen, mein Herz pochte, als wäre ich nicht nur das kurze Stück Weg hierher gekommen, sondern von einem anstrengenden Marsch. Einem Marsch von drei-mal-drei Jahren …
»Kommst du um Gnade für die Siedlung flehen?«, fragte der Kleinere. Seine Worte hatten einen eigenartigen Klang, anders als die Männer Vesontios. Er musste Suebe sein, auch wenn sich die Kleidung nicht von der eines Galliers unterschied, lange Braccae und eine Camisia darüber, weiche Schuhe, und ein glatter Helm auf dem Kopf. Beide trugen sie einen Brustpanzer aus mehrfach verleimten Leinenschichten, der sie als Wachen vor dem Schwert eines Gegners schützen konnte. Bei dem Größeren war an der rechten Seite das Lederband gerissen, das die Schulterklappe am Vorderteil befestigte, und bei jeder seiner Bewegungen wippte der Schulterteil sanft auf und ab.
Seine Frage verwirrte mich kurz ebenso wie die wippende Schulterklappe. Ich war so in Gedanken bei Loïc gewesen, dass ich gar nicht mehr an das gestohlene Heiligtum gedacht hatte.
Ich holte Luft und richtete mich auf, bemühte mich um die Größe, mit der ich als Bardin in einer Großen Halle auftrat.
»Ich habe wichtige Nachricht für den Anführer der Sequaner«, sagte ich.
Die beiden Krieger sahen einander an, sahen mich an.
»Wichtige Nachricht«, wiederholte der eine und der andere grinste. »Wichtige Nachricht von einem Weib, was kann das wohl sein?«
»Er wird ihr doch nicht etwa ein Kind gemacht haben?«, feixte der andere.
Ich verzog das Gesicht nicht, ließ sie ihre Witze machen. Es war nur gut, wenn sie mich nicht für eine aus dem feindlichen Lager hielten.
»Das würde ich ihm gerne selbst sagen«, meinte ich.
»Ob er das wohl gerne hört, ehe wir heute die Gegner in Grund und Boden vernichten?«, fragte der Kleinere.
Der Größere zuckte die Schultern, die Klappe seines Brustpanzers hüpfte in die Höhe. »Warum nicht. Und wenn sie noch kein Kind von ihm trägt, dann macht es ihm vielleicht Freude, ihr noch rasch eines zu machen.«
Der Kleinere deutete mir mit dem Kopf, ihm zu folgen.
Die Krieger, die an den Feuern saßen und an Brot und harten Würsten kauten, sahen mich neugierig an. Manche waren damit beschäftigt, ihre Waffen zu putzen. Andere starrten vor sich hin, warfen scheue Blicke zu den Leichenhaufen am Rande des Lagers. Witze flogen durch die Luft und doch war die Anspannung zu spüren, wie an der Sehne eines Bogens kurz vor dem Schuss. Sie waren siegessicher, jetzt, da sie das Heiligtum hatten, das war zu spüren, aber die Leichen, die vor dem Lager darauf warteten, bestattet zu werden, sprachen von dem Preis, den sie dafür bezahlt hatten.
Welch Ort, um Loïc wieder zu begegnen!
Der Krieger, der mir vorausging, hielt vor einem der Zelte an, das um kein bisschen anders aussah als die anderen. Grobe Holzlatten, die helle Stoffplanen hielten. Er wies mich an, zu warten, und ging in das Zelt hinein.
Ich bemühte mich, das Zittern in meinem Körper unter Beherrschung zu bekommen. Keine zwei Mannlängen von mir entfernt war Loïc, nur durch die dünne Zelthaut von mir getrennt.
Der Krieger kam wieder und fragte nach meinem Namen. »Bist wohl nicht das einzige Weib, das etwas von ihm wollen könnte.«
»Arduinna«, sagte ich und meine Stimme wollte mir kaum gehorchen. Er nickte, ging wieder in das Zelt hinein.
Ich erwartete, dass Loïc herauskäme, auf mich zueilte, doch es war erneut der Krieger, der rasch auf mich zutrat. Ehe ich auch nur ein Wort sagen konnte, hatte er mir einen geknoteten Fetzen als Knebel umgebunden, stopfte den dicken Teil zwischen meine Lippen. Scharf riss der Stoff in meine Mundwinkel, roch nach Schweiß und Dreck, dass es mich würgte. Was geschah hier? Mit einem weiteren Griff fesselte er meine Hände hinter dem Rücken, egal, wie sehr ich mich wand und trat. Ich war so überrumpelt, dass meine Gegenwehr wohl der eines kleinen Kindes glich.
Dann stieß er mich ins Zelt hinein und ich konnte gerade noch verhindern, zu stürzen.
Ein Tisch und ein Hocker standen da, wie die Römer sie benützten. Ein Schlaflager aus trockenem Gras und Fellen, mehr nicht. Hinter dem Tisch ein Mann, der mir fremd war und doch vertraut schien.
Er trat vor mich hin, musterte mich. Ich versuchte verzweifelt, etwas zu sagen, doch mit dem Knebel kam nur unverständliches Gegurgel aus meinem Mund. Der Krieger, der mich gefesselt hatte, stand hinter mir und lachte.
Wo war Loïc? In wessen Zelt hatten sie mich da gebracht? Irgendein suebischer Krieger, der vor dem Kampf noch gerne ein Weib besteigen wollte?
Die Sehnsucht hatte mich dumm gemacht. So dumm. So unvorsichtig. Was nutzte es, wenn Loïc in einem der Zelte war, wenn ich in einem anderen mein Ende fand? Tränen schossen mir in die Augen, wandelten sich in Wut über mich selbst.
Der Mann, der mich immer noch betrachtete, lachte auf.
»Das ist also die große Bardin, vor der ganz Vesontio zittert? Dieses dürre, dreckige Weib hat die Sequaner in Bann gehalten? Da ist meine kleine Tochter ja furchterregender, wenn sie ihren Kopf durchsetzen will!«
Ich versuchte erneut, etwas zu sagen, musste würgen.
Der Mann sah mich an. Etwas an ihm erinnerte mich an Loïc, der Ansatz seiner Haare, der Schwung seiner Augenbrauen. Er deutete dem Krieger, mir den Knebel und die Fesseln abzunehmen, ich holte Luft wie ein Ertrinkender.
»Wo ist der Anführer der Sequaner?«, sagte ich mit bemüht selbstsicherer Stimme, sobald ich wieder bei Atem war.
»Hier«, sagte der Mann und deutete mit beiden Händen auf sich.
Ich starrte ihn an. Konnte er sich so verändert haben? Hatten die Götter ihn so mit dem Fluch bestraft, dass er hart und gemein geworden war?
»Du bist nicht Loïc«, sagte ich.
»Loïc? Bei Bel, der bin ich nicht. Doch du fragtest nach dem Anführer der Sequaner. Das bin ich.«
»Aber – der Anführer der Sequaner ist der Sohn des Reix der Sequaner.«
»Ja.«
Er wirkte ungeduldig, als ich ihn immer noch anstarrte. Dann wandte er sich mit einem Grinsen an den Krieger, der hinter mir stand. »Die Klügste ist sie wohl nicht. Bei den Göttern, das verstehe, wer will, was mein Bruder an der gefunden hat.«
Sein Bruder. Ja, Loïc hatte einen jüngeren Bruder gehabt. Er war bei Zieheltern gewesen, wie alle hochgeborenen Kinder, als ich in Vesontio weilte. Loïcs Bruder ...
»Wo ist Loïc?«
Er lachte, doch es war ein eigenartiges Lachen, irgendwie bitter und auch ängstlich.
»Tot. Verschollen. Nein, wohl tot, seit drei Jahren hat niemand mehr von ihm gehört.«
Die Beine wollten unter mir nachgeben.
»Aber …« Zitternd zog ich die Fibel unter meinem Kleid hervor, die seit Grannamuro immer um meinen Hals hing. »Aber … erst letzten Herbst gab mir einer diese Fibel, die Loïc gehörte, ich habe sie erkannt, weil Loïc sie immer trug ... und der Mann sagte, er wäre dem Sohn des Reix der Sequaner gerade auf einem Kriegszug den Murus hinauf begegnet.«
Loïcs Bruder trat einen Schritt näher, lachte auf. Er schien großes Vergnügen daran zu finden, mich so verwirrt zu sehen.
»Das alte Ding? Loïc gab es mir, als er sich von seinem Sturz erholte, ist gewiss neun Jahre her. Ich habe es im Herbst gegen eine Kette für mein Weib getauscht.«
Alles drehte sich in meinem Kopf, nichts ergab mehr Sinn. Es war, als hätte ich mich im dichtesten Nebel verlaufen und fände den Weg nicht mehr.
»Was machen wir nun mit ihr, Dercilis?«, fragte der Krieger hinter mir.
Erneut sah mich Loïcs Bruder lange an. Sein Blick, der bis dahin eher belustigt gewesen war, wurde hart.
»Sie hat meinen Stamm lange in Angst und Schrecken gehalten. Ich sollte sie dafür bestrafen, wenn sie schon freiwillig hierher kommt. Oder kannst du mir einen Grund sagen, warum ich es nicht tun sollte?«
Ich war mir nicht sicher, ob er mit mir oder dem Sueben hinter mir sprach, aber mein Verstand war durch seine Worte aus der Starre gerissen worden, in die er getaumelt war, und ich antwortete, lange nicht so ruhig und gefasst, wie ich hoffte: »Ich kann für euch mit dem Reix der Noricer verhandeln. Voccio steht in meiner Schuld, seit ich ihm im Sommer das Leben gerettet habe.«
Beide Männer lachten.
»Wir brauchen nicht mit Voccio zu verhandeln. Er wird zu uns kommen, gemeinsam mit den Bewohnern Ovilavias, und uns anflehen, sie zu verschonen. Sie werden uns Ovilavia aushändigen, und wir werden uns hier niederlassen und er kann nichts dagegen machen. Wir haben ihr Heiligtum.«
»Die Noricer beeindruckt euer Diebstahl nicht«, log ich. »Eine Evocatio mag in Gallien eine wirksame Kriegslist sein, aber nicht hier.«
Ich sah den raschen Blick, den die beiden Männer einander zuwarfen.
»Woher weiß ein norisches Weib, was eine Evocatio ist?«, fragte der Suebe.
»Ich bin kein einfaches Weib. Ich bin eine weitgereiste Bardin und habe in meinem Leben viel gesehen. Glaubt mir, es ist klüger, mit Voccio zu verhandeln. Und ich kann euch dabei helfen.« Vielleicht konnte ich mich so aus dieser Misere retten.
Die Stimme des Sueben war kalt, als er zu Loïcs Bruder sprach: »Du hast gesagt, der Sieg ist uns gewiss, wenn wir erst das Standbild aus dem Tempel haben.«
»Er ist uns gewiss«, erwiderte Dercilis. »Sie versucht, uns zu täuschen. Sie werden wie die kleinen Mädchen vor einer Schlange zittern und es nicht wagen, uns anzugreifen, aus Angst, dass wir ihre Göttin zerstören und sie alle dem Untergang geweiht sind. Anflehen werden sie uns, sie zu verschonen.«
Ich sagte nichts, aber gab ein leises Schnauben von mir, als wäre ich von seinen Worten ebenso belustigt wie er vorhin von meinem Aussehen.
Der Suebe sah zweifelnd von mir zu Loïcs Bruder.
»Voccios Krieger werden über euch hinwegfegen wie der Besen eines Riesen über den Staub vor seiner Herdstelle«, sprach ich weiter. Meine Stimme klang nun so fest und ruhig wie die Morfrans, doch mein Inneres war ein einziges verzweifeltes Umherirren, wie ich hier wieder herauskäme. Zumindest verhinderte die Angst um mein eigenes Leben, dass ich vor Verzweiflung darüber, dass Loïc nicht hier war, weinend zusammenbrach. Nein, es war nicht die Sorge um mein Leben, stellte ich überrascht fest. Es war die Sorge um Samis, der unter dem Weißdornbusch auf mich wartete, und die Sorge um Ferchars Kind in meinem Bauch.
»Lass sie uns zu Baldram bringen«, sagte der suebische Krieger hinter mir. »Mir gefällt ihr Auftauchen hier nicht. Vielleicht ist es eine List. Wir können es uns nicht leisten, nachlässig zu sein.«
Loïcs Bruder sah mich nachdenklich an. Er wirkte nicht mehr ganz so sicher und belustigt. Die Jahre der Wanderschaft hatten mich gelehrt, hilfloses Weib zu sein oder mächtige Bardin, je nachdem, was nützlicher schien. Hoffentlich war ich nun als mächtige Bardin überzeugend genug, dass sie mich zu Voccio gehen ließen. Nicht, damit der Magosreix über die Sueben hinwegfegte und auf beiden Seiten sich die Haufen der Toten noch vergrößerten. Aber vielleicht konnte ich ihn tatsächlich zu Verhandlungen überreden.
Schließlich nickte Loïcs Bruder. »Ja, lass sie uns zu Baldram bringen. Es ist sein Krieg. Er ist auf der Suche nach einem Ort für seinen Stamm, nicht ich. Es soll nicht heißen, ich verstecke eine Verbündete Voccios vor ihm.«
»Das würde ihm nicht gefallen, Dercilis, wenn du das tätest.«
Der Suebe packte mich am Oberarm und sie zerrten mich aus dem Zelt. Wir marschierten quer durch das Lager, neugierig beäugt von den Kriegern.
»Es heißt, sie hätte meinen Bruder verflucht«, sagte Dercilis zu dem Sueben. »Sein Weib hat jedes Kind verloren, das er ihr gemacht hat. Ein Krüppel ist er geworden. Dabei ist sie nur ein zartes Weib, man fragt sich, warum sie so Angst vor ihr hatten.«
Die Worte hallten in meinem Kopf. Ein Krüppel. Sein Weib hat jedes Kind verloren. Meinte er Krüppel wegen seiner Hand oder weil er keine Kinder zeugen konnte?
»Da hat er ihr wohl übel mitgespielt, dein Bruder. Man darf sie nicht unterschätzen, die Weiber, verbünden sich mit bösen Geistern, schütten dir Gift in dein Bier.« Er gab mir einen Stoß in den Rücken, als ginge ich ihm zu langsam.
Dercilis schnaubte. »Loïc und ihr übel mitspielen? Vergöttert soll er sie haben. Auf den Rang des Reix hätte er für sie verzichtet.« Nun wurde es ein Lachen. »Hat er nun ohnehin.«
»Und du bist nun oberster Sequaner.«
»Und nach mir mein Sohn.« Unerwartet warm wurde seine Stimme, als er es sagte.
Sie brachten mich in ein Zelt, das ebenso aussah wie das erste, nur dass sich darin kein Tisch und Hocker befanden, sondern das Göttinnenstandbild aus Ovilavia und drei Männer, die am Boden auf Bärenfellen saßen und etwas besprachen. Sie sahen auf, als wir eintraten. Alle drei hatten sie ihr Haar zu einem seitlichen Knoten gebunden und trugen goldenen Schmuck. Der Älteste – der älteste der drei, aber lange noch kein alter Mann – ergriff das Wort.
»Wir haben auf dich gewartet, Dercilis. Inzwischen sollten unsere Gegner gemerkt haben, dass sie uns ausgeliefert sind.«
»Das Weib hier sagt, die Noricer glauben nicht an die Macht solch eines Diebstahls, Baldram«, sagte der Suebe hinter mir.
Der Anführer der Krieger sah mich an, als merke er erst jetzt meine Anwesenheit.
»Und wer ist dieses Weib, das so etwas behauptet? Eine Bettlerin, die sie aus Ovilavia geschickt haben, um Gnade zu flehen?« Er erhob sich, trat nahe an mich heran. Er roch nach Zwiebel und Schweiß.
Ich hielt den Kopf aufrecht.
»Ich bin Arduinna, Bardin von jenseits des schmalen Meeres, gekommen, Frieden zu stiften zwischen Voccio und euch.«
Schallendes Gelächter antwortete mir. Ogmios, was für Worte legst du mir in den Mund? Hatte ich nicht vor Jahren in der Schenke in Gallien schon gelernt, dass es ein Fehler war, sich groß aufzuspielen, wenn einem Männer gegenüberstanden, die voll der Kampflust waren? Ja, er hatte etwas von den Römerfreunden, die damals meine Leier zerstörten und mir die Zunge aus dem Leib schneiden wollten. Er hatte auch etwas von einem betrunkenen Centurio, dessen Lager ich teilte, damit er mich nicht mit dem Messer dazu zwang. Immer noch hatte ich nicht gelernt, was die beste Art der Verteidigung gegen Männer war, die einem gefährlich sein konnten.
»Warum sollten wir Frieden wollen, wenn wir sie besiegen können?«, sagte einer der beiden, die noch am Boden saßen. Er überragte die anderen beiden Sueben um einen ganzen Kopf, war breit wie ein Ochse und seine Frage klang ehrlich gemeint, nicht höhnisch.
»Vielleicht, damit nicht noch mehr eurer jungen Männer draußen unter denen liegen, die nie wieder die Sonne sehen werden?«, setzte ich nach, weniger großmächtig, sondern mehr mit der warmen Stimme Ffraids, Göttin der Mütter und Frauen.