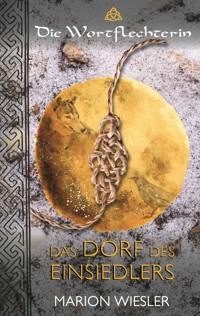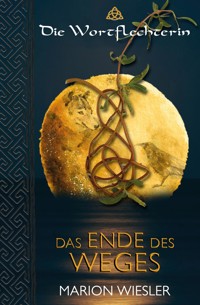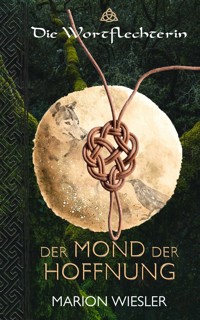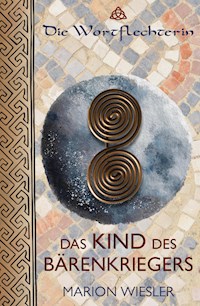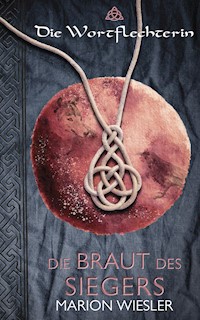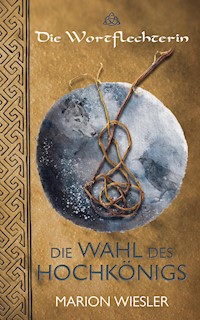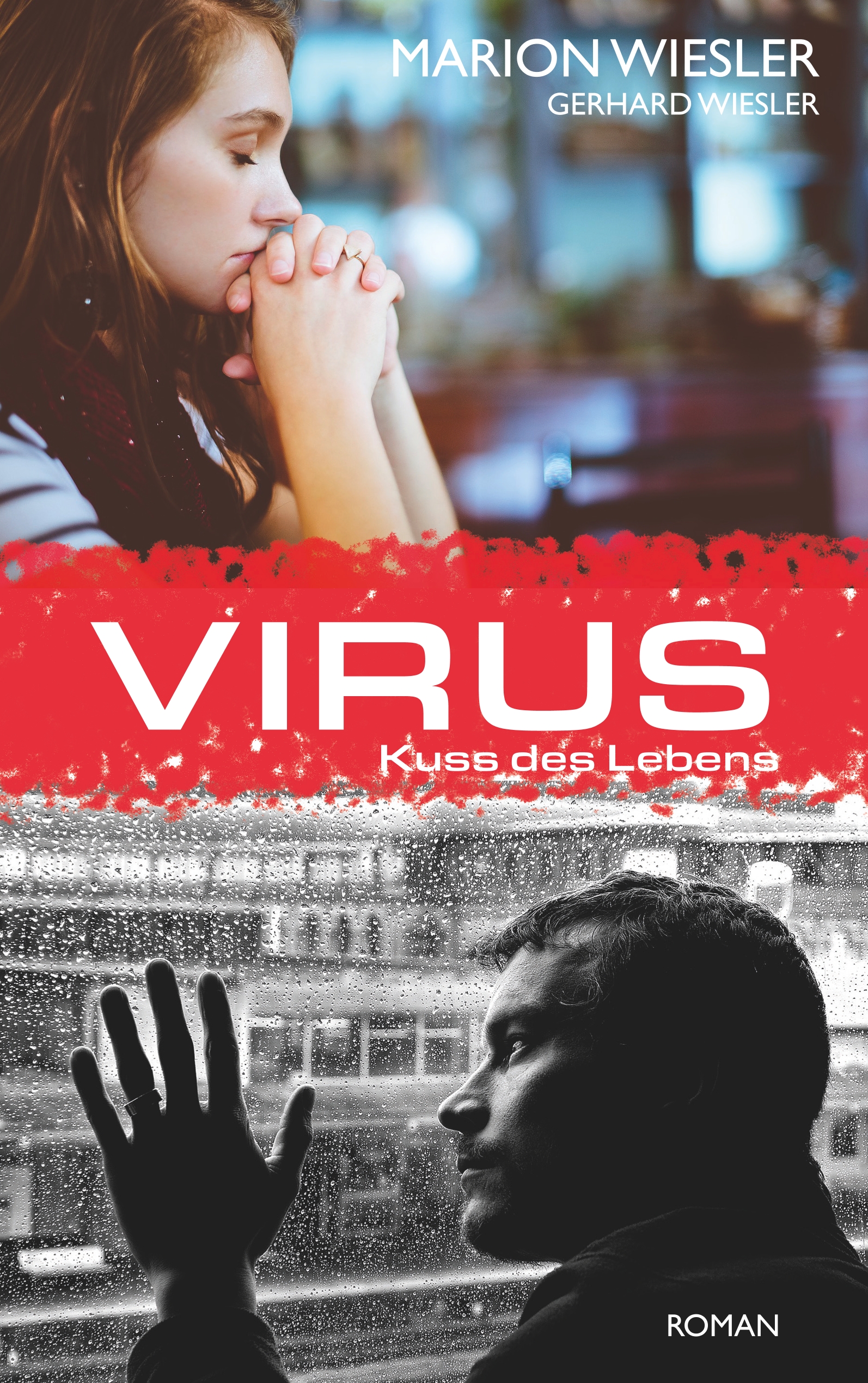6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Kelten, der loszog, die Sonne vom Himmel zu holen Norikum, 49 v. Chr. Alle neun Jahre gilt es, die Sonne mit einem gezielten Bogenschuss vom Himmel zu holen. Doch der heilige Bogen wurde zerstört. Bogenbauer Smertrios und seine Schwester Sanna müssen sich bis nach Gallien aufmachen, um zu versuchen, die Gunst der Götter für das Dorf zu sichern - oder sich selbst diesen Göttern opfern. "Der Bogen des Smertrios" bildet einen unabhängigen Band in der Welt der Keltenroman Serie "Die Wortflechterin". Fühle den Pulsschlag der Kelten in dir!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marion Wiesler
Der Bogen des Smertrios
Keltenroman
Vom Kelten, der loszog, die Sonne vom Himmel zu holenInhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Begegnung am Morgen
Kapitel 2: Der Sulnatris
Kapitel 3: Der Auftrag
Kapitel 4: Erste Überlegungen
Kapitel 5: Aufbruchspläne
Kapitel 6: Abreise
Kapitel 7: Die Bärenkrieger
Kapitel 8: Der Wettbewerb
Kapitel 9: Bestrafung
Kapitel 10: Wieder frei
Kapitel 11: Die Auswahl
Kapitel 12: Allosglastos
Kapitel 13: Ein Überfall
Kapitel 14: Livia
Kapitel 15: Sklaven
Kapitel 16: Eine lange Reise
Kapitel 17: Gallia Cisalpina
Kapitel 18: Lateinunterricht
Kapitel 19: Der Pfeilbauer
Kapitel 20: Erste Schritte
Kapitel 21: Die Jagd
Kapitel 22: Septimus
Kapitel 23: Caddos
Kapitel 24: Flucht
Kapitel 25: Ein Wiedersehen
Kapitel 26: Römer
Kapitel 27: Bei Aonghas
Kapitel 28: Alauda
Kapitel 29: Heimkehr
Kapitel 30: Das Kind
Kapitel 31: Verluste
Kapitel 32: Vorbereitungen
Kapitel 33: Der Sonnenschuss
Epilog: Frühling
Gute Geschichten sind Küsse für die Seele!
GLOSSAR:
MARION WIESLER
Impressum
Bände der HauptserieDie Wortflechterin
Die Wahl des Hochkönigs – Band 1
Der Markt der Lügner – Band 2
Die Braut des Siegers – Band 3
Das Fest der Sonnwend – Band 4
Das Kind des Bärenkriegers – Band 5
Der Mond der Hoffnung – Band 6
Das Ende des Weges – Band 7
Bände der Nebenserie
Die Welt der Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband, gratis auf www.marionwiesler.at)
Der Bogen des Smertrios
Der Krieger der Druiden
Die Schatten der Worte
(Schülerband)
Kapitel 1: Begegnung am Morgen
Sie schlief noch, als Smertrios erwachte. Er war froh darüber, denn gewiss würde sie mit ins Dorf gehen wollen, wenn sie wach wäre. Der Marsch durch den Wald war zwar nicht übermäßig weit, die Übelkeit, die Kalandina nun frühmorgens plagte, würde ihn aber mühselig machen.
Vorsichtig schob Smertrios sich von der fellbedeckten Lagerstatt. Kein Hauch der Morgendämmerung schimmerte durch die mit Rohhaut bedeckte Fensteröffnung, nur die schwache Glut der Feuerstelle bot ein wenig Licht.
Er kannte seine Hütte in- und auswendig. Gewiss, in letzter Zeit hatte Kalandina seine Sachen umgeräumt, hatte darauf bestanden, dass die Werkzeuge unter dem großen Vordach neben der Hütte gelagert wurden, die lehmverkrusteten Schuhe draußen blieben, aber er fand sich auch im Dunkeln mühelos zurecht und schlüpfte in die wollenen Braccae und die langärmelige Camisia.
Kalandina regte sich im Schlaf, murmelte. Smertrios schob die Decke über ihre Schulter, damit sie sich nicht erkältete.
Sie wusste, dass er heute ins Dorf wollte. Ehe die Sonne den höchsten Stand erreichte, wäre er zurück.
Natürlich, er könnte auch später gehen, wenn Kalandina dann dazu in der Lage wäre, aber eine nagende Unruhe hielt ihn schon die halbe Nacht wach.
Als er seinen Gürtel umband, klirrte das Messer leise gegen den metallenen Verschluss. Smertrios hielt inne, doch Kalandina rührte sich nicht. Seinen Umhang würde er draußen umlegen. Vorsichtig nahm er seinen Bogen und den Köcher vom Haken neben dem Eingang, bemüht, dass die Pfeile nicht gegeneinanderstießen.
Er öffnete die Türe nur einen Spalt und schlüpfte hinaus. Die Luft war kalt, aber es hatte keinen Frost gegeben. Der Frühling stand unleugbar bevor. Vielleicht war es nur das Erwachen der Erde, das er als Pulsieren in seinem Körper fühlte. Vielleicht sollte er wirklich warten und seine Frau mitnehmen.
Doch nun war er schon auf.
Er würde ihr aus dem Dorf etwas mitbringen.
Im zarten Grau des Morgens packte er die drei langen Bögen zusammen, an denen er die letzten Tage gearbeitet hatte, schlang sie sich mit einem Strick über die Schulter. Er war sehr zufrieden mit seinem Werk und sicher, dass die Männer, die die Bögen bei ihm bestellt hatten, es auch wären. Er hatte ein gutes Gespür für das Holz, es war, als würden die Bäume mit ihm sprechen. Schon als kleiner Junge, seit er das erste Mal die Männer auf der Jagd mit ihren Bögen gesehen hatte, hatte er gewusst, dass dies seine Berufung wäre. Er liebte es, den Tag mit seinen Bögen zu verbringen, das Holz unter seinen Fingern zu fühlen, die Muskeln in seinen Armen zu spüren, die Schönheit der geschwungenen Form mit seinen Augen zu liebkosen.
Der Köcher war voll mit Pfeilen, seinen eigenen und jenen, die er passend zu den neuen Bögen gefertigt hatte. Wenn erst die Sonne aufgegangen war, würde man die rot gefärbten Federn leuchten sehen. Zumindest bis zum nächsten Regen war es so viel einfacher, die wertvollen Pfeile wiederzufinden, wenn man bei der Jagd danebenschoss.
Ehe er die kleine Lichtung verließ, auf der seine selbstgebaute Hütte stand, pflückte er noch ein paar vertrocknete Köpfe des Pfeifengrases, zerrieb sie zwischen den Fingern und blies sie in die Luft, den Göttern zur Freude.
Vielleicht konnte er unterwegs noch einen Hasen schießen, Kalandina liebte frischen, gebratenen Hasen. Eines der wenigen Dinge, das sie an ihrem Leben hier im Wald schätzte.
Der Duft von aufgewühltem, modrigen Laub. Im feuchten Waldboden, dunkel im ersten Sonnenlicht des Tages, ein Abdruck, groß wie ein Männerfuß, mit langen Krallen. Smertrios blieb stehen. Es war noch sehr früh im Jahr, um einem Bären zu begegnen. Vorsichtig bewegte Smertrios sich weiter, die Finger fest um seinen Bogen. Die Spur war nun deutlich zu sehen, oftmals gekreuzt von einer ähnlichen, nur viel kleineren. Eine Bärin mit ihrem Jungen, frisch aus dem Winterschlaf erwacht. Er ginge wohl besser zurück, machte einen Umweg, doch ein Gefühl von Sehnsucht trieb ihn weiter. Er hatte schon lange keinen Bären mehr im Wald gesehen. Und der Wind stand günstig.
Auf einer kleinen Lichtung sah er sie. Struppig und abgemagert lag sie da, vor sich einen Dachs, den ihre starken Kiefer genüsslich in Stücke rissen. Das Bärenjunge kletterte auf ihrem Rücken herum, sie ließ es geduldig geschehen. Smertrios fühlte Ehrfurcht. Selbst vom langen Winter gezeichnet, strahlte die Bärin Würde aus. Er lehnte sich mit der Wange an die dicke Eiche, die ihn vor den Blicken der beiden Tiere schützte. Ganz still stand er, nur seine Finger spielten mit einem Pfeil, unsicher, ob er ihn abschießen sollte. Er müsste sie beide töten, das Junge alleine konnte nicht überleben. Aber warum sollte er? Er hatte genug Fleisch, und ein Bär hatte keine Sehnen, die er für seine Bögen benützen könnte. Er würde sein Leben nicht für eine Trophäe riskieren. Und wer weiß, vielleicht hatten ihm ja die Götter die Bärin geschickt. Vielleicht war sie ein Zeichen. Er würde den Druiden fragen, wenn er ihn im Dorf traf.
Ein Weilchen blieb er noch stehen, riskierte, dass der Wind sich drehte und die Bärin seine Witterung aufnahm. Seit er ein Kind gewesen war, hatte er sich immer mit dem Wald und seinen Bewohnern eins gefühlt. Wieder wurde ihm bewusst, welche Ruhe ihm ein Anblick wie jener der Bärin gab. Und wie viel mehr ihm das bedeutete, als mit anderen gemeinsam Bier zu trinken und von großen Taten zu prahlen. Ja, er hatte damals die rechte Entscheidung getroffen.
Vorsichtig und langsam zog er sich zurück, ein Lächeln auf den Lippen. Es würde ein guter Tag werden, wenn er so begann.
Noch ehe er auf den breiten Pfad einbog, der zum Dorf führte, hörte er bereits den Lärm. Schreie. Schreie, die nicht den kommenden Frühling bejubelten, sondern Schreie der Todesangst. Und Schreie, die eben diese Angst hervorrufen sollten, Kriegsschreie, das Schlagen von Eisen auf Holz, das schrille Trillern berittener Krieger.
Smertrios begann zu laufen, die zusammengeschnürten Bögen für die Männer im Dorf schlugen gegen seine Beine. Noch im Lauf legte er einen Pfeil in seinen eigenen Bogen ein, bereit zu schießen, sobald es nötig war.
Der ätzende Geruch von Feuer drang in seine Nase, nicht jene rauchige Morgenluft, die das Erwachen des Dorfes verkündete, sondern mindestens eine brennende Hütte.
Als er vom Wald auf den Weg trat, offenbarte sich ihm ein stets gefürchteter Anblick. Dunkle Rauchwolken erhoben sich über den Dächern im Osten des Dorfes, das große Tor stand offen, fremde Reiter preschten zwischen den Häusern umher, dazwischen die Menschen seines Stammes, aus dem Schlaf gerissen, in Panik.
Ein Überfall.
Ein Stamm, dessen Vorräte wohl früher zu Ende gegangen waren als der Winter.
Hungrig, gierig, zu allem bereit.
Smertrios kam ungesehen ins Dorf, schoss Pfeil über Pfeil, sobald er sicher war, zu treffen, war froh, zusätzliche Pfeile bei sich zu haben und doch bemüht, sie nicht zu schnell zu verbrauchen.
Wo war seine Familie? Er hastete durch das Gewühl, duckte sich hinter Mauerecken, warf sich zu Boden, um den fremden Speeren und Hieben zu entgehen. Er kroch westwärts, dem Haus der Eltern zu. Er sah die wenigen Krieger, die sein Dorf besaß, zu den eigenen Pferden hasten, dabei um sich schlagend und bemüht, das Schwert zu gürten. Er sah Bauern, die mit Sensen und Dreschflegeln ihr Hab und Gut verteidigten, sah Frauen, die an den Haaren davongezerrt wurden, ein Kind, aufgespießt von einem Speer. Endlich erblickte er seinen Vater, der Mutter und die kleinen Geschwister ins Haus drängte. Smertrios wusste um den Verschlag unter der Schlafstatt, eine in den harten Lehmboden gegrabene Grube, abgedeckt mit Brettern, darin wäre seine Familie wohl sicher. Alauda, seine ältere Schwester, sah ihn, ihre Augen panisch geweitet, ihr nur ein paar Monde altes Kind an die Brust gedrückt. Vater schob auch sie ins Haus, entdeckte Smertrios, deutete ihm hektisch, ehe er sich mit einem Eisenstab bewaffnet in den Kampf warf.
Wo war Sanna? Er hatte Sanna nicht gesehen. Wo war sie?
Ein Knüppel schwang knapp an Smertrios vorbei, er duckte sich im letzten Moment, stieß dem Angreifer den Bogen in den Bauch, der Fremde stürzte, die Hand um Smertrios' Bogen gekrallt, landete unglücklich. Der Bogen brach unter dem Gewicht des Fremden, unbrauchbar nun. Smertrios warf ihn zu Boden, zog einen der neu gefertigten aus dem Bündel.
War Sanna in Sicherheit? Er setzte an, zu seinem Elternhaus zu rennen, doch es trieb ihn in die andere Richtung.
Er sah ehemalige Kameraden, sah Barnario, den Anführer des Dorfes. Doch seine Augen suchten nach dem zierlichen Mädchen, nach langen, hellbraunen Haaren, nach seiner jüngeren Schwester. Sein Gefühl zog ihn in die richtige Richtung, in der Nähe des Tores entdeckte er sie durch den Dunst, den der dunkle Rauch durch das Dorf blies. Eng an die Palisade gekauert, den Kopf mit den Armen geschützt, die Hufe eines nervösen Pferdes nahe an ihrem Körper. Darauf ein Reiter, der versuchte, sich hinabzubücken, um Sanna auf das Ross zu zerren. Im nächsten Moment hatte Smertrios bereits einen Pfeil eingelegt, spannte den Bogen, schoss – und verfehlte. Zu kurz war sein Schuss gewesen, zu ungewohnt der für jemand anderen gebaute Bogen.
Er legte den nächsten Pfeil ein und rannte los, doch noch ehe er in die Nähe seiner Schwester kam, ergriff ein weiterer Mann sie, kein Reiter, ein Fußkämpfer, zerrte Sanna am Arm hoch, packte sie um die Hüfte und schleppte sie zum Tor hinaus.
Smertrios lief, so schnell ihn seine Beine trugen. Er würde nicht zulassen, dass einer dieser fremden Kerle seine Schwester entführte und missbrauchte!
Nicht Sanna!
Smertrios stolperte, fiel über einen verletzten Krieger. Rappelte sich auf, wehrte einen Angreifer ab, nur beseelt von dem Gedanken, seine Schwester zu retten.
Er passierte das Tor. Sah Sanna nicht. Nur eine zertrampelte Fläche, Fußspuren, Pferdehufe, ein wildes Durcheinander von Abdrücken. Unmöglich, die rechte Spur zu entdecken. Wohin? Gewiss in den Wald. Wohin sonst liefe ein Mann, der ein junges Weib zur Beute ergattert hatte. Der Wald, geeigneter Ort, sie ins Moos zu werfen oder gegen einen Stamm zu pressen. Schweiß rann Smertrios den Rücken hinab, nass klebten seine Haare im Nacken.
Er musste sie finden.
Er musste sie rasch finden.
Doch er fand sie nicht.
Immer panischer hetzte er durch den Wald. Die Sonne hatte inzwischen längst ihren höchsten Stand erreicht. Von Ferne hörte er die Geräusche aus dem Dorf, das Knistern des Feuers, das langsam abebbte, die verstummenden Schreie, die gespenstische Ruhe, die einkehrte.
Wie zum Hohn begannen die Vögel zu zwitschern, ihre Frühlingsgesänge in die Luft zu trällern. Sein Atem ging laut, immer wieder hielt er inne, versuchte, unter dem Rasseln seiner Lunge irgendein Geräusch seiner Schwester aufzuschnappen. Aber der Wald lag still und friedlich.
Kapitel 2: Der Sulnatris
Er kehrte ins Dorf zurück, ehe die Sonne unterging. Es war ihm egal, dass er die drei Bögen irgendwo abgelegt hatte, um besser laufen zu können. Seine Camisia war zerrissen, an unzähligen Ästen hängen geblieben. Er war nur müde. Und verzweifelt.
Sanna.
Die Männer im Dorf sahen ihn schweigend an. Man war bereits dabei, die Schäden zu beheben. Fing die aufgescheuchten Schweine und Schafe wieder ein, hatte all die gefangen genommenen Angreifer in der Mitte des Dorfes an Bäume gebunden. Keiner von ihnen war noch am Leben. Sie waren kein kriegerisches Dorf, aber sie wussten sich zu wehren. Niemand nahm ihnen ihre Vorräte weg.
Smertrios hatte keinen Blick für all das. Gebeugt ging er zum Haus seiner Eltern.
Als er die Türe öffnete, saßen die Frauen seiner Familie rund um die Feuerstelle. Und mitten unter ihnen saß Sanna. Ihre Augen noch von Angst geweitet, die Hände damit beschäftigt, aus ein paar Strohhalmen ein kleines Figürchen zu formen, während ihre jüngere Schwester Uinje ihr einen Zopf flocht. Ein Bild, vertraut von vielen Besuchen, und doch so unerwartet, dass Smertrios erstarrt stehen blieb.
Sanna sprang auf, als sie ihn sah, fiel ihm um den Hals. Die Ärmel ihres Unterkleides waren dreckig, der karierte Peplos darüber voller Erde, doch sonst sah sie aus wie an jedem anderen Tag.
»Smertrios!«
Er verstand es nicht. Er hatte doch gesehen, wie sie aus dem Dorf gezerrt wurde.
Auch Uinje und Giamvailos waren nun von den Fellen rund um die Feuerstelle aufgestanden und drängten sich an ihren großen Bruder. Nur Alauda blieb sitzen, ihren kleinen Sohn an der Brust.
Niemand schien verletzt. Mutter stand, einen dampfenden Krug in der Hand, inmitten ihrer Familie, lächelte Smertrios an. Sie war rundlich und klein, wie immer damit beschäftigt, die Familie mit Essen zu versorgen. Alles war gut, schien es.
Er musste es nur noch verstehen.
»Wie kommst du hierher, Sanna? Ich hab doch gesehen -«
»Es war furchtbar!« Sanna löste sich von ihm und nun sah er die blauen Flecken in ihrem Gesicht. »Diese Pferde! Die Männer! Ich wollte zu dir in den Wald, aber der Reiter hat mir den Weg verstellt.«
Smertrios fing Alaudas Blick auf, hörte ihr leises, verächtliches Schnauben.
»In den Wald zu dir, das kann nur Sanna einfallen. Ihretwegen sind wir alle aus dem Haus gestürmt, ihretwegen hätten sie fast Giamvailos erwischt.« Smertrios' ältere Schwester hatte Sanna nie besonders gemocht. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie eigentlich bereits gestern hatte abreisen wollen, zurück zu dem kleinen Weiler, an dem sie mit ihrem Mann auf einem Landgut lebte.
Giamvailos zupfte Smertrios am Bein. »Hast du mich gesehen? Ich war schnell wie der Blitz, mich erwischt keiner!« Sein kleiner Bruder strahlte stolz.
Smertrios nickte, in Gedanken woanders. »Aber wie kommst du wieder hierher? Ich hab doch gesehen, wie dieser Kerl dich aus dem Dorf schleppte.«
Sanna sah ihn verwundert an. Mutter reichte Smertrios den Tonbecher, der in diesem Haus nur von ihm benutzt wurde. Er sog den Duft des warmen Kräuterbiers ein. Die in den Becher eingeritzten Linien kannte er seit seiner Kindheit und ihre Struktur in seiner Hand zu fühlen, gab ihm ein Gefühl von Sicherheit.
»Du hast Rufius gesehen. Alaudas Mann hat Sanna gerettet, hat sie hinter den Ställen entlang zurück ins Haus gebracht. Die Götter haben es gut gemeint, dass die beiden noch eine Nacht geblieben sind.«
Rufius. Er hatte seinen Schwestermann nicht erkannt im Getümmel. Hatte den großen Mann, dessen lange Zöpfe so unüblich für die Männer in Smertrios' Dorf waren, für einen Angreifer gehalten. Und er hatte gedacht …
Ein eigenartiger Laut drang aus seiner Kehle, er wusste selbst nicht, ob es ein Lachen oder Weinen war. Er versuchte, seine Gefühle mit einem Schluck Bier hinunterzudrängen.
»Warum bist du hier?«, fragte nun Uinje. Sie klang abweisend, reckte den Hals, um größer zu wirken. Noch war sie keine Frau, aber sie würde gewiss eine werden, die sich von ihrem Mann nichts gefallen ließ.
»Ich hatte Bögen abzuliefern. Und da hörte ich die Schreie.«
»Das meinte ich nicht«, unterbrach Uinje ihn. »Alle anderen Männer sind draußen, um die Schäden zu beheben.«
»Lass gut sein, Uinje«, mischte Mutter sich ein. »Smertrios wollte nach Sanna sehen. Das ist nur verständlich.«
Sanna stand noch immer neben ihm und hielt seine Hand umklammert.
»Ist Kalandina mitgekommen?«
Kalandina – an seine Frau hatte er gar nicht gedacht, sie würde sich Sorgen machen.
»Nein. Zum Glück nicht. Sie ist daheim in Sicherheit.«
»Das ist gut.« Alauda lächelte leicht, während sie ihren Säugling sanft schaukelte. »In ihrem Zustand ist es wohl das Letzte, was man erleben will.« Ihre Stimme klang müde.
Smertrios nickte. Er fühlte sich, als hätte er die ganze Zeit die Luft angehalten. Noch einen Schluck Bier. Ausatmen. Sanna ansehen, ja, sie war da, seine geliebte kleine Schwester war wohlauf, war die unberührte junge Frau, eigenartig und herzlich, die sie war. Mutter war wohlauf, auch Uinje und der kleine Giamvailos, auch seine ältere Schwester und ihr Säugling. Ihr Haus stand, war keiner Brandlegung zum Opfer gefallen. Er konnte sich entspannen.
Die Türe öffnete sich in seinem Rücken und Vater und Rufius traten ein. Smertrios lächelte, auch die beiden waren unverletzt. Doch sein Vater blickte ernst.
Mutter reichte jedem der beiden Neuankömmlingen einen Becher mit Bier. Vater legte das Werkzeug, das er in Händen hielt, im Regal neben der Türe ab.
»Es ist dunkel geworden. Morgen machen wir weiter. Uinje, schließ die Fensterläden, die Nacht wird kalt werden.«
Das zehnjährige Mädchen eilte hinaus, um zusätzlich zu den gespannten Häuten noch die hölzernen Läden vorzumachen. Vater ließ sich seufzend neben dem Feuer nieder, legte ein weiteres Scheit Holz nach. Rufius setzte sich neben seine Frau Alauda, zwinkerte Sanna zu.
»Ist es schlimm?«
Mutter rückte zu ihrem Mann. Sie zupfte etwas von seiner Schulter, vielleicht Holzspäne. Vater nahm einen großen Schluck Bier, strich mit seiner sehnigen Hand Giamvailos über die Haare. Der kleine Junge strahlte.
»Nicht sehr. Zwei Tote bei uns – ein Kind und der alte Korbflechter, kein überlebender Fremder. Es war nur eine kleine Horde. Die Götter waren auf unserer Seite.«
»Der Nemeton hat gebrannt, und die Hütte des Druiden«, fügte Rufius hinzu. »Den Göttern sei Dank, keines der Häuser, die eng beieinander stehen. Sie glauben immer alle, wenn sie das Heiligtum zerstören, dann haben sie gewonnen. Dabei denke ich, das bringt die Götter erst recht gegen sie auf …«
»Zum Glück wart ihr noch hier.« Mutter lächelte ihren Tochtermann an, ihre Hände vollführten segnende Gesten.
Rufius sah zu Alauda. »Wir werden noch bleiben, bis alles wieder in Ordnung gebracht ist. Viele Zäune wurden niedergetrampelt.«
Smertrios stand immer noch etwas verloren zwischen Feuer und Türe. Sein Vater sah zu ihm hin.
»Wo warst du?«
»Ich wollte nach Sanna sehen. Das heißt, ich wollte euch sagen, dass ich ihre Spur verloren hatte, deshalb habe ich nicht geholfen, die Schäden zu richten.«
»Wo warst du während des Kampfes, meinte ich.«
Sein Vater war hager und zäh, sein Leben lang an schwere Arbeit gewöhnt und dennoch zumeist ein warmherziger und fröhlicher Mann, dessen Schnurrbart gerne vor Lachen zitterte. Doch nun klang seine Stimme hart.
»Ich habe gekämpft. Du hast mich gesehen.«
Smertrios straffte sich unter dem ungewohnten Tonfall.
»Ja.« Vater schwieg einen Moment, warf einen Blick auf seine Frau. »Alle haben dich im Kampf gesehen. Und alle haben sie dich gesehen, wie du davongelaufen bist, aus dem Dorf geflüchtet bist.«
»Ich bin Sanna hinterher. Ich dachte, sie wäre von den Angreifern entführt worden.«
»Sanna war nie in Gefahr. Rufius hat sich um sie gekümmert.«
»Das weiß ich – jetzt. Im Kampf sah es anders aus.«
»Im Kampf sah es so aus, als würdest du davonrennen. Flüchten. Wie ein Feigling, wie ein schwaches Weib. Sie bewundern höchstens deinen Mut, dass du dich überhaupt traust, noch einmal hier aufzutauchen.«
Schweigen. Die Stille lastete so schwer im Raum, dass Alaudas kleiner Sohn zu weinen begann.
Feigheit war ein Vergehen, war mindestens so schlimm wie der Diebstahl einer Kuh. Nein, schlimmer. Wer feige war, hatte im Stamm der Raben nichts verloren. Smertrios sah den anderen ins Gesicht. Er wollte ansetzen, sich zu verteidigen, doch an ihren Augen erkannte er, dass sie ihm nicht glauben würden. Selbst Sanna – sie sah so entsetzt drein, als hätte man ihr verkündet, ihr Bruder sei in Wirklichkeit ein Schaf. Ihr Blick schmerzte zutiefst. Allein Mutter versuchte ein ermutigendes Lächeln, aber sie war die Einzige. Und obwohl Smertrios noch stand und sie alle zu ihm aufsahen, fühlte er sich unendlich klein. Wie früher, wenn sie ihn wegen Sanna hänselten.
Die Bärin war kein gutes Zeichen gewesen. Er war in das Dorf gekommen, um Bögen zu verkaufen, um seine Familie zu sehen.
Und nun …
Vater seufzte und starrte ins Feuer.
»Morgen früh soll über dich entschieden werden.«
»Dann soll er wohl besser jetzt davonlaufen!« Sanna wollte ihren Bruder schon zur Türe schieben. »Wer weiß, welche Strafe sich die Versammlung ausdenkt. Gerade bei Smertrios.«
Ja, gerade bei ihm.
»Ich laufe sicher nicht davon, Sanna. Sie müssen mich anhören, und sie werden es hoffentlich verstehen. Ich bin nicht weggelaufen vor dem Kampf.«
Vater sah ihm lange ins Gesicht. Nickte dann erneut, doch nun mit einem freundlicheren Blick.
»Hoffen wir es.«
Er würde die Nacht über hierbleiben müssen. Ginge er nun zurück in den Wald, man sähe es erst recht als Flucht.
Als hätte sie seine Gedanken erraten, meinte seine ältere Schwester Alauda:
»Deine Frau wird sich schon keine Sorgen machen.«
Seufzend ließ Smertrios sich nun auch am Feuer nieder. Er hielt seine Hände nahe an die Flammen, spürte die Wärme, die wie feines Leinen seine Finger liebkoste.
»Ich wollte gegen Mittag zurück sein. Nur drei Bögen abliefern. Mehr nicht.«
Sanna neben ihm sprang auf. »Ich kann zu ihr laufen! Ich kann ihr sagen, dass du aufgehalten wurdest!«
»Nein!«
Vater, Mutter und Smertrios hatten es gleichzeitig gerufen. Rufius lachte belustigt.
»Du verlässt bei Nacht nicht das Dorf. Setz dich, Sanna.«
Vater deutete auf den Platz neben Smertrios, doch Sanna blieb stehen.
»Aber es ist Halbmond, ich kenne den Weg. Kalandina wäre sicher froh -«
»Nein, keine Widerrede!«
»Ich habe meinen Bogen, ihr wisst, wie gut ich damit umgehe, mir würde schon nichts passieren!« Nun schwang Trotz in Sannas Stimme.
Vater hob drohend die Augenbrauen. »Nein. Sie wird es überleben, wenn Smertrios nicht heute heimkehrt.«
Sanna setzte sich schmollend.
Wie um von dem Gespräch abzulenken, verkündete Giamvailos:
»Ich habe Hunger. Wir hatten heute noch gar nichts zu essen, sind nur den halben Tag in dem furchtbaren stickigen Loch gelegen.«
Mutter seufzte.
»Ich weiß. Jedes Jahr, wenn der Winter zu Ende geht, ist es dasselbe. Irgendwelche kleinen Stämme glauben, sie könnten an unsere Vorräte gelangen. Als hätte es sich nicht schon herumgesprochen, dass die Rabenleute wehrsam sind.«
Sie erhob sich, ging zu dem großen Regal an der Wand, in dem in Birkendosen und Körben einige Vorräte gelagert waren.
Während Uinje der Mutter half, für alle noch etwas Brot, getrocknetes Fleisch und ein wenig Schmalz zu richten, drückte Sanna ihrem Bruder den Ellbogen in die Seite und flüsterte:
»Ich hätte es geschafft. Auch in der Nacht.«
Er nickte, antwortete aber leise: »Es ist eine Bärin im Wald, mit ihrem Jungen. Die ist hungrig wie Giamvailos.«
Sannas Augen wurden groß, leuchteten im Schein der Flammen. »Wirklich? Oh, wie gerne würde ich sie sehen!«
Smertrios biss sich auf die Lippen. Wie hatte er vergessen können, dass Sanna sich von einer Bärin nicht abschrecken lassen würde, im Gegenteil, wie er sie kannte, musste man nun aufpassen, dass sie nicht bei der nächsten Gelegenheit davonlief, sie zu suchen. Es gab nur wenig, wovor seine Schwester Angst hatte.
Langsam kehrte Ruhe im Haus ein. Mit Rufius und Alauda zu Besuch war es eng hinten auf der Schlafstatt. Smertrios blieb auf den Fellen beim Feuer, er hatte schon so oft im Wald auf Laub und Moos geschlafen, es machte ihm nichts aus, auf dem harten Lehmboden zu liegen. Die Felle rochen vertraut nach Kindheit, wie das ganze Haus. Irgendwann verstummte auch das Flüstern, das von der Schlafstatt herüberdrang. So müde er gewesen war, nun konnte er nicht schlafen.
Sie glaubten, er wäre geflüchtet. Hätte feige das Dorf im Kampf im Stich gelassen. Großartig. Das hatte ihm noch gefehlt. Abgesehen davon, dass er nun drei Bögen irgendwo im Wald verloren hatte und seinen eigenen zerbrochen, er würde Kalandina auch nicht die erwarteten Tauschwaren bringen können, die Säcke voll Schafswolle und Leinen. Falls er überhaupt zu ihr zurückkehren konnte. Feiglinge wurden mitunter schwer bestraft. Und er zählte zu jenen im Dorf, die für ihr Handwerk zwar geschätzt wurden, aber sonst …
Alles hatte damals mit Sanna begonnen. Die Hänseleien, die Beschimpfungen. Nur, weil er sich um seine kleine Schwester gekümmert hatte. Nani, Mütterchen hatten sie ihn genannt. Dabei wäre Sanna ohne ihn nicht am Leben … Und weil er anders gewesen war, nicht nur wegen Sanna. Er hatte immer schon lieber die Tage alleine im Wald verbracht, als mit einem Rudel Burschen durch die Gegend zu rennen und sich im Kampf zu üben. Deshalb hatte er sich auch aus dem Dorf zurückgezogen, sobald er erwachsen war. Hatte sich eine Hütte im Wald gebaut. Sanna war damals sehr unglücklich darüber gewesen. Natürlich, er war oft im Dorf, seinem Vater zu helfen, aber Sanna wäre damals am liebsten mit ihm in den Wald gezogen, was Mutter nicht erlaubt hatte. Und dann die Sache mit Kalandina. Sie kannten sich schon lange. Man tanzte manchmal zusammen auf den Festen. Wahrscheinlich hatte er ihr gefallen, weil er eben nicht die ganze Zeit mit seinen Taten prahlte und sich bei jeder Gelegenheit prügelte, wie manch andere junge Männer im Dorf. Er war ebenmäßig gewachsen, groß und schlank, mit kräftigen Armen und geschickt wie sein Vater. Er war nicht so abgestumpft wie viele der Bauernburschen, die vor lauter schwerer Arbeit auf den Feldern kaum einen geraden Satz sagen konnten. Und er wusste Schönheit zu sehen und zu schätzen, das hatte Kalandina gefallen, zumindest hatte sie das gesagt, an jenem Abend. Aber natürlich behauptete sie, dass er sich nicht beherrscht hätte, dass er sie verführt hätte. Beim Fest der Wintersonnwend. Der Met war süß und stark gewesen, die Musik der Trommeln fordernd und berauschend. Sie hatten getanzt, gescherzt. Sie hatte sich an ihn gedrängt, hatte ihre Hand in seine Braccae geschoben, begeistert gegluckst, als ihre Finger fühlten, wie sein Stab groß und fest wurde. Niemand hätte etwas gesagt, aber dass sie gleich schwanger geworden war … Ja, es war eine Vollmondnacht gewesen, jene Zeit, in der die Frauen fruchtbar waren. Er hätte vorsichtiger sein müssen, sich besser beherrschen. Dennoch … Und er hatte sie zum Weib genommen, niemand konnte ihm vorwerfen, dass er die Gesetze missachtet hätte. Er freute sich ja auf das Kind, auf sein Kind. Er freute sich sehr. Aber es hatte seine Lage im Dorf nicht gerade verbessert. Kalandinas Familie hatte sich einen anderen Mann für sie erhofft.
Und nun Feigheit. Die Strafe würde hart sein, das fühlte er. Aber vielleicht glaubten sie ihm ja, sie wussten, wie wichtig ihm Sanna war, sie mussten das doch verstehen …
Das Feuer knisterte leise. Er starrte schon lange in die rote Glut, wahrscheinlich tränten seine Augen deswegen. Irgendwann schlich Sanna zu ihm, legte sich an seine Seite, schlang seinen Arm um sich. Er sollte wütend sein, dass er ihretwegen nun in Schwierigkeiten war. Aber sie war Sanna. Er war einfach froh, dass sie lebte und nicht geschändet und erschlagen im Wald lag.
Die Sonne war gerade erst aufgegangen, als Cavannus kam, ihn zu holen. Der stämmige Krieger war als Kind ein Freund von Smertrios gewesen, sie waren gleich alt. Doch seit Sannas Geburt vor sechzehn Sommern gehörte auch er zu jenen, die Smertrios verlacht hatten. Er hatte sein Schwert umgegürtet, es war nur schlicht, ohne aufwendige Verzierungen, denn so reich war Cavannus nicht. Und er trug seinen Speer mit sich. Fehlte nur noch, dass er weitere Männer mitgebracht hätte, um Smertrios zum Stammesführer zu geleiten. Er wäre auch von selbst zu Barnario gegangen.
Vater und Sanna kamen mit ihm. Sanna hatte zwar bereits in den Wald zu Kalandina laufen wollen, sobald die Nacht dem ersten Morgengrau gewichen war, doch ihre Sorge um den großen Bruder war dann doch größer als jene um die Bruderfrau.
Ihre Finger flochten hektisch an einer kleinen Strohfigur, während sie zur großen Halle gingen.
Männer schleppten gerade die Körper der Feinde zum Dorf hinaus, man würde sie neben dem Weg ablegen, dass die Tiere sie holten. Keine der Leichen besaß noch ihren Kopf, blutig standen die Halsstümpfe von den schlaffen Körpern ab. Der Sitte des Dorfes nach hatte man die Köpfe wohl bereits vor dem Tor auf hohen Stangen aufgespießt. Vielleicht hielt es ja weitere Plünderer ab.
Sanna schob ihrem Bruder die kleine Strohfigur zu, einen filigranen Vogel, ehe er die große Halle betrat. Sie und Vater blieben wartend vor der Türe stehen.
Der lehmverputzte Bau war das größte Haus im Dorf, geräumig genug, um allen Männern bei den Versammlungen Platz zu bieten. Zu Smertrios' Erleichterung befand sich jedoch nur der Rat der Ältesten darin. Gerade schienen sie darüber zu diskutieren, ob der Anführer der Feinde es wert wäre, dass man seinen Kopf in Zedernöl balsamierte und aufbewahrte.
Cavannus räusperte sich. Als die Männer aufblickten, trat Smertrios mit erhobenem Kopf vor. Vater hatte ihm eine Camisia geliehen, dass er nicht in seiner zerrissenen vor den Stammesführer treten musste, doch sie war etwas klein, sodass Smertrios das Gefühl hatte, von dem engen Hemd seiner eigentlichen Größe beraubt zu sein.
Barnario stand inmitten der Ältesten des Dorfes. Er war jünger als Smertrios' Vater, aber ein Anführer durch und durch. Wenn man ihn sah, verspürte man Hochachtung. Hochachtung, nicht Furcht, denn Barnario strahlte genau die richtige Mischung aus gefährlichem Raubtier und freundlichem Vater aus. Als Smertrios nun an ihn herantrat, wichen die alten Männer zurück. Sie nahmen auf den langen Bänken Platz, die an der Wand standen, abwartend, die meisten mit verschränkten Armen. Der Druide fehlte, aber außer Smertrios schien ihn niemand zu vermissen.
Smertrios verbeugte sich vor dem Stammesführer, wandte sich dann nach links und rechts zu den Ältesten, beugte auch vor ihnen seinen Kopf.
Seine Finger spielten versteckt unter seinem Umhang mit der kleinen Strohfigur, die Sanna ihm zugesteckt hatte. Bei keinem der Männer hatte er den Hauch von Freundlichkeit entdeckt.
Aufrecht stand er vor Barnario und blickte ihm ins Gesicht. War es an ihm, zuerst zu reden? Der Stammesführer sah ihn lange an. Endlich sprach er, und seine tiefe Stimme schien bis in Smertrios' Brust hinein zu vibrieren.
»Du weißt, was man dir vorwirft?«
Er nickte. Die Regeln verlangten, dass er sich erst verteidigte, wenn man ihn dazu aufforderte. Es hatte schon Fälle gegeben, wo es keine Aufforderung gab, keine Möglichkeit, selbst zu erklären, was geschehen war.
Cavannus trat hinter ihn, stieß den Speer auf den Bretterboden. Vielleicht hatte er Smertrios damit erschrecken wollen, doch der Bogenbauer zuckte nicht. Cavannus' Schritte waren laut gewesen, jede Wildsau im Wald bewegte sich leiser.
»Viele haben gesehen, dass du aus dem Dorf geflohen bist, anstatt zu kämpfen.«
Smertrios schwieg, wartete immer noch, dass man ihn aufforderte, sich zu verteidigen. Ein Wort nun, und man würde ihm jedes Recht absprechen, weiterzureden.
Cavannus, dem offenbar die Aufgabe zuteilwurde, den Rat in die rechte Stimmung zu bringen, fuhr fort:
»Das Dorf wurde überfallen, jeder Bauer kämpfte gegen die feindliche Horde, und du bist davongelaufen. Du bist an diesem Morgen ins Dorf gekommen und wieder geflüchtet, anstatt deinem Stamm zu helfen. Der Bruder deiner Schwester, kein Mann unseres Stammes, hat für uns gekämpft. Doch du, Sohn der Raben, hast es nicht getan. Wie ein Hase seist du gerannt, heißt es. So schnell deine Beine dich trugen. Feiger als ein schwaches Weib.«
Cavannus lachte gehässig, kleine Spucketropfen trafen Smertrios am Ohr. Er würde sich nicht zu dem Speerträger umdrehen, sollte er seine Rede weiterhin in seinen Rücken sprechen. Smertrios hielt seinen Blick auf Barnario gerichtet. Einst hatte der Stammesführer sein Bedauern darüber ausgesprochen, dass Smertrios in den Wald zog. Er wusste, dass Barnario ihn mochte, er schätzte seine Bögen, schoss selbst einen aus Smertrios' Werkstatt auf der Jagd. Doch nun bemühte sich der Stammesführer, sich keine Regung anmerken zu lassen.
Smertrios war ein guter Jäger, war ein Mann des Waldes. Er konnte nicht nur die Güte des Holzes spüren, sondern auch die Gefühle der Tiere. Barnario war ihm wohlgesinnt, das fühlte er. Gezwungen, diese Versammlung abzuhalten und nicht glücklich darüber. Die alten Männer an den Seiten der Halle jedoch, die ließen eine Woge der Abneigung auf Smertrios eindringen. Die meisten waren Krieger gewesen, Männer des Schwertes und der Schlacht.
Cavannus nahm seine Rede wieder auf und Smertrios begann zu spüren, wessen Wünsche er tatsächlich vertrat.
»Aber nicht nur bist du gestern davongelaufen wie ein feiger Hund, man muss sich schon seit Längerem fragen, ob du noch deinem Stamme dienst. Drei Bögen wurden bei dir in Auftrag gegeben, die du gestern hättest liefern sollen – das hast du nicht getan. Hättest du sie rechtzeitig gebracht, hätte es vielleicht weniger Verletzte gegeben. Man fragt sich, auf wessen Seite du stehst. Du hast die Tochter einer der angesehensten Familien unseres Dorfes geschwängert, hast sie damit für ihren Vater wertlos gemacht, wo sie doch für eine wichtige Verbindung vorgesehen war. Du hast sie zum Weib genommen, damit den Namen ihrer Familie beschmutzt. Du weigerst dich, im Dorf zu leben, ziehst es vor, in einer Hütte im Wald zu hausen, als wären die Menschen deines Stammes dir zuwider. Und nun hast du dein wahres Gesicht gezeigt – ein Feigling, dem der Stamm der Raben nichts wert ist. Wer weiß, vielleicht warst ja sogar du es, der den Angreifern das Tor geöffnet hat!«
Erneut stieß er den Speer hinter Smertrios auf den Boden. Und das war einmal ein Freund gewesen. Smertrios bemerkte das zufriedene Nicken, das einer der alten Männer Cavannus zuwarf. Kalandinas Vatervater. Das hatte er vermutet.
Barnario, der bis jetzt vor Smertrios gestanden war, setzte sich auf den kunstvoll geschnitzten Stuhl hinter sich. Er sah Smertrios nachdenklich an, als überlege er, ob er ihm das Wort überhaupt erteilen sollte. Smertrios begann zu schwitzen.
»Hast du etwas zu sagen, Bogenbauer?«
Smertrios zerdrückte die Strohfigur in seiner Hand. Möge Ogmios, der Gott der Redekunst, ihm gnädig sein, ausnahmsweise. Wie gerne hätte er nun seinen Bogen bei sich, um sich daran festzuhalten.
»Herr, du weißt, dass ich meinem Stamm zutiefst verbunden bin, auch wenn ich im Wald lebe. Als ich gestern hierher kam, um drei Bögen zu bringen, die drei deiner besten Krieger bestellt hatten, hörte ich Schreie. Ich rannte ins Dorf, ich sah, was geschah und ich habe alle meine Pfeile benützt, um das Dorf zu verteidigen. Ihr müsst nur sehen, wie viele der toten Feinde einen rotgefiederten Pfeil in ihrem Körper stecken haben. Ich sage nicht, dass ich sie alle getötet habe, doch getroffen. Ihr seht also«, wandte Smertrios sich an den Rat, »ich habe gekämpft. Doch dann sah ich, dass meine Schwester Sanna aus dem Dorf gezerrt wurde. Ich habe nicht erkannt, dass es mein Schwestermann war, der sie rettete, ich dachte, einer der Feinde will sie verschleppen. Und ihr wisst alle, dass Sanna mir so wichtig ist wie euch eure erstgeborenen Söhne. Ich wollte sie vor einem Schicksal bewahren, vor dem auch ihr eure Frauen und eure Töchter um jeden Preis zu retten trachten würdet. So irrte ich den ganzen Tag im Wald umher, überzeugt, dass sie dort wäre. Erst bei meiner Rückkehr erfuhr ich, dass mein Schwestermann Rufius sie gerettet hatte.«
Barnario nickte, verständnisvoll, wie es Smertrios schien. Die alten Männer murmelten, begannen sich zu beratschlagen. Nun musste er warten. Und ihren Urteilsspruch widerspruchslos annehmen. Er spürte den Schweiß seinen Rücken hinabrinnen. Bemühte sich, starr geradeaus zu blicken, ja nicht zu den beratschlagenden Alten hin. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor.
Von beiden Seiten der Halle trat endlich jeweils ein weißhaariger Mann zu Barnario vor und die drei Männer flüsterten miteinander. Das Gesicht des Stammesführers verfinsterte sich, es sah nicht gut aus, das fühlte Smertrios. Die beiden Alten nahmen wieder Platz, Barnario erhob sich. Gleich würde er wissen, welche Strafe man ihm zuteilte.
»Smertrios, höre. Höret ihr Männer, höret ihr Götter, was der Rat beschlossen hat. Einer der unseren hat sich eines großen Vergehens schuldig gemacht, hat sein Dorf in der Not im Stich gelassen – um seine Schwester zu retten, wie er nun behauptet; um sich feige in Sicherheit zu bringen, wie die anderen es sehen. Und es scheint, dass dieser Eine schon länger nicht mehr den Stamm unterstützt. Der Rat hat beschlossen, ihn aus dem Dorf auszuschließen, ihn zu ächten. Seinem Weib steht es frei, die Ehe zu lösen und ins Dorf zurückzukehren, zu ihren Eltern. Er selbst darf das Dorf nicht mehr betreten. Die Rabenleute können keine Feiglinge in ihrem Stamm gebrauchen.«
Smertrios biss die Zähne aufeinander. Das Urteil war anders, als er erwartet hatte. Er hatte sich auf eine Auspeitschung gefasst gemacht. Sein Blick fiel auf Kalandinas Vatervater. Er zählte zu den Ältesten im Dorf und seine Meinung zu den ausschlaggebendsten. Der alte Mann sah ihn mit versteinertem Gesicht an, doch Smertrios ahnte die Zufriedenheit, die er empfand. Seine Enkeltochter käme zurück ins Dorf, und Smertrios als Verbannter machte sie zu so etwas wie einer Witwe. Nach der Geburt des Kindes könnte sie erneut heiraten. Er brauchte nicht lange nachzudenken, wer hinter diesem Urteil stand, was die wahren Gründe waren. Es ging gar nicht darum, ob er ein Feigling war. Es war nur eine gute Ausrede für Kalandinas Familie, ihn loszuwerden. Sie hätten ihm auch die Hände oder Beine brechen können. Aber er war als Bogenbauer wichtig für sie, und eine Verbannung hinderte sie nicht daran, zu ihm in den Wald zu kommen, um Bögen zu erstehen. Sie konnten den Preis drücken, weil er nun kein Mitglied des Stammes mehr war. Wie klug. Er rührte sich nicht. Spürte einen erstickenden Schmerz in seinem Magen. Er würde sein Kind nicht sehen. Kalandinas Vater würde es nach der Geburt annehmen – oder es töten. Sein Kind.
Cavannus packte ihn am Arm, riss ihn herum, um ihn aus der Halle hinauszuführen. Plötzlich stand Darrach vor ihm, der Druide des Dorfes. Er war klein für einen Mann der Raben, gewiss einst größer gewesen, doch nun vom Alter gebeugt. Selbst die Männer im Ältestenrat verstummten, denn Darrach war gefürchtet, seine Macht größer als die des Stammesführers, schließlich handelte der Druide dem Willen der Götter folgend. Sein weißgrauer Bart stand buschig um seinen Hals, wie der Kragen eines dicken Schafes. Er trug ein ungegürtetes Hemd aus weißer Wolle, das ihn noch mehr wie ein Schaf aussehen ließ, und stützte sich auf seinen kunstvoll geschnitzten Stab, mit dem er den Kindern, denen er die Geschichte und die Gesetzte des Stammes nahebrachte, auch gerne einmal einen Schlag gegen die Beine gab. Hinter dem Druiden konnte Smertrios Sanna und seinen Vater erkennen, die neugierig bei der Tür der Halle hereinschauten.
»Ihr habt bereits ein Urteil gefällt?« Darrachs Stimme schnarrte.
»Ja«, antwortete Barnario ruhig. »Der Ältestenrat hat die Verbannung ausgesprochen.«
»Ein verständliches Urteil, aber hinfällig.«
Der Druide schlurfte an Smertrios vorbei auf den Stammesführer zu. Barnario erhob sich von seinem Stuhl und bot ihn dem alten Mann an. Darrach ließ sich mit einem satten Plumps auf die Sitzfläche fallen. Das Gemurmel, das unter den Männern aufgebrandet war, brachte er mit einem Schlag seines Stockes auf den Holzboden zum Schweigen.
»Wir brauchen ihn. Er ist der Bogenbauer der Rabenleute.«
Kalandinas Vatervater schob die Hände in seinen breiten Gürtel, verzog den Mund.
»Es gibt andere, die das auch können.«
Ein abschätziger Blick des Druiden traf ihn. Smertrios wagte nicht, Hoffnung zu fühlen. Er konnte nicht behaupten, dass der Druide ihm je wohlgesinnt gewesen war. Er erinnerte sich, wie Darrach einst gesagt hatte, er hätte Sanna den Göttern überlassen sollen, anstatt sich zum Narren zu machen, um sie am Leben zu erhalten. Er trat also nun nicht für ihn ein, weil er ihn schätzte. Warum dann?
»Es gibt Männer, die einen Bogen bauen können, ja. Aber keinen, der so viel von Bögen versteht wie Smertrios. Und es geht nicht um Bögen für die Jagd. Es geht um den Sulnatris.«
Erneut schwoll Gemurmel an. Der Sulnatris, der Schlangenbogen, der die Sonne beschützte. Jener Kultbogen, der nur alle neun Jahre in einem Ritual geschossen wurde. Die Drei war caddos, heilig. Die drei-mal-drei erst recht. Und der Zeitraum von neun Jahren war jener, der einem Ritual die größte Kraft gab. Schon ihre Ahnen hatten mit einem Bogenschuss das Dorf beschützt, seit es die Götter so bestimmt hatten. Alle neun Jahre, wenn im Herbst die Sterne in einer bestimmten Form standen.
»Ihr habt wohl recht gehandelt, ihn zu verbannen, doch als ihr euer Urteil gefällt habt, wusstet ihr nicht alles. Das Feuer, das gestern den Nemeton beschädigt hat, hat jenen Bogen, den uns die Götter einst gaben, zerstört. Smertrios wird einen neuen bauen. Drei-mal-drei Jahre sind vergangen, seit das letzte Mal die Sonne vom Himmel geschossen wurde, zur Tagundnachtgleiche im Herbst ist es erneut soweit. Danach könnt ihr ihn verbannen, wenn ihr wollt. Bis dahin muss er ein Rabenmann bleiben, denn kein Fremder darf den Sulnatris anrühren.«
Barbario senkte den Kopf, als Zeichen der Zustimmung.
»Wie du sagst, so sei es.«
»So sei es«, murmelten auch die alten Männer, mit wenig Begeisterung.
Der Druide erhob sich, beachtete das anschwellende Gerede der Männer nicht und trat auf Smertrios zu.
»Komm mit. Es ist keine leichte Aufgabe.«
Als sie zur Türe der Halle kamen, hängte Sanna sich bei ihrem Bruder ein. Sie hatte Tränen in den Augen, lächelte erleichtert und sah doch ängstlich aus. Smertrios fühlte sich ähnlich. Er hatte den Sonnenschuss zwei Mal gesehen, als sechsjähriges Kind und als fünfzehnjähriger Jüngling. Der Sulnatris war ein Bogen, ganz anders als die langen Holzbögen, die er baute, ganz anders als alle Bögen, die er kannte. Kurz und geschwungen, überzogen mit einem tiefen Schwarz. Er hatte keine Ahnung, wie er so etwas bauen sollte.
Kapitel 3: Der Auftrag
Der Geruch von kaltem Rauch hing über dem Nemeton und der kleinen Hütte daneben, in der der Druide lebte, und von der nur noch die Mauern aus dicken Baumstämmen standen – das Strohdach war den Flammen zum Opfer gefallen. Schwarz ragte auch die Palisade des Nemetons in den Himmel, nur die Knochen der Pferdeköpfe am Eingang leuchteten weiß. Darrach grunzte verärgert, persönlich beleidigt von dem Angriff auf das Heiligtum. Trotzdem vollführte er die üblichen Segnungen und Gebete, ehe er Smertrios, Sanna und ihren Vater in die heilige Einfriedung ließ.
In der Mitte, in einer großen Eisenschale, brannte das ewige Feuer. Jene Flamme, die niemals erlöschen durfte, selbst in der Nacht der Wintersonnwende nicht. An ihr wurden am Morgen nach der längsten Nacht wieder alle Herdfeuer der Hütten entzündet, die man am Abend davor ausgehen lassen hatte. Darrachs Schüler, ein schmächtiger Bursche, war damit beschäftigt, Holz nachzulegen. Dahinter stand der große Felsblock, auf dem Opferhandlungen vorgenommen wurden. Und oben, auf diesem Fels, lag nun ein verkohlter Stab.
Darrach deutete Smertrios, näherzutreten.
»Im Nemeton ist es im Winter zu kalt für ihn. Er war in meiner Hütte, gut verwahrt in einer Kiste. Nicht gut genug, wie es scheint.«
Der Druide reichte Smertrios die Reste des Bogens. Smertrios atmete auf. Fast die Hälfte war noch erhalten, wenn auch außen rußig. Er betrachtete ihn sorgfältig, putzte den verkohlten Teil weg, um den Aufbau des Bogens zu erkennen. Er hatte noch nie einen Bogen gesehen, der so kurz und gebogen war. An dem Bruchstück konnte er nun sehen, dass der Bogen aus mehreren Schichten bestand. Nicht nur Sehnen an der Außenseite, wie er sie auch schon manchmal benützt hatte, um schlechtes Holz zu verstärken, sondern auch Horn an der Innenseite.
Sanna sah ihm neugierig über die Schulter.
»Du wirst ihn bauen, ich werde ihn segnen, und dann wirst du mit ihm die Sonne vom Himmel schießen. Schaffst du es nicht, so musst du dich den Göttern opfern, um sie milde zu stimmen. Schaffst du es, sind dir Ruhm und Reichtum gewiss.« Darrach deutete auf den Bogenrest. »Die Götter lassen sich nicht täuschen. Er muss diesem völlig gleichen.«
»Aber wie kann man die Sonne vom Himmel schießen? Dann ist es doch auf ewig dunkel!«
Sanna hatte den letzten Sonnenschuss nicht miterlebt, sie war damals mit einem schweren Husten im Bett gelegen. Darrach schüttelte missbilligend den Kopf, als müsste dieses Ritual jedem Kind vertraut sein.
»Es ist nicht die echte Sonne, Sanna«, sagte Smertrios beruhigend.
Vater nickte. »Es ist eine bronzene Scheibe, die hoch oben zwischen zwei Bäumen auf einer Schnur befestigt wird, sodass es aussieht, als wäre es die Sonne. Sie wird am Tag des Gleichgewichtes zwischen Sonne und Dunkel herabgeschossen, und dann in der Erde vergraben, wo sie bis zur Wintersonnwend täglich mit Bier und anderen Opfergaben gestärkt wird, um dann, ehe die Sonne nach der längsten Nacht wieder aufgeht, stärker und ausgeruht im Nemeton den Göttern dargebracht zu werden.«
»Und deshalb beschützen die Götter dann unser Dorf, weil wir die Sonne genährt und verwöhnt haben?«
Darrach nickte.
»Wie groß ist die Scheibe? Und wie hoch oben hängt sie?«
Der Druide ging zu einem hölzernen Kasten an der unverbrannten Wand des Nemeton und entnahm ihm ein Bündel aus feinem Leinen. Als er den Stoff auseinander schlug, sah man in seinen Händen eine goldglänzende Scheibe, die etwa die Größe des Kopfes eines Kleinkindes hatte. Smertrios schluckte. Er wusste, dass die Scheibe zwischen den Wipfeln der beiden Pappeln hängen würde und sie kam ihm erschütternd klein vor. Sanna runzelte die Stirn, sah zu ihrem Bruder hin.
»Und die Schützen treffen das?«
Schweigen. Darrach sah Sanna durchdringend an, doch es war ihr Vater, der antwortete.
»Als ich ein Kind war, wurde sie getroffen. Doch bei den letzten beiden Malen musste sich der Schütze dem Sonnengott opfern, um dessen Gunst für das Dorf zu erhalten.«
Smertrios sah erneut auf den Rest des Sulnatris, dann auf die kleine Scheibe.
»Und die Pfeile? Welche Pfeile?«
»Der Bogen ist uns vor langer Zeit von den Göttern geschenkt worden. Gut behandelt, im Haus gelagert und in den nötigen Abständen aufgespannt und wieder abgespannt, hält er ewig -«
»Und wenn er nicht verbrennt«, warf Sanna ein, ein leises Kichern in der Stimme. Darrachs Blick hätte Smertrios dazu gebracht, den Kopf zu senken, doch Sanna sah dem Druiden lächelnd in die Augen.
»- hält er ewig, doch die Pfeile mit ihren Federn nicht. Der Pfeil ist der Teil des Schützens, den er in das Ritual einbringt. Den Pfeil darf der Schütze selbst wählen.«
»Kann ich den Schuss machen?« Sanna wippte auf ihren Füßen auf und ab, als ginge es darum, wer einen Nachschlag Eintopf erhalten durfte.
»Du bist eine Frau«, widersprach Vater sofort. »Und du hast doch gehört, Darrach hat gesagt, Smertrios werde schießen.«
»Aber ich schieße besser als Smertrios. Besser als die meisten Männer im Dorf.«
Damit hatte sie recht. Ihre Aussicht, die Sonne vom Himmel zu holen, war weitaus größer als die von Smertrios. Er war ein ausgezeichneter Bogenbauer, aber nur ein durchschnittlicher Schütze. Sanna hingegen schoss, als wäre sie selbst der Pfeil.
»Kommt nicht infrage«, sagte nun auch Smertrios. »Wenn du nicht triffst, musst du dich den Göttern opfern.«
»Aber ich treffe eher nicht nicht als du!« Sie sah hilfesuchend zu Darrach. »Oder verlangen die Götter, dass der Erbauer des Bogens den Schuss macht?«
Der Druide schwieg. Er sah von Smertrios zu Sanna, die Augen zu Schlitzen verengt, dann schloss er sie für einen langen Moment. Befragte er die Götter? Als er sie wieder anblickte, sah Smertrios Genugtuung im Gesicht des alten Mannes.
»Es ist das erste Mal, dass dieser Bogen neu gebaut werden muss. Einst gaben ihn uns die Götter, doch sie haben nicht damit geschossen. So kann wie jedes Mal jener Schütze die Sonne vom Himmel holen, den das Dorf dafür am besten geeignet sieht.«
Sanna blies die Luft aus der Nase. »Das bin gewiss nicht ich. Die Männer lassen nie eine Frau gelten.«
»Aber ich. Und ich bin der, der darüber bestimmt. Mir gefällt der Gedanke, dass Bruder und Schwester … zwei Kinder desselben Mannes, von einem Blut. Das ist noch viel besser. Doch wenn ihr die Sonne nicht vom Himmel holt, so seid ihr beide des Todes.«
Seine Augen blitzten auf, als begeistere ihn die Aussicht, den Göttern ein zweifaches Opfer bringen zu können.
Smertrios sah seinen Vater an, der blass geworden war.
Doch Sanna strahlte. »Keine Sorge. Wir holen die Sonne vom Himmel. Und die Sterne noch dazu, wenn du das willst.«
Darrach nickte. »Nimm die Reste des Bogens mit, Smertrios. Das Dorf ist verpflichtet, dir Hilfe zukommen zu lassen bei deinem Unterfangen. Bauen musst du ihn aber alleine, niemand außer dir und der Bogenschützin darf ihn berühren.«
Vater hatte den Kopf gesenkt. Smertrios meinte, ihn etwas murmeln zu hören. Es klang wie ein Gebet.
Während Sanna und Vater dem Rest der Familie Bericht erstatteten, eilte Smertrios durch den Wald zu seiner Hütte. Ja, er war zurück, ehe die Sonne den höchsten Stand erreichte – nur um einen Tag zu spät. Er fand Kalandina in eine dicke Decke gewickelt auf der Bank vor dem Haus sitzen. Ihre Augen waren gerötet.
»Das Dorf ist überfallen worden. Ich konnte nicht weg.«
Sie zog die Decke enger um sich, ihre Wangen wurden blass.
»Meine Eltern?«
»Es geht ihnen gut. Auch deinem Vatervater.« Nun, dem ginge es wohl besser, wenn Darrach die Verbannung nicht abgewendet hätte. »Es war nur eine kleine Horde, vielleicht zwanzig Männer.«
Kalandina nickte.
»Und die Wolle? Hast du sie nicht bekommen?«
Er wusste, dass sie sich danach sehnte, neues Garn zum Weben zu haben, um die langen Abende zu vertreiben. Als sie vorigen Mond nach der Hochzeit hierher zu ihm in den Wald gezogen war, hatten sie zwar den Webstuhl mitgebracht und einen Platz dafür an der Wand neben dem Regal mit den Vorräten gefunden, aber der Sack Wolle, den sie mitgenommen hatte, war längst aufgebraucht.
»Nein. Ich sagte schon, das Dorf wurde überfallen, es gab anderes zu tun …«
Kalandina nickte müde.
Sie gingen in die Hütte hinein, wo ein Tontopf mit Suppe neben dem Feuer köchelte. Smertrios dachte an den Hasen, den er hatte mitbringen wollen. Nun, es war alles anders gekommen.
Schweigend rührte seine Frau um. Er war froh, aus der engen Camisia seines Vaters in eine eigene zu schlüpfen. Als er, sich den Gürtel bindend, ans Feuer trat, hielt Kalandina ihm schon die dampfende Schüssel entgegen. Smertrios setzte sich an den niedrigen Tisch, die Beine darunter gekreuzt. Kalandina nahm ihm gegenüber Platz, jedoch ohne etwas zu essen. Sie sah müde aus, er konnte es verstehen. Sie war es nicht gewöhnt, alleine hier im Wald zu sein. Und sie war nicht wie Sanna, neugierig und unerschrocken. Sanna war immer ein Teil des Waldes gewesen, hatte schon als kleines Mädchen gelernt, lautlos durch das Dickicht zu schleichen und einen Bogen zu schießen. Kalandina hatte gewiss erst selten das Dorf verlassen, und wenn wohl, um über die viel benützte Straße nach Belsaberia auf den Markt zu gehen. Sein Kind, das sollte so werden wie Sanna. Sollte sich niemals fürchten im Wald, sondern von Anfang an mit seinen Geräuschen und Gerüchen aufwachsen, lernen, sich an Füchse und Dachse anzuschleichen … Er hatte seine Frau wohl angestarrt, in Gedanken versunken, denn sie wandte sich ab.
»Entschuldige«, sagte Smertrios. Und er erzählte ihr, was im Dorf geschehen war. Nur die Sache mit der Verbannung verschwieg er. Er wusste, dass Kalandina nur zu gerne zu ihrer Familie zurückkehren würde. Dabei hoffte er, dass sie sich an das Leben hier im Wald gewöhnen würde, dass sie lernen würde, es zu lieben, so wie er es tat.
Er fand es immer noch ungewohnt, dass er nicht mehr alleine in seiner Hütte lebte. Er hatte nicht vorgehabt, zu heiraten. Doch als er kaum einen halben Mond nach der Wintersonnwend im Dorf gewesen war, da hatte Kalandina ihn bereits abgepasst. Sie hatte etwas von ihren veränderten Brüsten gesprochen, hatte ihn daran erinnert, dass er sich nicht unter Beherrschung gehabt, und seinen Samen in sie ergossen hatte. Sie hatte noch kein Mondblut versäumt, und doch war sie bereits sicher, dass sie sein Kind erwartete. Er wünschte, er könnte es ebenso spüren. Er konnte nur zustimmen, dass ihre Brüste voller wirkten, aber er fragte sich, wie sich das wohl anfühlte, wenn man wusste, dass ein Kind in einem wuchs, obwohl noch niemand etwas sehen konnte. Er hatte sich sogleich bereit erklärt, sie zu seinem Weib zu nehmen. Schließlich war es sein Kind, hatte er in jener Nacht sich nicht zurückgehalten. Mutter hatte darüber den Kopf geschüttelt. Ob er denn wirklich sicher sei, dass sie ein Kind erwartete. Und dass sie sein Kind erwartete, wer weiß, vielleicht ahnte sie nur, dass er derjenige wäre, der am ehesten bereit war … Aber darin war er sich sicher. Es war sein Kind. Und selbst wenn die Götter es wieder zu sich riefen, sah er es als seine Pflicht an, sie zu seiner Frau zu nehmen. Und da waren sie nun … Mann und Weib. Einander fremd, verbunden einzig durch dieses kleine Ding, das noch unsichtbar in Kalandina wuchs und sie jeden Morgen mit Übelkeit quälte. Wie sollte er ihr nun darlegen, dass er in einem halben Jahr vielleicht den Göttern geopfert wurde? Er versuchte, die Sache mit dem Bogen harmloser klingen zu lassen, als sie war. Doch Kalandina ließ sich nicht so leicht täuschen.
»Beim letzten Sonnenschuss wurde der Schütze den Göttern geopfert, weil er nicht traf.«
»Ja. Aber ich bin nicht der Schütze. Nur der Erbauer. Sanna wird den Pfeil fliegen lassen.«
»Sie ist eine Frau.« Kalandina rümpfte die Nase.
Smertrios zuckte die Schultern. »Darrach hat es so bestimmt. Ich habe ein halbes Jahr, diesen Bogen zu bauen.«
Er klang zuversichtlicher, als er sich fühlte. Den ganzen Weg zu seiner Hütte hatte er darüber nachgegrübelt, wie er es schaffen sollte, den Bogen den Göttern genehm nachzubauen. Nun, er würde einen Weg finden. Irgendwie. Er musste. Sannas Leben stand auf dem Spiel.
Gerade, als Kalandina ihm eine zweite Portion Suppe einschenkte, wurde die Türe seiner Hütte aufgerissen. Sanna stand in der blassen Nachmittagssonne, ein wenig außer Atem, ihren Bogen in der Hand und einen Köcher auf dem Rücken.
»Und, wollen wir beginnen?«
Kalandina sah von Sanna zu Smertrios.
»Was ist mit den drei Bögen, die du ins Dorf bringen wolltest, musst du da nicht erst Ersatz schaffen? Ich brauche die Wolle.«
Smertrios erhob sich seufzend.
»Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Komm, Sanna.«
Er ging mit seiner Schwester hinter die Hütte, wo unter einem breiten Vordach eine Schnitzbank stand und eine große Anzahl Rohlinge an der Wand lehnten. Smertrios spannte einen der langen Holzstämme in die Halterung der Bank und nahm, mit einem Zugmesser bewaffnet, darauf Platz. Er konnte die Enttäuschung in Sannas Gesicht sehen. Sie setzte sich auf den hüfthohen Querbalken, der die Steher des Vordaches verband.
Mit ruhigen, langen Bewegungen schabte Smertrios Span um Span von dem geviertelten Eschenstamm.
»Was meinst du, Sanna, haben den Sulnatris tatsächlich die Götter unserem Stamm gebracht?«
»Wer sonst? Ich habe noch nie so einen Bogen gesehen.«
Sie schüttelte alleine über den Gedanken den Kopf, dass es anders sein könnte. Ihre Beine baumelten vor und zurück. Sie war eine junge Frau im heiratsfähigen Alter, und doch oft kindlicher als ihre kleine Schwester Uinje.
»Ich bezweifle es. Er fühlt sich nicht so an wie etwas, das Götter erschaffen. Und ich hoffe, dass ich recht habe, denn wie sollte ich einen Bogen bauen können, den Götter geformt haben?«
Sanna starrte ihn erschrocken an.
»Nicht von den Göttern? Aber Darrach sagte doch immer … das wäre … nein, wie kann etwas im Heiligtum nicht von den Göttern sein?«
Smertrios zuckte die Schultern. »Ich hoffe es eben. Vielleicht haben die Götter einst ja einen Menschen beauftragt, ihn zu bauen. Der verkohlte Rest fühlte sich sehr irdisch an.«
Seine Schwester nickte ernsthaft. »Wenn dieser Bogen nicht von den Göttern ist, woher dann?«
Smertrios betrachtete den Jahresring, der sich auf dem Eschenstamm zeigte. Der Baum war langsam gewachsen, die Ringe lagen nahe beieinander.
»Ich denke, dass es vielleicht andere Stämme gibt, die andere Bögen bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass jene Völker im Osten, von denen es heißt, sie täten alles auf dem Rücken ihrer Pferde – so ein kurzer Bogen wie der Sulnatris, der wäre gut geeignet, um vom Pferd aus damit zu schießen. Oder die Römer. Sie haben hochentwickelte Waffen. Warum nicht auch solche Bögen?«
Sanna kaute auf ihrer Lippe. »Auf dem Markt in Belsaberia sind manchmal Händler, die Waren aus dem römischen Reich verkaufen. Zumindest behaupten sie das. Vielleicht kennt sich einer von denen damit aus?«
Smertrios nahm die Füße von der hölzernen Sprosse, die über eine weitere Stange den Bogen festhielt. Er hatte nun wirklich nicht die Ruhe, hier zu arbeiten. Viel zu sehr quälten ihn die Überlegungen, wie er den Sulnatris nachbauen sollte. Der Rohling war zu gut, um ihn nach den Jahren der Trocknung jetzt durch seine Unruhe vielleicht zu verderben. Besser, er machte sich auf die Suche nach den Bögen, die er im Wald zurückgelassen hatte, die Bewegung täte ihm sicher gut. Und er konnte dabei Sanna zurückbringen, sie vor einer Begegnung mit der Bärin bewahren und weiter mit ihr Pläne schmieden.
Kalandina war von der Idee nicht angetan, dass Smertrios schon wieder weg wollte. Sie fand, Sanna könne sehr wohl alleine ins Dorf zurück gehen – wobei sie selbst das nie wagen würde, aus Angst, sich zu verirren. In Wahrheit fürchtete sie wohl, Smertrios käme erneut nicht zurück.
»Es ist bereits Nachmittag!«
Natürlich hatte sie recht. Es war ein ordentliches Stück Weg bis zum Dorf, selbst wenn er Sanna nur begleitete, käme er erst in der Dunkelheit zurück. Aber es schien Smertrios unerträglich, hier in der Hütte zu hocken und zu grübeln. Er konnte besser denken, wenn er sich bewegte. Sanna schien ihn zu verstehen.
»Wir können auch jagen gehen. Ich habe Vater gesagt, dass ich vielleicht bei dir übernachte, wenn es zu spät werden sollte.«
Er könnte Kalandina ihren Hasen bringen, vielleicht beruhigte sie sich dann. Erleichtert nickte er Sanna zu. Morgen brächte er sie dann ins Dorf zurück. Die Bärin erwähnte er lieber nicht vor seiner Frau, sie ging so schon ungerne zu dem Bach hinter der Hütte.
Ja, es tat ihm gut, mit Sanna durch den Wald zu schleichen. Sie schossen zwei Eichhörnchen – Smertrios mochte den nussigen Geschmack ihres Fleisches, vielleicht fand Kalandina ja auch Gefallen daran. Dann saßen sie eine Weile nur da, nebeneinander an einen Baumstamm gelehnt. Sanna hielt die beiden pelzigen Tiere im Schoß und schmiegte sich an ihren Bruder. Sie schwiegen. Mit Sanna konnte man wunderbar schweigen. Der Wald tat auch ihr gut, die Aufgeregtheit, die sie an den Tag gelegt hatte, ebbte ab.
»Es ist so einfach hier im Wald«, murmelte sie leise. »Wozu braucht es Dörfer und Rituale und Kämpfe? Du brauchst nichts davon, du hast alles. Und jetzt sogar eine Frau!« Sie sah ihn lächelnd von unten her an.
Smertrios nahm seinen Arm von ihrer Schulter, wandte sich ein wenig ab, als betrachte er etwas in der Ferne.
Sannas nackter Fuß zeichnete ein Muster in das Laub, es raschelte.