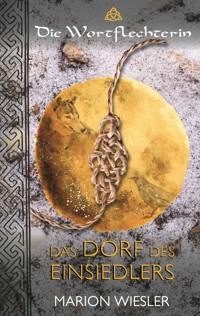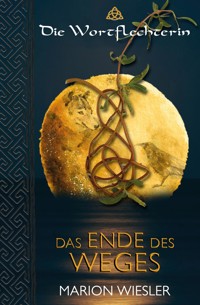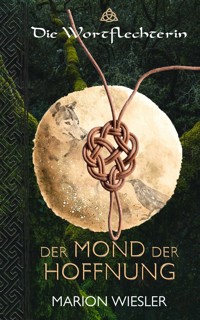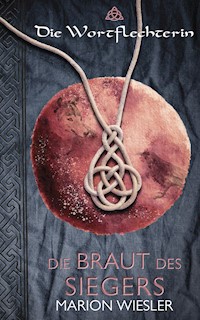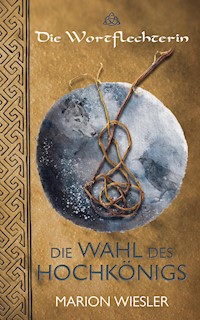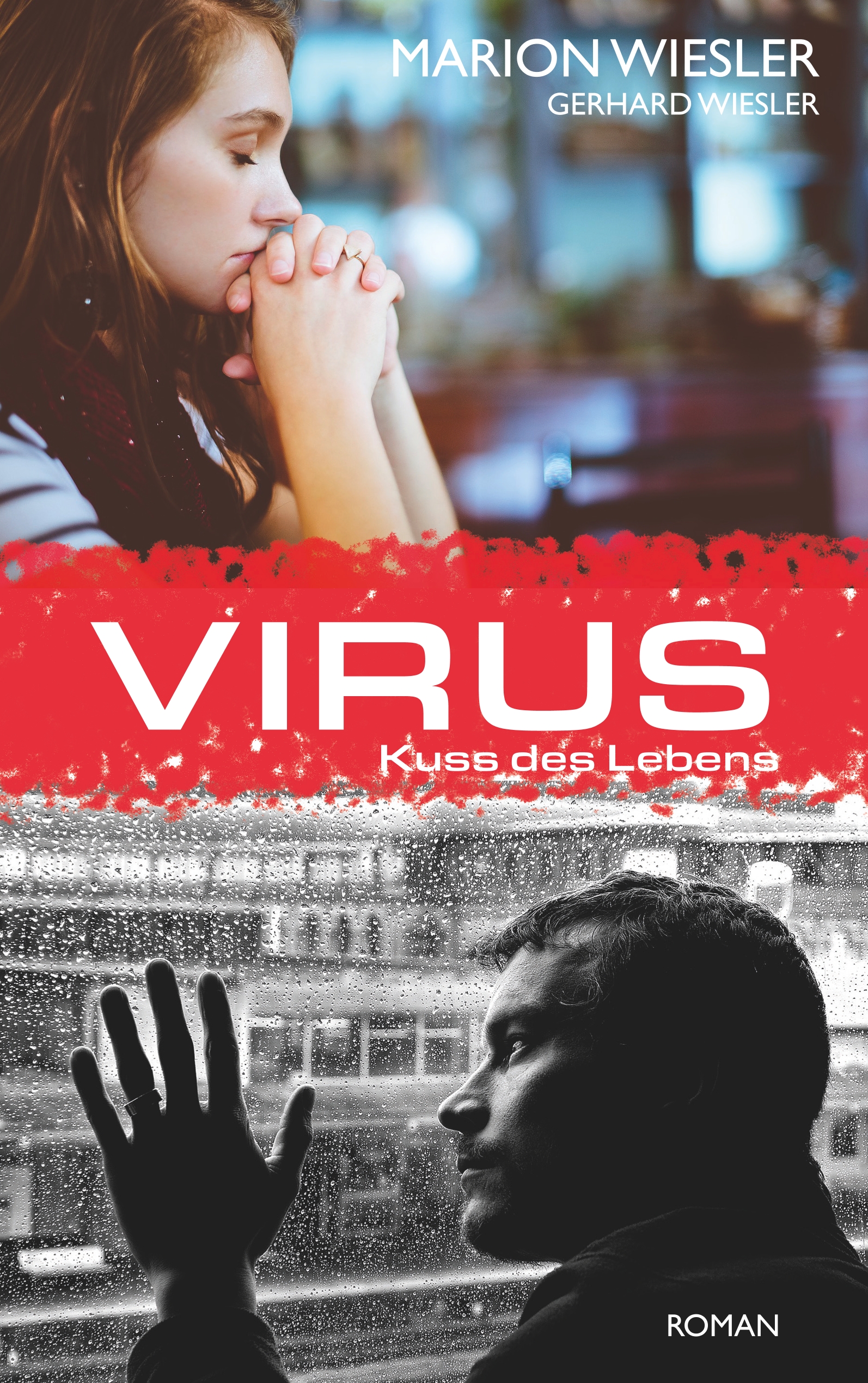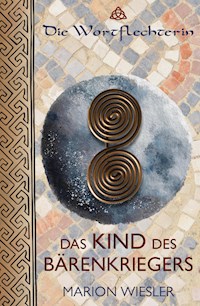
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Bardin, verflucht, nie sesshaft zu sein. Eine große Liebe. Gute Geschichten und treue Gefährten. Norikum, im Jahr 37 vor unserer Zeitrechnung. Seit drei-mal-drei Jahren wandert die Bardin Arduinna durch die Welt, gezwungen durch ein grausames Gebot. Doch was ist mit dem Mann, der wie sie das Ende dieses Fluches herbeisehnt? Band 5 der Keltenroman Serie „Die Wortflechterin“ widmet sich Loïc, dessen Schicksal von Arduinnas stetigem Wandern abhängt. Kein leichtes Los für einen Krieger und Herrschersohn. Ein spannender historischer Roman zur Keltenzeit, mit starken Frauen, vielfältigen Geschichten und einem unterhaltsamen Raben. Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marion Wiesler
Das Kind des Bärenkriegers
Keltenroman
Band 5 der Keltenroman Serie "Die Wortflechterin"Inhaltsverzeichnis
Arduinnas Welt
Noricum
Arduinnas Gedicht
Prolog: Mehr als drei-mal-sieben Jahre zuvor
Loïcs Geschichte: Ein Dutzend Jahre vor dem cynnedyf
Arduinna: Abendliche Ruhe
Loïcs Geschichte: Der Herbst vor dem cynnedyf
Arduinna: Entbehrungen
Loïcs Geschichte:Der Tag des cynnedyfs
Arduinna: Eine Erkenntnis
Loïcs Geschichte: Ein halber Mond nach dem cynnedyf
Arduinna: Verzweiflung
Loïcs Geschichte: Die ersten Monde nach dem cynnedyf
Arduinna: Bei dem Torwächter
Loïcs Geschichte: Der erste Winter des cynnedyfs
Arduinna: Der Reisewagen
Loïcs Geschichte: Der zweite Sommer des cynnedyfs
Arduinna: Die verfallene Hütte
Loïcs Geschichte: Der zweite Herbst des cynnedyfs
Arduinna: Gemeinsamer Weg
Loïcs Geschichte: Der dritte Winter des cynnedyfs
Arduinna: Die zweite Nacht
Loïcs Geschichte: Das vierte Jahr des cynnedyfs
Arduinna: Am Danubius
Loïcs Geschichte: Im vierten Herbst des cynnedyfs
Arduinna: Ein kleines Gehöft
Loïcs Geschichte: Der fünfte Herbst des cynnedyfs
Arduinna: Wendung zum Guten
Loïcs Geschichte: Das sechste Jahr des cynnedyfs
Arduinna: In Vindobona
Loïcs Geschichte: Der sechste Jahrestag des cynnedyfs
Arduinna: Die Hütte im Wald
Loïcs Geschichte: Das siebente Jahr des cynnedyfs
Arduinna: Eine tröstliche Geschichte
Loïcs Geschichte: Das achte Jahr des cynnedyfs
Arduinna: Das Reh
Loïcs Geschichte: Der neunte Sommer des cynnedyfs
Arduinna: In Lauriacon
Loïcs Geschichte: Der neunte Herbst des cynnedyfs
Arduinna: Der nächste Tag
Loïcs Geschichte: Der neunte Winter des cynnedyfs
Arduinna: Ein neuer Morgen
Loïcs Geschichte: Der Morgen der Abreise
GLOSSAR
GESCHICHTEN
PERSONEN
ORTE
Bücher aus der »Welt der Wortflechterin« :
Marion Wiesler
Impressum
Arduinnas Welt
Noricum
Verzeichnis der Orte und ihrer heutigen Namen im Glossar
Karte inspiriert von der berühmten Tabula Peutingeriana
Weitere Bände der Serie
Die Wortflechterin
Die Zeit des Aufbruchs
(Kurzband)
Die Wahl des Hochkönigs
Der Markt der Lügner
Die Braut des Siegers
Das Fest der Sonnwend
Das Kind des Bärenkriegers
Arduinnas Gedicht
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Prolog: Mehr als drei-mal-sieben Jahre zuvor
Als er auf dem schmalen Weg aus dem Wald bog, erblickte er die Palisade seines Dorfes. Tegid liebte diesen Anblick. Der Rauch, der von den Dächern hochstieg, das Geräusch der Schmiede und die Stimmen der Kinder, die die Schweine hüteten. Der Duft des Meeres, das hinter der Siedlung lag. Er sah die Bauern auf den Feldern ringsum, die sich um die Aussaat der Gerste kümmerten und die jungen Krieger, die sich im Schwertkampf übten. Wenn er die Palisade erblickte, wusste er, dass er wieder daheim war, und er wusste, dass man sich über seine Rückkehr freute.
Aber heute zögerte er. Er war nicht alleine.
Immer drängten sie ihn, jemanden zur Begleitung auf seine Reisen mitzunehmen, nicht alleine zu anderen Dörfern zu reiten. Dass er sich einen Burschen zulegen solle und auch einen Schüler. Doch er liebte seine Ruhe. Er genoss es, sich ungestört in die Welten der Lieder versenken zu können. Er war stolz, alle Widrigkeiten des Tages selbst zu meistern. Er wollte keinen Burschen, kein Gefolge, für das er verantwortlich war, und keinen Schüler, den die Eltern zu ihm schickten, nur weil Tegid ein angesehener Barde war.
Doch nun war es anders.
Er hatte im Wald ein Kind gefunden, einsam und schluchzend unter einer Ulme sitzend. Das kleine Mädchen hatte vor Angst geschrien, als er von seinem Pferd stieg und sich ihr näherte. Er hatte leise ein Lied zu singen begonnen und sie war ruhiger geworden, hatte ihn mit großen blauen Augen angesehen. Sie konnte noch keine zwei Sommer erlebt haben und ihr Hemdchen war schlicht, aber aus guter Wolle. Sie schien unverletzt. Tegid hatte sie hochgehoben und mit ihr gemeinsam die Umgebung abgesucht. Doch da war niemand.
So hatte er sie mit sich genommen.
Zwei Tage war das nun her und das kleine Mädchen war ihm rascher ans Herz gewachsen, als er gedacht hatte. Er war nur nicht sicher, ob man sie im Dorf ebenso herzlich aufnehmen würde.
Sie war an seiner Schulter eingeschlafen, die zarten Ärmchen um seinen Hals geschlungen und ihre Wange an seine Kehle gepresst. Er hatte seinen Umhang über sie geschlagen, um sie vor der Frühlingssonne zu schützen.
Sie strömten herbei, als er ins Dorf ritt, die Kinder allen voran. Meist brachte er Neuigkeiten und die eine oder andere spannende Geschichte mit, wenn er weg gewesen war. Tegid ritt nicht zu seinem eigenen Haus, sondern hielt vor der Großen Halle, aus der gerade Llacheu, der Anführer der Silurer, trat, begleitet vom Druiden des Stammes. Einer der Burschen der Halle eilte herbei, nahm sogleich die Zügel von Tegids Pferd, um es zu versorgen. Als Tegid sich vom Pferderücken schwang, erwachte das Kind in seinem Arm. Es schob den Umhang von sich und blickte blinzelnd umher.
Die Menschen ringsum wichen erstaunt zurück.
Creirwy, die Frau des Stammesführers, lachte auf. Tegid konnte sich vorstellen, was sie dachte. Wie wohl die meisten. Er hatte sich zwar nie ein Weib genommen, doch das hieß nicht, dass es nicht in einem anderen Dorf eine Frau geben könnte, die ihm ein Kind geboren hatte.
Noch ehe jemand sprach, sagte er:
»Seid gegrüßt, Männer und Frauen meines Stammes, mögen die Götter eure Tage segnen. Es ist gut, wieder daheim zu sein. Ich ahne, was ihr beim Anblick dieses Kindes denkt, doch bei den Göttern, ihr kennt mich als einen, der abseits seiner Geschichten der Wahrheit verpflichtet ist.«
»So ist es«, sagte Creirwys Mann Llacheu, die Daumen in seinen reich geschmückten Gürtel geschoben. Auch die Menschen ringsum riefen: »So ist es.«
Das Kind auf Tegids Arm vergrub das Gesicht in Tegids Camisia, erschrocken von den vielfältigen Stimmen.
»Zwei Tagesreisen von unserem Dorf, dem Norden zu, fand ich dieses Mädchen alleine im Wald. Gab es hier im Dorf vielleicht Nachricht von Unruhen dort? Ich selbst habe keine Spuren gesehen und keiner, den ich fragte, wusste etwas.«
Die Menschen sahen einander an, schüttelten die Köpfe.
»Vielleicht hat man sie ausgesetzt«, sagte Creirwy. »Hast du dich in der Umgebung dort umgehört?«
Tegid nickte.
»Sie ist zu alt, als dass ein Vater ihre Annahme verweigert hätte«, sagte der Goban, Ruß im Gesicht und seine Schmiedezange noch in der Hand.
»Warum sollte man ein Kind in ihrem Alter alleine im Wald aussetzen?«, fragte der Fassmacher.
»Sie braucht eine Mutter«, sagte seine Frau.
»Ein Wunder, dass sie alleine im Wald überlebt hat«, meinte der Bruder des Goban.
»Was soll nun mit ihr geschehen?«, fragte Llacheu, und Tegid war sich nicht sicher, ob der Stammesführer sich mit der Frage an ihn oder an den Druiden Efnisien wandte.
Tegid räusperte sich, verwundert darüber, dass er verlegen war.
»Ich würde mich um das Kind kümmern, so wir nicht doch noch seine Eltern finden.«
Creirwy lächelte. »Wusste ich es doch, dass dir eines Tages die Einsamkeit zu schaffen machen wird.«
Der Druide Efnisien schüttelte den Kopf.
»Ein Mädchen, gefunden im Wald. Du kennst die Geschichten, Tegid. Sie könnte ein Kind des Kleinen Volkes, der Sidhe, sein. Oder gar ein Wechselbalg, das die Feen ausgesetzt haben.«
Alle, die neugierig das Kind auf seinem Arm betrachtet und durchaus mit einem Lächeln auf ihr hübsches Gesichtchen mit den kurzen roten Locken geblickt hatten, wichen zurück. Sie waren gefährlich, die Wesen des Waldes. Unberechenbar und den Menschen meist nicht wohlgesinnt.
»Sie kann nicht im Dorf bleiben, wenn wir nicht wissen, ob sie menschlich ist«, fuhr der Druide fort.
Tegid nickte. Er wusste, was das bedeutete. Er könnte das Kind nun nehmen und sich ein Lager außerhalb der Palisade errichten. Sein Blick glitt über das Gesicht mit den großen Augen. Die kleine Hand legte sich auf seine Lippen, als wolle sie verhindern, dass er unüberlegt sprach. Als wüsste dieses Kind, dass er tatsächlich bereit wäre, ihretwegen sein gemütliches Heim zu verlassen.
Doch es stimmte. Es war keine Lösung, hier wegzugehen und sich woanders mit der Lüge niederzulassen, dass der Rotschopf seine Tochter wäre. Seine Tochtertochter wohl eher, denn Tegid zählte bereits vier-mal-zehn Sommer.
Er konnte auch die Götter die Wahrheit offenbaren lassen, ob dieses Kind in die Gemeinschaft aufgenommen werden durfte oder nicht. Ob es Mensch war oder ob der Barde auf die Trugbilder der Waldwesen hereingefallen war.
Tegid fasste das Mädchen ein wenig fester und nickte dem Druiden zu.
»So lass es uns sogleich feststellen«, sagte Llacheu, »damit wir unseren Barden mit einem reichen Mahl willkommen heißen und seinen Geschichten lauschen können.«
Die Menge ringsum rückte wieder näher, um einen guten Blick auf das Geschehen zu haben.
Tegid drückte den Kopf des Mädchens gegen seine Schulter, hielt ihn fest. Er kannte die Geschichten, wie man ein Sidhe-Kind von den Menschen unterschied.
»Hab keine Angst, meine Kleine«, sagte er. »Es dauert nur einen kurzen Augenblick.«
Sie begann, sich auf seinem Arm zu winden.
Efnisien hatte seinen Dolch gezückt.
Tegid wandte den Blick ab. Er wollte es nicht sehen, doch dann zwang er sich doch, hinzublicken. Er sollte der Erste sein, der die Wahrheit erfuhr und er fühlte sich dem kleinen Mädchen verpflichtet, mit ihm dieses Gottesurteil durchzustehen.
Seine Hände griffen fester zu, als die Spitze des Dolches sich der zarten Haut näherte. Das Mädchen schrie, als die Klinge mit einer raschen Bewegung seine Wange ritzte. Nicht nur ein kleiner Punkt, eine Linie über den ganzen Wangenknochen, auf dass man auf ewig sähe, dass sie im Verdacht gestanden hatte, ein Kind der Sidhe zu sein. Und wenn sie es tatsächlich war, so würde ein zweiter Schnitt ihre andere Wange zeichnen, damit die Menschen sich von ihr fernhielten. Töten konnte man Kinder der Waldwesen nicht, doch sich vor ihnen schützen.
Die zarte Haut öffnete sich, gab das Fleisch darunter frei, als wäre der Körper für einen Augenblick überrascht, was hier geschah.
»Es ist alles gut«, flüsterte Tegid, und die Erleichterung ließ seine Stimme zittern. Blut troff die kindliche Wange hinab, rotes, dickes Blut, nicht der grünliche Lebenssaft der Waldwesen.
»Sie darf bleiben«, sagte Efnisien und wischte die Klinge im Gras ab.
»Willkommen daheim!«, sagte Llacheu und eine seiner Mägde kam mit einem sauberen Tuch angelaufen, das sie auf die Wange des Kindes presste.
Loïcs Geschichte: Ein Dutzend Jahre vor dem cynnedyf
Mutter weint, Loïcs kleine Schwester auf dem Arm an sich gedrückt. Sein Bruder Dercilis sieht drein, als hätte er Essig getrunken. Loïcs Vater gibt den beiden Kriegern, die seinen Sohn und den Sohn eines seiner besten Männer begleiten werden, letzte Anweisungen.
Loïc sieht zu Coelius hinüber. Der Freund ist blass unter seinen Sommersprossen. Er sieht noch kleiner aus als er ist, vor dem breitschultrigen Krieger auf dem Pferd sitzend. Kein Reisewagen, nur die Reittiere und ein Packpferd. Casticos will, dass sie schnell sind.
Loïc wendet den Blick hinter sich, zu dem großen Krieger hinauf, dessen mächtigen Körper er in seinem Rücken fühlt. Der Krieger nickt ihm zu.
Eigentlich hätte Loïc zum Stamm der Lingonen geschickt werden sollen. Aber dann ist Caesar gekommen und hat Casticos geholfen, die Sueben zu vertreiben. Loïc hat das ungerecht gefunden. Schließlich hatte sein Vatervater Catamantaloedes die Sueben ja gerufen, um damals gegen die Haeduer zu kämpfen. Loïc hat gut aufgepasst, als der Druide die Geschichte erzählte. Dass der Suebenherrscher für seine Dienste dann in Casticos' Augen zu viel Stammesgebiet beansprucht hat. Und deshalb wollte Loïcs Vater, dass Caesar Ariovist vertreibt. Als der das getan hat, wollte Casticos dann aber plötzlich nicht, dass Ariovist ahnt, dass er dahinter steht. Und deshalb schickt er jetzt seinen ältesten Sohn und den Sohn eines Kriegers Ariovist nach, weit in den Osten. Als Geiselkind. Als Zeichen der Freundschaft.
Sie alle sehen so traurig aus. Dabei freut Loïc sich. Er hat den Suebenherrscher öfter gesehen, wenn der und Casticos sich trafen. Sie haben etwas von einem großen Abenteuer an sich, die Sueben, mit ihrem Haarknoten auf der Seite des Kopfes und den fremdartigen Götternamen, die sie anrufen. Noch nie ist ein Geiselkind der Sequaner über den Rhenos geschickt worden. Loïc zählt sieben Sommer und darf etwas erleben, das kein Kind der Sequaner zuvor erlebt hat.
Er beugt sich zu Coelius hinüber. Das Pferd folgt der Verlagerung des Gewichtes und macht einen Schritt zur Seite.
»Ich bin froh, dass du mitkommst«, sagt Loïc. »Es macht gewiss viel mehr Spaß, solch ein Abenteuer mit jemandem zu teilen.«
Sie sind gleich alt. Sie werden gemeinsam kämpfen lernen und jagen.
Coelius nickt, wenn auch zögerlich.
»Wir werden weit weg sein«, sagt er.
Loïc lächelt.
»Aber wir haben einander. Wir werden immer Freunde sein.«
Coelius’ Lippen wandern ein wenig in die Breite und seine Wangen bekommen wieder etwas Farbe.
»Bei Cicollos, Gott des Krieges, so sei es!«
Die beiden Krieger, die die Jungen vor sich auf ihrem Pferd haben, mahnen sie zu einem letzten Abschied.
Coelius hält den Kopf gesenkt und wagt nicht zurückzublicken, während Loïc die Augen neugierig umherschweifen lässt. So viele Menschen sind gekommen, die beiden Jungen zu verabschieden. Eines Tages, wenn er in vielen Jahren als Mann hierher zurückkehrt, dann wird er ihr Reix werden. Bis dahin sind sicher auch die Römer wieder weg, die vor Vesontio ihr Lager aufgeschlagen haben.
Aber im Augenblick findet er es spannend, dass sie noch hier sind. Bis jetzt hat er sie nur von der Palisade Vesontios aus betrachten können. Aus der Ferne sehen sie alle so gleich aus in ihren kurzen Röckchen und den gleichfarbigen Gewändern. Der Druide hat ihn ausgelacht, als er gefragt hat, ob all diese Soldaten die gleiche Mutter haben. Aber bis jetzt kannte er nur die Zweilinge einer der Mägde aus dem Küchenhaus, die einander ebenso gleichen wie diese Soldaten.
Sie reiten nicht nahe genug an dem Lager vorbei, dass er Einzelheiten erkennen könnte.
Die Reise ist anstrengend. Das Land ringsum längst nicht so reich und schön wie Vesontio, das vom blau glänzenden Dubis umflossen wird. Zertrampelte Felder. Ein paar niedergebrannte Höfe. Loïc fragt den Krieger, bei dem er auf dem Pferd sitzt, ob das die Sueben oder die Römer waren. Der meint nur:
»Den Bauersleuten ist das wohl egal.«
Sie müssen oft Umwege nehmen. Caesar und seine Männer sollen nicht sehen, dass man den ältesten Sohn des Reix der Sequaner zu den Sueben bringt.
Nachts, wenn sie zwischen den beiden Kriegern unter freiem Himmel schlafen, flüstern die beiden Jungen noch lange miteinander. Ob Ariovists Festung wohl ebenso groß ist wie Vesontio? Ob die Frauen so prächtigen Schmuck tragen werden wie daheim? Werden sie Freunde finden? Sich oft prügeln müssen?
Nach drei Tagen erreichen sie den Rhenos. Der Fluss ist breiter als der Dubis rund um Vesontio. Sie suchen den vereinbarten Ort, einen abgebrannten Weiler, der weit von der Stelle entfernt ist, wo die Römer Ariovist über den Fluss getrieben haben. Es heißt, Ariovists beide Frauen seien dabei umgekommen.
Die Buben sind aufgeregt und ängstlich. Beide pressen sie fest die Lippen zusammen und versuchen, sich nichts anmerken zu lassen. Die beiden Krieger sollen in Vesontio nicht erzählen, dass sie feige wären. Sie hören, wie ihre Begleiter leise miteinander reden. Was, wenn die Sueben nicht kommen, die Kinder zu holen? Was, wenn die Römer doch noch nicht wieder vollständig abgezogen sind und sie ihnen hier begegnen?
Sie warten zwischen den verkohlten Hausresten. Es riecht nach verbranntem Fleisch, nach kaltem Rauch und Verwesung. Loïc legt Coelius den Arm um die Schultern, als er merkt, dass dieser kämpft, nicht zu weinen.
»Das ist ein guter Ort hier«, sagt Loïc zu seinem Freund. »Die Römer haben empfindliche Nasen, da kommt sicher keiner hierher zurück.«
»Aber was, wenn die Sueben uns nicht holen?«
»Warum sollten sie nicht? Solange sie uns haben, wird Vater alles tun, dass Ariovist nichts geschieht, weder durch die Römer noch durch sonst jemanden. Deshalb schickt er uns ja hin. So hat Ariovist keinen Grund, ins Gebiet der Sequaner zurückzukehren, um sich an Vater dafür zu rächen, dass die Römer ihn vertrieben haben.«
Coelius zieht den Rotz durch die Nase hoch.
»Dein Vater ist ein kluger Mann«, sagt er.
Die beiden Krieger, die sich in ihrer Nähe hingesetzt hatten, stehen auf. Auch Loïc hört es. Das Geräusch eines Bootes, das ans sandige Ufer gezogen wird.
Einer der beiden Männer wagt sich hinter der Hauswand hervor, um sich einen Überblick zu verschaffen, kehrt zurück und deutet ihnen, dass sie kommen sollen.
Sie sind groß, die beiden Krieger der Sueben, die auf sie warten. Ihr Gewand ist dreckig, das des einen voller Blutflecken. Sie grinsen und sagen etwas zueinander, das Loïc nicht verstehen kann. Aber ihren Gesichtern nach nimmt er an, dass sie sich über ihn und Coelius lustig machen. Er sieht zu seinem Freund. Blass ist der und in seiner feinsten Camisia mit der goldenen Borte wirkt er im Vergleich zu den beiden Sueben fast wie ein Mädchen.
Die sequanischen Krieger übergeben die beiden Kinder, schieben sie den Sueben entgegen.
»Dies ist ein Pfand der Freundschaft von Reix Casticos, seine Hochachtung für den Herrscher der Sueben auszudrücken und ihm zu versichern, dass wir keine feindlichen Absichten gegenüber den Stämmen jenseits des Rhenos haben.«
»So soll es sein«, sagt der eine Suebe, dessen seitlicher Haarknoten leicht rötlich schimmert. »Wir werden aus den beiden Welpen tapferer Krieger machen, so wie wir es sind. Caesar mag uns vertrieben haben, aber nicht geschlagen.«
Der Abschied fällt kurz aus. Wenige Augenblicke später befinden sich Coelius und Loïc mit ihren beiden Begleitern und ihren Reisebeuteln in dem kleinen Boot mitten auf dem Rhenos. Am gegenüberliegenden Ufer warten zwei Pferde.
Der Krieger, dem eine Blutkruste die Wange ziert, sagt:
»Eure Zeit als verwöhnte Buben ist vorbei. Nun seid ihr unter Männern. Müsst erstmal mit einem Waldlager vorlieb nehmen, statt eurer weichen Bettchen.«
»Das macht uns nichts aus«, sagt Loïc. »Wir Sequaner sind harte Männer.«
Die beiden Sueben lachen schallend.
»Hältst dich wohl schon für einen großen Krieger, mit deinem Messerchen und der Schleuder am Gürtel.«
»Er ist sehr gut mit der Schleuder«, sagt Coelius schüchtern.
Loïc nickt. Als er die zweifelnden Blicke der Sueben sieht, steht er vorsichtig in dem schwankenden Boot auf und zieht das Hanfseil aus dem Gürtel. Er hat immer ein paar Steine in der Gürteltasche.
Der Suebe, der an der langen Ruderstange steht, befiehlt ihm, sich wieder hinzusetzen. Doch der andere hebt beruhigend die Hand.
»Lass ihn doch. Ein Bad im Rhenos wird ihn schon abkühlen.«
»Der Baum dort«, sagt Loïc und deutet auf eine Weide, die ein gutes Stück flussabwärts von den beiden Pferden steht. Er dreht die Schleuder. Das Boot wackelt, er muss die Bewegungen in den Knien abfangen. Der Stein fliegt geradewegs in sein Ziel, schlägt mit einem satten Geräusch gegen den Stamm.
Der sitzende Suebe pfeift durch die Zähne.
»Bei Thyr, der kleine Welpe ist vielleicht doch zu etwas zu gebrauchen«, sagt er.
Stolz setzt Loïc sich wieder hin. Er hat zwei hartgesottene Krieger beeindruckt, die frisch aus dem Schlachtengetümmel kommen. Er wird einst bestimmt ein großer Herrscher werden, wenn er erwachsen ist.
Arduinna: Abendliche Ruhe
Es war noch nicht sonderlich spät, meine Gefährten und ich könnten noch ein Stück Wegstrecke zurücklegen, doch ich war müde. Drei Monde, hatte der Druide Orubianus gesagt, würde es von Smertrios’ Hof nach Vesontio dauern, die Handelsstraße nach Norden und dann den Danubius entlang. Ich hatte noch nicht einmal den Fluss erreicht in den letzten zwei Monden. Der Druide mochte die Strecke zu Pferd berechnet haben, aber ich war nicht nur zu Fuß unterwegs, ich musste auch viel Zeit damit zubringen, mein Essen zu erjagen, mir ein Nachtlager zu bauen oder ein wenig Geld damit zu verdienen, Geschichten in Dörfern zu erzählen oder auf einem Gehöft für ein paar Vorräte mitzuhelfen. Die Tage waren kurz um diese Zeit des Jahres. Ich ging zumeist nicht auf der Handelsstraße, sondern knapp daneben, immer in der Sorge, dass mein Maistir Morfran aus irgendwelchen Gründen hier reisen könnte. Es war knapp gewesen, dass ich ihm beinahe in Ferchars Dorf begegnet wäre. Es war wesentlich langsamer, neben als auf der Straße zu gehen, vor allem in Schnee und Matsch. Meist war ich auch so schrecklich müde, dass ich am liebsten wie ein Bär die Kälte des Winters in einer Höhle verschlafen hätte.
Es war ein sonderbares Gefühl, morgens nicht mehr die Götter nach dem Weg zu befragen. In all den Jahren hatte ich nie Angst gehabt, mich zu verirren – man konnte sich nicht verirren, wenn man kein Ziel hatte – doch nun plagte mich oft die Sorge, vom Weg abzukommen, nach dem Jagen nicht mehr zur Handelsstraße zurückzufinden oder gar in die falsche Richtung zu gehen.
Ich war froh, den längeren Weg über den Danubius gewählt zu haben und nicht den kürzeren, aber laut Orubianus wesentlich beschwerlicheren, quer durch die Berge. Niemals wäre ich nach den Erfahrungen des letzten Winters freiwillig um diese Jahreszeit in die Berge gegangen. Halb erfroren war ich damals in der Unwirtlichkeit der Alpen.
Die Straße hier war wie eine Hand, an der ich mich einem kleinen Kind gleich anhalten konnte.
Cú sah mich mit fragendem Blick an, als ich in den Wald abwich. Wir hatten die letzte Nacht in einem kleinen Weiler verbracht, hatten sogar ein paar Vorräte mitbekommen, als Dank für das Lied, das ich gesungen hatte. Für ihn gab es keinen Grund, bereits jetzt nach einem Platz für das Nachtlager zu suchen. Für mich schon. Ich sehnte mich danach, am Feuer zu sitzen, auf meiner Leier zu spielen und mich bald in Schlafes Arme zu legen. Die Kälte des Winters zehrte heuer schlimmer als je an mir.
Branna war uns bereits ein Stück die Straße entlang vorausgeflogen und ich musste sie mit einem Pfiff darauf aufmerksam machen, dass wir anhielten. Die Rabin kam aufgeregt zu mir geflattert.
Es lag nur noch dort Schnee, wo die Sonne den ganzen Tag nicht hinkam. Wenn ich die Nächte seit dem Fest der Wintersonnwend richtig gezählt hatte, so musste heute Imbolc sein. Zum drei-mal-dritten Mal seit dem Fluch war damit der tiefste Punkt des Winters überschritten. Die Schafe gebaren die ersten Lämmer und bald würde die Göttin des Frühlings die Welt wieder mit zartem Grün überziehen. Oh, bei Lug, wie ich mich nach frischem Grün verzehrte! Jede Faser meines Körpers sehnte sich nach einer Suppe aus Brennnesseln, Giersch und Gundelrebe, nach den ersten Trieben des Wegerichs oder gar den zarten Blättern der Buche. Mochte die Straße auch eine beliebte Handelsstrecke zwischen dem Norden und dem römischen Reich sein, an der sich viele Menschen mit ihren Höfen niederließen, die Nahrung des Winters bestand selbst bei den wohlhabenden von ihnen um diese Zeit großteils aus gepökeltem Fleisch, schrumpeligen Rüben und Getreide. Es war noch lange hin, bis wir alle wieder in frischem Grün schwelgen konnten.
Ich fand einen Platz im Schutz eines Euenbusches. Bald hatte ich von den Bäumen ringsum etwas Reisig zu einer Bettstatt geschichtet, mit trockenem Laub bedeckt und wie jeden Abend mit meinem eigenen Wasser eine Grenze rund um den Platz gezogen. Branna hatte meine Tätigkeiten wie immer mit ihren Bemerkungen begleitet, während Cú das seine dazu beitrug, mit erhobenem Bein unser Nachtlager mit seinem Geruch vor Feinden zu schützen. Ich fand genug Totholz, um die ganze Nacht ein Feuer brennen zu lassen, und saß nach kurzer Zeit auf unserem Lager auf meiner Rehhaut. Nahe an den Flammen stand die bronzene Schale, die Sanna mir geschenkt hatte, darin eine Suppe mit einem Teil des geselchten Fleischs, das die Bauersleute mir heute gegeben hatten, und einer Handvoll Fichtennadeln. Beinahe ein Festmahl für diese Jahreszeit im Wald. Das Salz, mit dem das Fleisch gesurt worden war, würde meine Suppe wunderbar würzig machen.
Das Euengehölz in meinem Rücken hielt den Wind ab, der nun gegen Abend wieder stärker wurde. Auch wenn bis auf das rote Fleisch ihrer Früchte alles an den Euen giftig war, so mochte ich sie sehr. Ihre runden, weichen Nadeln boten einen dichten Windschutz und die ganze Pflanze, egal, ob sie mehr als Busch oder Baum wuchs, versprühte eine fröhliche Freundlichkeit, die gerade in der Kälte des Winters willkommen war.
Sie lachen und singen hier, cara Arduinna. Sie haben sogar einen Barden mit einer Leier. Ich meine, so manche Melodie zu erkennen. Anfangs habe ich es nicht ausgehalten, wenn irgendwo Musik erklang und es warst nicht du. Inzwischen finde ich Trost in den Liedern. Manchmal singe ich sogar mit. Heute traf ich einen Jungen, Titus. Ihm waren die Lieder fremd, doch er sang mit uns. Und lachte über meine falschen Töne. Er mag vielleicht acht Sommer zählen und hat wache, lebhafte Augen und so struppiges Haar wie ich als Kind. Sein Anblick machte mich traurig. So hätte unser Sohn sein können, wäre uns beiden ein anderes Leben vergönnt gewesen.
Während die Suppe vor sich hin köchelte, nahm ich meine Leier aus ihrem Beutel. Orubianus hatte recht gehabt, sie machte mich sichtbarer, wie der Bogen einen Schützen. Wo auch immer ich hinkam, egal ob Weiler, Gehöft oder Dorf, überlegte ich sehr genau, ob ich sie auspackte und ein Lied spielte. Wir mussten tief in Noricum sein, wo wir Barden noch große Verehrung erfuhren, doch es war nun nicht nur die Angst vor den Römern, die mich zögern ließ. Morfran war mir auf der Spur. Ein mit Hund und Rabe reisendes Weib, das ihr ungewöhnlich rotbraunes Haar unter ihrem Schal verbarg, mochte auffällig genug sein, wenn es Geschichten erzählte. Eine Bardin mit einer Leier aber erst recht. Und eine, die nicht mit Gefolge und zu Pferd reiste, sondern zu Fuß, blieb den Menschen gewiss noch mehr in Erinnerung. Gleichzeitig dachte ich jeden Tag an die Worte des Druiden Orubianus. Dass es meine Aufgabe war, die Lieder der gallischen Stämme außerhalb Galliens in Sicherheit zu bringen und sie in der Erinnerung der Menschen zu bewahren. Das war aber nur möglich, wenn ich die Geschichten vor Zuhörern erzählte und die Lieder sang … Es war jedes Mal eine schwierige Entscheidung.
Eines Tages würde Morfran mir wohl begegnen. Seit ich Smertrios' Hof verlassen hatte, bemühte ich mich jeden Abend, mich dafür zu wappnen. Seine Stimme, so volltönend wie die tiefsten Saiten meiner Leier, hatte große Macht. Ich musste nur die Augen schließen und an ihn denken, schon sah ich sein gestrenges Gesicht vor mir, den durchdringenden Blick seiner Habichtaugen. So sehr ich mich bemühte, mich mit der Kraft der Erde unter mir zu verbinden, der Gedanke an seine Rügen über meinen Gesang, an den Hieb des Stockes gegen meine Beine, wenn meine Finger nicht schnell genug über die Leier liefen, ließ mich immer noch zittern. Nach all den Jahren, die ich der Welt getrotzt hatte, war ich immer noch wehrlos.
Cú hatte sich neben mich auf unser Lager gelegt und sah mich mit seinem treuherzigsten Blick an und auch Branna, im Geäst über uns, keckerte leise. Die beiden liebten es, wenn ich abends die Leier nahm und spielte.
Ich gab den Versuch auf, mich gegen Morfran zu stärken. Jeden Abend hoffte ich, dass ich am nächsten Tag mehr Kraft hätte. Dass ich ein Bild, ein Wort fände, an dem ich mich anhalten könnte. Morgen vielleicht. Jetzt war es Zeit, mich Liedern hinzugeben.
Meine Finger waren warm genug vom Feuermachen und der Wärme der Flammen, ich zog meine Handstrümpfe aus und strich zärtlich über das Instrument.
So viele Lieder hatte Tegid mich gelehrt, so viele Morfran. So lange war es her und sie hatten ein Eigenleben entwickelt. Manche begrüßten mich sogleich wie alte Freunde, ließen meine Finger über die richtigen Saiten tanzen, als hätte ich die Melodie am Tag davor das letzte Mal gespielt. Manche verbargen sich vor mir, spielten Verstecken wie ein kleines Kind und mussten erst mit viel Geduld wieder hervorgelockt werden. Und doch gab es nichts Schöneres, als am Feuer zu sitzen, alleine mit meiner Leier, und mich ihren Klängen hinzugeben. Erst seit ich wieder eine Leier besaß, merkte ich, wie sehr sie mir gefehlt hatte.
Deine Leier ist dein Geliebter, hatte Tegid immer gesagt. Als ich Loïc begegnet war, hatte ich eine noch viel größere Liebe kennengelernt, aber sich auf der Leier den Liedern hinzugeben, war fast so tröstlich wie eine Umarmung.
Loïcs Geschichte: Der Herbst vor dem cynnedyf
Loïc streckt die Beine von sich. Die Herbstsonne ist angenehm mild. Sein Blick gleitet über den Platz vor der Großen Halle. Noch sind ihm die hiesige Haartracht und die Gesichter fremd. Nur manche der Vorbeigehenden erkennt er. Beinahe ein Dutzend Jahre war er weg aus Vesontio.
Seine Schwester Berula neben ihm auf der Bank beobachtet ihn, das spürt er aus dem Augenwinkel. Als er die Dunon verließ, hing sie noch an Mutters Brust. Nun ist sie bald eine junge Frau. Sie hat Mutters Augen und Vaters dickes Haar. Seit Loïc zurück ist, sucht sie jede Gelegenheit, in seiner Nähe zu sein. Alles will sie wissen. Er erzählt gerne. Alle anderen, scheint es ihm, wollen nur, dass er schnell wieder so ist wie sie. Gleich am ersten Abend musste er den seitlichen Haarknoten lösen. Sie werfen ihm missbilligende Blicke zu, wenn er Bei Thyr sagt, statt Bei Bel. Der Druide war erschüttert, dass er so gut wie nichts über den großen Krieg gegen Caesar wusste. Loïc hat ihm nicht verraten, dass er und Coelius mit ihren Zieheltern gelacht hatten, als sie von der Niederlage Galliens hörten. Er war ein Dutzend Jahre alt gewesen und gab den Sueben recht, dass das wohl nicht geschehen wäre, wenn Ariovist und seine Männer an der Seite der gallischen Stämme gekämpft hätten.
»Coelius sagt, die Frauen der Sueben seien hübscher als die bei uns«, sagt Berula.
Loïc lehnt den Kopf gegen die Hauswand und schmunzelt.
»Coelius sagt das, weil ihn gestern Abend eine der Küchenmägde als Grünschnabel bezeichnet hat.«
Berula kichert. Sie dreht eine Haarsträhne um ihren Finger.
»Aber stimmt es?«
»Wenn ein Suebe dich zum Weib bekäme, wäre er glücklich.«
Seine kleine Schwester denkt eine Weile über Loïcs Worte nach, beißt sich auf die Lippe.
»Hat Vater gesagt, dass er mir einen Sueben zum Mann geben will?«
Loïc schüttelt den Kopf.
»Ich glaube, er erwähnte etwas von einem der Männer von jenseits des Meeres, das die Römer das Ihre nennen.«
Berula sieht ihn mit erschrockenen Augen an. Loïc kann sich das Lachen nicht verkneifen.
»Ich habe keine Ahnung, Berula.«
Sie wird rot und senkt den Blick. Doch als sie ihn wieder ansieht, funkeln ihre Augen.
»Ich habe gehört, die Mandubierin, die Vater dir erwählt hat, soll klein, dick und hässlich sein.«
»Dann muss ich ja achtgeben, dass ich sie nicht mit dir verwechsle.« Er grinst.
Seine Schwester schlägt ihn gegen den Oberarm.
»Ich verstehe nicht, wieso Vater dich überhaupt von den Sueben zurückgeholt hat.«
»Weil du und Dercilis zu jung sind, eine Bündnisehe einzugehen.«
»Du bist auch erst drei-mal-sechs Jahre alt. Es hieß, du würdest erst in drei Jahren wiederkommen.«
»Du weißt, warum. Caesar weilt derzeit am anderen Ende seines großen Reiches. Der Reix der Mandubier und Vater wollen die Zeit nützen, ein Bündnis zu schließen, da die Augen des Römers nicht auf ihnen weilen.«
Die Vermählung wird im Frühjahr sein. Sie haben ihn jetzt schon heimgeholt, damit er den Winter über sich wieder in die Gebräuche der Sequaner einlebt. Manches ist noch dunkle Erinnerung, vieles ist ihm fremd. Die Römer bestimmen hier viele Bereiche des Lebens. Der Druide hat bereits begonnen, ihn Latein zu lehren. Als zukünftiger Reix wird er mit den Beamten der Römer immer wieder verhandeln müssen.
»Ich hätte gerne den Sohn des Schmieds zum Mann, er ist stark und nett. Oder einen Menapier, man sagt, der Stamm der Menapier hat gute Männer.« Sie seufzt. »Du kannst wenigstens eine Zweitfrau nehmen, wenn dir Vaters Wahl nicht gefällt …«
Loïc richtet sich auf, stützt die Ellbogen auf die Knie und sieht der Weberin nach, die mit einem dunkelroten Stoff über dem Arm an der Halle vorbeigeht.
»Die Sueben verachten Männer, die mehr als eine Frau begehren«, sagt er.
Berula kichert.
»Unsinn! Man weiß doch, dass Ariovist zwei Frauen hatte.«
»Für Herrscher gelten andere Regeln.«
»Du wirst auch Reix werden.«
Loïc zuckt die Schultern.
»Sarralia wird schon recht sein. Es geht um die beste Wahl für den Stamm, wir werden schon gut miteinander auskommen.«
Berula kniet sich auf die Bank.
»Gibt es eine, die bei den Sueben dir nachtrauert? Die dich gar liebt?«
»Eine? Dutzende!« Er lacht. »Du hast wohl zu verträumte Ansichten von der Beziehung zwischen Männern und Frauen.«
»Und du bist genauso ein Mann wie alle anderen!«
Sie sagt es, als wäre Mann ein schlimmes Schimpfwort.
Coelius tritt mit drei anderen jungen Kriegern aus der Halle.
»Wir wollen zum Dubis hinunter reiten. Kommst du mit?«
Loïc erhebt sich, streckt sich.
»Ein Wettreiten?«
»Warum nicht.«
»Bin dabei.«
»Darf ich zusehen?«, fragt Berula.
Loïc wirft einen fragenden Blick zu den Kameraden hin.
»Von der Palisade neben der Töpferei hast du den besten Blick, denke ich«, sagt er.
Sie schlingt ihren Umhang fester um sich und strahlt.
»Es macht doch Spaß, dass du wieder da bist«, sagt sie.
Arduinna: Entbehrungen
Ich hatte so fest geschlafen, dass das Feuer in der Nacht erloschen war. Es war der drei-mal-dritte Winter, den ich auf Wanderschaft verbrachte und man sollte meinen, ich wäre Kälte und Entbehrung inzwischen gewöhnt. Doch es wurde jedes Jahr anstrengender.
Ich kroch von meinem Lager. Gerne würde ich weiter schlafen, weiter träumen. Loïc war mir heute Nacht nahe gewesen. Er war es nun oft, seit meinem Sturz in den Arrabo viel öfter als früher. Seine stumme Umarmung, die Wärme seiner Nähe, fühlten sich so wohlig und nährend an, dass ich ewig so schlafen könnte. Doch mein Körper zwang mich in die Höhe. Das Surfleisch der Bauern gestern war mir nicht bekommen, mein Magen begehrte auf. Ich schaffte nur ein paar Schritte, ehe ich mich übergab. Ich zitterte in der morgendlichen Kälte und mühte mich ab, mit klammen Fingern das Feuer wieder in Gang zu bringen.
So dünn wie ich war, war ein verdorbener Magen genau das, was ich brauchte … Cú saß neben mir, legte seinen Kopf auf meinen Oberschenkel. Seit wir bei Smertrios waren, suchte er ständig meine Nähe, als machte er sich Sorgen um mich.
»Es ist alles gut, Cú. Muss das Fleisch gewesen sein.«
Branna kam von ihrem Schlafplatz im Geäst gesprungen und stolzierte eine Runde um die Feuerstelle.
»Moooorgn«, krächzte sie, guter Laune wie meist. Sie schüttelte ihr Gefieder und legte den Kopf schief, als ich nicht sogleich antwortete.
Sonnengott Lug hatte bereits seine Strahlen über die Erdenkante gereckt. Ich hatte lange geschlafen, ungewöhnlich lange. Ich schnupperte an den Resten des Fleisches in meinem Vorratsbeutel. Es roch nicht verdorben, doch mich ekelte davor. Cú und Branna freuten sich darüber, als ich es ihnen als Morgenmahl gab.
»Hoffentlich kommen wir heute erneut zu einem Gehöft, ich hätte nichts gegen ein paar Tage in einem warmen Haus«, sagte ich und stellte meine Essensschale mit Wasser gefüllt zum Feuer. »Geht es euch auch so?«
»Popelfurz!«, sagte Branna und schnappte Cú das letzte bisschen Fleisch vor der Nase weg. Sie flog damit auf den Ast einer Fichte, plapperte zufrieden vor sich hin. Cú sah mich an, als wollte er sich über sie beschweren. Ich kraulte ihn hinter den Ohren, bis er wohlig seufzte. Sogleich kam die Rabin eifersüchtig wieder herunter und setzte sich auf meinen Oberschenkel, ihren langen Schnabel fordernd in mein Gesicht gereckt.
»Cú ist größer als du«, sagte ich zu ihr. »Er benötigt mehr Futter.«
Wir benötigten alle mehr Futter. Obwohl diese Handelsstraße eine kluge Entscheidung gewesen war, da es ihr entlang viele Siedlungen und Gehöfte gab, war ich ständig hungrig. Ich hatte den Sommer über mir zu wenig Fett auf die Rippen gefuttert und die Winter hier nördlich der Alpen waren weit härter als jene am Meer in Gallien. Ich warf ein paar Kiefernnadeln in das Wasser in meiner Schale und die letzten Reste eines schrumpeligen Apfels. Hauptsache, etwas Warmes im Magen.
Immer weitergehen. Nicht aufgeben. Lieder verteilen und sammeln. Bis ich in Vesontio war.
Ich hatte keine Ahnung, was dann geschehen würde. Aber ich hatte das klare Gefühl, dass sich das cynnedyf wenn, dann nur dort lösen ließ. Außerdem war Vesontio wohl der Ort, an dem Morfran mich am allerwenigsten erwartete.
Drei-mal-drei Jahre hatte ich mich durch das cynnedyf nur treiben lassen, hatte der Druide Orubianus mir vorgeworfen, und er hatte recht. Niemand hatte mir verboten, nach Vesontio zurückzukehren. War es nicht der naheliegendste Ort, wenn ich ein Zeichen der Götter erhoffte? Natürlich konnte ich dort nicht so einfach in die Duron marschieren. selbst nach drei-mal-drei Jahren würde man mich wohl davonjagen. Oder umbringen. So Loïcs Vater Casticos noch lebte und nicht Loïc inzwischen Reix war. Nein, war er nicht, das hatte doch Noibio in Grannamuro gesagt. Dass er die Fibel dem Sohn des Reix der Sequaner abgekauft hatte.
Meine Hand fuhr zu dem Schmuckstück, das an seinem Lederband um meinen Hals hing. Loïcs Fibel … Seit ich dieses Stück von ihm besaß, wuchs meine Sehnsucht, ihn wiederzusehen, jeden Tag. Loïc war mir seit meinem Sturz in den Arrabo so nahe, dass ich meinte, ihn im Traum jede Nacht berühren zu können. Ich wollte ihn endlich wiedersehen, mein Körper und meine Seele sehnten sich nach ihm, dass ich es kaum ertrug. Bald war der Tag des Gleichgewichts zwischen Licht und Dunkel. Dann jährte sich der Tag, an dem Morfran mich verflucht hatte, zum drei-mal-dritten Male. Drei, die heilige Zahl der Götter, drei-mal-drei, die heiligste von allen. An jenem Tag musste ich in Vesontio sein, das fühlte ich. Was dort so grauenvoll begonnen hatte, würde sich dann vielleicht endlich lösen.
Der Gedanke versetzte mich jeden Abend vor dem Einschlafen in Aufregung. Es hatte des Druiden bedurft, mir den Mut zu geben. Orubianus hatte mir die Kraft der Göttin Ffraid geschenkt und ich fühlte deren stärkende Liebe in mir wie ein zweites Herz klopfen. Ffraid war eine Kriegerin, die für die Frauen und Mütter kämpfte, während sie die Welt mit ihren Liedern bereicherte. Ihre Kraft wärmte mich bei all meiner Müdigkeit. Ich wünschte, ich könnte Orubianus Nachricht zukommen lassen, wie dankbar ich ihm war.
Nachdem ich mich mit dem heißen Kiefernwasser gestärkt hatte, erhob ich mich, die Arme dem Himmel entgegen gereckt. Schwach wärmten Lugs Strahlen mein Gesicht. Raureif ließ die Äste glitzern. Es war still hier im Wald. Kein Vogel sang, keine Brise ließ die Blätter am Boden rascheln. Nur ganz leise vernahm ich das Plätschern eines Baches.
Cú setzte sich neben mich und streckte seine Schnauze in die Sonne. Branna wählte meinen Kopf als Sitzplatz. Wir tanzten nicht mehr in der Dämmerung, um den Willen der Götter zu erfragen. Sie fanden auch so immer Wege, meine Schritte zu lenken. Ich hatte mir angewöhnt, ihnen stattdessen schon am Morgen zu danken. Ich war nun eine Dienerin Ffraids, seit Orubianus mich ihr geweiht hatte. Ffraid war eine Kämpferin, die Lieder schätzte. So sang ich ihr jeden Morgen ein Lied. Und dann eines für Ogmios, den Gott der Redekunst, dem Tegid mich geweiht hatte. Er sollte sich nicht vernachlässigt fühlen. Und weil ich um diese Jahreszeit für jeden Tag dankbar war, den Lug sich nicht hinter den Wolken verkroch, sang ich noch ein drittes Lied für den Sonnengott.
Danach war das Bedürfnis, unter meinem Umhang am Feuer liegen zu bleiben, meist verschwunden und ich fühlte mich wieder gestärkt genug, weiter durch die Kälte zu wandern. Ich hatte es seit dem Tag, da Morfran mich verfluchte, zwei-mal-vier Winter lang getan, ich würde es auch diesen drei-mal-dritten Winter tun. Weitergehen. Nicht aufgeben.
Loïcs Geschichte:Der Tag des cynnedyfs
Zwei Krieger rammen Loïc ihre Speere in den Rücken. Halten ihn in Schach wie einen tollwütigen Wolf. Sie sind unter jenen gewesen, die gejubelt haben, als Loïc im Herbst von seinen Zieheltern bei den Sueben zurückkam. Viele Übungskämpfe haben sie den Winter über miteinander gefochten. Er hat sie bis eben vielleicht nicht als Freunde, aber doch als Kameraden angesehen. Es ist ihm egal. Sollen sie ihre Speere in ihn bohren. Wenn man nur Arduinna in Ruhe lässt.
Sie kniet zu den Füßen ihres Maistirs, dessen Hand fest in ihrem Nacken. Wie sie alle anstarren. Ganz Vesontio scheint herbeigeeilt zu sein. Als wäre Arduinna es gewesen, die ihn zur Flucht überredet hat. So viele Gründe hat sie vorgebracht, warum sie nicht gehen sollten, als Loïc heimlich ins Gästehaus eilte, das Nötigste gepackt. Doch was wäre ein besserer Weg gewesen? Seit er ihr begegnet war, galt all sein Denken ihr. Sie wusste es so gut wie er, die Götter hatten sie füreinander bestimmt.
Loïc hat ihren Maistir Morfran unauffällig über die Regeln der Barden befragt. Morfran hat ein Weib und Kinder, warum sollte nicht auch die junge Bardin einen Mann nehmen. Morfran sagte klar, dass sie niemals heiraten dürfte. Sie sei zu Wichtigerem bestimmt. Er ist ihr Maistir, er kann über sie befehlen wie ein Vater. Und Loïc will sie auch nicht als Zweitfrau. Sie ist Arduinna, jüngste Bardin des Treffens im Carnutenwald. Sie soll, wenn, seine Rigana sein. Oder er ihr Angetrauter, Mann der Bardin, verstoßen von seinem Stamm. Er ist zehn-und-ein Jahr weg gewesen, es gibt keinen unter den Sequanern, der ihm etwas bedeutet. Außer seiner Schwester und Coelius vielleicht, der mit ihm bei den Sueben war. Er kennt sie alle kaum. Ans Meer wollte er mit Arduinna, von dem sie ihm so viel erzählt hat und das er noch nie gesehen hat. Irgendwo würden sie ein Dorf finden, in dem sie sich niederlassen, zwei Unbekannte, zwei Fremde. Vielleicht sogar in Arduinnas alter Heimat, wo sie als Bardin nicht in Angst vor den Römern leben müsste.
Aber man hat sie entdeckt. Irgendjemand hat ihre Flucht früher verraten, als er angenommen hat.
Und dann forderte Sarralias Vater Arduinnas Tod.
Es heißt, als die Mandubier sechs Jahre zuvor in ihrem Hauptort Alesia an Vercingetorix’ Seite kämpften und starben, wäre er einer der wenigen gewesen, die überlebten. Er ist ein Mann, der keine Gnade kennt. Er würde auch den Tod seiner Tochter fordern, wenn er von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt wäre. Ihre Heirat mit Loïc soll den Makel abwaschen, den die Niederlage in Alesia auf den Mandubiern hinterlassen hat. Es geht um seinen Ruf, seine Ehre. Nichts, was ihm wichtiger ist.
Der Reix der Mandubier fordert Arduinnas Leben als Opfer für diese Heirat.
Sie steht neben Morfran, von ihm in die Höhe gezerrt, seine Hand in ihrem Nacken zwingt ihren Kopf nach hinten. Sie ist blass und ihr Haar wirr, aber sie bricht nicht zusammen.
Schreit nicht. Weint nicht. Loïc hat Krieger gesehen, die weniger tapfer sind.
Der Griff seines Vaters an seinem Oberarm und die Speere in seinem Rücken verhindern, dass er auf den Reix der Mandubier zustürzt, als dieser seine Forderung stellt.
Und Arduinnas Maistir handelt schnell. So sehr Loïc ihn hasst, weil er Arduinna nie freigäbe, er bewundert ihn in diesem Augenblick. Loïc könnte nur einem der Krieger die Waffe aus der Hand reißen und den fremden Reix töten. Es wäre sein und Arduinnas Tod. Doch ihr Maistir formt mit der Schnelligkeit des Habichts einen Spruch, der grauenvoll ist. Grauenvoll genug, dem Mandubier als Ersatz für Arduinnas Tod zu genügen. Und der jungen Bardin und Loïc das Leben und den Hauch einer Hoffnung zu schenken.
Und Sarralia – wenn sie den Kopf schüttelt, wenn sie sich damit nicht zufrieden gibt … Ihr Vater überlässt ihr die Entscheidung. Loïc starrt sie an. Will sie mit seinem Blick zwingen, mit diesem grauenvollen Fluch zufrieden zu sein. Sie sieht ihn nicht. Hat nur für den Vater Augen. Sie nickt, hastig. Sie ist kein böses Weib. Nie hat sie jemand gefragt, ob sie Loïc zum Mann nehmen will. Sie könnte auf dem Tod der Nebenbuhlerin bestehen. Aber sie tut es nicht.
Loïc sieht, wie Morfran Arduinna eine Haarsträhne abschneidet und den Fluch bindet. Ihn nur zu sprechen, genügt dem Barden wohl nicht. Will er ihnen alle Hoffnung nehmen?
Während die Bardin hastig die Dunon verlässt, verfolgt von den neugierigen Blicken der Menschen ringsum, schieben sie den jungen Sequaner in die Große Halle. Coelius eilt mit gesenktem Kopf auf Loïc zu. Der sommersprossige Krieger wirkt von der ganzen Sache beinahe so mitgenommen wie er. Loïc fühlt Dankbarkeit für das Mitgefühl seines einzigen Freundes – sofern er überhaupt etwas fühlt. Es soll nun alles schnell gehen. Man bringt Loïc in seine Kammer, wäscht ihn, kleidet ihn, schmückt ihn mit seinem Torque und Armreifen. Er lässt es geschehen. Er ist wie taub. Als wäre sein Inneres zu Stein geworden. Wachen stehen in der Türe. Krieger der Mandubier. Noch lange werden sie jeden seiner Schritte bewachen.
Es ist wohl das traurigste Festmahl, das man sich vorstellen kann. Niemand spricht. Niemand, in der ganzen Halle. Loïc hat keine Erinnerung, was aufgetischt wird, er verspürt Übelkeit, nicht Hunger.
Der Vater lässt die Musikanten aufspielen. Ein Barde gibt Lieder zum Besten. Arduinnas Maistir ist nirgends zu sehen, dabei haben er und seine Schülerin doch ihren Aufenthalt verlängert, um bei der Vermählung zu singen.
Der Druide bindet das Band der Ehe zwischen Sarralia und Loïc in der Halle, als wagten sie es nicht, ihn hinaus zum Heiligen Hain zu lassen. Sarralia hat geweint, ihre Augen sind rot. Sie zittert.
Dann bringt man das Brautpaar ins Schlafgemach. Duftendes Bodenstroh, Girlanden aus Frühlingsblumen. Nun ist auch Arduinnas Maistir wieder da. Coelius sagt, er habe Morfran am Umgang der Palisade gefunden, von wo aus er seiner Schülerin nachblickte.
Sie stellen sich rund um das Bett auf, all jene, die den Vollzug dieser bedeutenden Ehe bezeugen werden. Sarralias Vater. Loïcs Vater. Der Druide der Sequaner. Die Wehmutter der Sequaner. Die beiden höchsten Krieger beider Stämme. Morfran, seine Leier in der Hand. Wenn es nach seinen Plänen gegangen wäre, würde Arduinna Loïcs Vereinigung mit Sarralia mit einem Lied begleiten. Wenigstens das bleibt ihnen beiden nun erspart. Die ganze Sache ist so schon grauenvoll genug.
Coelius hat ihm während des Festmahls laufend Wein nachgeschenkt. Es lässt ihn zumindest die Scheu verlieren. Sarralias Magd hilft ihr, all den Schmuck, den roten Schleier und den Peplos abzulegen. Loïcs Bursche tritt zu seinem Herrn, doch er schickt ihn weg.
Loïc begehrt Sarralia nicht. Er begehrt bestenfalls, ihrem Vater ein Messer in den Leib zu rammen.
Sie liegt da, seine Braut, nackt, blass und zitternd. Als wäre er ein brandschatzender Krieger, der über die Frauen der besiegten Dörfer herfällt.
Er hört ihren Vater verächtlich schnauben, als Loïc nackt zu ihr aufs Bett steigt.
Arduinnas Maistir stimmt ein Lied an. Treibend, pulsierend.
In der Nacht davor hat Arduinna bei Loïc gelegen. In seinen Armen, an seinem Herzen. Weich und zart. Er schließt die Augen, denkt an sie, an ihren Körper.
Er schließt die Ehe mit Arduinna, auch wenn Sarralias Körper seine Stöße empfängt.
Sie bewachen ihn Tag und Nacht, egal, was er tut. Beide – Vaters Männer und die Krieger der Mandubier. Loïc ist schon dankbar, als sie nach ein paar Tagen zumindest nachts vor der Kammer des Schlafgemachs stehen und nicht darin.
Verfolgt von den Wachen stürmt er am Morgen nach der Vermählung zu Morfran ins Gästehaus. Der sitzt auf der Bettkante, den Kopf in die Hände gestützt, und sieht erschrocken auf, als der junge Krieger durch die Türe stürzt.
Loïc schreit und macht ihm Vorwürfe, sodass die beiden Krieger seines Vaters schon zwischen die Männer treten und ihn zurückdrängen. Arduinnas Maistir schweigt lange, lässt ihn toben. Als sein Gesicht nass von Tränen ist und er nicht mehr weiß, was sagen, deutet Morfran den Kriegern, sie alleine zu lassen. Sie gehen nur zögerlich und warten vor der Türe.
Morfran steht da, in seiner vollen Größe als Mann des Krieges, nicht als Barde. Schatten unter den Augen. Die Decke auf dem Bett, in dem Arduinna bis zur vorigen Nacht geschlafen hat, ist sorgsam zusammengelegt, als hätte sie nie einen Fuß hier ins Gästehaus gesetzt.
»Ich war es nicht, der mit ihr geflohen ist«, sagt Morfan mit einer Stimme so ruhig wie der See bei Windstille.
»Ich weiß.«
Und wie Loïc es weiß. In jeder Faser seines Körpers wälzen sich die Gedanken, was er hätte anders machen können. Er bereut nicht, dass sie fliehen wollten. Es war vielleicht dumm, aber sie sind beide bereit gewesen, das Wagnis einzugehen. Doch er verzeiht sich nicht, dass er nicht achtsamer gewesen ist. Er war so froh, als sie tief im Wald waren. So sicher, dass bis zum Morgengrauen niemand ihre Flucht entdecken würde. Deshalb beschloss er zu rasten, als Arduinnas Pferd zu lahmen begann. Das war die wahre Dummheit. Zu sich auf sein Ross hätte er sie nehmen sollen, ihres einfach zurücklassen. Es hätte ihre Verfolger vielleicht sogar auf eine falsche Spur gelockt. Dann wären ihnen noch viele Nächte vergönnt.
»Das ist die Last, die ich tragen muss«, sagt Loïc, »aber du hast sie dem Tod geweiht.«
Arduinnas Maistir tritt näher an ihn heran und Wut funkelt in seinen Augen.
»Ich habe ihr das Leben gerettet!«, sagt er, groß und mächtig vor ihm stehend.
»Ein junges Weib, zwei-mal-sieben Sommer zählend, alleine, jeden halben Mond weiterziehen müssend – das nennst du das Leben retten?«
»Wäre es dir lieber gewesen, man hätte sie den Göttern geopfert?«
»Du bist oberster Barde der Carnuten! Alle preisen, wie mächtig deine Worte sind – konntest du nicht etwas wählen, das weniger grausam war?«
»Ich denke nicht, dass es an dir ist, mir Vorwürfe zu machen. Du hast nichts zu ihrer Rettung getan.« Morfran fährt mit dem Daumen über den Ring aus Arduinnas Haar, den er am Finger trägt. »Es ist nun geschehen und wir sind alle drei darin verwoben.«
»Hast du ihr wenigstens jemanden nachgeschickt? Weißt du, wo sie ist?«
Der Barde sieht den Sohn des Reix lange an mit diesen Raubvogelaugen. Loïc hat schon die Hoffnung, er sagt nun, er habe ein geheimes Mittel angewandt, als er den Fluch sprach. Dass Arduinna in Sicherheit ist.
»Ich habe keine Ahnung, wo sie ist«, sagt Morfran schließlich.