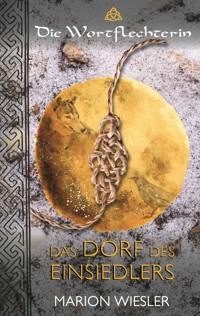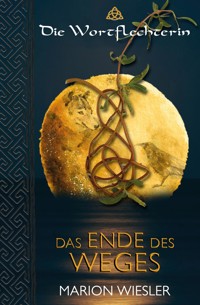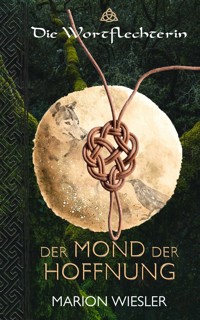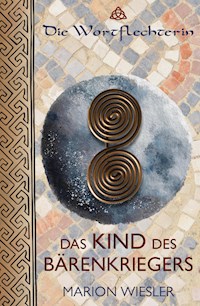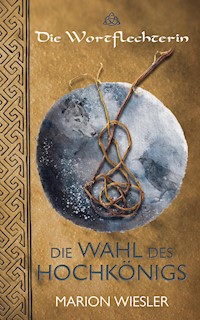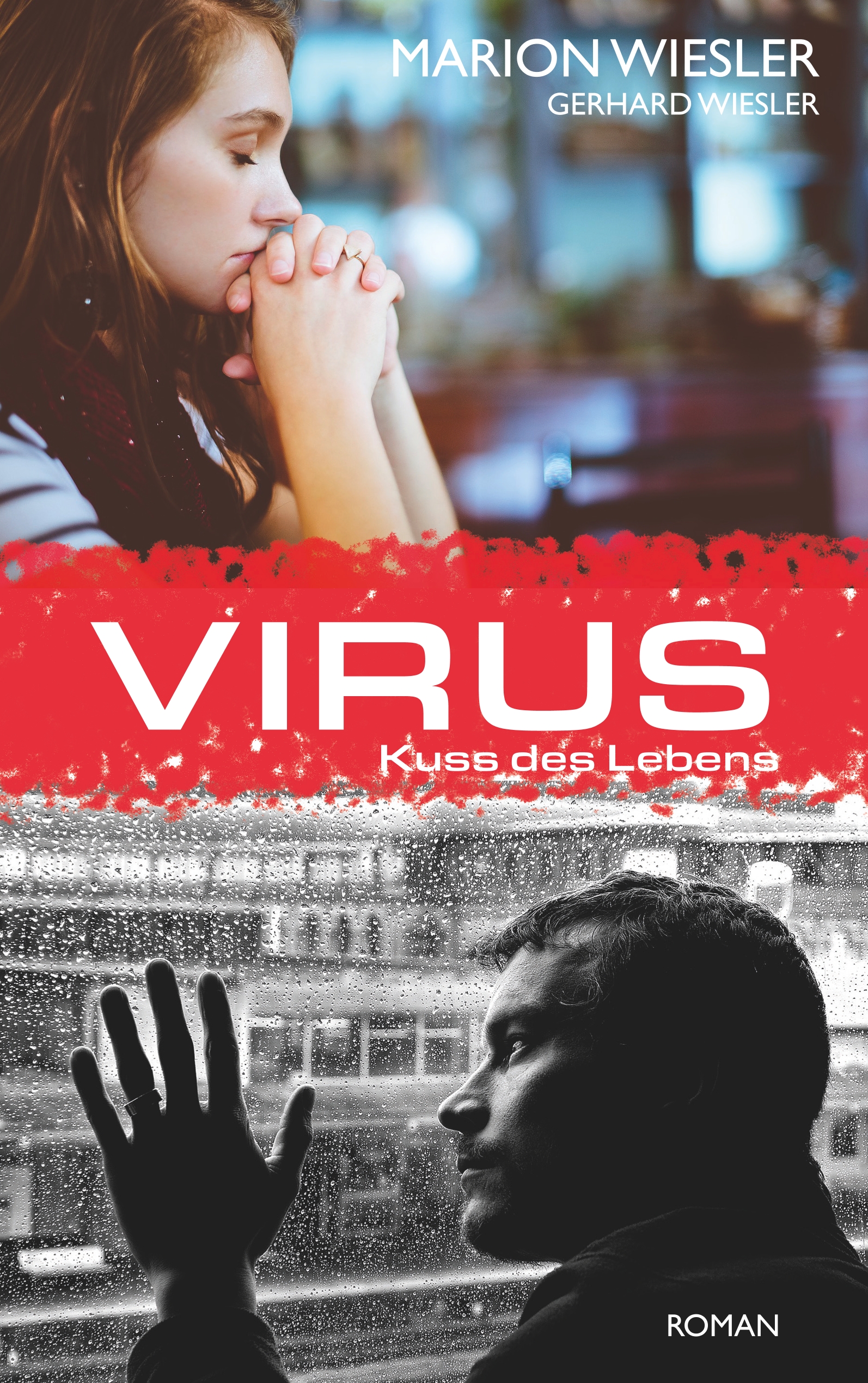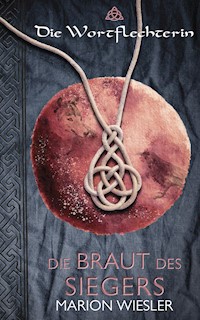
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Bardin, verflucht, nie sesshaft zu sein. Eine große Liebe. Gute Geschichten und treue Gefährten. Norikum, im Jahr 38 vor unserer Zeitrechnung. Nach wie vor zieht die Bardin Arduinna gemeinsam mit ihrem Wolfshund und ihrer Rabin von Ort zu Ort, um den Mann ihres Herzen zu schützen. Sie trifft auf einen Kriegertrupp, der sie zur Vermählung ihres Anführers mit der Herrschertochter eines besiegten Stammes mitnimmt. Rasch merkt sie, dass die Lage dort sie sehr an ihre eigene Vergangenheit erinnert und es ist an ihr, eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern – so es dafür nicht zu spät ist. Es flammt aber auch Hoffnung für ihre eigene Zukunft auf, denn einer der Krieger ist dem Mann begegnet, dessentwegen sie seit drei-mal-drei Jahren diesen Fluch erträgt. Band 3 der Keltenroman-Serie »Die Wortflechterin« Wem der Geschichtenreichtum in »Der Name des Windes« von Patrick Rothfuss gefallen hat, findet hier Ähnliches in einem real historischen Kontext. Tauch ein in die Welt der Kelten und fühle den Pulsschlag jener Zeit in dir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marion Wiesler
Die Braut des Siegers
Keltenroman
Band 3 der Keltenroman Serie"Die Wortflechterin" Eine Bardin, verflucht, nie sesshaft zu sein. Eine große Liebe. Gute Geschichten und treue Gefährten.Inhaltsverzeichnis
38 vor unserer Zeitrechnung:
Noricum:
Die Wortflechterin
Prolog: Drei-mal-drei Jahre zuvor
Kapitel 1: Spätherbst in Noricum
Kapitel 2: Nächtliche Musik
Kapitel 3: Morgentanz
Kapitel 4: In Erwartung
Kapitel 5: Ankunft
Kapitel 6: Der Brautmann
Kapitel 7: Das war gut
Kapitel 8: Wartend
Kapitel 9: Rückkehr
Kapitel 10: Die Kammer der Braut
Kapitel 11: Nächtliche Gespräche
Kapitel 12: Träume des Wassers
Kapitel 13: Castios Plan
Kapitel 14: Schmuck
Kapitel 15: Die Jüngste von allen
Kapitel 16: Mitleidlos
Kapitel 17: Die Pferdeweide
Kapitel 18: Die Ankunft des Schiffes
Kapitel 19: Ablenkung
Kapitel 20: Die Fibel
Kapitel 21: Noibios Offenbarung
Kapitel 22: Beunruhigende Neuigkeiten
Kapitel 23: Überraschung im Wald
Kapitel 24: Die Puppe
Kapitel 25: Heimliches Wiedersehen
Kapitel 26: Sorgen
Kapitel 27: Im Lagerhaus
Kapitel 28: Draugo und seine Tochter
Kapitel 29: Der herzlose Alte
Kapitel 30: Wahrheit
Kapitel 31: Am Flussufer
Kapitel 32: Eine Haarsträhne und Tuchfasern
Kapitel 33: Esox und Noibio
Kapitel 34: Hochzeitsvorbereitungen
Kapitel 35: Vaterliebe
Kapitel 36: Wichtige Erkundungen
Kapitel 37: Pläne
Kapitel 38: Bei Noibio
Kapitel 39: Es ist soweit
Kapitel 40: Der Tag der Vermählung
Kapitel 41: Wehen
Kapitel 42: Unberührtheit
Kapitel 43: Die Vereinigung
Kapitel 44: Schmerz
Kapitel 45: Unerwarteter Besuch
Kapitel 46: Die Vermählung
Kapitel 47: Tod oder Leben
Kapitel 48: Im heiligen Hain
Kapitel 49: Danach
Kapitel 50: Verabschiedung
Kapitel 51: Ein Wort
Kapitel 52: Die Annahme des Kindes
Kapitel 53: Noibio
Kapitel 54: Überfall
GLOSSAR
GESCHICHTEN:
PERSONEN:
Weitere Bücher der Serie »Die Wortflechterin«
Bücher aus der »Welt der Wortflechterin« :
Marion Wiesler
Impressum
38 vor unserer Zeitrechnung:
Noricum:
Bragnreica:
Das heutige Deutschlandsberg, das ich als Herrschersitz des Voccio erkoren habe
Solva:
Später Flavia Solva, bei Leibnitz
Murus:
Der Fluss Mur
Grannamuro:
Ort an der Mur, wo heute Radkersburg liegt
*historisch nicht nachgewiesene Namen
Die Wortflechterin
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Geboren von Seelen, die niemand kennt,
Gefunden im Wald unterm Ulmenbaum.
Ewig getrieben vom Wandel des Monds,
Vom Maistir verflucht, nie sesshaft zu sein.
Die Bäume des Waldes sind mir ein Dach,
Die Früchte der Erde mein Brot,
Begleitet von Wesen der Luft und der Nacht
Durchquere ich Täler, Berge und Seen.
Träumend von ihm, dessen Ruf ohne Klang,
Dessen Sein ohne Bild, das Ende des Fluchs.
Ich folge den Göttern, den Menschen zu dienen,
Sie zu erfreuen, doch mir zur Einsamkeit.
Ich bin Arduinna, die Wortflechterin.
Prolog: Drei-mal-drei Jahre zuvor
Sie waren zu dritt. Ihre Steine flogen in hohem Bogen und trafen mit einem satten Geräusch. Zielsicher. Sie waren alle jung und doch schon große Krieger. Jeder, der in dieser Zeit in Gallien aufwuchs, war ein Krieger, auch wenn sie beinahe noch Kinder gewesen waren, als Caesar ihr Land eroberte.
Ich hatte nur Augen für einen von ihnen. Noch hatte er mich nicht entdeckt, seine ganze Aufmerksamkeit war auf den Wettstreit mit seinen Freunden gerichtet. Der Tag war kalt und ich konnte die Dampfwölkchen sehen, die ihrer aller Atem erzeugte. Seine Freunde drehten die Schleuder über dem Kopf, doch Loïcs wirbelte neben seinem Körper, aufrecht, nicht quer wie die Flügel der Lindensamen, wenn sie zu Boden flatterten.
Hier auf der Wiese sah man Loïc den Herrschersohn nicht an. Kein Schmuck zierte seine Arme, kein Torques seinen Hals. Er lachte, als er die Wildsau, die sie auf eine große Holztafel gemalt hatten, nur am Hinterteil traf.
Einer seiner Freunde entdeckte mich, rempelte ihn an.
Er drehte den Kopf zu mir, mit diesen strahlenden Augen. Er winkte mich zu sich. Hier, vor seinen Freunden.
Ich sah das Grinsen in deren Gesicht. Meine Leier in ihrem dicken Wolltuch unter den Arm geklemmt, trat ich näher. Es war nicht einfach gewesen, mich aus der Halle zu schleichen. Morfran hatte ein scharfes Auge auf mich. Mein Maistir, der nicht ohne Grund der Habicht genannt wurde.
»Willst du es probieren?«, fragte Loïc mich und hielt mir seine Schleuder entgegen. Ich fühlte Röte in meine Wangen steigen, die sich in Trotz wandelte, als ich den abschätzigen Blick seines Freundes sah.
»Gerne«, sagte ich.
»Du willst einer Frau das Werfen mit der Schleuder beibringen?«, sagte sein Freund. Er war kleiner als Loïc, drahtig und in eine fein gewebte wollene Camisia gekleidet.
»Ja«, sagte Loïc und sah seinen Freund mit ernstem und geradem Blick an. »Ich will, dass sie sich verteidigen kann. Gegen Männer, die meinen, Frauen sollten sich nicht wehren.«
Für einen Augenblick schien die kalte Luft zwischen den beiden zu knistern. Dann lachte Loïc.
»Ich will sehen, ob eine Bardin so etwas kann.«
Der Freund schnaubte, halb belustigt. Der zweite junge Krieger machte ein paar Schritte zur Seite und ließ einen Stein auf das Ziel fliegen, ehe er seine Schleuder in seinen Gürtel schob.
»Besser, wir gehen, Acorrus. Am Ende trifft sie noch mehr als du«, sagte er mit einem Augenzwinkern.
Loïc grinste.
Der drahtige Bursche sah ihn an, dann mich.
»Ja«, sagte er. »Es ist wohl besser, wir gehen.«
Ich fragte mich, ob sie Bescheid wussten. War es so offensichtlich? Bemühten wir uns denn nicht, es geheim zu halten, niemanden sehen zu lassen, was wir fühlten? Aber die beiden kannten Loïc, seit sie Kinder waren. Er konnte es vor ihnen wohl nicht verbergen.
So standen wir nun alleine auf der Wiese. Hinter dem Fluss, der Vesontio umgab, thronte die Palisade der Dunon, als beobachte Morfran uns.
Wir schwiegen. Warteten, bis die beiden jungen Männer hinter dem Gebüsch verschwunden waren, von dem aus ich sie beobachtet hatte. Wir hörten noch ihr Lachen und Scherzen.
Loïc nahm einen Stein von dem Haufen, den sie zum Üben aufgeschichtet hatten.
»Ich meine das ernst«, sagte er. »Ich will, dass du lernst, die Schleuder zu nutzen.«
Ich sah ihn an. Sein Blick lag auf der dünnen Narbe auf meiner Wange. Er war einer der wenigen, die wussten, woher sie stammte. Sanft strich sein Finger darüber.
»Ich will wissen, dass du dich verteidigen kannst. Gegen Tiere. Gegen Menschen.«
Er wusste auch von dem Überfall, bei dem mein geliebter Maistir Tegid ums Leben gekommen war. Wir kannten einander erst seit einem halben Mond und doch wussten wir mehr übereinander als andere Menschen in unserem Leben.
Seine Hand, schwielig vom vielen Üben mit dem Schwert, griff nach meiner und er schob die kleine Schlaufe am Ende der langen Hanfschnur über meinen Mittelfinger, wie man einen Ring anstecken mochte. Dann berührte er mit dem losen Ende meinen Daumen und ich klemmte es mit dem Zeigefinger ein. Die Schnur war straff gedreht, ein wenig rau und speckig vom Gebrauch. Loïc stellte sich hinter mich und fasste nach meiner Hand, er legte den Stein in das lederne Schiffchen in der Mitte des dünnen Hanfseils. Seinen Arm um mich geschlungen, sein Körper in meinem Rücken, seine Hand auf meiner, drehten wir gemeinsam die Schleuder, ließen sie neben uns wirbeln, bis Loïc unsere Arme leicht nach hinten bewegte und mit einem leisen Jetzt und einem Ruck nach vorne mich dazu brachte, die Finger zu öffnen. Zu spät, der Stein flog weit zur Seite und scheuchte einen Hasen auf, der dort im Gras gesessen hatte. Wir lachten.
Lange übten wir. Er hinter mir, wir beide die Nähe genießend. Dann irgendwann ich alleine unter seinem aufmerksamen Blick. Als ich mehrmals hintereinander die aufgemalte Wildsau traf, leuchteten seine Augen so stolz, dass ich vor Freude hätte zerbersten wollen.
Loïc trat zu mir und küsste mich sanft. Meine Wangen glühten von Kälte und Anstrengung.
»Du bist geschickt. Du ahnst nicht, wie sehr mich das beruhigt.«
Wir schwiegen, sahen zu der Zielscheibe hin.
Wir wussten beide, dass ich gehen musste, egal, wie sehr uns die Götter gezeigt hatten, dass wir zusammengehörten. Loïc war der Sohn des Reix der Sequaner, es stand ihm nicht zu, eine Frau nach seinem Willen zu wählen. Seine Heirat war eine Frage der Stammesbindungen. Und auch wenn mein alter Maistir Tegid mir bereits vor drei Jahren das Bardenzeichen eintätowiert hatte, Morfran sah mich nach wie vor als Schülerin und ich war ihm untergeben wie einem Vater. Niemals würde der oberste Barde der Carnuten zustimmen, dass eine Bardin Zweitfrau wurde, selbst wenn der Mann ein Sohn eines Reix war.
Aber vielleicht … in ein paar Jahren … wenn ich frei war von der Bindung an Morfran, wenn Loïc Reix war und den Carnuten eine Bardin abwerben konnte für seinen Stamm …
Eine Amsel flatterte vor mir ins zertretene Gras, pickte nach einem Wurm. Bald würde es Frühling werden.
»Dein Vater hat uns gebeten zu bleiben. Bis zur Tagundnachtgleiche«, sagte ich.
Loïc riss seinen Blick von der gemalten Wildsau los.
»Ich weiß.«
Er hob seinen Umhang auf, neben dem ich auch meinen und meine Leier abgelegt hatte.
»Mir wäre lieber, dem wäre nicht so«, sagte er. Das Blau seiner Augen wurde dunkel, wie das Meer vor dem Regen.
Wir schwiegen. Zur Tagundnachtgleiche würde Loïcs Braut kommen. Morfran und ich hätten vor zwei Tagen wieder abreisen sollen, heimwärts zu den Carnuten. Doch das Wetter hatte umgeschlagen und schwere Regenstürme hatten die Wege rund um Vesontio unpassierbar gemacht. Oft reiste es sich im Winter leichter, als wenn der Frost wich und Schlamm und Fluten die Straßen unwegsam machten.
Und nun sollten wir bleiben.
»Morfran hat mir aufgetragen, ein Lied für die Hochzeit zu dichten.«
Loïc sagte nichts, doch seine Hand griff nach meiner. Er sah mich lange an und da war so viel Trauer in seinem Blick, dass ich mich genötigt sah, tröstend zu lächeln.
»Ich wünschte wirklich, ihr würdet nicht dabei sein.«
Das wünschte ich auch. Zusehen zu müssen, wie der Mann, den ich liebte, eine andere zur Frau nahm. Dies noch besingen zu müssen. Es war mehr, als ich zu ertragen meinte.
Ich zog meine Hand aus seiner und bückte mich nach meiner Leier.
»Ich habe ein Lied gedichtet«, sagte ich und wickelte das wollene Tuch von meinem Instrument. »Aber ich werde es nicht zur Hochzeit singen. Es ist … nur für dich.«
Ich setzte mich ins Gras, das hier, wo die Burschen gestanden hatten, flachgetreten und frei von Raureif war. Ohne Loïc anzusehen, stimmte ich meine Leier. Die Kälte behagte ihr nicht, doch wer wusste, wann ich wieder die Gelegenheit hatte, mit ihm alleine zu sein.
Er setzte sich mir gegenüber, ich konnte seinen Blick auf mir fühlen, warm wie Sonnenstrahlen.
Ganz leise begann ich zu singen. Es war ein Lied über das Meer, über meine Liebe für das Blau der Wellen, den salzigen Duft. Es war ein Lied, das aus meiner Seele sprach und genauso von Loïc handelte wie von dem weiten Ozean. Denn meine Liebe zu ihm war dem Meer so gleich. Unendlich. Alles verschlingend. Strahlend schön und unerbitterlich.
Loïc hatte den Kopf gesenkt, lauschte aufmerksam.
Klar und hell entschwanden die letzten Töne in den kalten Himmel.
Wir schwiegen.
Er hob den Kopf und sein Lächeln war traurig. Lange sahen wir einander an. Dann stand er auf, griff nach meinem Umhang und legte ihn mir um die Schultern.
»Sing es noch einmal«, sagte er leise und setzte sich nahe an meine Seite. »Ich will mir jedes Wort davon merken, dass es mich immer begleitet.«
Erinnerungen waren alles, das wir für einander schaffen konnten.
Kapitel 1: Spätherbst in Noricum
Die Sonne schien mir ins Gesicht, während die Knochennadel sich durch die dicke Haut kämpfte. Das Wildschwein war alt gewesen, das ich vor ein paar Tagen gemeinsam mit meinem Hund und meinem Raben erjagt hatte. Die Beute hatte mich zu einer Rast gezwungen, einer willkommenen Rast. Seit ich vor einem Mond den Markt Solva verlassen hatte, war ich von einer großen Unruhe getrieben gewesen. Hin und her, in alle Richtungen, hatten die Götter mich jeden Tag geschickt, als könnten sie sich nicht einigen, wohin sie wollten, dass ich ging. Die Tage, an denen die Götter mir den Weg nach Süden wiesen, hatten mich beunruhigt, die hohen, schneebedeckten Berge am Horizont vor mir und das Römische Reich dahinter. Doch sie waren mir immerhin so gnädig gewesen, dass sie mich jeden Abend einen kleinen Hof finden ließen, wo man uns gerne aufnahm und mir ausgiebige Nahrung als Dank für ein paar Geschichten und meine Mithilfe anbot. Erstmals seit langem hatte ich in dem letzten Mond keine Nacht im Wald verbracht, hatte immer ein gastfreundliches Haus gefunden. Als wollten sich die Götter für das entschuldigen, was in Solva geschehen war. Oder mich für einen harten Winter mästen … Es war nicht einmal mehr ein halber Mond bis Samhain und danach begann zumeist die kalte Zeit. Seit mein cynnedyf mich zwang, nie länger als einen halben Mond an einem Ort zu bleiben, war der Winter eine Zeit der Mühsal und des Schreckens, für die es sich gut vorzubereiten galt. Und war dieses Gebot schon schlimm genug, das mein Maistir Morfran damals über mich gesprochen hatte, dieses Jahr fürchtete ich die dunkle Zeit noch mehr, denn im letzten Winter hatten die Götter mich in die eisigen Berge geschickt.
Doch nun saß ich seit fünf Tagen hier, in einem Wäldchen an einem großen Fluss, und verarbeitete das Wildschwein. Und ich stellte fest, so angenehm die essensreichen Nächte bei den Bauersleuten gewesen waren, der Wald hatte mir gefehlt und ließ mich sogleich ruhiger werden.
Ich hatte den Großteil des Fleisches in schmale Streifen geschnitten und nahe dem Feuer getrocknet. Es würde eine zähe Angelegenheit werden, die Wildsau war schon frisch nicht gerade zart gewesen, aber gut genug für stärkende Eintöpfe im Winter. Die Haut hatte ich sorgsam mit meinem Messer von Fleischresten befreit und ebenfalls getrocknet. Ich hatte weder die Zeit noch die Mittel, Leder daraus zu gerben, aber für meine Zwecke würde die Rohhaut reichen. Ein neues Paar Bundschuhe und ein Paar schlichte Stiefel, ein Beutel für das getrocknete Fleisch. Ich war wirklich fleißig gewesen. Aus den Knochen hatte ich nicht nur Nadeln geschnitzt, sondern auch eine kleine Flöte. Es hatte mehrere Versuche gebraucht, bis ich die Löcher an den richtigen Stellen gebohrt hatte und das Instrument schön klang. Zum Glück hatte so ein Schwein vier Beine … Es war das erste Mal, dass ich das Bedürfnis verspürte, etwas zum Musizieren zu haben, seit man in Gallien meine Leier zerstört hatte.
Morgen würden wir weitergehen. Der Fluss, dessen Rauschen ich jenseits der lehmigen Straße vor dem Wäldchen hören konnte, lief nach Osten. Ich hoffte, die Götter ließen uns ihm weiter folgen, denn ich sah keine Möglichkeit, ihn zu überqueren. Und zu den Bergen im Süden wollte ich wahrlich nicht …
Als das Licht schwächer wurde, legte ich Holz im Feuer nach, nachdem ich es tagsüber zu einer schwachen Glut hatte niederbrennen lassen.
Die Flammen begannen gerade hochzuflackern, als ich Lärm hörte.
Stimmen.
Das Wiehern von Pferden.
Rasch warf ich Erde auf das Feuer, um es zu löschen. Immer wieder waren auf der Straße Menschen vorbeigezogen – nicht allzu viele und zumeist alleine oder in kleinen Gruppen, Händler, Bauern, zu Fuß oder mit Ochsenkarren – doch dies nun klang anders. Cú neben mir hatte die Ohren gespitzt, schnupperte.
Ich hörte Lachen und Reden. Ich hörte das Klopfen von Metall auf Holz und bald darauf zog auch der Geruch nach Rauch zu meinem Lagerplatz. Ganz offensichtlich hatte man ein Nachtlager am Straßenrand aufgeschlagen. Meine Begleiter und ich verhielten uns still. Wir waren vielleicht zwei-mal-zehn Mannlängen von den Männern entfernt, doch das dichte Buschwerk am Waldrand verhinderte, dass ich etwas sehen konnte. Wir waren wohl nur in Gefahr, wenn einer aus dem Trupp tiefer im Wald Brennholz suchen ging oder sich in Ruhe erleichtern wollte.
Mein Blick glitt über mein Lager. Ich hatte es mir behaglich eingerichtet in den letzten Tagen, hatte aus Astwerk ein schräges Dach errichtet, um vor Regen geschützt zu sein, hatte Tannennadeln und Laub darunter als Bettstatt aufgeschichtet. Wer aufmerksam hinsah, erkannte auch schon am Weg hierher die dünnen Bäume, die ich mit der Axt gefällt hatte, um ein Gestell zum Trocknen des Fleisches zu errichten.
Es war besser, ich ging nachsehen, wer meine neuen Nachbarn waren, als dass man mich in der Nacht überraschte. Cú und Branna würden mich immer beschützen und bewachen, aber wer wusste, wie viele Männer dort lagerten.
Ich deutete Branna, hier zu bleiben, und hoffte, der Vogel gehorchte.
Cú und ich schlichen uns näher an die Straße heran.
Die Abenddämmerung hatte bereits eingesetzt, leise raschelte das Laub im Wind. Ich legte mich flach auf den Boden, sobald ich durch das Buschwerk etwas erkennen konnte. Cú tat es mir gleich.
Der Trupp bestand aus etwa fünf-mal-sechs Männern und sie waren keine Händler, sondern bewaffnete Krieger. Jeder von ihnen trug ein Schwert an seiner rechten Seite, manche hatten ihren langen Schild noch um den Rücken geschlungen, manche hatten ihn bereits abgelegt. Zwischen der staubigen Straße und dem Fluss grasten ebenso viele Reitpferde, wie es Männer gab, kein Reisewagen war weit und breit zu sehen, auch kein Fuhrwerk mit Ochsen, nur zwei Packpferde. Krieger, die es eilig hatten. Krieger auf Raubzug, gewiss nicht auf der Flucht, sonst wären sie weder so fröhlich noch so laut.
Krieger auf Raubzug waren gefährlich. Das Blut rauschte fordernd in ihren Adern, die Lust auf die Schlacht entlud sich auch in einer Lust auf Frauen.
Ich würde mich tiefer in den Wald zurückziehen.
Gerade als ich mich langsam rückwärts schieben wollte, hörte ich ein lautes Krächzen. Im Dämmerlicht des Abends sah ich einen schwarzen Schatten auf das Lager zufliegen und im nächsten Augenblick landete Branna neben dem Feuer und steckte ihren Kopf in einen großen Sack, den einer der Männer gerade abgestellt hatte.
Der Krieger fluchte, scheuchte den Raben davon.
Ich presste die Lippen aufeinander.
Konnte die Rabin nicht einmal gehorchen?
Der Vogel flatterte nun aufgeregt herum, kreischte den Krieger an, der mit den Armen um sich wedelte, um das lästige Tier loszuwerden.
Andere Männer lachten, was Branna nur anfeuerte. Sie flog nun zu einem grauhaarigen Krieger, dessen goldener Halsreif es ihr angetan hatte. Die Rabin liebte alles Glänzende.
Als der Mann sein Schwert zog, um den zudringlichen Vogel abzuwehren, der auf seiner Schulter zu landen versuchte, krächzte Branna ein empörtes »Miiist! Guutermann!«
Der Mann stutzte, sein Blick glitt über die Umgebung.
Es musste ihm klar sein, dass zu einem Raben, der Menschenworte sprach, vermutlich ein Mensch gehörte, der sie ihm beigebracht hatte.
Ich senkte den Kopf zu Boden, damit das Glänzen meiner Augen mich nicht verriet.
Die Männer scheuchten nun alle Branna herum, die immer lauter kreischte.
Was nur in den Vogel gefahren war. All das reiche Futter, das die Bauern ihr in letzter Zeit gegeben hatten, hatte die Rabin wohl ihre Scheu völlig verlieren lassen.
Nun zog auch ein zweiter Krieger sein Schwert. Ich zögerte, war mir der Gefahr bewusst, die es bedeutete, einzugreifen. Doch Cú neben mir stürmte vor, preschte zu den Kriegern, stellte sich mit gesträubten Nackenhaaren hin und knurrte drohend.
Für einen Augenblick verharrten alle still, dann zog jeder sein Schwert und sah sich um, wohl eine Wolfsmeute oder einen Überfall erwartend.
Ich erhob mich, schob mich eilig durch das Buschwerk, ehe einer meiner Gefährten noch verletzt wurde.
»Verzeiht!«, rief ich laut. »Tut ihnen nichts.«
Ich pfiff und Cú eilte sofort zu mir, während Branna nur widerwillig von dem Stück Brot abließ, das sie aus dem Beutel gestohlen hatte.
Es war nicht mehr allzu viel Tageslicht vorhanden, Sonnengott Lug hatte den Himmel gerade verlassen, um schlafen zu gehen, dennoch hatte ich im Aufstehen eilig die Lederhaube tiefer in die Stirn gezogen. Ich trug mein Haar offen und hoffte, dass die zu große Kappe und mein Haar die drei blauen Punkte auf meiner linken Schläfe verbargen. Ich war in Solva zu vielen Römerfreunden begegnet, als dass ich so weit im Süden sofort als Bardin erkannt werden wollte.
Die Männer starrten mich an. Einer lachte, laut und befreit. Andere stimmten mit ein.
Drei-mal-drei Jahre alleine in der Welt hatten mich gelehrt, das rechte Maß zu finden. Harmlos und verloren zu wirken, kein lohnendes Ziel für einen Überfall zu sein, weil ich in meinem geflickten Reisekleid armselig aussah, und doch mit genügend Sicherheit und Härte aufzutreten, dass ich nicht als leichtes Opfer für lustgierige Männer gesehen wurde. So mancher, der es versucht hatte, musste schmerzhaft bemerken, dass ich mich zu wehren wusste und die Tiere an meiner Seite gefährlich waren. Doch mir war sehr wohl bewusst, dass ich gegen einen Trupp von mehr als zwei Dutzend Männern keine Aussicht auf Erfolg hätte.
»Wir sind nur hungrige Wanderer«, log ich.
»Hast dich wohl verlaufen«, kam einer auf mich zu. Er hatte sein Schwert wieder in die Scheide gesteckt und die Hände unter seinen breiten Gürtel geschoben. Die anderen jedoch standen immer noch mit gezogener Waffe und wachsamem Blick auf den Waldrand da.
»Nein«, sagte ich. »Ich bin schon auf dem rechten Weg.«
Man war immer auf dem rechten Weg, wurde erwartet. Am besten ganz in der Nähe und von tatkräftigen Männern …
Die Krieger musterten mich nun alle.
»Eine Frau, alleine«, sagte der, der direkt vor mir stand, mit Verwunderung in der Stimme. Er war ein junger Krieger, groß gewachsen, mit einem kantigen Gesicht und freundlichen Augen.
Ich lächelte, bewusst ein wenig herablassend.
»Man kann es sich nicht immer aussuchen.«
Der grauhaarige Krieger mit dem prächtigen Halsreif, der es Branna so angetan hatte, winkte mich zu sich. Ich zögerte einen Augenblick, doch dann schritt ich mit erhobenem Kopf zu ihm.
Seine Statur hatte mich über sein Alter getäuscht. Er war schlank und groß wie der junge Krieger, der mich angesprochen hatte, doch sein Gesicht verriet aus der Nähe, dass sein Haar schon lange grau sein musste. Sein Schnurrbart war sorgfältig gestutzt, das Haar ordentlich mit Öl nach hinten gestrichen und in einer geraden Linie auf Ohrläppchenlänge geschnitten. Sein linkes Auge war weiß, blind und tränte.
Sein Umhang war mit Pelz besetzt, seine Camisia mit golddurchwirkten Borten am Halsausschnitt, der Haken seines Gürtels reich verziert. Dies war eindeutig der Anführer. Wenn nicht gar ein Reix.
Er betrachtete mich im schwindenden Tageslicht. Cú stand wachsam neben mir, bereit, seine Herrin zu verteidigen. Branna auf meiner Schulter trippelte aufgeregt hin und her, legte den Kopf schief und keckerte leise, den Blick auf den glänzenden Halsreif gerichtet.
»Es ist gefährlich, alleine im Wald«, sagte der Krieger. Seine Stimme war tief und kraftvoll.
»Im Wald oft weniger als auf der Straße«, antwortete ich.
Er musterte mich noch genauer, nickte.
»Und du bist tatsächlich ganz alleine?«
»Ja.«
»Dann sei an unserem Feuer für diese Nacht willkommen. Wir werden dir Schutz bieten, vor den Gefahren des Waldes und vor jenen der Straße.«
Ich zwang meine Lippen zu einem Lächeln. Ich zog eine Nacht im Wald einer unter Kriegern vor, doch der bestimmte Blick des Mannes machte mir klar, dass dies kein Angebot, sondern ein Befehl war.
»Danke. Dann lasst mich nur meine Sachen holen.«
Er nickte, dann deutete er mit einer Kopfbewegung einem seiner Männer, mit mir zu gehen. Cú knurrte leise, ein missmutiges Geräusch, das meine Gefühle nur zu gut widerspiegelte.
Ich würde mit der Rabin noch ein ernstes Wörtchen reden müssen.
Kapitel 2: Nächtliche Musik
Als ich mit meinem Leiterwägelchen und meinem Besitz zum Lager zurückkehrte, nickte mein Begleiter dem Anführer zu, wohl als Bestätigung, dass ich tatsächlich alleine im Wald gewesen war. Ich hatte im Dunkel des Abends zusammengepackt, was ich gefunden hatte, doch so manches Stück Rohhaut und auch die Reste des Fleisches, die noch nicht getrocknet genug gewesen waren, würden nun die Tiere des Waldes erfreuen.
Die Krieger lagerten inzwischen rund um das Feuer und einer verteilte Essen. Man deutete mir, mich zu setzen. Ich schlang meinen Umhang enger um mich, nicht nur, weil der Abend kühl war, sondern weil ich im Dunkel meiner Kleidung unsichtbar sein wollte. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich in den Kreis der Männer einzufügen, nachdem zwei von ihnen zur Seite gerückt waren, damit ich Platz fand. Meinen Wagen stellte ich hinter mich, Cú schob sich zwischen den kleinen Handkarren und seine Herrin, als wolle er beides beschützen. Branna hatte es sich auf einem der Bäume am Waldrand bequem gemacht. Sie war schuld, dass ich unter lauter Männern die Nacht verbringen musste und nun zog sie sich zurück, dachte ich, immer noch verärgert.
Doch niemand fragte mich nach meinem Namen, niemand beachtete mich. Langsam wurde ich ruhiger. Die Männer ringsum scherzten, waren guter Dinge. Ich musste mich doch geirrt haben, Krieger auf Raubzug verhielten sich anders.
»Ist nicht viel, dafür werden wir morgen umso mehr Appetit haben!«, lachte der Krieger, als er mir etwas Brot, Zwiebel und Äpfel reichte.
»So erwartet ihr morgen reiche Beute?«, fragte ich.
Nun wurde das Lachen des Mannes laut und dröhnend. Er stieß den Krieger neben sich an.
»Erwarten wir morgen reiche Beute?«, fragte er ihn. Das Lachen breitete sich aus, doch niemand erklärte etwas.
Ich aß schweigend. Das Brot war recht frisch. Lange konnten sie nicht unterwegs sein.
Von der anderen Seite des Feuers drangen plötzlich Leierklänge durch die Nacht. Eine Stimme erhob sich, sang ein fröhliches Lied. Die Männer wurden stiller, klopften leise den Herzschlag des Liedes mit ihren Händen gegen ihre Schenkel.
Ich versuchte, durch Dunkelheit und Flammenleuchten den Sänger zu erkennen. Der Feuerschein erhellte ein offenes Gesicht, eine hohe Stirn. Das Alter des Mannes war schwer einzuschätzen in diesem Licht. Doch seine Stimme war mitreißend und klar, die Finger auf den Saiten seiner Leier flink und geschickt.
Ich ertappte mich dabei, dass auch meine Hand leise mitklopfte, dass mein Körper sich mit den Tönen füllte und in ihrem Klang mitschwang.
Als der Sänger endete, verlangten die Männer rund ums Feuer ein weiteres Lied.
»Spiel was Neues!«, rief einer. »Etwas, das wir nicht kennen!«
Stille breitete sich aus und alle sahen gespannt zu dem Leierspieler.
Das Rauschen des Flusses und das leise Schnauben der Pferde hatte etwas Wehmütiges, dachte ich unvermittelt.
Der Sänger ließ seinen Blick zu den Sternen hinauf schweifen, dann lächelte er, ehe er sich über seine Leier beugte.
»Dieses Lied, heißt es, kommt von weit her. Ich wollte es mir aufheben, falls wir eines Tages Besuch aus fernen Ländern empfangen, aber es kann wohl nicht schaden, es zu üben.«
Seine Finger glitten prüfend über die Leier, sorgsam drehte er an einem der Stimmwirbel, um eine der Saiten einen Hauch zu verkürzen. Er ließ sich Zeit, spielte mit der gespannten Erwartung seiner Zuhörer.
Die Bäume des Waldes flüsterten währenddessen leise, der Nachthimmel über uns umfing mich wie eine große Umarmung. Weit und breit war kein weiteres Feuer zu sehen und doch kam es mir so vor, als wären wir alle miteinander verwoben mit der gesamten Welt, nur durch unser Warten auf ein Lied aus fernen Landen, eingebettet in den Atem allen Lebens.
Dann erklangen die ersten Töne einer Melodie. Langsam und schwermütig. Seine Stimme setzte ein und mir wollte der Atem stocken.
Ich kannte dieses Lied, es war ein Lied meiner Heimat.
Es war Ewigkeiten her, dass ich es das letzte Mal gehört hatte, damals, im Wald der Carnuten, als die Barden diesseits und jenseits des schmalen Meeres ihre Lieder austauschten. Mein Inneres sang mit ihm und ich war dankbar für die Dunkelheit, die verbarg, dass Bilder jener letzten Tage mit meinem geliebten Vatervater und Maistir Tegid in mir erwachten und meine Augen feucht werden ließen.
Als der Sänger kurz stockte, sprangen die nächsten Töne und Worte über meine Lippen, ohne dass es mir bewusst war. Ich fühlte den Blick der beiden Männer neben mir, doch der Drang des Liedes war so groß, dass ich mich der Melodie hingab. Der Sänger nahm mich erfreut mit sich, gemeinsam tanzten unsere Stimmen zum Spiel der Leier, auch wenn unsere Worte unterschiedlichen Stammesklängen folgten.
Noch während wir sangen, erhob sich der Leierspieler und kam auf meine Seite des Feuers. Er kniete sich vor mir hin, ohne dass seine Finger auch nur einen Ton verzögert hätten. Nun konnte ich sein Gesicht sehen, lachende Augen und ein Mund, der so aussah, als kenne er keine Traurigkeit.
Unsere Blicke versanken ineinander, alles ringsum verschwand im Nebel der Dunkelheit. Wir begleiteten einander durch das Lied, aufmerksam und hingegeben wie zwei Liebende jede Berührung des anderen aufnehmen und erwidern.
Meine Wangen glühten, als der letzte Ton verklang und die Männer ringsum in Jubel ausbrachen.
»Mehr! Mehr!«, riefen sie.
Der Mund des Sängers wurde zu einem breiten Lächeln, er nickte mir zu und stimmte ein neues Lied an, ehe ich zu Atem kommen konnte. Ich kannte es nicht, doch es war eine schlichte, fröhliche Weise, und im Nu wechselten sich der Sänger und ich mit einfachen Strophen ab, deren Worte zumindest ich aus dem Augenblick heraus erfand. Mein Innerstes wurde weit und hell, ich fühlte mich leicht und fröhlich wie schon lange nicht. Immer schneller liefen die Finger meines Gegenübers über die Saiten, immer verrückter wurde der Inhalt unserer Weise.
Lachend beendeten wir das Lied, als unsere Zungen nicht mehr hinterherkamen, Worte zu formen.
Die halbe Nacht sangen und spielten wir, langsam ruhiger und leiser werdend. Mal folgte ich dem Leierspieler in ein Lied hinein, dann stimmte ich singend eine Weise an und er nahm die Melodie auf und begleitete mich. Ich zog sogar die Knochenflöte hervor und spielte zu seinem Gesang, merkte jedoch, dass meine Fertigkeiten auf der Flöte etwas verrostet waren.
Irgendwann war ich leer und müde. Wir nickten einander zu.
»Zeit zu schlafen«, sagte der Sänger. Leiser Widerspruch regte sich unter jenen, die sich noch nicht in ihre Umhänge gehüllt und niedergelegt hatten.
Dann war es still. Das Feuer brannte nach wie vor, knisterte und knackte. Zwei der Krieger hielten Wache, marschierten auf der Straße auf und ab.
Der Sänger legte seine Leier in seinen Schoß, immer noch vor mir kniend.
»Ich bin Meduris«, sagte er leise.
»Arduinna.«
Wir schwiegen, unsere Stimmen müde.
Der Krieger, der neben mir in seinen Umhang gerollt schlief, grunzte leise.
Wir mussten beide grinsen.
»Wir sind unterwegs zu einem Ehebündnis. Komm mit und wir werden bei den Feierlichkeiten selbst die Götter tanzen lassen!«
Ich senkte den Kopf. »Wir werden sehen …«, sagte ich.
Lächelnd erhob ich mich und zog mich hinter meinen Handkarren zurück. Cú folgte mir augenblicklich.
Ich spürte den Blick des Barden, als ich mich niederlegte. Ich rollte mich in meinen Umhang ein, schlang den Arm um Cú und dankte der großen Göttin, wie auch immer ihr Name in dieser Gegend lauten mochte, für den wunderbaren Beginn dieses Tages.
Kapitel 3: Morgentanz
Als ich erwachte, brannte das Feuer hoch. Der Sonnengott war noch weit davon entfernt, sich zu erheben, und doch waren die Krieger schon dabei, sich bereit zu machen. Ich schälte mich aus meinem Umhang. Es war kalt, Raureif glitzerte im Gras, der Atem der Pferde blies weiße Wölkchen in die Dämmerung.
Branna kam zu mir geflogen, krächzte eine morgendliche Begrüßung. Ich kraulte sie unter dem Schnabel, dankbar nun, dass die Rabin mich gestern zu den Kriegern gebracht hatte.
Ich sah mich um. Manche der Krieger krochen wie ich verschlafen aus ihren Umhängen, kratzten sich und gähnten. Andere standen mit nacktem Oberkörper und bloßfüßig am Fluss und wuschen sich. Ein junger Bursche legte dem alten Anführer soeben goldene Armreifen an und kämmte sein Haar sorgsam aus dem Gesicht.
Meduris, der Barde, stand mit einem Krieger beisammen, seine Leier in einem Lederbeutel auf dem Rücken, und unterhielt sich angeregt. Als hätte er gespürt, dass ich ihn ansah, wandte er sich um und lächelte mir zu. Ich nickte.
Der Abend war für mich etwas Besonderes gewesen. Vor einigen Jahren, als meine Leier in Gallien zerstört worden war, hatte ich mir geschworen, nie wieder Heldenlieder zu singen und es hatte sich ergeben, dass ich überhaupt nicht mehr vor Menschen sang. Doch ich musste zugeben, dass ich mich schon lange nicht so gut gefühlt hatte, wie an diesem Morgen …
Ich erhob mich, zog mich von den Männern und ihrer Lagerstelle zurück in den Wald hinein, Cú und Branna an meiner Seite. Es galt, die Götter nach dem Weg zu fragen, wie ich es immer tat. Ich fand eine Stelle, die vom Lager aus nicht einsichtig war, und schloss die Augen. Die Arme dem Himmel entgegen gereckt, begann ich mich langsam zu drehen. Ballen, Sohle, Ballen, Sohle, immer schneller tanzte ich im Kreis um mich selbst, hörte Cú um mich springen und Branna über mir in der Luft flattern. Die beiden liebten dieses Spiel am frühen Morgen. Meduris’ Gesicht erschien mir, wie er und ich im Dunkel der Nacht mit unseren Stimmen um das Spiel seiner Finger auf der Leier getanzt hatten, ebenfalls immer schneller und schneller. Ich fühlte ein Lachen in mir hochsteigen und dann überkam mich das Bewusstsein des Augenblicks, in dem ich meinen Tanz anhalten musste.
»Lass es den Fluss entlang sein«, flüsterte ich, an das reißende Wasser denkend, das eine Überquerung zu einer gefährlichen Mühsal machen würde. Ich schwankte ein wenig, schwindlig vom Drehen, öffnete die Augen.
Dem baldigen Sonnenaufgang zu, in den Wald hinein nach Osten. Osten war gut.
So sei es.
Ich kehrte zum Lager zurück, um meine Sachen zu holen und mich von den Kriegern zu verabschieden.
Den Pferden waren bereits die Fußfesseln abgenommen worden. Sonnengott Lug schickte seine ersten Strahlen über die Erdenkante und tauchte Mensch und Tier in sein herbstliches Licht. Prächtig geschmückt waren die Krieger jetzt, trugen zu ihren Schwertern und Schilden Hals- und Armreifen, goldene Fibeln an ihren Umhängen. Eine prunkvolle Hochzeit würde dies wohl werden.
Meduris stand neben meinem Handkarren und wartete lächelnd auf mich.
Im Tageslicht erkannte ich neben seinem Auge die drei blauen Punkte, die auch meine linke Schläfe zierten. Ich nahm die Lederhaube ab, schob mein Haar hinter das Ohr.
Er schmunzelte.
»Das habe ich erwartet«, sagte er.
»Es war schön, mit dir zu singen«, antwortete ich.
»Jederzeit wieder.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich muss gehen, wohin die Götter mich schicken.«
Er nickte und ich spürte seinen Blick in meinem Rücken, als ich zu seinem Herren hinüber ging. Der grauhaarige Anführer war in ein Gespräch mit dem jungen Krieger verwickelt, der ihm ähnlich sah, und die beiden wirkten, als wollten sie nicht gestört werden. Ich jedoch wollte rasch weg. So nickte ich ihm zu, als sein Blick mich kurz streifte. Er erwiderte die Geste und wandte sich wieder dem Mann neben sich zu. Als ich zu meinem Karren zurückkehrte, war Meduris nicht zu sehen. Die Unruhe des Aufbruchs war unter den Männern zu spüren und steckte mich an. Ich beeilte mich, zwischen den Bäumen zu verschwinden.
Ich war noch nicht allzu lange marschiert, immer dem Sonnenaufgang entgegen, als der Wald in dieser Richtung endete und ich wieder auf den Fluss und die lehmige Straße traf. Das erleichterte das Weiterkommen, mein Karren war kein Freund der Wurzeln und Unebenheiten des Waldes. Er hatte die letzten Monde schon viel mit mir mitgemacht und rumpelte selbst auf ebenen Wegen wie ein hinkender alter Mann. Nur wenige Mannlängen weiter brach seine Achse. Ich fluchte. Gewiss, ehe ich in Bragnreica das Wägelchen erstanden hatte, hatte ich all meinen Besitz immer in meinem großen Ziegenfellbeutel und der Rehhautrolle getragen, doch die letzten Monde hatten mich verwöhnt, auch wenn es oft mühsam war, den Karren über Wurzeln und steile Hänge zu ziehen. Und nun hätte ich auch noch den Beutel mit all dem getrockneten Fleisch für den Winter zu tragen … Mir blieb wohl nichts anderes übrig, als eine neue Achse aus einem Ast zu fertigen. Also weitere Tage hier am Fluss.
Noch hatte ich den Gedanken nicht zu Ende gedacht, als ich Lärm und Hufgetrappel hörte. Ich hatte angenommen, dass der Kriegertrupp längst weit weg wäre, sollte er in dieser Richtung dem Fluss folgen, doch nun kamen sie tatsächlich um die Biegung geritten, die Wald und Fluss hier machten.
Lautes Gejohle begrüßte mich und meine beiden Gefährten.
Der grauhaarige Anführer sah von seinem Ross zu mir herab.
»Sieh an, da ist sie ja. Ohne ein Wort verschwunden.«
Ich lächelte.
Meduris trieb sein Pferd nach vorne, schloss zu seinem Herrn auf. Er grinste über das ganze Gesicht.
»Das ist aber nett, dass du hier auf uns wartest! Wusst ich es doch, dass du mit uns ziehen sollst.«
»Die Achse meines Wagens ist gebrochen«, sagte ich.
»Tja, so strafen es die Götter, wenn man nicht gebührend mit einem Lied Abschied nimmt!«
Er schwang sein Bein über den Nacken seines Pferdes und sprang herab.
»Lass sehen.«
Das Ross des Anführers trippelte unruhig hin und her.
»Wir haben keine Zeit für so etwas«, sagte sein Reiter. »Sie soll bei dir aufsitzen, Meduris.«
Meduris, der neben meinem Handkarren kniete und die gebrochene Achse betrachtete, erhob sich wieder.
»Da ließe sich auch nicht viel machen, Iantumarus.«
Er sah mich fragend an. Ich blickte die Straße entlang, die geradeaus nach Osten führte, immer dem Fluss entlang. Sie ritten meinen Weg. Ein Lächeln drang auf meine Lippen. Ich könnte noch ein wenig länger mit Meduris singen.
Ich nickte.
Rasch hatte der Barde den Sack mit dem getrockneten Fleisch und die Rehhautrolle auf den Rücken eines der beiden Packpferde gebunden. Ich schlang mir den Ziegenfellbeutel um die Schulter und schob den Handkarren von der Straße weg. Vielleicht fand ihn jemand, der ihn nutzen und wiederherstellen würde. Er hatte mir gute Dienste geleistet.
Cú bellte aufgeregt, als Meduris mir auf sein Pferd half. Es waren große Pferde, die Schulter auf der Höhe meiner Nasenspitze, größer als jene, die ich sonst kannte. Ich schob mein Kleid hoch, um gut sitzen zu können und ließ den Ziegenfellbeutel vor mir auf dem Widerrist des Reittiers aufliegen. Die kühle Morgenluft strich über meine nackten Beine, doch das Fell des Pferdes war warm und weich an meinen Schenkeln. Der Barde schwang sich hinter mich, griff nach den Zügeln. Ich fühlte die Wärme seines Körpers im Rücken durch meinen wollenen Umhang hindurch.
Der grauhaarige Anführer, Iantumarus, nickte mir zu, wischte sich über sein tränendes blindes Auge und wendete sein Ross der Marschrichtung zu.
Der Tross setzte sich wieder in Bewegung, die Pferde schritten dankbar aus, Cú trabte neben uns her, den Kopf zu mir erhoben. Branna landete kurz auf meiner Schulter, fühlte sich aber durch die Nähe des fremden Mannes gestört und erhob sich wieder in den Himmel.
Die Luft war so klar und frisch, die Gleichmäßigkeit der Pferdeschritte so treibend, dass wie von selbst ein altes Lied auf meinen Lippen zu summen begann. Ich fühlte, dass Meduris sich ein wenig vorbeugte, lauschend, dann summte er erst mit, und als er sich der Melodie sicher war, begann er zu singen.
Einige der anderen Krieger stimmten mit ein.
Hatte ich wirklich gedacht, nach Solva hätte ich für lange Zeit kein Bedürfnis, Menschen nahe zu sein?
Kapitel 4: In Erwartung
Das Kind in Sammunias Bauch trat, schlimmer als die letzten Tage. Es fühlte wohl ihre Unruhe. Der Dunkelmond war seit fünf Nächten vorbei, heute kamen sie. Ein Bote hatte bereits gemeldet, dass sie auf den Hügeln nahe der Ebene gesichtet worden waren. Sammunia wünschte, sie könnte es verhindern.
Es war schlimm genug, was geschehen war, und dann auch noch gerade jetzt, so kurz vor der Niederkunft. Sie seufzte. Sie seufzte oft in letzter Zeit, fiel ihr auf. Es brachte ein wenig Erleichterung.
Der Bursche stand vor Castio, wartete, dass ihr Gemahl eine Entscheidung traf, in welchem Gewand und mit welchem Schmuck er sich den Ankömmlingen präsentieren wollte.
»Nichts davon«, sagte Castio und machte eine wegwerfende Handbewegung zu den beiden prächtigen Camisias, die der Bursche in Händen hielt. »Etwas Schlichtes, Bescheidenes, auch an Schmuck nur wenig.«
Sammunia, die vor dem bronzenen Spiegelscheibe an der Wand stand und ihr Haar flocht, drehte sich um.
»Sie werden nicht darauf hereinfallen«, sagte sie.
»Das lass meine Sache sein, Weib.«
Er schob sich näher an die Bettkante, bemüht, sein verletztes Bein nicht zu viel bewegen zu müssen. Der Bursche hatte nun schlichte Braccae und eine blassbraune Camisia ohne Borten gebracht und half ihm beim Anziehen. Castio schimpfte, forderte, dass Sammunia den Verband neu band, der sich beim Versuch, die Braccae anzuziehen, zu lockern begann.
Sie seufzte erneut. Er war ständig gereizt, seit er von der Schlacht zurückgekehrt war. Sie war sicher, dass es nicht nur an den Schmerzen lag, die ihm die Wunde bereitete. Da waren ganz andere Wunden, die in ihm gärten, doch das hatte er sich selbst zuzuschreiben.
Sie zog an den schmalen Stoffstreifen um seinen Oberschenkel fester an als nötig. Er zuckte zusammen und warf ihr einen bösen Blick zu, den sie nicht zu bemerken vorgab. Sie musste sich abstützen, um wieder aus der Hocke hoch zu kommen und tat dies an seinem gesunden Bein.
Castio gab ein gepresstes Grunzen von sich.
Der Bursche, der Castios goldene Armreifen in Händen hielt, wurde mit einer verärgerten Geste weggeschickt.
»Ich sagte, kein Schmuck!«, bellte Castio.
Sein Versuch, arm zu wirken, war lächerlich, und sie war sicher, das wusste er auch.
»Sag Brigia, sie soll zu mir kommen«, befahl er dem Burschen, der Anstalten machte, die Kammer zu verlassen.
»Und bring mir Wein«, rief er ihm noch hinterher.
Sammunia steckte den Schleier in ihrem Haar fest. Ein Blick in den Spiegel verriet ihr, dass sie gut aussah. Sie sah immer gut aus, wenn sie ein Kind erwartete, die Brüste rund und voll, die Wangen samtig. Es behagte ihr, dass sie es war, die nachher die Ankömmlinge am Tor begrüßen würde. Sie gäbe viel darum, dass es nicht nötig wäre, dass dieser Iantumarus gar nicht käme, aber da er nun einmal kam, so empfand sie es als angemessen, dass die Herrin der Duron bewies, dass sie nicht nur ein Schmuckstück am Arm ihres Mannes war.
Kurz legte sie Castio die Hand auf die Schulter. Er sah zu ihr hoch, seufzte.
»Ich weiß«, sagte Sammunia. »Ich wünschte auch, dass die Dinge anders gekommen wären.«
Castio nickte, fasste nach ihrer Hand und drückte sie.
»Du darfst vor ihm keinerlei Schwäche zeigen. Sei höflich, aber kühl. Wir dürfen ihm keinen Grund geben, unsere Leute unnötig zu quälen, aber wir müssen ihm deutlich zeigen, dass wir nicht gebrochen sind.«
Sammunia nickte.
Der Bursche brachte eine Schale Wein und Brigia. Castio konnte vor Sammunia nicht verbergen, wie seine Züge weicher wurden, als das junge Mädchen eintrat. Sammunia hatte Castios erstes Weib nicht gekannt, doch ringsum bestätigte man ihr, dass Brigia ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war. Es gab ihr jedes Mal einen Stich, wenn ihr Mann die Tochter seiner ersten Frau so verliebt ansah. Dabei wusste sie, dass sie langweilig gewesen war und Castio die Nächte mit Sammunia wesentlich mehr genoss.
Castio holte hörbar Luft.
»Geh dich umziehen«, sagte er zu seiner Tochter.
Das Mädchen sah an sich hinab. Sie trug ein rotes Kleid mit kunstvoll gewebten Borten und einen dunklen Peplos, beides betonte die Blässe ihres Gesichts und ließ ihr hellblondes Haar leuchten. Eine Bernsteinkette schmiegte sich an ihren Hals und an den Armen, deren Haut noch kindlich weich war, trug sie mehrere Armreifen aus Glas und aus Gold.
»Aber …«, stammelte sie.
»Ich will, dass du schlicht aussiehst.«
Sammunia verbiss sich ein Grinsen. Keine Frau wollte schlicht aussehen, wenn sie ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte.
Sie sah das Unverständnis in Brigias Gesicht. Röte kroch auf deren Wangen und sie biss sich auf die Lippen.
»Er ist ein mächtiger Mann, hast du gesagt. Sollte ich da nicht schön sein? Rudja hat immer gesagt, es ist wichtig, einen Mann zu beeindrucken von Anfang an.«
Castio schnaubte. »Deine Milchmutter ist tot und ihre Weisheiten waren oft nicht mehr wert als die Futterreste im Schweinetrog. Ich sage, du kleidest dich schlicht.«
Brigias Mund zog sich schmollend zusammen und ihre Fingerspitzen rieben über das verschlungene Muster auf der Öllampe, die auf der Truhe neben dem Bett stand, das tönerne Ding schien plötzlich furchtbar wichtig zu sein.
»Du willst das, oder?« Die hellen Augen des Mädchens sprühten Funken zu Sammunia hin.
Die Rigana tat so, als bemerke sie es nicht und wandte sich der Truhe zu, in der sie ihren warmen Umhang aufbewahrte.
»Was?« Castio hatte gerade versucht, sein schmerzendes Bein vom Bett zu schieben und verstand nicht, wovon Brigia sprach.
»Sie will nicht, dass ich hübscher bin als sie, oder? Es gefällt ihr nicht, wenn einmal die Blicke sich nicht auf sie richten, auf ihre vollen Brüste …«, flüsterte Brigia zischend.
»Wovon redest du, Kind?«
Brigia zuckte die Schultern. »Ich bin drei-mal-fünf Jahre alt, Vater. Ich werde heute einen Mann nehmen, damit dieses Dorf die Bedingungen erfüllt, die deine Niederlage uns auferlegt. Bald werde auch ich Kinder unter meinem Herzen tragen, und ich wette, mein erstes wird ein Sohn sein, so wie bei Mutter, selbst wenn mein Busen noch klein ist.«
Castio starrte seine Tochter an.
Sammunia konnte nicht anders, sie lachte auf.
»Dein Busen wird nie groß sein, Mädchen. Und ja, du wirst heute irgendeinem Krieger versprochen werden, das hat dein Vater so ausgehandelt mit diesem Iantumarus. Abgaben und eine Friedensbraut – dich. Aber deswegen gibt es keinen Grund, nicht dem Willen deines Vaters zu folgen, dass du dich schlicht kleidest. Noch bestimmt er über dich, bis du in die Hände irgendeines fremden Kriegers übergehst, der wohl so viele der Unseren getötet hat, dass sein Herr ihn dafür belohnt, mit dir, einer jungen, unschuldigen Braut.«
Sie hatte kein Mitleid mit dem Mädchen. Jede Frau, die Tochter eines Stammesführers war, wusste, dass sie ihren Mann nicht würde wählen können. Meinte Brigia etwa, Sammunia wäre glücklich gewesen, Castio zu nehmen, nachdem sein erstes Weib gestorben war? Man raufte sich zusammen. Sie war nicht unzufrieden jetzt, er war ein weitaus besserer Mann, als sie anfangs angenommen hatte. Bis zu diesem unsinnigen Angriff … Bei den Göttern, sie mochte gar nicht daran denken!
»Ja«, sagte Castio. »Das wirst du für den Stamm tun, aber ich bin sicher, es wird ein guter Mann sein, den du bekommst. Dennoch kleidest du dich heute schlicht. Und hol meinen Burschen, dass er mir in die Halle hilft.«
Brigia zog die Lippen zwischen die Zähne. Doch sie würde gehorchen, das wusste Sammunia. Sie gehorchte immer, dazu hatten ihre Mutter und ihre Milchmutter sie erzogen. Brigia hatte eben nicht das Feuer in sich, das in Sammunia loderte.
Kapitel 5: Ankunft
Der Sonnengott hatte noch nicht lange seinen höchsten Aussichtspunkt verlassen, da sahen wir vor uns in dem breiten Flusstal Rauch aufsteigen, als wir über eine Hügelkuppe kamen. Iantumarus, der flankiert von zwei Kriegern an der Spitze des Trupps ritt, hob den Arm und alle hielten an. Der Atem der Pferde dampfte in der kalten Luft, Lugs Strahlen waren nur schwach durch die Schleierwolken hindurchgedrungen und der Wind kündete den nahenden Winter.
Noch ein Stück des Weges vor uns erhob sich eine Siedlung direkt am Ufer des Flusses und, wie es mir erschien, auf einer kleinen Halbinsel, die in den Fluss hineinragte.
Iantumarus lachte. »Dort liegt sie also, unsere Beute.«
»So wie der Alte getan hat, hätte ich mir mehr erwartet«, antwortete der Krieger neben ihm. Er war jünger als Iantumarus – nun, alle in dem Trupp waren jünger als ihr Anführer – aber auch schon ein Mann, der Kindeskinder haben konnte.
»Er ist Herr über ein Gebiet von fünf Dutzend Höfen, hat er gesagt. Liegen wohl alle gut versteckt in den Wäldern«, brummte der Krieger zu Iantumarus’ anderer Seite. Es war derjenige, der mir gestern Abend entgegen gekommen war, und der Iantumarus ähnlich sah. Er hatte den Körper eines Mannes, der sich von Kindheit an im Kampf geübt hatte – geschmeidig und sehnig, gewiss geschickt mit dem Schwert und auf dem Pferd, weniger im Kampf ohne Waffen, dazu wirkte er nicht breitschultrig und bullig genug. Ich nahm an, dass er ein Sohn des Iantumarus war und der auserkorene Brautmann.
Ich ließ den Blick über das weite Tal schweifen. Große Wiesen und abgeerntete Äcker erstreckten sich vom Fluss bis zu den sanften Hängen, wo der Wald begann. Nur vereinzelt sah man Höfe, umgeben von einem Hag aus dichten Hecken. Ich erblickte Schafe und Kühe, die zufrieden grasten. Dieses Tal war fruchtbar und gewiss nicht so arm, wie der Mangel an Ansiedlungen es wirken ließ. Aber fünf Dutzend Höfe waren wirklich nicht zu entdecken.
»Ich würde mein Haus auch nicht einsam inmitten dieser Ebene errichten, wo mich jeder schon von Weitem sieht«, sagte Meduris leise hinter mir.
Ich nickte.
»Nun, mit fünf Dutzend Höfen hat er geprahlt, für fünf Dutzend Höfe mag er nun Abgaben zahlen«, sagte Iantumarus und wischte sich über sein tränendes Auge.
Er trieb sein Ross wieder an und wir ritten den Hügel hinab.
Das Dorf am Flussufer kam rascher näher, als ich gedacht hätte. Ich fühlte meinen Bauch kribbeln. Eine Brautholung. Gemeinsam vor vielen Menschen mit Meduris singen und erzählen. Noch einmal die Freude empfinden, die ich abends zuvor am Lagerfeuer verspürt hatte. Doch das Wort Brautholung hinterließ auch einen unangenehmen Geschmack in meinem Mund, erinnerte mich an eine andere Gelegenheit, bei der jedoch nicht die Braut, sondern der Brautmann geholt worden war. Jener schreckliche Tag, als man Loïc und mich auseinanderriss, als Morfran den Fluch über mich sprach.
Meduris fasste mich um die Taille, beugte sich zu meinem Ohr vor. »Diese Hochzeit wird so schnell keiner vergessen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir zusammen die Brautleute in ihr gemeinsames Leben zu singen. Entengrütze, ich pfeif drauf, ob es eine Hochzeit oder sonst was ist, solange wir wieder gemeinsam singen können.«
Meine Schultern spannten sich an. Es war wunderbar gewesen am Abend zuvor. Viel zu schön, wenn ich ehrlich war.
»Ja, es war recht nett«, sagte ich.
Meduris zog am Zügel seines Pferdes, hielt es an. Die beiden Krieger hinter uns wichen fluchend aus, ritten an uns vorbei.
»Recht nett? Recht nett!«
Er war so entrüstet, dass ich grinsen musste. Ich drehte den Kopf zu ihm und er sah mein Lachen. Seine Miene entspannte sich und sein Mund öffnete sich zu einem breiten Lächeln.
»Ja, du hast recht«, sagte er nun mit leichtem Ton. »Es war recht nett. Durchaus verbesserungsfähig jedoch, aber ein Anfang.«
Er trabte das Pferd an, um wieder seine Position im Trupp einzunehmen.
Ich sah zu Cú hinab, der neben uns herlief. Oh ja, das konnte noch gefährlich werden. Es war nie gut, wenn Männer Gefallen an mir fanden. Und doch auch schön.
Man hatte unsere Ankunft bereits gemeldet, denn als wir uns der Palisade der Siedlung näherten, erwartete uns bereits eine Gruppe Menschen.
Es waren einige Krieger, im Verhältnis zu Iantumarus und seinen Männern eher schlicht gekleidet. Die Stoffe mit ihren Borten waren edel, aber es fehlte beinahe jeglicher Schmuck außer den goldenen Halsringen. Vor der Gruppe Krieger stand eine Frau, die Hand auf ihren sichtbar gewölbten Bauch gelegt. Sie mochte in meinem Alter sein, vielleicht vier-mal-sechs Sommer alt, und ihre Miene war hart.
»Seid gegrüßt in Grannamuro, Iantumarus und deine Männer ebenso.«
Die Reiter stiegen ab und Iantumarus blickte sich suchend um. Keine Stallburschen eilten herbei, die Pferde zu übernehmen.
Die Frau mit ihrer pelzbesetzten Mütze über einem Schleier und dem feinen Tuch um die Schultern lächelte.
»Ihr könnt die Tiere draußen auf die Weide bringen. Ich bin gewiss, sie sind es gewohnt, im Freien zu sein. Unsere sind es, sodass wir keine Ställe haben.«
Ihre Hand deutete der Palisade entlang nach Osten.
Ich sah, wie Iantumarus sich straffte. Er machte einigen seiner Männer ein Zeichen, die sogleich begannen, die Pferde wegzuführen.
Was für ein Empfang … Meduris hatte mir vom Pferd geholfen und ich musste den Kopf recken, um die Gruppe am Tor genauer zu betrachten. Trotz der Kälte des Tages schien die Luft zu flirren. Beinahe erwartete ich, dass im nächsten Augenblick jemand sein Schwert zog und sich schreiend auf Iantumarus stürzte. Herzlich war diese Begrüßung wahrlich nicht zu nennen.
Die Herrin der Ansiedlung und ihre Männer standen noch immer so, dass sie den Eingang in das Dorf verstellten. Die Männer hatten alle ihr Schwert gegürtet, doch keine Schilde am Arm. Sie sahen auch nicht wütend aus oder bereit, anzugreifen, nein, sie lächelten höflich, was durchaus etwas Einschüchterndes hatte. Auf mich zumindest, die ich seit Jahren gewohnt war, jeden fremden Ort mit großer Vorsicht zu betrachten.
Ich fühlte aber auch Unruhe unter Iantumarus’ Gefährten.
»Ihr müsst verzeihen, Männer, dass Reix Castio euch nicht selbst hier am Tor empfängt«, fuhr die Frau fort. »Doch es fällt ihm immer noch schwer zu gehen, nachdem ja einer von euch ihm ein Schwert in den Oberschenkel gerammt hat.«
»Das war ich!«, hörte ich die stolze Stimme eines der Reiter. Die Augenbrauen der jungen Frau am Tor hoben sich leicht, ihr Blick musterte den Rufer.
Meduris beugte sich zu mir, flüsterte: »Na, der bekommt heute sicher nicht den besten Wein von ihr dargereicht.«
Meine Anspannung machte sich in einem leisen Kichern Luft. Der Name Castio kam mir bekannt vor, doch noch hatte ich kein Bild zu ihm im Kopf. Die Freude darüber, weiterhin mit Meduris singen zu können, war dem Zweifel gewichen, ob ich mich hier nicht in eine gefährliche Lage begeben hatte. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich in Dinge hineingeriet, denen ich lieber ausgewichen wäre. Cú neben mir leckte meine Hand. Er freute sich immer, wenn wir unter Menschen waren, denn dies bedeutete für ihn meist, Essen zu bekommen, ohne dafür jagen zu müssen.
Iantumarus trat einen Schritt auf die Herrin des Dorfes zu.
»So sei er entschuldigt. Ich nehme an, er erwartet uns schon in der Halle.«
»Ja, das tut er«, sagte die Frau. Ihre Stimme war immer noch hart. Sie und Iantumarus standen nun nahe voreinander und blickten einander abschätzend an. Der Hass im Gesicht der Frau war nicht zu übersehen.
Das war kein Bündnis wie jenes damals zwischen Sequanern und Mandubiern, das Loïcs Vater geschlossen hatte, um seinen Stamm zu stärken. Dies war der Preis für eine verlorene Schlacht, wie es schien, eine Friedensbraut, die sicherstellte, dass der Angreifer es nicht noch einmal versuchte.
Ich war gespannt, ob der alte Krieger auf den Hass der Dorfherrin mit der Härte des Siegers reagieren würde.
Unerwarteterweise lächelte er und verbeugte sich ganz leicht vor der hochschwangeren Frau.
»Müsste ich nicht annehmen, dass du Castios Weib bist – ein glücklicher Mann, solch ein Weib zu haben – dann würde ich hoffen, dass du die Braut bist, die wir zu holen gekommen sind, denn deine Schönheit wäre eine Zierde für unseren Stamm.«
Oh, er war ein alter Fuchs! Der Rigana war die Überraschung über seine Rede anzusehen, die Röte, die plötzlich ihre Wangen überzog, kam gewiss nicht von der kühlen Luft. Sie musste einen Augenblick nach Worten suchen und ihre Stimme war ein wenig höher, als sie wieder sprach.
»Castio erwartet euch. Ihr entschuldigt mich. Ich muss mich um eure Bewirtung kümmern, Gebrinius wird euch zur Halle führen.«
Sie wies mit dem Arm auf einen der Krieger hinter sich. Gebrinius war wohl die rechte Hand des Reix und ein hoher Krieger. Er hatte eine frische Narbe im Gesicht, dicker, roter Schorf auf dem Kinn. Sein Haar begann bereits zu ergrauen, doch trotz der verheilenden Wunde unter seinem Mund strahlte er jene Sicherheit aus, die nur alten Kriegern zu eigen war. Sie hatten dem Tod oft genug ins Auge gesehen und waren ihm jedes Mal entkommen, solch einen Menschen schreckte nur noch wenig im Leben. Insofern war er Iantumarus sehr ähnlich, wenn auch um einiges jünger als dieser. Als sich die Männer der Siedlung nun in Bewegung setzten, um die Gäste ins Dorf und zur Halle zu führen, bemerkte ich, dass einige von ihnen ein wenig hinkten.
Die Herrin ließ die unerwünschten Ankömmlinge an sich vorbeiziehen, musterte jeden der Männer aufmerksam. Ihre Augenbrauen hoben sich erstaunt, als ich an ihr vorbei schritt.
Just in diesem Augenblick landete auch noch Branna auf meiner Schulter und die junge Rigana wich erschrocken zurück, eilte davon, ihr Tuch eng um sich hüllend. Der Rabe, der Todesvogel … Ich kraulte Branna unter dem Kinn, um sie zu trösten, dass man ihre Liebenswürdigkeit so gerne verkannte.
Gebrinius führte uns tiefer ins Dorf. Nun erkannte ich, dass sich hier keine Halbinsel in den Fluss hinein streckte, sondern Häuser auf Pfählen direkt im Wasser ruhten, verbunden mit hölzernen Stegen. Boote verschiedener Größe waren an ihnen vertäut. Die Große Halle befand sich direkt am Ufer. Vor dem Tor an der Schmalseite des reich verzierten Gebäudes stand ein steinerner Trog, in dem sich Wasser zum Waschen befand.
Die Männer des Dorfes hatten einen Halbkreis um den Trupp gebildet, ergänzt von neugierigen Frauen und Kindern.
Die Häuser verrieten, dass das Dorf nicht arm war. Die meisten waren bemalt, der Lehmputz ordentlich und schadenfrei in Stand gehalten. Und doch hatte ich das Gefühl, man versuchte, den Reichtum unsichtbar zu machen und zu wirken, als wäre man ein schlichtes Fischerdorf, wo doch allein die Anlage der Stege und die fensterlosen Lagerhäuser entlang dem Ufer auf eine Flusshandelssiedlung schließen ließen.
Die Ankömmlinge wuschen sich Hände und Gesichter. Cú steckte gierig seine Schnauze über die Kante des Trogs und trank, durstig von unserem langen Marsch. Meduris neben mir murmelte ein leises Lied, während er sein Gesicht vom Staub des Ritts säuberte.
Ich wünschte, ich könnte mein Gewand wechseln. Da ich die letzten Tage mich mit dem Aufarbeiten des Wildschweins beschäftigt hatte und mich heute Morgen mit all den Kriegern rundum nicht umgekleidet hatte, trug ich das armseligste Kleid meines kargen Besitzes … Hätte ich geahnt, dass ich heute noch zu einem Empfang in einer Großen Halle ginge, hätte ich wie die Krieger in der Früh mich entsprechend gekleidet. Es ging hier nicht um Schönheit, hier ging es um die Stellung in der Gemeinschaft. Nun, es war, wie es war.
Ich hielt nach Branna Ausschau, die davongeflogen war. Ich entdeckte sie oben auf dem Dach der Großen Halle, wo sie den Schnabel begeistert zwischen die Halme der Schilfdeckung steckte, auf der Suche nach Käfern und Larven.
»So höflich zum Weib des Gegners?«, murmelte einer seiner Gefährten leise zu Iantumarus.
Der schöpfte Wasser in sein Gesicht, ehe er ebenso leise antwortete:
»Es ist Aufgabe ihres Mannes, sie zu erziehen, nicht meine. Soll sie sich nur noch mehr ärgern, an den Verlierer gefesselt zu sein, statt dem Sieger zu gehören.«
Der andere Krieger nickte. »Ich mag es, wenn sie sich ärgern.«
Ich sah weg, als sich die beiden mir zuwandten.
Kapitel 6: Der Brautmann
Wir betraten die Große Halle. Auch hier – der Türrahmen war mit kunstvollen Schnitzereien verziert, die Halle geräumig und hoch. Eine Reihe von Feuerstellen in der Mitte, von denen jedoch nur zwei brannten, und eine beträchtliche Anzahl an niedrigen Tischen sprach von großen Festen und Zusammenkünften. Und dennoch … die Wände waren kahl, keine kunstvoll gewebten Tücher zierten sie. Die Felle an den Tischen waren schlicht, nur von Schaf und Ziege, der Boden mit Stroh, nicht mit duftenden Kräutern bedeckt.
Es passte nicht zusammen.
Am unteren Ende der Halle saß der Reix auf einer Bank, deren Machart nicht erkennbar war, da sie zur Gänze mit einem großen Tuch bedeckt war. Castio erhob sich nicht, als die Gäste eintraten, sein linkes Bein lag ausgestreckt auf der Sitzfläche, sein Gesicht war blass. Graue Strähnen zogen sich durch seinen Schnurrbart und über seine Schläfen.
Ich kannte ihn tatsächlich, stellte ich fest. Er war einer der Stammesführer, die bei den Verhandlungen in Bragnreica gewesen waren. Ich konnte ihn nicht einschätzen, denn er hatte an Voccios Tafel nie viel geredet, sich kaum in die Gespräche eingebracht.